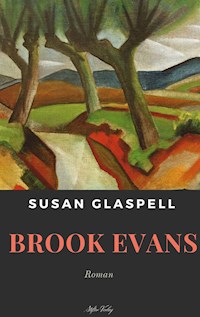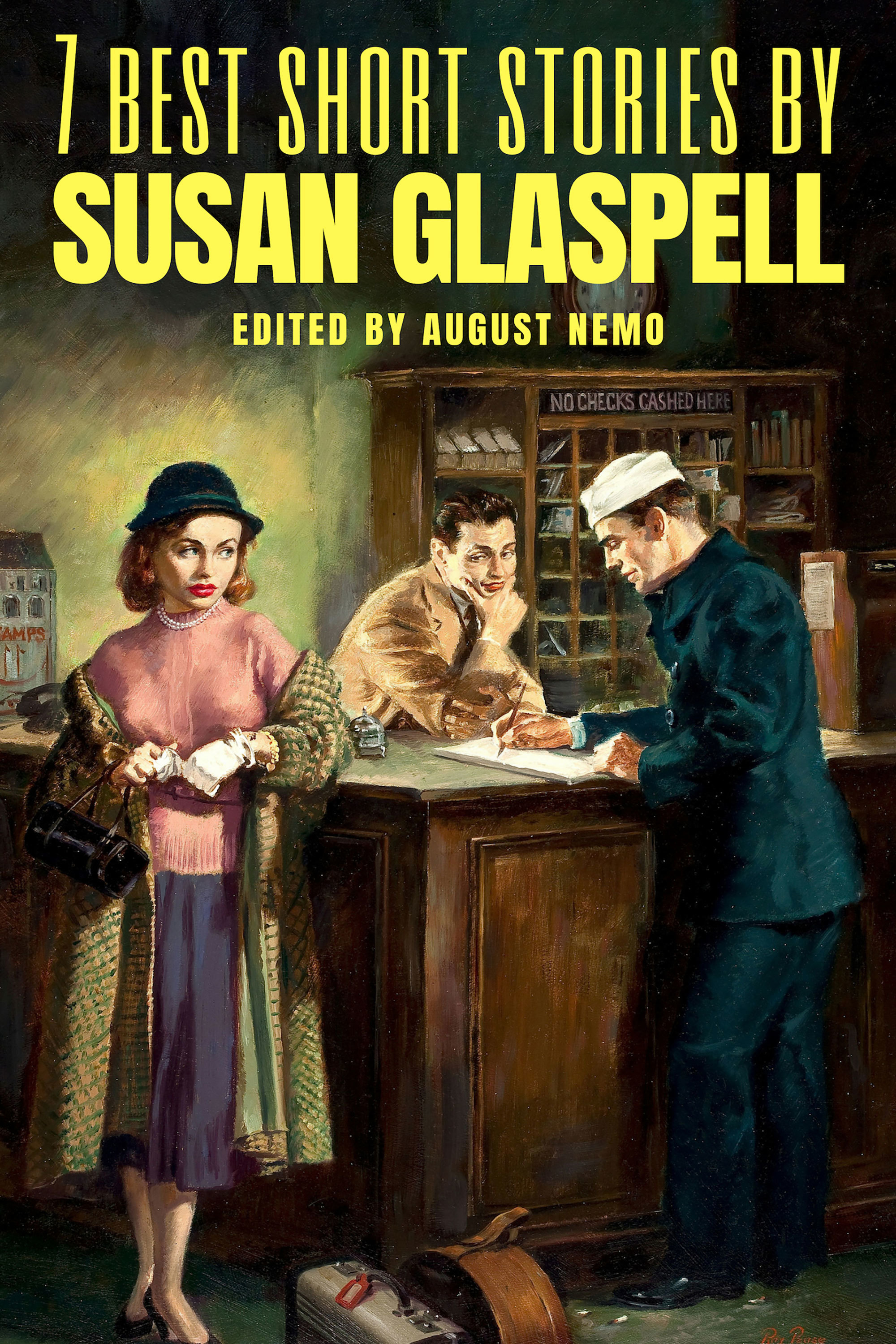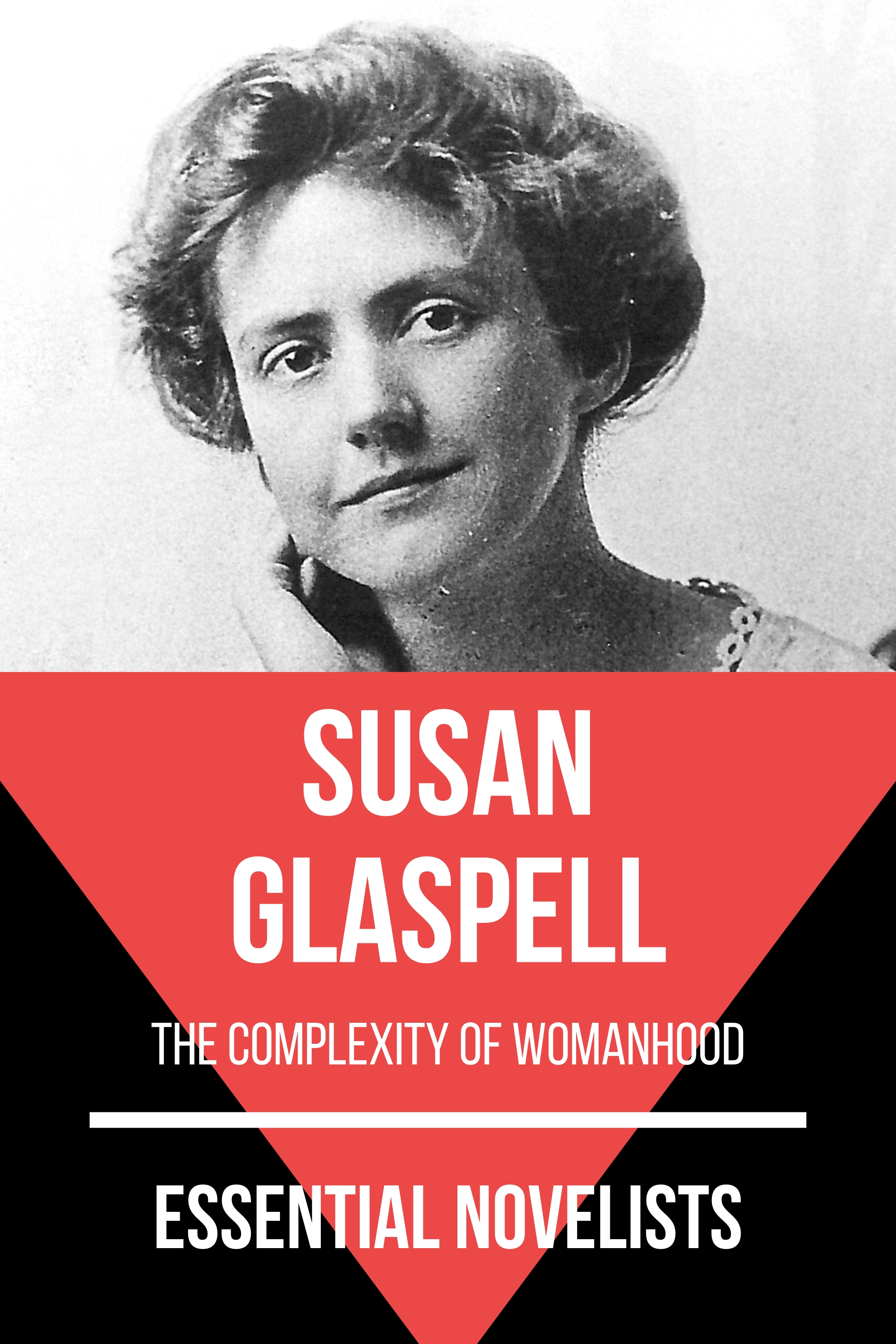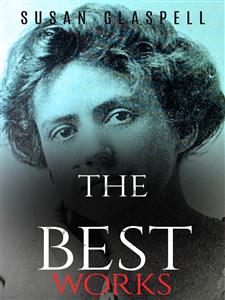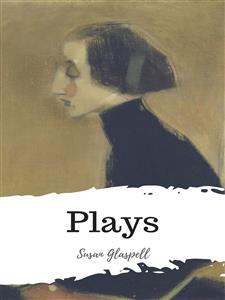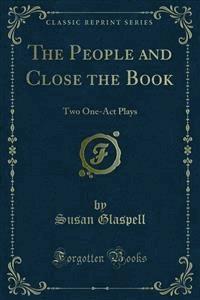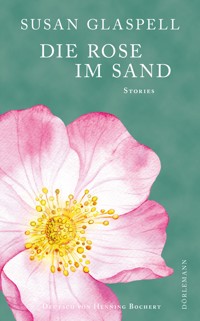
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mrs Paxton flieht vor ihrem Unglück Hals über Kopf in eine verlassene Rettungsstation in den Dünen. Dort, umgeben von Dünen, Meer und Herbststürmen, gibt sie sich ihrer stillen Melancholie und Trauer hin, die in einer mürrischen Einsamkeit mündet. Bis eines Tages ein kleines Wunder der Natur sie ins Leben zurückholt.Der Senator aus Johnson vertritt vehement die Interessen seiner Wähler im Kapitol. Doch sein Unbehagen wird größer und größer … und er kippt im letzen Moment seine siegreiche Abstimmung, um einem Mörder eine Chance zu geben.Susan Glaspells Stories erzählen von Wendungen im Leben, in denen ihre Protagonisten den Mut zur Umkehr finden. Ihre Themen sind universell, sie handeln von Individualität und sozialer Konformität, den Kompromissen der Ehe, den Enttäuschungen und Hoffnungen des Alterns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Susan Glaspell
Die Rose im Sand
Stories
Herausgegeben, mit einem Nachwort versehenund aus dem Amerikanischen übersetztvon Henning Bochert
DÖRLEMANN
Neuübersetzung Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © 2023 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung einer Illustration von Elta11/Shutterstock Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-900-3www.doerlemann.ch
Inhalt
Susan Glaspell
Das Gnadengesuch
Senator Harrison beendete sein Plädoyer und setzte sich. Applaus gab es nicht, aber er hatte auch keinen erwartet. Schon fragte Senator Dorman: »Herr Präsident?«, auf den vollen Galerien entstand Unruhe und unter den Senatoren ungeduldiges Stühlerücken. Auf dem Pressebalkon ordneten die Reporter ihre Blätter und prüften mit ernstem Blick ihre Bleistiftspitzen. Dorman war der beste Redner im Senat und gehörte zur populären Partei. Dies würde die große Rede der Sitzungsperiode werden, und nach einer Flut von Eisenbahn- und Versicherungsvorlagen war das eine ermunternde Aussicht.
»Ich möchte Ihnen erläutern«, begann er, »wieso ich mich für diesen Beschluss zur Empfehlung einer Begnadigung für Alfred Williams eingesetzt habe. Dass jedem Lebewesen eine Chance gegeben wird, ist eines der großen Gesetze des Universums. In dem uns vorliegenden Fall wurde dieses Gesetz gebrochen. Jedoch läuft das nicht auf die Frage einer zweiten Chance hinaus. Der Junge, von dem hier die Rede ist, hat nicht einmal eine erste erhalten.«
Senator Harrison schwang seinen Sessel halb herum und schaute hinaus auf die Grünpflanzen, die auf dem Gelände des Kapitols wieder zeigten, was in ihnen steckte. Auch ohne zuzuhören, wusste er in groben Zügen, was Senator Dorman zu sagen hatte, und er war der ganzen Angelegenheit ein wenig überdrüssig. Er hoffte, dass sie heute Abend auf die eine oder andere Weise damit zum Ende kommen und sich etwas anderem zuwenden würden. Er hatte sein Mögliches getan, und für alles Weitere waren nun die anderen verantwortlich. Er meinte, dass sie angesichts der geschlossenen Gegenwehr aus Johnson County, dem Tatort des Verbrechens, ziemlich viel auf sich nahmen, um die Begnadigung zu erwirken. Eine Gemeinde sollte ihre eigenen Verbrechen doch wohl am besten selbst beurteilen, und als Senator für Johnson County hatte er entsprechend versucht, sie davon zu überzeugen.
Ihm war bewusst, dass sein Argument gegen den Jungen überzeugend war. Im Grunde gefiel ihm die Haltung, die er eingenommen hatte. Er wirkte wie die fleischgewordene, empörte Rechtsprechung, die versucht, sich der Flut der Gefühle entgegenzustemmen. Er gefiel sich in dem Gedanken, weit über die Gegenwart und den Einzelfall hinauszudenken und als Wächter der Zukunft und des Ganzen aufzutreten. Die Reporter würden in ihrem Bericht über den heutigen Abend geschraubt über den rührenden Appell von Senator Dorman sprechen und dann leidenschaftslos die logische Argumentation des Oppositionsführers nachvollziehen. Aus der Logik gewann das Ich mehr Befriedigung als aus der Beredsamkeit. Ein wenig war er sogar stolz auf seine Unbeliebtheit. Sie wirkte wie ein Opfer.
Er fragte sich, wieso Senator Dorman sich der Sache dermaßen verschrieben hatte. Während der gesamten Sitzungsperiode hatte der Senator aus Maxwell im Namen dieses Jungen, mit dem ihn nicht das Geringste verband, alle persönlichen Interessen hintangestellt. Wahrscheinlich handelte es sich, so seine Vermutung, um ein soziologisches und psychologisches Experiment. Senator Dorman hatte dem Gouverneur versprochen, der Vormund des Jungen zu werden, falls er freikäme. Der Senator aus Johnson folgerte, dass sein wortgewandter Kollege als studierter Sozialwissenschaftler herausfinden wollte, was er aus ihm machen könne. Anzunehmen, dass das Interesse lediglich persönliches Mitgefühl sei, wäre wohl unehrenhaft.
»Ich muss mich mit der Geschichte nicht aufhalten«, sprach der Senator aus Maxwell, »Sie sind bereits alle damit vertraut. Es heißt, es handle sich dabei um das furchtbarste Verbrechen im Bundesstaat. Das gebe ich gern zu und bitte Sie aber, einen Augenblick die Umstände zu betrachten, die dazu geführt haben.
Bei der Geburt des Jungen strengte seine Mutter die Scheidung gegen seinen Vater an, die sie auch erhielt. Als Alfred drei Monate alt war, heiratete sie erneut. Schon als Baby lehrte sie ihn, seinen Vater zu hassen. Immer, wenn etwas schieflief, erklärte sie ihm, sein Vater sei schuld. Seine ersten Eindrücke waren, dass sein Vater für alles Übel im Universum verantwortlich war.
Sieben Jahre lang ging das so weiter, dann starb seine Mutter. Sein Stiefvater wollte ihn nicht. Er zog nach Missouri, da würde ihm der Junge bloß ein kostspieliger Klotz am Bein sein. Er unternahm keinerlei Anstrengungen, ihm ein Zuhause zu finden; er erklärte ihm auch nichts, sondern ging einfach fort und ließ ihn zurück. Im Alter von sieben Jahren stand der Junge allein in der Welt, nachdem er eines gelernt hatte – seinen Vater zu hassen. Er blieb noch einige Tage im leeren Haus, dann kamen die neuen Bewohner und setzten ihn vor die Tür. Es mag ihm durchaus merkwürdig vorgekommen sein, dass er in eine Welt hinausgeschickt wurde, in der kein Platz für ihn war.
Die Nachbarn, die er um Asyl bat, rieten ihm, sich an seinen Vater zu wenden, anstatt Fremde zu belästigen. Er wisse nicht, wo sein Vater sei, erklärte er. Sie sagten es ihm, und er lief los – eine Strecke von fünfzig Meilen. Bitte denken Sie daran, meine Herren, er war erst sieben Jahre alt. In diesem Alter schlägt der durchschnittliche Junge sein drittes Lesebuch auf und spielt mit Murmeln und Kreiseln.
Als er zum Haus seines Vaters kam, machte man ihm auf der Stelle klar, dass er dort nicht erwünscht war. Der Mann hatte wieder geheiratet, es gab andere Kinder, für Alfred hatte er keinen Platz. Er wies ihn ab; doch die Nachbarn protestierten, und er musste ihn aufnehmen. Vier Jahre lang wohnte er in diesem Haus, in das er ungebeten eingezogen und in dem er nie willkommen gewesen war.
Die ganze Familie war ihm feind. Der Vater befriedigte seinen Abscheu gegen die tote Mutter des Knaben, indem er ihren Sohn verprügelte, seine Frau dazu brachte, ihn zu misshandeln, und die übrigen Kinder, ihn zu verachten. Undenkbar, dass solche Zustände möglich sind. Der einzige Beweis für ihre Existenz ist, dass es sie gibt.
Das Verbrechen muss ich nicht im Einzelnen beschreiben. Nach einem Streit mit seiner Stiefmutter wegen verschütteter Milch wurde er an jenem Abend von seinem Vater verprügelt. Wie immer ging er zum Schlafen in die Scheune; aber das Heu ließ ihm keine Luft, sein Kopf pochte, er konnte nicht einschlafen. Mitten in der Nacht stand er auf, ging zum Haus hinüber und tötete sowohl Vater als auch Stiefmutter.
Selbstverständlich vermag ich nicht zu sagen, welche Gedanken dem Jungen durch den Kopf rasten, als er im stickigen Heu lag und das heiße Blut gegen seine Schläfen pochte. Ich kann nicht sagen, ob er klaren Verstands oder wahnsinnig war, als er zum Haus hinüberging, um das furchtbare Verbrechen auszuführen. Ich behaupte nicht einmal, dass es nicht geschehen wäre, hätte es einen Menschen gegeben, der ihm eine kühlende Hand auf die heiße Stirn gelegt und einige beruhigende, liebevolle Worte gesprochen hätte, um seine quälende Einsamkeit und sein Leid zu lindern. Ich möchte nur, dass Sie eines bedenken: Er war damals elf Jahre alt und hatte keinen einzigen Freund auf der ganzen Welt. Mitgefühl war ihm unbekannt; alles, was er kannte, war Ungerechtigkeit.«
Immer noch betrachtete Senator Harrison die knospenden Gewächse auf dem Gelände, folgte jedoch vage der Geschichte. Er wusste, wann der Senator aus Maxwell die Fakten aufgezählt hätte und sein Plädoyer beginnen würde. Ihm war bewusst, dass es kraftvoller war als erwartet – mehr Logik und weniger leere Ermahnung. Er sprach über das Leben des Knaben in der Besserungsanstalt und im Strafvollzug nach Begehen des Verbrechens – und wie er sich durch Freundlichkeit hatte entfalten können, über seine geistigen Errungenschaften, die Briefe, die er schreiben konnte, die Bücher, die er gelesen hatte, die Hoffnungen, die er nährte. Es war bekannt, dass er in den zwölf Jahren, die er dort verbracht hatte, kein einziges Mal unfreundlich oder gemein gehandelt hatte; er reagierte auf Zuneigung – hungerte danach. Das war keineswegs ein Bericht über einen Degenerierten, erklärte der Senator aus Maxwell.
Dem Senator aus Johnson ging eine Menge durch den Kopf. Er versuchte, sich zu erinnern, wer das Buch Du an seiner Statt geschrieben hatte. Er hatte es einmal gelesen und ärgerte sich, dass er sich keine Namen merken konnte. Als Nächstes fragte er sich, wieso die Philosophen nicht mehr über die Ungleichheit zu sagen hatten, dass Menschen, die nie Probleme gehabt hatten, über Menschen richteten, die ausschließlich Probleme hatten. Außerdem überlegte er, dass abstrakte Regeln nicht immer passgenau auf konkrete Fälle anzuwenden waren und dass es ohnehin schwierig war, dem Leben mit Regeln beizukommen.
Dann fragte er sich, wie es dem jungen Alfred Williams ergangen wäre, wäre er an Charles Harrisons Stelle geboren worden; und dann stellte er sich den umgekehrten Fall vor. Wie es wohl Charles Harrison ergangen wäre, wäre er an Alfred Williams’ Stelle geboren. Ob die Idee zum Mord wohl in Alfred Williams’ Herz entstanden wäre, wäre er in die Lage von Charles Harrison hineingeboren worden, und ob es für Charles Harrison ein Ding der Möglichkeit gewesen wäre, seinen Vater zu ermorden, wäre er in Alfred Williams’ Situation geboren worden. So gesehen war es nicht leicht einzuschätzen, wie viel davon dem Jungen selber zuzuschreiben war und wie viel dem Platz, den die Welt für ihn bereitgehalten hatte. Und wenn es eher dem für ihn bereitgehaltenen Platz als dem Jungen zuzuschreiben war, wieso lag die Schuld dann nicht eher bei denen, die ihm diesen Platz bereitet hatten, als bei dem, der ihn einnahm? Das Ganze war sehr verwirrend.
»Dieser Laufbursche hier«, sagte der Senator aus Maxwell und hob den kleinen Kerl auf den Tisch, »ist erst elf Jahre alt und bis auf drei Pfund genauso schwer wie Alfred Williams zum Zeitpunkt des Mordes. Ich frage Sie, meine Herren, wenn dieser kleine Kerl heute Abend desselben Verbrechens schuldig würde, inwiefern würden Sie ihn, wenn Sie morgen davon in der Zeitung läsen, mit jenem moralischen Urteilsvermögen anklagen, das die vornehmste Bedingung moralischer Verantwortung darstellt? Wenn Alfred Williams’ Geschichte die von diesem Knaben hier wäre, würden Sie bedauern, dass niemand da war, das kindliche Temperament zu zügeln, oder würden Sie sagen, es läge am angeborenen Mordinstinkt? Und nehmen wir noch einmal an, dies wäre Alfred Williams, 11 Jahre alt, würden Sie nicht in die Zukunft sehen und sagen wollen, da er zwölf Jahre im Strafvollzug und in der Besserungsanstalt verbracht hätte, wo er die erforderlichen Charakterzüge eines nützlichen und ehrenwerten Bürgers entwickelte, dass damit die Justiz ihren Zweck erfüllt hätte und die Zeit reif wäre, dass die Welt endlich ihre Schuld zurückzahlt?«
Senator Harrison betrachtete den Laufburschen, der gegenüber auf dem Tisch stand. Elf Jahre war jünger, als er angenommen hatte. Als er an sich selbst mit elf Jahren zurückdachte – an seine Verantwortungslosigkeit, seine Abhängigkeit –, nicht auszudenken, was geschehen wäre, hätte die Welt sich derart gegen ihn gestellt wie gegen Alfred Williams. Mit Elf war sein größtes Problem gewesen, dass die Jungs in der Schule ihn »Gelbschopf« genannt hatten. Ihm fiel ein, dass er deswegen mit einem Stein nach einem von ihnen geworfen hatte. Er fragte sich, ob er den Stein aus krimineller Neigung geworfen hatte. Er fragte sich, wie wahrscheinlich es war, dass Kinder Verbrechen begingen, gäbe es keine regulativen Einflüsse. Der wesentliche Unterschied zwischen Alfred Williams und anderen Elfjährigen lag scheinbar lediglich in fehlenden regulativen Einflüssen.
Plötzlich kam ihm ein neuer, bewegender Gedanke. Alfred Williams war um seine Kindheit betrogen worden. Höchstwahrscheinlich war er nie Schwimmen gewesen oder bei einem Sportturnier und vielleicht auch nie im Zirkus. Vielleicht hatte er nicht einmal einen Hund besessen. Der Senator aus Maxwell hatte recht, als er sagte, dass der Junge nie eine Chance gehabt hatte und um alles betrogen worden war, was einem Jungen zustand, seit die Welt selbst jung war.
Und die Jahre hernach – wie machten die ihm das wieder wett? Er erinnerte sich an das Schrecklichste, das er über das Staatsgefängnis gehört hatte: Dort drin sah man niemals die Sonne aufgehen, und man sah sie niemals untergehen. Die da drin sahen sie zum Mittag, wenn sie über die Brüstung kletterte, aber wie sie sich zum Tage erhob und zur Nacht herabsank, das blieb ihnen verwehrt. Noch nicht einmal die Sterne konnten sie dort im Gefängnis betrachten. Jahre war es her, seit Alfred Williams zu Gottes Himmel aufgeblickt und sich als ein Teil von alldem hatte fühlen können. Die Stimmen der Nacht drangen nicht bis zu jener kleinen Zelle im Herzen des riesigen Steinbaus durch, in der er seine Abende mit jenen Meisterwerken verbrachte, mit denen er, wie es hieß, vertrauter war als das durchschnittliche Senatsmitglied. Wenn er las, was Victor Hugo über die Unermesslichkeit der Nacht zu sagen hatte, konnte er nur die ihn ringsum einschließenden Mauern sehen und versuchen, in der Zeit vor über zwölf Jahren einen hinlänglichen Begriff dessen zu finden, was Nacht eigentlich war.
Dem Senator aus Johnson schauderte: Einem lebendigen Wesen hatte man alles Lebendige genommen, und das nur, weil in der fraglichen Stunde niemand da gewesen war, der ihn mit einem Wort aufgehalten hätte. Menschen hatten ihn um alles Menschliche betrogen und ihn dann aus Gottes Welt ausgeschlossen. Man hatte ihm ein Leben bar aller Entschädigungen bereitet.
Den Senator überkam ein Gefühl starken Selbstmitleids. Als Vertreter von Johnson County oblag es ihm, diesem Jungen die ganze großartige Welt da draußen vorzuenthalten, die Menschen, die ihm helfen wollten, sowie das, was der Senator aus Maxwell »seine Chance« nannte. Wenn Johnson County heute obsiegte, würde er für den Rest seines Lebens an etwas Unangenehmes zu denken haben. Mit zunehmendem Alter würde er immer öfter daran denken, was der Junge draußen aus sich hätte machen können, wenn der Senator aus Johnson nicht logischer und mächtiger gewesen wäre als der Senator aus Maxwell.
Senator Dorman kam zum Ende seiner Rede. »Dem unablässigen Vorurteil der Bewohner von Johnson County zum Trotz kann ich heute vor Ihnen stehen und sagen, dass ich nach kritischer Betrachtung dieses Falls nichts Rechtswidriges von Ihnen verlange, wenn ich Sie anflehe, diesem Jungen seine Chance zu gewähren.«
Umgehend kam es zur Abstimmung. Der Senator aus Johnson County schaute zu den knospenden Pflanzen hinaus und fragte sich, ob der Jungen drüben in der Strafanstalt wohl wusste, dass im Senat heute sein Fall besprochen wurde. Ganz ohne Eitelkeit fragte er sich, ob das, was er als allwissende Vorsehung zu betrachten gelernt hatte, es nicht vorgezogen hätte, dass Johnson County in dieser Sitzungsperiode von einem weniger fähigen Mann vertreten worden wäre.
Eine große Stille legte sich über die Kammer, da Ja- und Neinstimmen fast abwechselnd aufeinanderfolgten. Nach einigem Warten rief der Senatsschreiber in angespanntem Ton: »Jastimmen, 30; Neinstimmen, 32.«
Der Senator von Johnson hatte sich als allzu treuer Diener seiner Wählerschaft erwiesen. Dem Jungen im Strafvollzug wurde seine Chance versagt.
Es folgte das Übliche: Einige Frauen auf den Galerien, die Jungs zu Hause hatten, weinten laut; die Reporter stritten sich um die Telefonkabinen, und die meisten Senatoren begannen, überaus interessiert das Journal des Vortags zu studieren. Senator Dorman gab sich nicht mit solcherlei Scheinheiligkeiten ab. Ein ehrlicher Blick in sein Gesicht machte in diesem Moment deutlich, wie viel seiner Seele er in den Kampf um eine Chance für diesen Jungen gelegt hatte, und der Zug um seine Augen ließ die Theorie vom psychologischen Experiment eher schlecht aussehen.
Senator Harrison schaute hinaus auf die knospenden Bäume, aber auch sein Gesicht hatte sich verändert, er schien Meilen und Jahre vorauszuschauen. Er wirkte, als ob er selbst den Stimmen der Nacht und dem Kommen und Gehen der Sonne entsagt hätte. Nie wieder würde er sie betrachten, sie spüren, ohne sich bewusst zu sein, dass er sie einem anderen Geschöpf vorenthielt. Er wunderte sich über seine eigene Anmaßung, etwas Lebendigem die Teilhabe am Universum zu verweigern. Und währenddessen sah er vor sich jenen Jungen, der in einer engen Zelle saß, vor sich das Buch eines geliebten Dichters, und sich auszudenken versuchte, wie es wohl wäre draußen unter den Sternen.
Die Stille in der Senatskammer löste sich auf; man fuhr mit etwas anderem fort. Dem Senator aus Johnson kam es vor, als ob Sonne, Mond und Sterne im Aufbegehren für den Jungen, der sie besser kennenlernen wollte, aufschrien. Und dennoch waren es nicht so sehr Sonne, Mond und Sterne als vielmehr der ungenutzte Fischteich, das unbesuchte Spielfeld, der nie gesehene Zirkus und, allem voran, der unbesessene Hund, die Senator Harrison auf die Beine brachten.
»Herr Präsident«, sagte er, zog an seinem Kragen und schaute geradeaus, »ich beantrage eine Neuabstimmung.«
Es gab ein Lufteinsaugen, einen Augenblick höchster Stille und dann gewaltigen Applaus. Männern aller Parteien und Seiten kam derselbe Gedanke. Johnson war das führende County seines Wahlbezirks. Im Herbst stand eine Wahl an, und Harrison würde kandidieren. Diese sechs Worte bedeuteten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass er nicht nach Washington gehen würde, denn der Senator aus Maxwell hatte den richtigen Ausdruck gefunden, als er das Vorurteil von Johnson County im Fall Williams als unablässig bezeichnet hatte. Der Puls der Welt schlägt im Augenblick ihres Geschehens mit solchen Dingen – selbst wenn sie sie später verdammt, und jener in dieser Senatskammer versammelte Teil der Welt war dabei keine Ausnahme.
Der Lärm überraschte Senator Harrison, und beinahe angewidert sah er sich um. Als der Tumult schließlich verebbte und er erkannte, dass man von ihm eine Rede erwartete, wurde er rot und packte verzweifelt seinen Stuhl.
Die Reporter waren wieder auf ihren Plätzen und lehnten sich nervös vor. Dies war Senator Harrisons Gelegenheit, etwas Wertvolles zu sagen, das sie als Überschrift in einen schwarzen Rahmen stellen würden – und sie waren überzeugt, er würde es tun.
Er tat es nicht. Wie ein Schuljunge, der seine Aufgabe vergessen hatte, stand er da und errötete immer mehr. »Ich – ich glaube«, brachte er schließlich heraus, »dass einige von uns falsch liegen. Ich bin jetzt dafür – ihm eine Chance zu geben.«
Man wartete, dass er fortführe, aber nach einem hilflosen Blick durch den Kammersaal setzte er sich. Der Senatsvorsitzende wartete minutenlang, dass er wieder aufstehe, aber schließlich wandte er seinen Stuhl ab und blickte hinaus auf die Vegetation auf dem Kapitolgelände, sodass nichts übrig blieb, als die Anwesenden erneut aufzurufen. Diesmal stand es 50 zu 12 für den Jungen.
Es folgte ein Antrag, die Sitzung umgehend zu schließen – niemand wollte sich an jenem Nachmittag noch mit etwas anderem befassen. Alle wollten dem Senator aus Johnson etwas sagen; aber sein Gesicht war kalt geworden, und da sie sowieso gewöhnlich Angst vor ihm hatten, hielten sie sich fern. Alle außer Senator Dorman – ihm bedeutete es zu viel. »Darf ich Ihnen sagen«, sprach er angespannt, »dass ich nie jemanden etwas Edleres haben tun sehen?«
Der Senator aus Johnson machte nervöse Bewegungen. »Sie glauben, es ist ›edel‹«, fragte er fast verächtlich, »ein Feigling zu sein?«
»Ein Feigling?«, rief der andere. »Nun, das ist wohl kaum der richtige Ausdruck. Es war – heldenhaft!«
»Ach was«, sprach Senator Harrison mit schwankender Stimme, »ein klarer Fall von Feigheit. Verstehen Sie«, lachte er, »ich hatte Angst, dass mich das mit siebzig noch heimsucht.«
Senator Dorman begann eifrig zu sprechen, aber der andere unterbrach ihn und ging davon. Er sah es so, wie seine Wähler es sehen würden, und das beschämte ihn. Sie würden sagen, er hätte nicht den Mut, für seine Überzeugungen einzustehen, er hätte er Angst vor der Unbeliebtheit, dass sein Urteilsvermögen der Eloquenz des Senators aus Maxwell zum Opfer gefallen sei.
Als er aber aus dem Gebäude in den milden Aprilnachmittag hinaustrat, schien es ihm schon anders. Immerhin war er nicht der Einzige, der zur Weichheit neigte. Es gab die Bäume – ihnen wurde eine zweite Chance zum Knospen gewährt; die Vögel – ihnen wurde eine zweite Chance zum Singen gewährt; die Erde – ihr wurde eine zweite Chance zur Fruchtbarkeit gewährt. Da überkam ihn ein ruhiges Gefühl von Einssein mit dem Leben.
Freckles M’grath
Viele Besucherinnen und Besucher des Kapitols betrachteten fälschlicherweise den Gouverneur als wichtigste Personalie im Haus. Sie liefen auf den Gängen hin und her in der Hoffnung, irgendeinem führenden Amtsträger zu begegnen, während doch Freckles McGrath, die eigentliche Seele des Kapitols und in jeder Hinsicht die bemerkenswerteste Person darin, stets ansprechbar und zugewandt war.
Freckles McGrath war der Fahrstuhljunge. Offiziell war er als William verzeichnet, aber das war bloß ein Zugeständnis an die Wahlbürger, denen das amtliche Verzeichnis zugestellt wurde. In der Zeitung – er erschien regelmäßig in der Zeitung – hieß er immer »Freckles«, und jeder vom Gouverneur abwärts sprach ihn mit diesem Titel an, dessen Angemessenheit ihm hundertfach in sein gewitztes, fröhliches irisches Gesicht gestempelt stand.
Wie alle anderen Angestellten des Staates stand Freckles während dieser ersten Woche der neuen Sitzungsperiode unter Hochspannung. Es ging um eine Gesetzesreform, der der Reformgedanke derart eingeschrieben war, dass die Gefahr bestand, allem und jedem würde dadurch eine Reform aufgenötigt. Zufällig gehörte der Gouverneur jener Parteigruppe an, die bei der Gesetzgebung den Ton angab; jede Fuge und Spalte des herrschaftlichen Gebäudes atmete Reform.
Hoch über allem anderen Wichtigen dräute jedoch der Kelley-Gesetzentwurf. Vom Anfang der Sitzungsperiode an verging kaum ein Tag, an dem nicht einer von Freckles’ Fahrgästen das Kelley-Gesetz leise flüsternd erwähnte. Aus dem, was er im Haus aufschnappte und was er in der Zeitung las, bastelte sich Freckles eine ungefähre Vorstellung davon zusammen, was es mit diesem Gesetz eigentlich auf sich hatte. Es handelte sich um eine groß angelegte Reformmaßnahme, die den Eisenbahnen zeigen würde, dass der Staat nicht ihr Privateigentum war. Die Eisenbahngesellschaften würden mehr Steuern zahlen müssen und machten darum ein fürchterliches Theater; wenn aber das Kelley-Gesetz durchkommen sollte, wäre das ein großer Sieg für die Reform und würde den Gouverneur im Staat »festigen«.
Freckles McGrath war eindeutig für Reformen. Zum Teil lag das daran, dass die Redefetzen, die er von der gesetzgebenden Versammlung aufschnappte, spannender waren, wenn sie sich für Reformen aussprachen, als wenn sie dagegen waren; zum Teil lag es daran, dass er den Gouverneur vergötterte, und nicht zum Wenigsten lag es daran, dass er Mr. Ludlow verabscheute.
Mr. Ludlow war Lobbyist. Einige Mitglieder der Versammlung hatte Mr. Ludlow in der Hand – jedenfalls schloss Freckles das aus Gesprächen, die er auf seinem Posten zu hören bekam. Über Mr. Ludlows Methoden war in dieser Periode reichlich geredet worden.
Freckles selbst war kein Snob. Auch wenn er hörte, dass man Mr. Ludlow als eine Schande bezeichnete, und auch wenn er selbst der festen Überzeugung war, dass er eine Schande sei, war das für ihn noch lange kein Grund, nicht mit ihm zu reden. Als also Mr. Ludlow eines Morgens allein einstieg und die Gelegenheit irgendeine Art von Aufmerksamkeit zu fordern schien, trällerte Freckles: »Guten Mo-horgen!«
Aber der Mann, vielleicht tief mit etwas beschäftigt, schob lediglich seine Brauen zusammen und ließ nicht erkennen, ob er ihn gehört hatte. Hernach waren Henry Ludlow, Lobbyist, und Freckles McGrath, Fahrstuhlführer, Feinde.
Eines Tages kurz vor Mittag, fast am Ende der Sitzung, fuhren ein Mitglied des Senats und eines des Repräsentantenhauses im Fahrstuhl gemeinsam nach unten.
»Hat keinen Zweck, noch länger zu warten«, sagte der Senator, als sie einstiegen. »Stärker als jetzt werden wir nicht mehr. Alles hängt an Stacys Stimme, und die hängt davon ab, wer ihm zuletzt über den Weg läuft.«
Freckles sperrte die Ohren auf und stellte den Fahrstuhl auf langsame Fahrt ein. Die Zeitungen hatten Stacy, was das Kelley-Gesetz anging, als Wackelkandidat beschrieben.
»Im Moment ist er stabil, aber es kann sehr gut sein, dass Ludlow mit ihm spricht, ehe er heute Nachmittag seine Stimme abgibt, und dann – ach, ich weiß nicht!« Und mit einem kleinen Wedeln seiner Hände trat der Senator hinaus.
Freckles McGrath saß da, tief in Gedanken. Das Kelley-Gesetz stand am Nachmittag im Senat auf der Tagesordnung. Wenn Senator Stacy dafürstimmte, würde es verabschiedet. Wenn er dagegenstimmte, würde es abgelehnt. Er würde dafürstimmen, wenn er Mr. Ludlow nicht begegnete; er würde nicht dafürstimmen, falls doch. So war die Lage, und Freckles ahnte, dass die gesamte Zukunft des Gouverneurs auf dem Spiel stand.
Beim scharfen Läuten der Glocke wurde ihm vage bewusst, dass sie eben schon geklingelt hatte. In der nächsten halben Stunde hatte er viel zu tun und musste die Mitglieder der Versammlung nach unten fahren. Merkwürdigerweise fuhren Senator Stacy und der Gouverneur gemeinsam hinunter, und als er sah, wie sie das Gebäude zusammen verließen, strahlte Freckles vor Glück.
Stacy kehrte als einer der Ersten zurück. Freckles musterte ihn beim Betreten des Fahrstuhls genau und befand, dass er seinen Standpunkt nicht geändert hatte. Aber irgendetwas an Senator Stacys Mund ließ vermuten, dass man sich seiner nicht allzu sicher sein durfte. Freckles erwog, ob es wohl ratsam wäre, geradewegs damit herauszuplatzen, wie viel besser es doch sei, sich an die Reformleute zu halten; aber als der Junge gerade seinen Mut zusammengeklaubt hatte und im Begriff war, etwas zu sagen, stieg Senator Stacy aus.
Ungefähr zehn Minuten später wartete Freckles mit dem Aufzug im Erdgeschoss und las Zeitung, als ihn Schritte aufhorchen ließen. Gleich darauf bog Mr. Ludlow um die Ecke. Wie üblich war er tadellos gekleidet, bloß sein eisengrauer Schnurrbart schien ein wenig pompöser hervorzustehen als sonst. Als er in die Kabine trat, lag ein verächtlicher Blick in seinen Augen. Als wolle er sagen: »Die dachten wohl, sie könnten mich kleinkriegen, ja? Ha, wie einfältig sie doch sind!«
Freckles McGrath knallte die Tür zum Fahrkorb zu und setzte die Kabine nach oben in Bewegung. Er wusste nicht, was er vorhatte, aber irgendwie wusste er, dass er keine weiteren Fahrgäste wollte. Auf halber Strecke zwischen Untergeschoss und Erdgeschoss hielt er den Fahrstuhl an. Er brauchte Zeit zum Nachdenken. Brächte er diesen Mann hinauf zur Senatskammer, würde er der Reform schlichtweg den Todesstoß versetzen! Daher kniete er sich hin, tat so, als würde er etwas reparieren, und dachte schnell und angestrengt nach.
»Ist was kaputt?«, fragte eine nervöse Stimme.
Freckles sah sich um und Mr. Ludlow ins Gesicht; er erkannte, dass der ehrenwerte Lobbyist nervös war.
»Ja«, sagte er ruhig. »Macht komische Sachen. Irgendwas läuft da nicht rund.«
»Schön, fahr ihn zum Untergeschoss und lass mich raus«, sagte Mr. Ludlow scharf.
»Geht nicht, er steckt fest.«
Mr. Ludlow trat hinzu und schaute sich das an, aber sein Wissen erstreckte sich nicht auf Fahrstuhlmechanik.
»Ruf lieber jemanden, der uns rausholt«, sagte er nervös.
Freckles richtete sich auf. In seine kleinen grauen Augen trat ein Funkeln, auf seinen sommersprossigen Wangen brannten rote Punkte.
»Ich glaube, jetzt tut er’s wieder.«
Und so war es. Niemals in seiner ganzen Geschichte war der Fahrstuhl des Kapitols derart geschmeidig gelaufen. Wie von der Leine gelassen rauschte er am ersten und zweiten Stock vorbei, die haltlose Raserei trieb dem ehrenwerten Lobbyisten das Blut aus dem Antlitz.
»Anhalten, Junge!«, schrie er alarmiert.
»Geht nicht!«, rief Freckles mit schreckerfüllter Stimme. »Er geht durch!«
»Stürzt er ab?«, keuchte der Lobbyist.
»Ich – ich glaub schon!«
Der Mittelteil des Kapitols war sehr hoch. Über dem genutzten Gebäudeteil gab es ein Stück, das zum Turm hinführte. Der Schacht war bis ganz nach oben gebaut worden, wurde aber praktisch nie genutzt. Vorbei an als Lagerräume genutzten Etagen und solchen ohne jeden Zweck flogen sie – das Gesicht des Mannes kreidebleich, der Junge unzusammenhängend flehend. Dann, keine drei Meter vorm Schachtende und dreißig Zentimeter vor dem obersten Stockwerk, kam der Fahrstuhl ruckend zum Stehen. Er schwang vor und zurück; vollführte absonderliche, entsetzliche Bewegungen.
»Er stürzt ab!«, hechelte Freckles. »Klettern Sie raus!«
Und Henry Ludlow kletterte. Er stemmte die Tür auf und wuchtete sich hoch. Kaum berührten seine Füße festen Boden, reckte sich Freckles und knallte die Tür zum Fahrkorb zu. Wieso er das tat, war ihm in dem Moment nicht ganz klar. Später meinte er, dass ihm etwas geraten hatte, die Stimme seines Gefangenen nicht ungehindert den Schacht hinabtönen zu lassen.
Henry Ludlow war durchaus nicht dumm. Als er die schnelle und reibungslose Abwärtsfahrt der Kabine sah, wusste er, dass man ihn reingelegt hatte. Es wäre übermenschlich von ihm gewesen, darüber nicht in wütende Drohungen auszubrechen. Aber was nützte das schon? Die Kabine glitt hinab-hinab-hinab, und er stand da, vielleicht gar hundert Meter über allen anderen im Gebäude – allein, gelackmeiert, geschlagen!
Selbstverständlich probierte er sein Glück an der Tür am Ende der Wendeltreppe, obwohl er sicher wusste, dass sie verschlossen war. Man hielt sie allzeit verschlossen; jemanden vom Reinigungspersonal hatte er vor einigen Tagen nach dem Schlüssel fragen hören, um jemanden nach oben zu bringen. Vielleicht könnte er aufs Dach steigen und Notsignale geben. Aber die Tür nach draußen war ebenfalls verschlossen. Er war also machtlos. Und unten – tja, unten wurde das Kelley-Gesetz verabschiedet!
Er rüttelte am Gitter des Fahrstuhlschachts. Er machte eigentümliche, laute Geräusche und wusste doch die ganze Zeit, er würde sich nicht bemerkbar machen können. Schließlich und endlich setzte sich Henry Ludlow, ehrenwerter Lobbyist, allein auf dem Dachboden des Kapitols auf eine Kiste und frönte seiner Wut.
Unten nahm sich Freckles McGrath, jüngster Vorkämpfer der Reformen im Haus, ordentlich zusammen. Er lachte und redete und pfiff. Er brachte die Leute mit so viel Nonchalance hinauf und hinunter, als wüsste er nicht, dass oben, ganz oben im Schacht, wutentbrannte Augen darauf hofften, die Fahrkabine zu sichten, und schreckliche Flüche buchstäblich auf seinen stoppeligen Rotschopf herabsegelten.
Das Kapitol erlebte einen großartigen Nachmittag. Jedermann strömte zu den Pforten der Senatskammer, wo das Kelley-Gesetz verabschiedet wurde. Die Reden die Maßnahme betreffend waren kurz. Das Beste war, überhaupt keine Reden zu schwingen; es ging darum, auf der Anwesenheitsliste bis zum »S« zu kommen, ehe ein Herr mit eisengrauen Haaren und eisengrauem Schnurrbart eintreten und etwas zu dem blondgeschopften Senator mit dem schwachen Mund sagen konnte, der weiter hinten im Kammersaal saß.
Freckles wurde abberufen, gerade als man zur Abstimmung schritt. Als er zurückkam, stand Senator Kelley draußen auf dem Gang, umringt von einer ansehnlichen Anzahl Männer, die ihm auf den Rücken klopften. Der Gouverneur selbst stand auf den Stufen der Senatskammer; seine Augen leuchteten, er lächelte.
Freckles fuhr seinen Fahrstuhl ins Untergeschoss zurück. Er wollte kurz allein sein, allein mit der Tatsache, dass er es gewesen war, Freckles McGrath, der diesen großen Sieg für Reformen errungen hatte. Er, Freckles McGrath, hatte die Zukunft des Gouverneurs gesichert. Wer weiß, vielleicht hatte er sich an diesem Nachmittag einen Namen gemacht, von dem die Geschichtsbücher berichten würden!
Freckles war ein freundlicher kleiner Junge; er wusste, dass es für einen eleganten Gentleman nicht allzu angenehm sein dürfte, den Nachmittag auf dem Dachboden zu verbringen, daher beschloss er, hinaufzufahren und Mr. Ludlow zu holen. Das erforderte Mut; aber er hatte seinen Sieg errungen, und für Zögerlichkeit war jetzt keine Zeit.
Die lange Fahrt nach oben hatte etwas Unheimliches. Er dachte an Geschichten, die er gelesen hatte, über einsame Türme, in denen Menschen geköpft oder auf andere Weise beseitigt wurden. Er schien überhaupt nicht oben anzukommen, und als er schließlich doch ankam, sah er die beiden fürchterlichsten Augen, die er je gesehen hatte, auf sich hinabblicken – als würden ihnen gleich Furien entspringen.
Der Anblick der problemlos bis ganz nach oben fahrenden Kabine und des kühnen kleinen Jungen mit den Sommersprossen und den Fledermausaugen, der sein Spiel so gekonnt gespielt und derartigen Schaden angerichtet hatte, war zu viel für Henry Ludlows Selbstbeherrschung. Worte brachen aus ihm hervor, die er nie im Leben benutzt hatte, die zu benutzen er sich nie imstande geglaubt hätte. Freckles aber stand da und sah ruhig hoch zu dem aufgebrachten Lobbyisten, und gerade als Mr. Ludlow rief: »Dich mach ich einen Kopf kürzer, du kleiner Rotzbengel!« legte er den Hebel um und schickte die geschmeidig gleitende Kabine schachtabwärts. Hinter ihm erscholl ein wutentbrannter Schrei, dann die laute Aufforderung, zurückzukommen, aber er schenkte dem keine Beachtung, und die Kabine machte noch eine Weile ihre üblichen Touren zwischen Untergeschoss und den gesetzgebenden Kammern.
Knapp eine Stunde später versuchte Freckles es erneut. Er fuhr den Fahrstuhl bis auf etwa einen Meter an die oberste Etage heran und lugte mit fragendem Blick zwischen dem Gitterwerk hindurch. Der ehrenwerte Lobbyist schluckte Zorn und Stolz hinunter, denn er wusste wohl, was von ihm erwartet wurde.
»Hach, na schön«, murmelte er schließlich, und angesichts dieses einsichtigen Verhaltens fuhr Freckles die Kabine hinauf, öffnete die Tür, und Henry Ludlow trat ein.
Kein Wort wurde zwischen ihnen gewechselt, bis das Licht der Etage mit der Senatskammer in Sicht kam. Da wandte sich Freckles mit der höflichen Nachfrage an den Gentleman, wo er denn auszusteigen wünsche.
»Bring mich bitte zum Büro des Gouverneurs hinunter«, sagte Mr. Ludlow mit steinernem, bedeutungsschwangerem Blick.
»Sehr gern«, erwiderte Freckles fröhlich. »Den Gouverneur finden Sie jetzt wohl in seinem Büro. Er war den Nachmittag über hauptsächlich im Senat, wo das Kelley-Gesetz verabschiedet wurde.«
Mr. Ludlow kniff die Lippen zusammen. Er richtete sich auf, sein Schweigen war ungeheuer.
Binnen nur fünfzehn Minuten ließ die Verwaltung Freckles holen.
»Ich verlange seine Entlassung!«, sagte Mr. Ludlow, als der Junge eintrat.
»Zufälligerweise haben Sie in diesem Haus nicht das Sagen«, erwiderte der Gouverneur mit einer gehörigen Portion Schärfe. »Obwohl die Angelegenheit selbstverständlich gründlich geprüft werden wird.«
Innerlich war der Gouverneur ein einziges Glucksen, sein Herz war erfüllt von Bewunderung und Dankbarkeit; aber wäre Freckles in der Lage, das Spiel bis zum Ende durchzustehen? Hätte der Junge das Geschick, die subtile Raffinesse, die wahre Meisterhand, welche die Situation verlangte? Falls nicht, dann – so sehr er auch der rettende Geist war – müsste Freckles im Interesse der Reformen gehen. Vor ihm stand ein ausgesprochen unschuldig aussehender Junge, der ihn fragend ansah.
»William«, sprach der Gouverneur – Freckles gab das zunächst einen Stich, bis ihm einfiel, dass er von Amts wegen William hieß –, »dieser Gentleman hat sehr ernste Vorwürfe gegen dich vorgebracht.«
Freckles sah Mr. Ludlow gekränkt an und wartete, dass der Gouverneur weiterspräche.