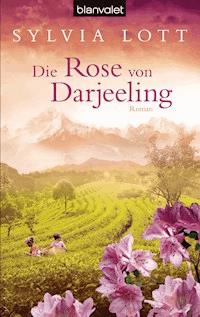8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo wilde Rosen ein altes Herrenhaus umranken, sucht eine Frau nach ihren Wurzeln ...
Frankreich 1958: Jeanne verzaubert in den Fünfzigerjahren ganz Paris mit ihren Chansons. Nun lebt sie mit ihrem Mann in einem Château im malerischen Loire-Tal und widmet sich leidenschaftlich ihrer großen Liebe, der Rosenzucht. Doch ein Schatten liegt über ihrem Glück, denn Jahre zuvor musste sie das, was sie am meisten liebte, zurücklassen, um zu überleben ...
Hamburg 2017: Die Journalistin Ella erbt ein verfallenes Anwesen in Frankreich. Sie ahnt nicht, dass das Vermächtnis ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Und dass es ein Geheimnis birgt, das zu Ellas Wurzeln an der ostfriesischen Küste zurückreicht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Frankreich 1958: Jeanne verzaubert in den Fünfzigerjahren ganz Paris mit ihren Chansons. Nun lebt sie mit ihrem Mann in einem Château im malerischen Loire-Tal und widmet sich leidenschaftlich ihrer großen Liebe, der Rosenzucht. Doch ein Schatten liegt über ihrem Glück, denn Jahre zuvor musste sie das, was sie am meisten liebte, zurücklassen, um zu überleben …
Hamburg 2017: Die Journalistin Ella erbt ein verfallenes Anwesen in Frankreich. Sie ahnt nicht, dass das Vermächtnis ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Und dass es ein Geheimnis birgt, das zu Ellas Wurzeln an der ostfriesischen Küste zurückreicht …
Autorin
Die freie Journalistin und Autorin Sylvia Lott ist gebürtige Ostfriesin und lebt in Hamburg. Viele Jahre schrieb sie für verschiedene Frauen-, Lifestyle- und Reisemagazine, inzwischen konzentriert sie sich ganz auf ihre Romane. »Die Inselfrauen«, »Die Fliederinsel« und »Die Inselgärtnerin« standen wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
Mehr unter www.romane-von-sylvia-lott.de und www.facebook.com/sylvialott.romane
Von Sylvia Lott bei Blanvalet bereits erschienen
Die Rose von Darjeeling
Die Glücksbäckerin von Long Island
Die Lilie von Bela Vista
Die Inselfrauen
Die Fliederinsel
Die Inselgärtnerin
Die Rosengärtnerin
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Sylvia Lott
Roman
Das Gedicht »Bevor ich sterbe« von Erich Fried stammt aus »Lebensschatten«, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1981, 2001.
Die Zitate hier stammen aus dem Lied »Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre«, Komposition Friedrich Hollaender, Text Friedrich Hollaender und Robert Liebman, 1931 Ufaton Verlagsgesellschaft mbH, 50% assigned 2005 to Frederick Hollaender Music and 50% assigned 2007 to Dreiklang-Dreimasken Bühnen- und Musikverlag GmbH
Das Zitat hier stammt aus »Worstward Ho – Aufs Schlimmste Zu« von Samuel Beckett, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Blanvalet
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Margit von Cossart
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
JB · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-22613-8V005
www.blanvalet.de
Bevor ich sterbe
Noch einmal sprechen
von der Wärme des Lebens
damit doch einige wissen:
Es ist nicht warm
Aber es könnte warm sein.
Bevor ich sterbe
noch einmal sprechen
von Liebe
damit doch einige sagen:
Das gab es
das muss es geben.
Noch einmal sprechen
vom Glück der Hoffnung auf Glück
damit doch einige fragen:
Was war das
wann kommt es wieder?
ERICH FRIED
1
Mon bijou,
seit ich von deiner Existenz weiß, ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht an dich gedacht hätte. Mit so viel Liebe, dass mein Herz ganz wund ist. Mit so heftig ziehender Sehnsucht, dass nur mein schlechtes Gewissen mich daran hindern konnte, zu dir zu kommen. Immer war ich aber auch überzeugt davon, dass es besser für dich und deine Familie ist, wenn ich mich unsichtbar im Hintergrund halte. Deshalb hast du mich nie kennengelernt. Manchmal frage ich mich, ob du wohl trotzdem etwas von mir geahnt hast?
Ich habe es geschworen. Erst, wenn ich nicht mehr lebe, wirst du von mir erfahren. Wenn du diese Zeilen liest, werde ich also nicht mehr sein. Ich wünsche mir so sehr, dass du mich verstehen und mir verzeihen wirst. Dass meine Liebe dich auch dann noch erreicht, berührt … Und wer weiß schon, wie es nach dem Tode weitergeht? Vielleicht werde ich irgendwann als Molekül im Duft meiner Rosen um dich herumschweben. Diese Vorstellung gefällt mir, sie macht mir den Tod etwas annehmbarer. Wie auch die Hoffnung, einige geliebte Menschen wiederzutreffen. Ansonsten bin ich empört, ja zutiefst wütend über die Aussicht, bald sterben zu müssen. Denn ich lebe verdammt gern, obwohl sich diese Krankheit in meinem Körper ausbreitet und mich zunehmend einschränkt. Die Ärzte geben mir nicht mehr viel Zeit.
Eigentlich hätte ich schon viel früher damit anfangen sollen, wollen, mein Leben für dich aufzuschreiben. Es ist nur nicht so einfach. Ich habe schon mehrfach einen Versuch unternommen. Beim Erinnern geht man noch einmal durch alles hindurch – das Schlimme und das Schöne. Es wühlt auf, strengt an, man bleibt stecken, wo man sich gar nicht lange aufhalten wollte, und braucht wieder eine Weile, um sich davon zu erholen. Deshalb hab ich es wohl zu lange hinausgeschoben. Jetzt weiß ich nicht, ob mir noch ausreichend Energie für einen vollständigen Bericht bleiben wird. Aber was wäre schon wirklich vollständig? Erinnerungen sind immer lückenhaft, subjektiv, verfälscht.
Mein geliebter Schatz, du hast gelernt zu recherchieren. (Das weiß ich über dich, und ich weiß noch mehr. Nein, das muss dir nicht unheimlich sein.) Wo du Lücken in meinen Aufzeichnungen vermutest, frag meine Wegbegleiter. Sei neugierig, ich erlaube es dir, ich bitte dich sogar darum! Es geht nicht um mich, es geht am Ende vor allem um dich. Du wirst mehr über dich selbst erfahren, wenn du mich mit all meinen Stärken und Schwächen kennenlernst.
Ich hatte ein reiches Leben, mit mehr Facetten als der Kristallleuchter, auf den ich gerade blicke – das Abendlicht bricht sich in ihm, und kleine Regenbogen verzaubern den Raum.
Leider war nicht jede Facette so hübsch. Im Grunde habe ich vier Leben gelebt – das als Kind und junges Mädchen in den Weinbergen des Bordelais, das als Fremdarbeiterin während des Krieges an der deutschen Nordseeküste in Ostfriesland, anschließend das als Chansonsängerin in Paris und schließlich meine letzten Jahrzehnte als Baronin im Loire-Tal. Vier Leben, jedes mit seinen eigenen Schönheiten, Schwierigkeiten, Stimmungen. Nur das eine, welches ich mir am meisten gewünscht habe, das ist mir versagt geblieben. Davon konnte ich immer nur träumen. Dieses Unerfüllte hat mich wohl am meisten geprägt. Ihm oder besser der Sehnsucht danach verdanke ich meine größten Erfolge. Kritiker und Publikum rätselten in den Fünfzigerjahren viel über »Jeannes Geheimnis«. Jetzt endlich will ich es lüften, für dich, mein geliebter Schatz.
Wenn ich überlege, wo ich am besten anfangen soll, tauchen vor meinem geistigen Auge unsere Weinberge im Morgennebel auf. Ich sehe sie vor mir wie an jenem Junitag im Jahre 1942, als ich aufbrach, um mit Artur die letzten beiden Arbeitspferde des Weinguts Château d’Avril bei den deutschen Besatzern auf dem Rathausplatz von Bordeaux abzuliefern.
2
Bordelais, Juni 1942
So früh morgens war es noch kalt, aber Jeanne zitterte auch ein wenig vor Aufregung. Sie zog eine fadenscheinige altrosafarbene Strickjacke über das Baumwollkleid, dessen Blümchenstoff schon lange verblichen war, und verbarg ihr schulterlanges kastanienbraunes Haar unter einem Kopftuch. Die Wellen mit ihrem rötlichen Glanz weckten immer gleich Aufmerksamkeit, und es war besser, nicht aufzufallen.
Als sie vor dem kleinen Wandspiegel in ihrer Schlafkammer den Sitz des Kopftuchs überprüfte, sah sie das Gesicht eines jungen Mädchens mit spitzem Kinn und hübschem kleinem Mund. Auf dem hellen Teint schimmerten Sommersprossen, die bis zur Weinlese sicher wieder kräftiger werden würden. Das Auffälligste an ihr waren die großen dunkelbraunen Augen, die immer gleich verrieten, was sie dachte. Jede Nuance ihrer Gefühle konnte man daran ablesen. Jeanne wünschte, sie könnte gucken wie Mata Hari – geheimnisvoll, undurchdringlich, rätselhaft –, und zog sich selbst eine Fratze. Sie schob das Tuch noch ein Stück tiefer über den Haarwirbel in die Stirn, dann griff sie nach ihrem Rucksack und ging in die Küche, um sich von ihrer Mutter zu verabschieden. Es roch nach gebackenen Maisbrötchen.
»Knall die Haustür nicht wieder, Jeanne«, mahnte ihre Mutter, »grand-père schläft noch.« Dem Großvater ging es seit Wochen schlecht. »Willst du nicht frühstücken?« Jeanne schüttelte den Kopf. Es war doch kaum etwas da, sie wollte dem Großvater nichts wegessen, was ihn vielleicht wieder auf die Beine bringen konnte. Und bestimmt würde Artur einen Imbiss aus der Gutsküche mitbringen. »Setz dich«, befahl die Mutter. »Kind, du wirst immer magerer.« Jeannes Magen knurrte wie zur Bestätigung. Die Mutter reichte ihr eine Tasse mit Ersatzkaffee aus gerösteter Gerste und ein warmes petit pain. Auf dem Tisch stand ein Töpfchen mit Erdbeermarmelade. Sie schmeckte säuerlich, weil es kaum noch Zucker gab. Während Jeanne dennoch gierig ein Brötchen verschlang, mahlte die Mutter weiter Maiskörner zu jenem groben Mehl, mit dem sie inzwischen die meisten Mahlzeiten zubereitete. Ihr besorgter Blick verriet, dass sie ihrer Tochter zutraute, noch ganz andere Unannehmlichkeiten als nur Lärm zu provozieren. »Halt dich zurück, wenn du in der Stadt bist! Es wimmelt dort von Soldaten.«
»Natürlich. Ich soll ja nur für Madame etwas aus der Teppichreinigung abholen. Und Artur begleitet mich, er hat dort auch etwas zu erledigen.«
»Weiß Madame davon?«, fragte ihre Mutter misstrauisch. »Ich glaub, sie sieht es nicht mehr gern, wenn ihr Sohn so engen Kontakt zu dir hält.«
»Sie hat es sogar selbst vorgeschlagen«, entgegnete Jeanne auftrumpfend.
Ihre Augen funkelten unternehmungslustig. Sie war erst zweimal in der großen Stadt gewesen.
»Tatsächlich? Sollst du etwa einen der Aubussons aus der Reinigung holen?« Die d’Avrils besaßen etliche dieser kostbaren Wandteppiche. »Der ist doch viel zu schwer für dich. Außerdem gäb’s jetzt wirklich Wichtigeres …«
Kopfschüttelnd unterdrückte Jeanne ein Glucksen. »Ich hole nur einen Beutel Staub ab.«
In diesem Moment begriff ihre Mutter, was der Auftrag zu bedeuten hatte. Einen Moment lang glitzerte es in ihren Augen, ihre Mundwinkel zuckten, sie konnte ihre Schadenfreude nicht verhehlen. Im vergangenen Jahr hatte sie selbst dabei geholfen, nachts im Weinkeller der d’Avrils im engsten Kreis von Familie und vertrauenswürdigen Mitarbeitern Flaschen mit minderwertigen Abfüllungen einzustauben. Sie hatten feinen grauen Staub, der bei den Teppichreinigungen angefallen und auf Bitten von Monsieur gesammelt worden war, in Siebe gefüllt und ihn mit sanftem Klopfen wie Puderzucker auf die falsch etikettierten grünen Glasflaschen rieseln lassen. Die somit auf alt getrimmten Chargen waren den Deutschen wenig später für viel Geld als Bordeaux-Raritäten verkauft worden. Einige sollten sogar direkt in den privaten Weinkeller von Reichsmarschall Hermann Göring nach Deutschland gegangen sein.
Mit derartigen kleinen subversiven Aktionen wehrten sich die Winzer gegen die Demütigungen, die sie ertragen mussten. Es half nicht wirklich gegen das Gefühl der Beschämung darüber, innerhalb kurzer Zeit von den Deutschen, denen Frankreich auch noch selbst den Krieg erklärt hatte, besiegt worden zu sein. Aber zumindest tröstete es ein wenig über den Frevel hinweg, den die Besatzer trieben, indem sie Spitzenweine für sich reklamierten und bei ihren Besäufnissen runterkippten wie Bier.
Deutsche austricksen – das war ein neuer Volkssport geworden. Es gab keinen Franzosen, von einigen Kollaborateuren abgesehen, der sich daran nicht klammheimlich erfreute. Auch die Miene von Jeannes Mutter verriet, dass sie eine gewisse Genugtuung empfand. Doch schon nach wenigen Sekunden wechselte ihr Gesichtsausdruck, und sie schaute wieder gewohnt ängstlich.
»Sei in Gottes Namen nicht frech zu den doryphores! Provozier sie nicht!«
»Was für Ausdrücke du benutzt, maman«, erwiderte Jeanne gespielt vorwurfsvoll, doch mit einem verschmitzten Lächeln. Doryphores, »Kartoffelkäfer«, nannten sie die Deutschen, seit man für die Verwendung der abschätzigen Bezeichnung »boches« ins Gefängnis gesteckt werden konnte. Zeitgleich mit Hitlers Soldaten hatten zwei Jahre zuvor auch Heerscharen von Kartoffelkäfern Frankreich heimgesucht. »Mach dir keine Sorgen. Was sollte denn an einem Beutel voller Staub verdächtig sein?« Unbekümmert drückte Jeanne ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange. »Es kann etwas länger dauern. Artur möchte auf dem Rückweg noch seinen alten Chemielehrer besuchen, aber wir sind auf jeden Fall vor Beginn der Sperrstunde zurück.«
Ihre Mutter seufzte. Sie wusste wohl, dass sich ihre siebzehnjährige Tochter, das letzte ihrer fünf Kinder, das noch zu Hause wohnte, keine Vorschriften mehr machen ließ.
Jeanne schulterte ihren leeren Rucksack und bemühte sich, leise mit ihren holzbesohlten Schuhen über den Steinfußboden zu gehen. Vorsichtig zog sie die Tür ins Schloss. Das sandfarbene Kalksteinhäuschen ihrer Eltern, die wie schon ihre Vorfahren als Weinbauern für die adlige Familie d’Avril arbeiteten, lag auf einer kleinen Anhöhe umgeben von Rebreihen. Ihr Vater wässerte wie immer vor dem Frühstück den Gemüsegarten. Mit der Gießkanne hinkte er zur Regenwassertonne. Das steife Bein war ihm nach einer Verletzung im Großen Krieg geblieben. Das und sein hohes Alter hatten ihn jetzt vor der Einberufung bewahrt. Jeanne winkte ihm zu. Doch er reagierte nicht, wandte sich stattdessen seinen Bienenkörben zu, die er bald, wie jedes Jahr, im Park der d’Avrils aufstellen würde.
Nach einigen flotten Schritten auf dem Pfad zum Château blieb Jeanne stehen – was für ein Anblick, wie schön! Sie spürte einen schmerzhaften Stich in der Brust. Frühnebel schwebte über den lang gezogenen Senken der Weinberge. Die Farben der Schleier wechselten zwischen Lachsrosa und Silbrig, sie schmeichelten dem Zartgrün der Landschaft. So liebte Jeanne ihre Heimat. So wirkte das Bordelais – das größte Weinanbaugebiet der Welt, das die berühmten Bordeauxweine hervorbrachte – noch intakt wie vor dem Krieg.
Jeanne schloss für einen Moment die Augen. Sie atmete tief durch. In der weichen Luft lag ein berückender süßlicher Duft, der ihr augenblicklich das Herz öffnete – die Weinreben blühten. Ihre Knospenkaspeln mussten über Nacht aufgeplatzt sein. Jeanne schnupperte konzentriert wie ein Feinschmecker, der einen Spitzenwein verkostete. Sie glaubte, auch eine Brise vom Meer wahrnehmen zu können. Wie ein Versprechen von Frische und Freiheit. Zwar hatte sie das Meer, das knapp sechzig Kilometer entfernt lag, noch nie gesehen, aber schon von klein auf meinte sie, an bestimmten Tagen seine vom Wind herbeigetragenen Aromen ausmachen zu können.
Ja, und nun mischte sich noch ein Hauch Rosenduft in die Komposition. Jetzt riecht es wie im Frieden, dachte Jeanne beglückt und sog das Duftgemisch ein, das sie an unbeschwerte Kindertage erinnerte.
Die Rosen liebte sie besonders. Schon als kleines Mädchen war sie deren Hüterin gewesen. Hatte Schädlinge von ihren Blättern und Blüten geklaubt, sie gewässert, mit Pferdedünger versorgt und mit ihrer Zuneigung gestärkt. Voller Begeisterung hatte sie freiwillig dem Obergärtner der d’Avrils assistiert. Und irgendwann war ihr die Kontrolle der Rosenbüsche, die am Ende einer jeden Weinstockreihe wuchsen, übertragen worden. Eine große Verantwortung für ein junges Mädchen. Die dunkelrot blühenden Sträucher standen dort schließlich nicht, weil es schön aussah (was es natürlich trotzdem tat), sondern, um als Frühmelder den Befall mit Ungeziefer, Pilzen und andere Pflanzenkrankheiten anzuzeigen. Meist war es bei ihrer Entdeckung noch früh genug, die robusteren Weinreben wirkungsvoll zu schützen.
Die Kirchenglocke tönte aus dem Dorf herüber, sie schlug sechsmal. Jeanne musste sich beeilen. Artur wollte am Anfang der Eichenallee, die zum Weingut führte, mit den Pferden auf sie warten. Trotz der Morgenkühle geriet sie ins Schwitzen, als sie eine Abkürzung quer über den Weinberg nahm. Der Dunst begann sich aufzulösen. Und von Nahem waren die Veränderungen unübersehbar. Wein blühte nie sonderlich spektakulär, eher unscheinbar. Doch jetzt hatte Mehltau die Blätter der Rebstöcke mit weißlichen Flecken übersät. Da bedurfte es keiner empfindsamen Rosen als Frühwarnsystem mehr. Die Gefahr näherte sich nicht, sie war längst da.
Überall wucherte Unkraut. Hier und da hatten Weinbauern, die für das Château arbeiteten, versucht, zwischen den Rebreihen Hirse fürs Vieh und Gemüse für ihre Familien zu ziehen. An manchen Stellen waren sogar Rosen und Rebstöcke herausgerissen und durch Maispflänzchen ersetzt worden. Der karge, extrem wasserdurchlässige Boden eignete sich zwar ideal für den Weinanbau, aber überhaupt nicht für Gemüse. Entsprechend mickerten die Pflänzchen vor sich hin. Ihr Anblick erfüllte Jeanne mit Groll. Gequält stöhnte sie auf.
Es fehlte eben an allem – an Arbeitskräften, Spritzmitteln, Lieferwagen, Benzin … Die Deutschen hatten die meisten Fahrzeuge beschlagnahmt, außerdem war Treibstoff streng rationiert. Gegen diese und so viele andere kriegsbedingte Erschwernisse kamen die besten Winzerfamilien nicht an. Sogar renommierte Weingüter wie das der d’Avrils befanden sich in einem erbarmungswürdigen Zustand. Arturs Familie besaß noch vier weitere Weingüter. Und jeder hier kannte die Redensart »Je mehr Châteaus du hast, desto ärmer bist du«.
Jedenfalls war das Bargeld immer knapp bei den d’Avrils. Bislang hatten sie ja noch Wein als Tauschmittel und zweite Währung gehabt. Doch neulich hatte Jeanne zufällig Monsieur große Befürchtungen äußern hören. Sie könnten in diesem Jahr von Glück sagen, wenn es ihnen gelänge, nur halb so viel Wein zu produzieren wie noch drei Jahre zuvor, im letzten Friedensjahr. Und jetzt verlangten die Besatzer auch noch, dass sie ihre letzten beiden Arbeitspferde ablieferten! Die Deutschen brauchten mehr Rösser, um Soldaten und Kriegsmaterial an die russische Front zu bringen.
Aufgebracht kickte Jeanne einen großen Kieselstein aus dem Weg. Für die Weingüter war das eine Katastrophe. Wie sollten sie das Unkraut pflügen, wie reife Trauben, Weinfässer und -flaschen transportieren? Ganz abgesehen davon wollte natürlich niemand seine Tiere fürs Schlachtfeld hergegeben. Jeanne wusste, wie stolz Artur auf sein Pferd Lalott war. Mühsam hatte er der Stute beigebracht, mit genau dem richtigen Druck Furchen zwischen den Rebreihen zu ziehen.
Artur, der jüngste Sohn der d’Avrils, war ein Jahr jünger als Jeanne und für sie wie ein Bruder. Als Kinder hatten sie im Weinberg und in den Kellern miteinander gespielt, die Arbeiterfamilien gehörten zur großen d’Avril-Weingutsfamilie dazu. Sie schufteten gemeinsam, identifizierten sich mit »ihrem« Wein, und sie feierten gemeinsam. Natürlich gab es Unterschiede, jedoch nicht für die Kinder – zumindest so lange nicht, bis der adlige Nachwuchs auf weiterführende Schulen wechselte. Am privaten Musikunterricht der d’Avril-Kinder hatte Jeanne häufig ganz selbstverständlich teilgenommen. Sie war talentiert, konnte gut singen, gesellte sich einfach dazu, außer, wenn sie bei der Weinlese helfen musste.
Als einziges Arbeiterkind war Jeanne zunächst stillschweigend geduldet gewesen, schließlich akzeptiert. Sie bereicherte auch den Chor der d’Avril-Kinder, der immer dann zum Einsatz kam, wenn besondere Gäste das Weingut besuchten. Sie stellten sich am Eingang auf und sangen ein Begrüßungsständchen. Der Musiklehrer hatte Jeanne auch geholfen, sich das Lispeln abzugewöhnen. Nur manchmal, wenn man ganz genau darauf achtete, stieß ihre Zunge noch etwas mehr gegen die obere Zahnreihe als erforderlich. Aber seit jemand gesagt hatte, das klinge doch ganz reizend, störte es Jeanne nicht mehr.
Eine Lerche stieg über ihr empor und brachte sie auf andere Gedanken. Wie freudig sie zwitscherte! »Alouette, gentille Alouette«, begann Jeanne, frech und beschwingt, das beliebte Kinderlied zu singen.
Eigentlich sang sie fast immer. Wenn sie allein war, bei der Arbeit, in der Natur. Manchmal erfand sie ganz spontan mit Artur zusammen spaßige Texte zu bekannten Melodien. Sie freute sich auf Artur.
Eine schleichende Entfremdung hatte eingesetzt, seit Artur die weiterführende Schule in der nächsten Kleinstadt besuchte. Er lernte plötzlich Latein und Chemie, während Jeanne nach dem Abschluss der Dorfschule nur noch ihrer Mutter, Madame und dem Gärtner zur Hand gehen sollte. Doch vor Kurzem hatte Artur auf Geheiß seines Vaters die Schule abgebrochen. Es gab zu wenige männliche Arbeitskräfte auf dem Weingut. Die meisten jungen Franzosen befanden sich in Kriegsgefangenschaft. Und manche andere hielten sich versteckt. Bordeaux galt als Nest von Widerstandskämpfern, da wurde einiges gemunkelt, aber Jeanne wollte das alles gar nicht so genau wissen. Jedenfalls sahen sie und Artur sich jetzt wieder häufiger, und das war schön.
Ihr junger Freund stand auch tatsächlich schon wie verabredet unter den Eichen am Rande des lieblichen Parks, der das Château umgab. Ein sympathischer, mittelgroßer Junge mit verwuscheltem braunschwarzem Haar und dunklen Augen. Im Verhältnis zum Oberkörper waren seine Beine recht kurz geraten, doch er hatte etwas Tatkräftiges und Gewitztes. »Napoleon«, neckte Jeanne Artur manchmal. Das ehemals Schmächtige wuchs sich aus, sein Kreuz war in letzter Zeit deutlich breiter geworden, und die Pickel im Gesicht wurden weniger.
»Bonjour, Schnecke!« Artur kam mit den beiden ungesattelten Pferden näher. »Du bist spät dran.« Er grinste, aber Jeanne erkannte, dass er um die Nase herum ganz weiß war.
»Tut mir leid«, sagte sie, während sie ihre Strickjacke auszog und um die Taille knotete, »meine Mutter hat mich aufgehalten.«
»Hunger?« Er wies auf seinen prall gefüllten Rucksack.
»Jetzt nicht, danke.« Jeanne lächelte. »Aber ich freue mich schon auf die Rast.«
Artur hielt ihr seine Hände als Steigbügel hin, und sie schwang sich auf den Rücken des zweiten Pferdes. Sie war schon öfter ohne Sattel geritten, sogar ohne Zaumzeug, nur mit den Händen in der Mähne. Artur übergab ihr die Zügel, dann saß er geübt auf Lalott auf.
»In der Stadt sollten wir die Pferde führen«, sagte er, »sie kennen den Straßenlärm nicht.«
Jeanne nickte nur.
Im Schritttempo schaukelten sie nebeneinanderher. Der warme Geruch von Pferd und Lederriemen stieg Jeanne in die Nase, an ihren Schenkeln spürte sie das leicht kratzige Fell. Wenn der Anlass nicht so traurig wäre, dachte sie, könnte es ein schöner Ausflug werden. Die Sonne schien, Vögel jubilierten, und die nur mäßig verschlammte Landstraße schlängelte sich malerisch durch die Weinberge.
Vor Wochen hatten die d’Avrils bereits sechs Pferde abliefern müssen. Das hatte Arturs herzkranken Vater derart mitgenommen, dass er auf dringenden ärztlichen Rat dieses Mal seinen Sohn schickte. Die ganze Zeit über, während sie an schattigen Kiefernwäldchen und blumigen Weiden vorbeiritten, zermarterte Jeanne sich das Hirn, ob es nicht irgendetwas gab, das die Pferde vor ihrem Schicksal bewahren könnte.
Als sie schon ein Stück auf einer gepflasterten Straße zurückgelegt hatten, legten sie die erste Rast ein. An einem schattigen Plätzchen neben einer Stallruine bereitete Artur auf einem Baumstumpf ihr Picknick vor – etwas Brot, ein paar Radieschen, gerollte Crêpes, die mit Ziegenkäse und frischen Kräutern gefüllt waren, eine gebratene Taube und dazu würzig-fruchtige Konfitüre. Jeanne setzte sich ins Gras unter einen blühenden Akazienbaum, dessen Honigduft sie wie eine unsichtbare Laube umfing. Erleichtert schüttelte sie die unbequemen Schuhe von den Füßen. Artur füllte zum Trinken frisches Wasser vom Bach ab und tränkte noch die Pferde, bevor er sie an einem Baumstamm festband und sich endlich auch zum Essen niederließ.
»Das ist ja ein richtiges Festmahl!« Ohne falsche Scham langte Jeanne zu. »Es soll kaum noch frei lebende Tauben in Bordeaux geben, kannst du dir das vorstellen?«, sagte sie mit vollem Mund.
»Pigeon rôti, gebratene Taube – das wird als das Fleischgericht des Jahres in die Geschichte eingehen.« Artur grinste jungenhaft. Dann bekamen seine Augen einen schwärmischen Glanz. »Wie gern würde ich mal wieder in so’n richtig großes Stück Fleisch beißen. Mmh … in ein leckeres entrecôte vom Rind …«
Jeanne ging sofort auf das Spiel ein, sie malten sich oft köstliche Speisen aus. »Oder in eine knusprige Entenkeule.« Sie seufzte schmachtend.
»Zum Nachtisch dann bitte eine große Schale mousse au chocolat!« Artur biss ein Stück vom Brot ab und tat, als schmeckte er das erträumte Dessert.
»Oder Sandkuchen mit richtig viel Butter und Mandelsplittern. Und cannelés«, fabulierte Jeanne weiter, »mit süßer Karamellkruste und innen schön saftig …«
»Mmh, ich schmeck schon die Vanille darin.«
»Butter! Ich möchte mir einfach mal wieder Butter auf der Zunge zergehen lassen, frische, fette, sahnige Butter.«
»Ja, und süße Schlagsahne …«
»Überhaupt alles, was man aus Kuhmilch machen kann«, schwärmte Jeanne. »Käse, Quark … Ach, auf einem Bauernhof müsste man leben, nicht auf einem Weingut!«
Artur zog seine Wangen nach innen und schluckte, offenbar lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Komisch verzweifelt sahen sie einander an.
»Komm, lass uns von was anderem reden.«
Artur teilte das Täubchen mit seinem Winzermesser in zwei Hälften und reichte Jeanne das größere Stück. Sorgfältig knabberte er seines bis auf die blanken Knöchelchen ab und erzählte zwischendurch von einem Roman, den er gerade las. Es ging darin um den Ruin der Bordeaux-Weingüter im 19. Jahrhundert, als die Reblaus sämtliche Weinstöcke befallen hatte, und um den gelungenen Neustart wenige Jahre später. Die Franzosen hatten reblausresistente Weinstöcke aus Kalifornien importiert.
»Tja, aber bei der Gelegenheit haben wir uns auch den verdammten Mehltau ins Land geholt«, ergänzte Jeanne, die diese Geschichte oft von alten Leuten erzählt bekommen hatte.
»Stimmt, eine neue Plage, das war völlig überflüssig«, gab Artur zu. »Trotzdem … Kalifornien muss ein tolles Land sein. Dahin möchte ich unbedingt einmal.« Nachdenklich sah er Jeanne an. »Wovon träumst du? Außer natürlich davon, dass der Krieg endlich vorbei ist.« Er lächelte wissend. »Und mal abgesehen von deinem eigenen Rosengarten und der großen Liebe.«
»Vom Meer!«, antwortete Jeanne, ohne lange zu überlegen. »Mir ist, als würde ich es längst kennen. Aber ich hab’s noch nie mit eigenen Augen gesehen.«
Sie stellte sich vor, dass es etwas in ihr auslösen würde, doch was genau, das wusste sie nicht. Es war nur eine Ahnung, eine ferne Verheißung, die sie manchmal in der Luft witterte – vielleicht ein Gefühl von Freiheit.
Artur nickte verständnisvoll. »Es ist grandios!« Gleich strahlte er kennerhaft. »Ich war doch als Kind mal mit meinen Eltern in Biarritz – Sandstrand, steile Klippen, hohe Wellen mit weißem Schaum! Es prickelt unter der Haut, wenn man drin badet. Selbst wenn’s kalt ist, macht es Spaß. Man fühlt sich so … so …«, er suchte nach dem passenden Wort, »… so lebendig!«
»Welche Farbe hat das Meer?« Jeanne hatte sehr Widersprüchliches darüber gehört.
»Blau, ein kräftiges Dunkelblau. Aber es wechselt auch, je nach Tageszeit. Und da ist immerzu ein Brausen, als würde es atmen, das hört man noch im Schlaf.«
»Ich hab mal gelesen, man kennt das Meer erst dann, wenn man es bei Orkan und bei Windstille erlebt hat.«
»Mag wohl sein. Das ist wie mit Menschen, oder?«, erwiderte Artur, der gern philosophierte. »Na, dich kenn ich dann ja schon ganz gut.« Er hatte sie traurig und glücklich erlebt, gelangweilt und aufgeregt.
Jeanne grinste. »So wie ich dich«, gab sie zurück. »Deine Mutter braucht sich wirklich keine Gedanken zu machen.«
»Um Gottes willen! Natürlich nicht.«
Das stimmte. Wer wie sie als Kinder zusammen Doktorspiele ausprobiert, Weintrauben bis zum Erbrechen genascht, heimlich die erste Zigarette geraucht und Klingelstreiche im Dorf verübt hatte, war davor gefeit, sich in den anderen zu verlieben. Jeannes verstorbene Großmutter hatte sie beide immer in Schutz genommen, wenn sie nach einem Streich erwischt worden waren. »Eh bien, sie sind Kinder«, pflegte sie zu sagen, »und außerdem: Einmal ist noch keine Gewohnheit.«
Jeanne erinnerte sich, wie schlecht Artur als Kind Schmerzen hatte ertragen können. Auch die Schmerzen anderer hatten ihn immer sofort zum Einlenken gebracht. Sie waren gute Kameraden für den Rest ihres Lebens. Sie wussten auch voneinander, wer wann in wen verliebt war. Artur himmelte derzeit Fleur an, die Tochter des Dorfarztes, der seinen Vater behandelte. Das kaprizöse Mädchen mit den dunklen Mandelaugen erinnerte an eine Zirkusprinzessin. Klein, zierlich, eigensinnig und hübsch war sie.
Jeanne hatte Artur bereits Ratschläge für deren Eroberung gegeben. Unter anderem den, die Tintenflecke an seinen Fingern mit Bimsstein zu entfernen. Und neulich erst den, Fleur ein wirklich zu ihr passendes, ganz persönliches Geschenk zu machen. Daraufhin war Artur auf dem Dachboden verschwunden, um stundenlang nach einem seidenen Sonnenschirm mit Lochstickereien zu suchen, der einst den Teint seiner Großmutter geschützt hatte. Den vergilbten Schirm hatte er dann Fleur zum Geburtstag geschenkt, zusammen mit einem Seil, das er zwischen zwei Bäume im Park gespannt hatte, damit sie dort Seiltanzen üben konnte. Wie dieses Geschenk bei Fleur angekommen war, darüber hatte Artur sich bislang noch nicht geäußert. Jeanne drängte ihn nicht. Sie war sich sicher – sollte er es einem Menschen verraten wollen, dann ihr.
Umgekehrt war Artur der einzige Mensch, der damals mitbekommen hatte, dass Jeanne sich in den deutschen Offizier Georg Winterfeld verguckt hatte. Monatelang war der große Blonde aus Hamburg bei den d’Avrils im Château einquartiert gewesen. Die Deutschen hatten zwei Jahre zuvor kurzerhand das Haupthaus für sich requiriert und die französischen Besitzer damit gezwungen, in ein Nebengebäude umzuziehen.
Es waren aufregende Tage voller zwiespältiger Gefühle gewesen. Allein schon die Feststellung, dass die Feinde nicht wie Monster aussahen! Jeannes Gedanken schweiften zurück in jene Zeit.
In schneidigen Uniformen mit blank geputzten Koppeln marschierten die Soldaten auf dem Weingut ein. Einige lächelten die Frauen an. Jeanne war hin- und hergerissen zwischen Empörung, Scham und Faszination. Aus ihrem Versteck im Dachgeschoss des Pferdestalls beobachteten sie und eine Freundin, wie die Deutschen sich auf dem Hof mit freiem Oberkörper an den Brunnen erfrischten, sich bespritzten und lachten! Kichernd, seltsam erhitzt, schauten sie zu. Es waren gut gebaute, strahlende junge Männer, die meisten wohl gerade erst achtzehn, höchstens zwanzig, viele blond und groß. Sie erweckten den Eindruck, als könnten sie es selbst kaum fassen, dass sie so leicht durch Frankreich marschiert und nun, nachdem der Waffenstillstand sich schnell als Kapitulation Frankreichs entpuppt hatte, wirklich und wahrhaftig die Sieger waren.
Die kleinen Jungen auf dem Weingut spielten auf einmal nur noch »Deutsche«, sie wollten sein wie die Sieger. Abgesehen von einigen übereifrigen Kollaborateuren verhielten sich die meisten Erwachsenen wie in Schockstarre verfallen. Sie schwiegen gegenüber den Besatzern oder gaben sich zumindest äußerst schmallippig. So auch das Ehepaar d’Avril, das für Jeanne der Inbegriff von Vornehmheit und schlichter Eleganz war. Aber dann kam dieser Hauptmann, höchstens Mitte zwanzig, charmant, wohlerzogen. Sogar die d’Avrils behandelten ihn mit Respekt. Und da begann etwas in Jeanne, gegen die strengen Freund-Feind-Regeln zu revoltieren.
Gab es nicht überall Gute und Böse, in jedem Volk? Kam es nicht auf den einzelnen Menschen an? Immer kühner wurden ihre Gedanken. Waren sie denn nicht in erster Linie Mann und Frau? Nun, sie war noch keine richtige Frau, aber sie glaubte, schon wie eine empfinden zu können – alles in ihr drängte nach Liebe. Wenn der Hauptmann sie doch nur in den Arm nehmen und küssen, wenn er sich mit ihr unterhalten würde, dachte sie. Er würde staunen, wie reif sie schon war und was in ihr steckte.
Jeanne hielt fortan eigentlich immer Ausschau nach Georg Winterfeld. Details an ihm entzückten sie. Allein die blonde Haarsträhne unter seiner schief aufgesetzten Mütze! Und das leicht spöttische Lächeln, das wärmer wurde, sobald sich ihre Blicke trafen. Manchmal zwinkerte er ihr zu. Sie suchte Vorwände, um in der Nähe des Châteaus zu sein und Georg Winterfeld begegnen zu können. Am sandfarbenen, berankten Gebäude fand sich immer etwas zu tun. Gewissenhaft lenkte sie den Efeu um die weißen Fensterläden herum. Mit Hingabe pflegte sie, meist summend oder singend, die in Pastellfarben blühenden Rosenbäumchen vor der Fassade.
Außer ein paar tiefen Blicken, die bei ihr Herzrasen und schlaflose Nächte ausgelöst hatten, geschah lange nichts. Doch eines Tages sprach der deutsche Hauptmann sie vor dem Portal an. Gerade, als sich ein Dorn in ihren Finger gebohrt hatte. Er kam auf sie zu, nahm ihre Hand in seine und entfernte behutsam den Stachel – aber er ließ ihre Hand nicht gleich wieder los, sondern streichelte über die aufgerissene Stelle. Nur sekundenlang und doch eine Ewigkeit.
Sein Blick machte ihr merkwürdig weiche Knie. Ihr Herz klopfte so heftig, dass es davon in ihren Ohren dröhnte.
»Wie heißt du?« Sein Französisch hatte einen starken deutschen Akzent.
»Jeanne.«
»Jeanne …« Er wiederholte ihren Namen auf eine Weise, lang gezogen, mit tiefer, samtiger Stimme, dass es ihr vorkam, als hörte sie ihn zum allerersten Mal. »Was für Augen! Du singst sehr hübsch, Jeanne. Wie alt bist du?«
»Fünfzehn«, antwortete sie wahrheitsgemäß.
»Das ist verdammt jung«, erwiderte er und schenkte ihr einen Blick, in dem aufrichtiges Bedauern lag. Aber ich bin nicht zu jung, hätte sie am liebsten laut ausgerufen, im nächsten Monat werd ich schon sechzehn! Doch sie konnte nicht einmal nicken, war wie gelähmt von der Energie, die während dieser kostbaren Sekunden von seiner Hand in ihre floss.
»Durst?« Artur riss Jeanne aus ihren Erinnerungen. Er reichte ihr über den Baumstumpf hinweg die Wasserflasche.
»Habt ihr mal was von ihm gehört?«, fragte Jeanne unvermittelt.
Der Offizier war nach einem Jahr Aufenthalt im vergangenen Juli an die Front nach Russland geschickt und durch einen dicken cholerischen Hauptmann ersetzt worden, dem man besser aus dem Weg ging. Seither war’s vorbei mit dem höflichen Umgang, der die zu Beginn des Krieges noch weit verbreitete, beinahe sprichwörtliche Ansicht Les Allemands sont corrects (Die Deutschen sind korrekt) gefestigt hatte. Die ersten zwei Monate nach der Kapitulation waren chaotisch gewesen, Jeanne wusste es vor allem vom Hörensagen – Millionen Franzosen aus dem Norden des Landes auf der Flucht, Bordeaux völlig überlaufen, Plünderungen an der Tagesordnung. Fast jeder deutsche Soldat hatte siegestrunken Wein, Parfüm oder schöne Stoffe geraubt und nach Hause geschickt.
Seit August 1940 jedoch wurden Plünderungen streng bestraft. Die Deutschen hatten sich seitdem bemüht, als wohlorganisierte und großzügige Besatzer zu erscheinen. Doch auch diese Phase war nun vorüber. Der neue Offizier im Château machte mit seinen Männern Schießübungen im Salon der d’Avrils, sie zielten zum Spaß auf Ahnenporträts oder auch gern mal auf die Glocke der Dorfkirche. Die Willkür nahm zu, sie enthielt brutale und sadistische Züge.
Natürlich wünschte Jeanne den Deutschen nicht den Sieg. Aber sie betete jeden Abend, dass Georg Winterfeld nichts geschehen möge. Vielleicht lebt er nicht mehr, dachte sie, oder er liegt zerfetzt in einem Lazarett, mit verkrustetem Blut in seinem blonden Haar.
Artur wusste sofort, wen Jeanne meinte. Schweigend schüttelte er den Kopf. Zu hören war nur das Bienengesumm im Akazienbaum und fernes Pferdegetrappel. Jetzt pfiff die Dampflok, mit der sie später zurückfahren wollten. Auf der Landstraße näherten sich zwei Männer auf breiten Ackergäulen mit mehreren Pferden im Schlepptau, auch sie sicherlich auf dem Weg nach Bordeaux. Am Horizont tauchten weitere Reiter auf. Lalott knabberte vernehmbar frische Triebe vom Baum. Plötzlich erschien Jeanne alles ganz furchtbar traurig.
Artur spürte wohl ihren Stimmungswechsel. »Gleich nach dem Krieg werde ich dir das Meer zeigen«, versprach er.
Jeanne schaute abwesend in die Ferne. Ihr Blick blieb am Bachufer hängen. Dort reiften wilde Erdbeeren. Barfuß lief sie über einen Schotterpfad hin, zwei Beeren waren schon rot. Sie naschte eine und pflückte die andere für Artur. Auf dem Rückweg trat sie auf etwas Spitzes.
»Merde!« Jeanne beugte sich hinunter, nahm den Übeltäter in die Hand – und hatte eine Idee. »Hé, lass uns Lalott ein Steinchen unter einen Huf schieben!« Schon lächelte sie wieder. »Bis Bordeaux wird sie hoffentlich lahmen, und solche Zozzen wollen die Deutschen bestimmt nicht an der Front haben.«
»Ich weiß nicht«, Artur zögerte. Er nahm die Erdbeere und biss bedächtig hinein. »Das tut ihr weh, dann mag ich nicht auf ihr sitzen.«
»Du musst auf lange Sicht denken.«
Jeanne reichte Artur den scharfkantigen Stein, der sie gepiekst hatte. Er betrachtete ihn nachdenklich.
»Na gut, einverstanden«, willigte er schließlich ein. »Einen Versuch ist es wert.« Während Artur Lalotts rechten Huf hob, um ihr das Steinchen unters Eisen zu drücken, kam Jeanne wieder der geplante Besuch beim Chemielehrer in den Sinn. Sie kannte den Mann überhaupt nicht, und er hatte sie auch noch nie gesehen. »Soll ich eigentlich mitkommen zu diesem ehemaligen Lehrer?«, fragte sie. »Warum willst du ihn überhaupt besuchen? Da steckt doch sicher irgendwas dahinter, oder?«
»Entschuldige bitte, Lalott«, murmelte Artur. Er klopfte dem Pferd den Hals, wie um Zeit zu gewinnen. »Ist zu deinem Besten, glaub mir.« Umständlich setzte Artur sich wieder ins Gras. »Stimmt!« Er blinzelte gegen die Sonne an. »Du bist eindeutig die Schlauere von uns, Jeanne. Im Grunde hättest du auf die weiterführende Schule gemusst, nicht ich.«
»Lenk nicht ab«, erwiderte Jeanne, wenn auch insgeheim geschmeichelt. Sie würde gern mehr lernen.
Aber sie war ja »nur ein Mädchen«. »Die heiraten doch eines Tages und kriegen Kinder. Wozu also der Aufwand?«, sagten alle – ihre Eltern, der Pastor und die Lehrer. Jeanne sah das anders.
Auch Jungen heirateten eines Tages und bekamen Kinder. Hinderte sie das etwa daran, etwas zu lernen? Mit diesem Hinweis war sie bislang allerdings nur auf Unverständnis und Unwillen gestoßen. Sie hatte nicht einmal eine ordentliche Gärtnerlehre machen dürfen.
Sogar der weise Marschall Pétain, der sich als Held von Verdun im Ersten Weltkrieg die Wertschätzung der Franzosen erworben hatte und nun als greises Staatsoberhaupt in der nicht besetzten zone libre, der sogenannten freien Zone des zweigeteilten Frankreich von Vichy aus regierte, wurde nicht müde, »Arbeit, Familie, Vaterland« als die Ideale der neuen Zeit zu preisen. Frauen hatten sich um die Familie zu kümmern, sie sollten zu Hause bleiben und nicht egoistischen, eigenen Interessen folgen.
»Also gut, du darfst aber mit niemandem drüber reden, Jeanne«, hörte sie Artur mit gedämpfter Stimme sagen. Er beugte sich vor. »In Wirklichkeit hat mein Vater mich von der Schule genommen, weil … weil ich heimlich Kupfersulfat herstellen soll.«
Ungläubig sah Jeanne ihn an. »Du?«
Wie sollte ein Sechzehnjähriger das bewerkstelligen? Sie wusste natürlich, dass der Mehltau nur mit ausreichenden Mengen Kupfersulfat bekämpft werden konnte. Die Deutschen nannten das Mittel, das man damit herstellte, Bordelaiser Brühe. Es war die einzig wirksame Medizin. Aber es gab einfach nicht mehr genug vom Grundmaterial Kupfer, weil die Besatzer fast alle Metalle für die Rüstungsindustrie beschlagnahmt hatten. In ganz Frankreich konnte man legal kein Kupfer mehr erwerben. Schon zu Beginn des Krieges hatten die Winzer alte Stromkabel aus ihren Häusern gerissen, bestes Kochgeschirr, dekorative Beschläge, kunstvoll gehämmerte Reliefs geopfert, einfach alles, was aus Kupfer bestand, und es gegen Kupfersulfat eingetauscht. Anfangs war das noch erlaubt gewesen. Sogar Skulpturen waren eingeschmolzen worden. Doch jetzt? Keine Chance!
»Mein alter Lehrer Monsieur Lavalle soll uns helfen«, erklärte Artur den Plan. »Er hat schließlich Chemie studiert und kennt verschiedene Methoden, wie man das Zeug herstellt. Mein Vater hat schon mit ihm gesprochen. Grob gesagt, muss man nur Salpeter- und Schwefelsäure mischen und das dann mit Kupfer reagieren lassen.«
»Ihr seid ja irre!«, stieß Jeanne hervor, aber ihre Augen leuchteten. »Und wenn sie euch erwischen? Die sperren euch ein oder Schlimmeres.«
»Wenn wir nichts gegen den Mehltau unternehmen, werden wir bald unsere Leute nicht mehr bezahlen können«, sagte Artur ernst. »Auch deine Familie nicht, Jeanne.« Erschrocken starrte Jeanne ihn an. Das hätte sie niemals für möglich gehalten. »Papa sagt, wenn kein Wunder geschieht, muss er das Château d’Avril bald verkaufen.«
Jeanne atmete tief ein. »Und das Wunder willst du bewirken.« Es war keine Frage, sondern eine Feststellung.
»Genau.«
»Puh!«
»Wir richten uns ein kleines, einfaches Labor ein, in dem verlassenen Häuschen, in dem früher die Dumonts gelebt haben, das kennst du doch«, fuhr Artur fort. »Das liegt mitten im Weinberg, weit genug von anderen Häusern entfernt. Da können wir nachts experimentieren.«
Zwei offene Militärfahrzeuge rumpelten über das Pflaster, überholten die Reiter und Pferde, einige Soldaten feixten. Einen Moment lang befürchte Jeanne, sie würden anhalten, doch zum Glück fuhren sie durch.
»Ja, aber …« Sie stand auf und zog sich die Schuhe wieder an, sie war jetzt zu hibbelig, um weiter ruhig im Sitzen zuhören zu können. »Bleibt immer noch die Frage: Wie kommt ihr an Kupfer?«
Auch Artur sprang hoch. »Mein Vater kennt einen belgischen Diplomaten, der in Bordeaux lebt. Er ist Stammkunde bei uns und weiß einen guten Tropfen zu schätzen.« Er lächelte listig, während er die Pferde losband. »Belgien bezieht immer noch Kupfer aus Afrika, aus einer der Kolonien, die heißt Kongo. Und dieser Diplomat hat uns zugesagt, dass er auf Weintransportern, die zwischen Bordeaux und Belgien verkehren, Kupfer für uns schmuggelt. Wenn wir ihn dafür, natürlich unter der Hand, mit Wein bezahlen.«
»Ganz schön gewagt.« Jeannes Knie zitterten, als sie ihren Rucksack wieder schulterte und dann den Baumstumpf als Tritthilfe nutzte, um das Pferd zu besteigen.
Artur schwang sich wie ein Musketier auf Lalott. Ein breites Lächeln ließ sein Gesicht strahlen. »Schnecke, das Glück ist mit den Wagemutigen!«
Kurz vor Bordeaux begann Lalott tatsächlich zu lahmen. Artur prüfte die empfindliche Stelle im Huf, und Lalott bäumte sich entgegen ihrem Temperament auf. Der Himmel hatte sich zugezogen. Artur und Jeanne führten die Gäule am Halfter durch die Gassen der Stadt. Das Klackern der Hufeisen hallte von den Häusern wider. Auf dem Pflaster dampften frische Pferdeäpfel. Aus allen Richtungen strömten Bauern, Winzer, aber auch Leute, die wohl eher einen Handwerksbetrieb oder ein Geschäft besaßen, das Waren per Fuhrwerk transportierte, mit ihren Pferden herbei. »Mehr als tausend Jahre waren sie unsere treuesten Arbeitskameraden«, hörte Jeanne einen Mann verbittert sagen, »und jetzt geben wir sie her, als wären sie räudige Hunde.« Es schnürte ihr die Kehle zu.
Überall hingen Hakenkreuzfahnen. Auf dem Rathausplatz drängten sich Mensch und Tier. Es roch scharf nach Schweiß, Leder, Pferd, nach Angst und unterdrückter Wut. Jeanne sah viele versteinerte Mienen. Die Luft vibrierte von den mühsam beherrschten Emotionen ihrer Landsleute. Manch harter Kerl schien einem Tränenausbruch nahe. Deutsche Offiziere mit Listen und Schreibzeug nahmen Personalien auf und machten sich Notizen. Andere begutachteten die Tiere systematisch. Stets schaute einer ihnen ins Maul, umkreiste sie, prüfte die Flanken. Wenn er nickte, brachten Untergebene das Pferd fort.
»Das kann ja noch ewig dauern, bis wir drankommen«, flüsterte Jeanne, nervös zupfte sie ihr Kopftuch zurecht. »Die Teppichreinigung liegt doch ganz in der Nähe. Am besten gehe ich jetzt allein dorthin, sonst sind wir nachher zu spät dran.« Madame hatte ihr den Weg vom Rathaus aus erklärt.
»Ja«, stimmte Artur zu. Auf seiner Stirn glänzten feine Schweißperlen. »Ist wohl besser so.«
Jeanne nickte und machte sich auf den Weg. Ein blonder Soldat hielt Wache neben dem Rathausportal. Er hatte Ähnlichkeit mit Hauptmann Georg Winterfeld. Sie konnte nichts dagegen tun, gleich schlug ihr Herz schneller.
»Haltet ihr Franzmänner uns für blöd?«, schrie plötzlich ein Uniformierter nur eine Armlänge von ihr entfernt in schlechtem Französisch. Jeanne schreckte zusammen. »Glaubt ihr etwa, wir kennen uns nicht aus mit Pferden?« Sie versuchte, sich schnell weiter durch die Menschenmenge hindurchzuschlängeln. Aber aus den Augenwinkeln sah sie, wie der Deutsche triumphierend mehrere kleine Steine hochhielt. »Dein Gaul lahmt nicht wirklich, Froschfresser!« Er versetzte dem Pferdebesitzer mit seinem Gewehrkolben einen Schlag in den Nacken. Der Mann schrie auf vor Schmerz.
O Gott, dachte Jeanne, und alles Blut schoss ihr in den Bauch, ich war nicht die Einzige mit dieser Idee, und schlimmer noch – diese Idee ist überhaupt nicht gut! Hoffentlich kommt Artur damit durch, hoffentlich tun sie ihm nichts! Sie spürte, wie die Schweißtücher unter ihren Achselhöhlen feucht wurden und ihr Puls raste. Aber sie durfte jetzt nicht umkehren, um Artur zu warnen. Dafür war es zu spät, damit würde sie ihn nur verdächtig machen. In diesem Zustand konnte sie jetzt auch nicht in die Teppichreinigung gehen. Jeanne zwang sich, ruhiger zu atmen und gemessenen Schrittes um den Block zu spazieren. Nach einer Weile ging es wieder.
Sie musste nach dem Weg fragen. Kurz darauf stand sie vor dem Geschäft, holte noch einmal tief Luft und trat ein. Eine hell klingende Ladenschelle meldete Kundschaft. »Bonjour«, begrüßte sie freundlich eine alte Dame, die aus dem Dunkel hinter dem Tresen auftauchte. Sie trug ihr graues Haar hochgesteckt wie wahrscheinlich schon in ihren besten Jahren vor dem Großen Krieg.
»Bonjour«, erwiderte Jeanne befangen. »Ich soll eine Kleinigkeit für Madame d’Avril abholen. Und sie lässt Ihnen beste Grüße ausrichten.«
Die alte Dame hob ihre an einer Kette vor der Brust baumelnde Stielbrille, um sie prüfend anzuschauen. »Ach ja, ich weiß Bescheid«, sagte sie dann und holte etwas unter dem Tresen hervor. »Ich habe es in eine Porzellanvase mit Deckel umgefüllt und zugebunden«, erklärte sie, »falls es heut noch regnet. Im Stoffbeutel würde die Lieferung sonst vielleicht matschig werden, und das wäre doch ein Jammer, nicht wahr?« Ein feines Kräuseln in ihren Augenwinkeln verriet, dass die Frau wusste, welch hehre Aufgabe dem Staub beschieden war. Jeanne lächelte schüchtern. Behutsam wickelte sie die Vase in ihre Strickjacke ein und stopfte sie in ihren Rucksack.
»Es ist keine Kostbarkeit«, sagte die Frau mit Blick auf das Gefäß. »Nur Fabrikarbeit und auch schon etwas angeschlagen.«
»Merci, Madame.« Jeanne knickste.
»Es ist mir ein Vergnügen. Mit den allerbesten Empfehlungen unseres Hauses. Und bitte grüßen Sie Madame d’Avril ganz herzlich von mir!« Die Dame ging voran, sie hielt ihr die Ladentür auf wie einer feinen Kundin. Jeanne errötete. »Nochmals vielen Dank, Madame. Auf Wiedersehen.« Sie presste den Rucksack vor ihren Bauch, um ihn im Gedränge besser schützen zu können.
Als sie den Rathausmarkt erreichte, kam ihr Artur entgegen – mit Lalott am Zügel! »Sie wollen sie nicht! Zu alt, zu lahm!« Er wedelte strahlend mit einem amtlich aussehenden Zettel, bemühte sich aber sofort wieder um einen gleichgültigen Gesichtsausdruck. »Hier hab ich’s schwarz auf weiß«, sagte er Jeanne leise ins Ohr.
»Das ist ja wunderbar!« Ihr fiel ein Felsbrocken vom Herzen. Aufgeregt berichtete sie ihm, dass auch andere den Steinchentrick versuchten. »Ich hatte schon Befürchtungen, dass sie auch bei dir …«
»Sie haben Lalotts Huf kontrolliert«, fiel Artur ihr ins Wort. »Aber vorhin, als wir die Stadt erreicht hatten, weißt du, da konnte ich meine Gute einfach nicht länger leiden sehen. Ich hab den Stein rausgepult und dir nichts davon gesagt. Ein bisschen lahmen wird sie trotzdem noch eine Weile.«
Jeanne knuffte ihn erstaunt, halb mahnend wie eine große Schwester, deren Anweisung nicht befolgt worden war, doch auch strahlend, denn sie fühlte sich unglaublich erleichtert.
»Schwein gehabt!«
Übermütig stimmte sie einen Schlager an, und beim Refrain fiel Artur in den Gesang ein, obwohl sie ringsum nur Kopfschütteln ernteten.
Da sie auf dem Rückweg mit dem Pferd nicht wie vorgesehen den Zug nehmen konnten, geriet ihr Zeitplan durcheinander. Sie erreichten das Haus des Chemielehrers, der in der nächstgelegenen Kleinstadt zum Château d’Avril lebte, später als angekündigt. Artur hielt es für klüger, allein mit Monsieur Lavalle zu sprechen.
»Je weniger Leute eingeweiht sind, desto geringer die Wahrscheinlichkeit aufzufliegen, sagt mein alter Herr.«
»Aber ich bin doch jetzt eingeweiht.«
»Das muss ja niemand wissen. Erst mal jedenfalls.«
»Du hast recht. Ich werde schweigen wie ein Grab.« Jeanne sah sich in der Geschäftsstraße um. Selbst um diese Zeit gab es vor einigen Läden noch Schlangen. Vor allem Kinder, alte Frauen und alte Männer warteten. Die jüngeren Frauen, die ihre Familien allein durchbringen mussten, pflegten sich schon lange vor Geschäftsöffnung anzustellen. Nun, am späten Nachmittag, erhielt man oft nicht mehr, was einem laut Lebensmittel- oder Bekleidungskarte offiziell zustand. Aber die Leute nahmen alles, was sie bekommen konnten. Selbst wenn man etwas nicht benötigte, war es nützlich, denn man konnte es immer noch gegen etwas anderes eintauschen. Jeanne schnaufte ungeduldig. Wie viel Lebenszeit verloren ging mit diesem ewigen Schlangestehen und Tauschen! »Geh nur, Artur. Ich werd mir hier schon die Zeit vertreiben.«
Vielleicht konnte sie sich nützlich machen und für jemanden, der auf die Toilette musste, den Platz in der Schlange freihalten. Allerdings fesselten gerade ungewöhnliche Schaufenster ihre Aufmerksamkeit. Gegenüber dem Haus, in dem der Lehrer wohnte, befand sich ein Büro mit Aushängen in den Fenstern. Während Artur die steile Stiege zur Lehrerwohnung erklomm, überquerte Jeanne die Straße. OFFICE DE PLACEMENT ALLEMAND stand über der Tür. Es handelte sich um ein deutsches Werbebüro, das freiwillige Arbeitskräfte für Deutschland suchte.
Ein pinkfarbenes Plakat zeigte den Kopf eines edlen Germanen mit Stahlhelm und unten, kleiner gezeichnet, Reihen von arbeitswilligen Menschen. Sie geben ihr Leben, verkündeten große Lettern – gemeint waren ganz offenbar die Deutschen, die in Russland kämpften – und dann ging es weiter mit der Aufforderung: Gebt ihr eure Arbeit, um Europa vor dem Bolschewismus zu retten. Damit waren die Franzosen gemeint. Jeanne atmete schwer aus.
Im anderen Schaufenster stand etwas von einer neuen Regelung. Für drei Franzosen, die freiwillig zum Arbeiten nach Deutschland kämen, sollte jeweils ein französischer Kriegsgefangener entlassen werden. Jeanne fragte sich, ob man sich wohl »seinen« Kriegsgefangenen aussuchten durfte. Dann wäre das Angebot sicher für manche Familie verlockend.
Die Tür wurde geöffnet, und ein jovial wirkender Mittvierziger im Anzug kam aus dem Büro. »Guten Tag, Mademoiselle!«, sagte er mit tiefer Stimme. Vielleicht hatte er sich gelangweilt und freute sich, dass mal jemand Interesse zeigte. Bei ihm jedenfalls stand die Kundschaft nicht Schlange. »Darf ich Sie ein wenig informieren? Ganz unverbindlich selbstverständlich.« Es sprach gut Französisch, aber man hörte den deutschen Akzent heraus. Jeanne zuckte mit den Achseln. »Möchten Sie vielleicht ein Glas Wasser, Mademoiselle?« Jeanne hatte tatsächlich Durst. Der Mann war der typische Vertreter, geschäftsmäßig liebenswürdig, offen und gewandt, letztlich nicht unsympathisch. Er wies ins Büro, und nach kurzem Zögern trat sie ein. Was sollte schon Schlimmes passieren? Jeder konnte durch die Fenster hineinblicken. Der Mann bat sie, auf dem Besucherstuhl vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen, und füllte für sie aus einer Syphonflasche Wasser in ein Glas. »Mein Name ist Müller.« Sie nickte, ohne ihren Namen zu nennen, und trank in kleinen Schlucken, um nicht zu gierig zu erscheinen. Jeanne erfuhr, dass es mittlerweile dreihundert solcher Werbestellen in beiden Zonen Frankreichs gab, vor allem, um französische Facharbeiter nach Deutschland zu holen. Herr Müller arbeitete selbstständig auf Provisionsbasis. »Sie erhalten ordentliche Verträge, das kann ich Ihnen zusagen, Sie arbeiten acht Stunden am Tag, haben Anspruch auf Urlaub und erhalten genauso viel Lohn wie Ihre deutschen Kollegen.«
»Ja, aber …«, sagte Jeanne hilflos. Warum erzählte er ihr das alles? »Vielleicht, wenn ich ein junger Mann wäre …«
»Oh, Mademoiselle, wir haben auch schon viele Frauen nach Deutschland vermittelt. Ungefähr zwanzig Prozent unserer Vertragsabschlüsse betreffen weibliche …«
»Aber ich habe keinen richtigen Beruf erlernt«, warf Jeanne ein. Sie fand das alles durchaus interessant, doch natürlich dachte sie nicht im Traum daran, nach Deutschland zu gehen. Dennoch hörte sie aufmerksam zu. Bis es ans Fenster klopfte. Artur stand dort. Jeanne lächelte Herrn Müller höflich an. »Es tut mir leid, ich muss dann wieder.«
»Vielleicht kennen Sie jemanden«, sagte der Deutsche und stand auf, »vielleicht haben Sie Brüder, Freunde, Nachbarn … Geben Sie weiter, was ich Ihnen erklärt habe. Und vielleicht sieht man sich ja auch mal wieder. Au revoir, Mademoiselle.«
»Au revoir. Und danke für das Wasser.« Eilig folgte Jeanne Artur zum Haus gegenüber, wo er Lalott vom Eisenring an der Fassade losband.
»Er macht mit!«, raunte ihr Freund aufgekratzt. »Lavalle kann uns auch die erforderlichen Apparaturen beschaffen. Nächste Woche fangen wir an.«
»Großartig!«
Jeanne freute sich mit ihm. Das war doch alles in allem prima gelaufen heute! Es stimmte wohl – das Glück war mit den Wagemutigen.
Als sie schon das Stadttor hinter sich gelassen hatten, blieb Artur plötzlich stehen. »Wo ist dein Rucksack?«
»Ach du Schreck!« Jeanne schlug sich an die Stirn. »Den muss ich bei diesem Herrn Müller vergessen haben!« Lalott nutzte die Gelegenheit, frisches Gras am Wegesrand zu fressen. »Ich lauf schnell zurück, warte hier auf mich.«
Außer Atem kam Jeanne an – gerade noch rechtzeitig. Herr Müller befand sich in Begleitung eines deutschen Soldaten, mit dem er sich vertraut unterhielt, und wollte gerade zum Feierabend die Tür abschließen.
»Mein Rucksack«, stieß Jeanne keuchend aus, »entschuldigen Sie bitte, ich habe meinen Rucksack bei Ihnen vergessen. Er muss noch neben dem Stuhl stehen.«
Der Soldat erwiderte ihr bemühtes Lächeln nicht. Herr Müller ging ins Büro und brachte ihr den Rucksack. Erleichtert drückte Jeanne ihn an sich.
»Darf ich mal sehen, was Sie darin haben?«, fragte der Soldat. Jeanne erstarrte. Dieser Tag hatte schon so viele Aufregungen gebracht, sie war müde und hungrig und erschöpft. Und jetzt das! Sie hob eine Hand gegen ihre Stirn, zupfte nervös mit zwei Fingern am Kopftuch. »Öffnen Sie Ihren Rucksack«, blaffte der Soldat.
Jeanne überlegte fieberhaft, wie sie reagieren sollte. Ungeduldig riss der Soldat ihr den Rucksack aus den Händen.
»Vorsicht!«, rief sie spontan. »Nein, bitte nicht!«
Das reizte den Mann offenbar nur noch mehr. Mit einem Ruck entzurrte er den Verschluss, dann beförderte er ihre Strickjacke hervor und wickelte die Vase aus – vorsichtig, als befände sich darin Sprengstoff. Entsetzt schaute Jeanne zu. Oje, was würde Madame sagen, wenn sie hörte, dass sie sich hatte erwischen lassen? Und dass der kostbare Staub, ihr Mittel zur Weinveredelung, nun verloren war? Gleich beim ersten Versuch gescheitert. Ob die Deutschen ihr mildernde Umstände zugestehen würden, wenn sie sagte, dass sie vorher noch nie etwas Unerlaubtes getan hatte? Der Spruch ihrer Großmutter schoss ihr durch den Kopf. Einmal ist noch keine Gewohnheit. Doch grand-mère war nicht mehr da, um sie zu verteidigen und zu retten. Jeanne kamen die Tränen.
Der Soldat starrte die Vase misstrauisch an. Er holte ein Klappmesser aus seiner Hosentasche und schnitt die Bindfäden durch.
»Meine Großmutter …« Jeanne begann zu weinen. Der Soldat hob den Deckel. Blickte verständnislos in das Porzellangefäß. »Es ist nur Staub!«, sagte Jeanne mit erstickter Stimme.
Der Soldat schien das Wort nicht zu kennen. Doch Herr Müller hatte wohl in diesem Moment ein Aha-Erlebnis. »Ihre Großmutter?«, wiederholte er. »Ist das ihre Asche?«
Jeanne war kurz perplex, dann begriff sie, welche Chance dieses Missverständnis bot. Der Deutsche verwechselte das französische Wort für Staub mit dem für Asche.
»Ja!«, stieß sie hervor. »Das ist die Asche meiner geliebten Großmutter!«
»Och, Kindchen!« Herr Müller legte ihr tröstend eine Hand auf die Schulter. »Es ist ja nichts passiert. Walter, gib ihr doch das Ding zurück. Du hast ja gehört – die Asche ihrer Großmutter.«
Angewidert streckte der Soldat ihr die staubgefüllte Vase, die für ihn nun eine Urne mit verbrannten sterblichen Überresten einer alten Französin war, entgegen.
»Oh, vielen Dank, ganz herzlichen Dank! Auf Wiedersehen!«
Hastig packte Jeanne die Vase wieder in ihren Rucksack und machte sich auf den Weg.
3
Loire-Tal, Gegenwart
»Hab ich dir eigentlich schon gesagt, wie unglaublich froh ich bin, dass du mitkommst?« Ella pustete eine Strähne zur Seite, die sich aus ihrem blonden Haarknoten gelöst hatte, und sah ihre Beifahrerin dankbar an.
»Seit Hamburg ungefähr neunundzwanzigmal, seit wir in Frankreich sind, etwa elfmal.« Anna lächelte. »Guck bitte nach vorn, Ella. Das da könnte ein Stau werden. Wollen wir die Strecke mit den Mautgebühren nehmen?«
»Na klar, laut Navi ist das der kürzeste Weg nach Cremont.« Ella konzentrierte sich wieder auf den stockenden Verkehr der Pariser Ringautobahn. Als voraussichtliche Fahrzeit bis zum Ziel an der Loire zeigte das Navi zweieinhalb Stunden an. »Kostet aber extra«, mahnte Anna. »In Anbetracht unserer knappen …«
»Ach was!« Ella lächelte gespielt herablassend. »Man erbt schließlich nicht alle Tage ein Château samt Dorf. Da sollte man auch standesgemäß anreisen.«
Selbstironisch warf sie einen Blick in den Rückspiegel. Ihr alter vollgepackter Mercedes-Kombi, der seit Jahren in Hamburg-Uhlenhorst auf der Straße geparkt wurde, wirkte wie immer verlottert – was Ellas Mutter, die auf dem Land mit Eigenheim und Garage lebte, stets entsetzte. »Wie magst du überhaupt mit einem derart verbeulten und versifften Auto durch die Gegend fahren?«, fragte sie stets. Vergeblich versuchte Ella jedes Mal wieder, ihr klarzumachen, dass es sich einfach nicht lohnte, ein von Lindennektar betröpfeltes Auto für fünfzehn Euro durch die Waschanlage zu jagen, wenn es einen Tag später doch wieder so aussehen würde wie vorher. Und da es schon einige Dellen hatte, brauchte sie sich keine Sorgen darum zu machen, dass es welche bekommen könnte. Sie fand das beruhigend, aber das verstand ihre Mutter nicht.
»Noch hast du es nicht geerbt«, korrigierte Anna, während sie beim Stop-and-go mit einem Franzosen auf der Überholspur flirtete und lässig an ihren kurzen dunklen Haaren zupfte. Anna war nicht nur etwas älter als Ella, schon Anfang vierzig, sie sah die Dinge meist auch realistischer. »Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, weshalb du dir den Kasten nicht erst mal angesehen hast, bevor du mit Sack und Pack dahin übersiedelst.«
»Hab ich dir doch schon erklärt«, erwiderte Ella. »Weil ich keine halben Sachen mache.« Etwas kleinlauter fügte sie hinzu: »Und weil so eine Reise schließlich auch jedes Mal Geld kostet. Mir bleibt doch sowieso nur die Flucht nach vorn.«
»Wegen Sven, meinst du«, ergänzte Anna. Sie hatte sich wochenlang Ellas Liebeskummer seinetwegen anhören müssen. Es lief einfach nicht mehr rund. Ella wollte endlich mit ihm zusammenziehen, weil sie fand, dass es Zeit wurde, Nägel mit Köpfen zu machen, und sie die Hoffnung auf die große Liebe inzwischen aufgegeben hatte. Doch Sven druckste herum, es zeichnete sich immer deutlicher ab, dass er lieber seine Freiheit behalten wollte. Es nützte nichts, Ella konnte sich nicht länger vormachen, dass sie die gleichen Ziele verfolgten. Und nur guter Sex und ab und zu ein gemeinsames Wochenende, das reichte ihr nicht mehr. Sie musste endlich wissen, wohin sie gehörte. Es fiel ihr nur verdammt schwer, konsequent Schluss zu machen. Ein Ortswechsel, so hoffte sie, würde ihr den Schritt erleichtern. »Wovon willst du in diesem Jahr in Frankreich eigentlich leben?«
Für Anna, die als Psychologin mit ihrem Mann, der Anwalt war, und zwei Kindern ein vorbildliches Leben mit eigenem Häuschen in Hamburg-Niendorf führte, waren geordnete finanzielle Verhältnisse das A und O. Und gesellschaftliche Reputation. In dieser Hinsicht verkörperte sie genau das Gegenteil von Ella, die gern liebenswert Verrückte und Künstlertypen um sich scharte. Mit rund zwanzig von ihnen hatte sie eine Woche zuvor in ihrer Zweizimmerwohnung ihren Abschied gefeiert. Die Freunde würden ihr furchtbar fehlen, das wusste sie jetzt schon. Die Wohnung war nun für ein Jahr untervermietet, ihre privaten Sachen und wenige Lieblingsstücke hatte Ella bei ihrer Mutter auf dem Südermarschhof untergestellt, ein paar Dinge vorausgeschickt nach Cremont.
»Och, das krieg ich schon irgendwie hin«, antwortete Ella vage. »Ich brauch ja nicht viel.«
Die Frauen kannten sich, seit sie vor Jahren in derselben Frauenzeitschriftenredaktion gearbeitet hatten. Das war in der Zeit vor #MeToo gewesen, bevor Frauen überall auf der Welt von den Belästigungen durch Vorgesetzte und mächtigere Männer berichteten und lautstark dagegen protestierten. Ihr Chefredakteur, ein Choleriker und Chauvi, hatte sie alle an den Rand eines Nervenzusammenbruchs getrieben. Damals durften Männer wie er noch ungestraft Sätze wie »Nun schieben Sie mal Ihre Titten aus dem Blickfeld« von sich geben.
Die Leidenszeit unter diesem Chef hatte die so gegensätzlichen Frauen zusammengeschweißt. Ella hatte schließlich gekündigt, um als freie Journalistin zu arbeiten, Anna war schwanger geworden. Zweimal im Abstand von zwei Jahren. Sie hatte die Zeit genutzt, um beruflich umzusatteln und Psychologie zu studieren. Nun war sie als kassenfinanzierte Psychologin ständig ausgebucht und verdiente ordentlich. Auch ihr Umgang mit Geld stand in diametralem Gegensatz zu Ellas. Ella hatte nie welches, und wenn ihr doch einmal etwas zufloss, gab sie es aus, um dem Geld, dem Kosmos oder sich selbst zu beweisen, wie sehr sie den schnöden Mammon, nun ja, nicht direkt verachtete, aber eben nicht an die erste Stelle setzte.
In den vergangenen Jahren allerdings war die Situation für freie Journalisten immer schlechter geworden, prekär lautete das angesagte Wort dafür. Sogar Ella hatte angefangen, jeden Euro dreimal umzudrehen und sich erst vor Kurzem aus Verzweiflung beim Krummerhörner Anzeigenblatt in ihrer alten ostfriesischen Heimat beworben. Werbetexte für Anzeigenkunden schreiben, Jubelberichte über Firmenjubiläen, Fotos von Misswahlen mit Milchkühen, den Honoratioren die Füße küssen – all das hatte sie immer verachtet und vermeiden wollen. Den Hungertod allerdings auch. Und der war ihr nicht mehr allzu fern erschienen.
Ella hielt an der Mautstation, ließ das Fenster herunter und zog ein Ticket. Ein kühler Wind drang ins Auto. Es war Mitte Oktober, und der Herbst begann bereits, unangenehm zu werden.
»Soll ich dich mal ablösen?«, fragte Anna.
»Nö, danke«, sagte Ella. Sie waren am Vormittag nach einer Übernachtung in Maastricht und einem kleinen Bummel durch die niederländische Stadt gut ausgeruht weitergefahren, eine Autostunde vor Paris hatten sie in einem mittelalterlichen Städtchen Rast gemacht. »Der Kaffee vorhin war extra stark. Ich bin noch ganz fit.« Nach dem leckeren Schokokuchen kniff ihre Jeans jetzt noch.
»Hast du endlich mit deiner Mutter gesprochen?«, hakte Anna nach. »Weiß sie, wie pleite du bist? Deine Familie besitzt doch immerhin diesen großen Hof da oben an der Küste, da kann sie dir doch mal was rüberschie…«
»Nein!«, fiel Ella ihr heftig ins Wort. Sie hatte schließlich ihren Stolz. »Außerdem ist das alles nicht mehr so doll wie früher.« Der große Hof mit einst siebzig Hektar Land und dreißig Kühen war im Laufe der Jahre immer weiter verkleinert worden. Nach dem Tod ihres Vaters, der vor fünf Jahren mit einem Sportflugzeug abgestürzt war, hatte die Bank einen Kredit gekündigt und ihre Familie damit gezwungen, noch ein Stück Land und das meiste Vieh zu verkaufen. »Milchwirtschaft lohnt sich nur noch, wenn du mehr als hundert Kühe hast und das quasi industriell betreibst«, erklärte Ella ihrer Freundin, die in Hamburg aufgewachsen war. »Diese alten Gulfhöfe wie unserer sind auch enorm aufwendig im Unterhalt, erst recht, wenn man ein bisschen Gespür für Tradition hat.«
»Die Tradition der Polderfürsten«, sagte Anna bedeutungsvoll. »Das Wort Polderfürst hab ich übrigens, als ich damals mit dir bei deiner Familie zu Besuch war, das erste Mal gehört.«
So hatte man früher in Ostfriesland die wohlhabenden Marschbauern genannt, deren Land dem Meer abgerungen worden war. Sie residierten gleich hinter den Deichen auf besonders prächtigen Höfen.
Den Rest des Familienerbes zu bewahren bedeutete für Ellas Bruder Ulfert und seine Frau Tomke ein ständiges Abwägen zwischen Stil und Finanzierbarkeit. Sie neigten mehr als Ella zum Modernen. Glatt und pflegeleicht sollte es sein. Ein Ideal, das ihre Mutter, der seit dem Tod des Vaters alles gehörte, gern unterstützte. Sie hatten das riesige Dach mit spiegelnden Sonnenenergiekollektoren ausgestattet, etliche Ferienwohnungen in das große Wohnhaus und die Scheune eingebaut. Ulfert und Tomke betrieben nun gerade noch so viel Landwirtschaft mit Kühen, Hühnern, Hund und Ponys, dass sie guten Gewissens Urlaub auf dem Bauernhof für Familien anbieten konnten. Das war ja auch nicht das Schlechteste. Viele Bauern waren auf Maisanbau und Biogasanlagen umgestiegen. Andere Besitzer ließen ihre Gulfhäuser notgedrungen einfach verfallen, manche vermieteten sie an Oldtimersammler oder Trödelhändler, die meisten verhunzten sie bei der Instandhaltung mit billigstem Baumaterial. Wenn Ella dann auch noch die Verspargelung sah, die durch immer neue Windkraftparks bei aller ökologischen Nützlichkeit, die ihr durchaus einleuchtete, die Landschaft verschandelte, tat es ihr in der Seele weh.