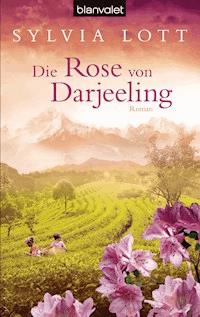9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Norderney-Saga
- Sprache: Deutsch
Ein Friseursalon auf Norderney und starke Frauen, die in schwierigen Zeiten für ihre Träume und die Liebe kämpfen – Die große Familiensaga voll nostalgischem Insel-Charme!
Der Erste Weltkrieg verändert Norderney, die Urlauber fehlen, Geld und Waren sind knapp und Frieda arbeitet hart, um den familieneigenen Friseursalon Fisser über die schwere Zeit zu retten. Auch ihre Freundin Grete tut alles, um als Krankenschwester den Inselbewohnern und Soldaten zu helfen. Beide warten jeden Tag auf Nachricht ihrer Ehemänner, doch nur einer kehrt aus dem Krieg zurück. Die Revolution erreicht auch die Insel. Nach dem Umbruch kündigt sich ein neuer Aufschwung an und Norderney avanciert wieder zum beliebten Seebad. Die Menschen sehnen sich nach Frieden und Fortschritt. Frieda weiß: Sie muss die Zeichen der Zeit nutzen, um den Salon ins neue Jahrzehnt zu führen …
Die Norderney-Saga von Sylvia Lott:
Die Frauen vom Inselsalon
Sturm über dem Inselsalon
Bände 3 und 4 in Vorbereitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Der Erste Weltkrieg verändert Norderney, die Urlauber fehlen, Geld und Waren sind knapp, und Frieda arbeitet hart, um den familieneigenen Friseursalon Fisser über die schwere Zeit zu retten. Auch ihre Freundin Grete tut alles, um als Krankenschwester den Inselbewohnern und Soldaten zu helfen. Beide warten jeden Tag auf Nachricht ihrer Ehemänner, doch nur einer kehrt aus dem Krieg zurück. Die Revolution erreicht auch die Insel. Nach dem Umbruch kündigt sich ein neuer Aufschwung an, und Norderney avanciert wieder zum beliebten Seebad. Die Menschen sehnen sich nach Frieden und Fortschritt. Frieda weiß: Sie muss die Zeichen der Zeit nutzen, um den Salon ins neue Jahrzehnt zu führen …
Autorin
Die freie Journalistin und Autorin Sylvia Lott ist gebürtige Ostfriesin und lebt in Hamburg. Viele Jahre schrieb sie für verschiedene Frauen-, Lifestyle- und Reisemagazine, inzwischen konzentriert sie sich ganz auf ihre Romane, die regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste zu finden sind. Bei der Recherche zu einem ihrer Romane faszinierte sie die glanzvolle und wechselhafte Geschichte Norderneys, und die Idee entstand, eine mehrbändige Saga zu schreiben. »Die Frauen vom Inselsalon« und »Sturm über dem Inselsalon« sind die ersten beiden Teile einer vierbändigen Reihe um einen Friseursalon auf Norderney in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und ww.facebook.com/blanvalet.
SYLVIA LOTT
Sturm über dem Inselsalon
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright des Gedichtes von Mascha Kaléko aus »In meinen Träumen läutet es Sturm« (Hrsg. Gisela Zoch-Westphal): © 1977 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Der Verlag dankt dem Stadtarchiv Norderney und besonders Matthias Christian Pausch für die Bereitstellung der historischen Fotos.
Copyright © 2022 der Originalausgabe by Blanvalet
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Margit von Cossart
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotive: H. Armstrong Roberts/ClassicStock/
Archive Photos/Getty Images; www.buerosued.de
LH · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-25795-8V003
www.blanvalet.de
Die Hauptpersonen rund um den Inselsalon
Frieda Fisser, geb. Dirks
Die flachsblonde Fischertochter mit den blauen Augen hat ihren Traum wahr gemacht, arbeitet jetzt im Salon Fisser und ist mit Hilrich, dem Sohn des Besitzers, verheiratet. Die Krönung ihres Glücks ist die inzwischen fünfjährige Tochter Lissy. Auch sie trifft der Krieg schwer, doch sie wäre nicht Frieda, wenn sie nicht aus allem das Beste machen würde. Die modebewusste junge Frau hat viele innovative Ideen für den Salon.
Grete Lubinus, geb. Lehmann
Grete, Tochter eines Berliner Fabrikanten, hat Norderney, wo sie früher nur Urlaube mit der Familie verbrachte, zu ihrer Heimat gemacht. Die Seeluft tut ihr gut, von den Ekzemen und ihrem quälenden Asthma ist fast nichts mehr zu spüren. Grete arbeitet bis zu Beginn des Krieges als Krankenschwester im Seehospiz, einer Kinderheilstätte, und heiratet am Tag der Mobilmachung überstürzt Dr. Max Lubinus, der schon wenige Stunden später, noch vor der Hochzeitsnacht, in die Schlacht ziehen muss.
Fritz Fisser
Das gutmütige und allseits beliebte Oberhaupt der Familie Fisser und Meister des Friseursalons ist kaisertreu bis in die Bartspitzen und hat sich trotz seines fortgeschrittenen Alters freiwillig für die Inselwacht gemeldet. Seit Beginn des Krieges lebt er im zur Kaserne umfunktionierten Seehospiz. Die Geschicke seines Salons liegen derzeit in den Händen seiner Frau Jakomina und seiner Schwiegertochter Frieda.
Jakomina Fisser
Die Matriarchin der Friseurfamilie Fisser muss einiges mitmachen, denn auch ihr Sohn Hilrich leistet Kriegsdienst. Nun gibt es bis auf den Lehrling Emil niemanden mehr, der die Herren rasieren kann. Auch die Verpflegung der Familie wird immer schwieriger. Doch zusammen mit ihrer Schwiegertochter Frieda scheut sie sich vor nichts − einfallsreich und geschäftstüchtig war sie schließlich schon immer.
Hilrich Fisser
Der gutaussehende Sohn von Jakomina und Fritz Fisser steckte einst die schönsten Damenfrisuren und wusste genau, wem welche Bartform am besten stand. Er schwärmt für Berlin und verspricht seiner Tochter Lissy, nach dem Krieg mit ihr dort hinzureisen. Als Sanitäter muss er an die Ostfront, wo er in der Ukraine eine Begegnung hat, die sein Leben völlig auf den Kopf stellt.
Dr. Max Lubinus
Nach der spontanen, überraschenden Hochzeit mit Grete − natürlich war es Frieda, die das ungleiche Paar zusammenbrachte − ist nun auch der charmante junge Mediziner mit den Reformideen von der Insel abgereist. Er soll seinen Dienst als Stabsarzt an der Front in Belgien leisten und wird von Grete schmerzlich vermisst.
Rieka Dirks
Friedas jüngste Schwester hat es faustdick hinter den Ohren. Sie macht gerne mal die Nacht zum Tag und feiert mit den Marinesoldaten, die auf der Insel stationiert sind. Rieka ist Friedas Sorgenkind, doch im Grunde ihres Herzens ist sie ein gutes Mädchen.
Joseph Graf Ritz zu Gartenstein
Der österreichische Adlige, der Friedas Herz einst höherschlagen ließ, hat Norderney schon vor einiger Zeit verlassen, um eine reiche Erbin zur Frau zu nehmen. Denn der junge Graf muss eine gute Partie machen, um seine verarmte Familie vor dem Bankrott zu bewahren. Aus Friedas Gedanken ist er allerdings nie verschwunden, insgeheim hält sie immer noch Ausschau nach ihm.
Martin von Welser
Der gesellige junge Pilot, den Grete bei einem Besuch der Pferderennbahn kennengelernt hatte, musste die Insel zu Kriegsbeginn fluchtartig mit seinen Kunstfliegerkollegen verlassen. Nun ist er zurück, um in der Seeflugstation Wasserflugzeugführer auszubilden. Er ist enttäuscht, dass Grete inzwischen geheiratet hat.
Das Wickwief
Die Witwe lebt allein in einem Häuschen in den Dünen. Sie gilt als Wahrsagerin, liest aus Teeblättern die Zukunft und hat manchmal Visionen. Weil ihre Zauber und Rituale schon vielen Insulanern geholfen haben, genießt sie allgemein Respekt. Zu Frieda hat das Wickwief eine ganz besondere Beziehung, aber auch die abergläubische Jakomina ist eine treue Kundin, die sich bei ihr gern Rat holt.
Was man so braucht …
Man braucht nur eine Insel
Allein im weiten Meer.
Man braucht nur einen Menschen,
Den aber braucht man sehr.
Mascha Kaléko
Frieda
»Wir sehen uns dann heute Abend bei der Versammlung«, sagte Frieda, während sie ihrer Schwiegermutter Platz an der Registrierkasse machte und den Friseurkittel auszog.
»Ja«, antwortete Jakomina Fisser, »sei besser etwas früher da, es wird bestimmt voll. Und grüß deine Eltern schön.«
»Mach ich«, versprach Frieda. Sie setzte einen Strohhut auf ihr hochgestecktes flachsblondes Haar und rief durch den Flur in Richtung Küche. »Komm, Lissy, wir wollen zu Oma Meta und Opa Dirk. Du darfst heute bei ihnen übernachten.«
Hüpfend kam ihre fünfjährige Tochter in den Verkaufsraum des Inselsalons. Ihre braunen Locken wippten noch, als sie von hellem Glöckchenklang begleitet durch die Ladentür in den Laubengang traten, der das Eckgeschäft von zwei Seiten umgab. Im Damensalon, wo Frieda hauptsächlich arbeitete, wenn sie nicht an der Kasse stand, war an diesem Tag kaum Betrieb. Aber im Herrensalon brummte es, weil plötzlich alle Männer, auch die ganz jungen und die alten, einen militärischen Kurzhaarschnitt wollten. Frieda strich Lissy über den Kopf, um sie zu beruhigen. Nicht nur ihr Kind war aufgedrehter als sonst. Alle Menschen befanden sich seit Tagen im Ausnahmezustand, sie selbst fühlte sich wie betäubt. Denn seit einer Woche herrschte Krieg.
Es war schwer zu begreifen. Frieda ahnte, dass ihr Verstand und ihre Seele dieses epochale Ereignis nur teilweise erfassen konnten. Die Bedeutung eines Krieges, in den beinahe die ganze Welt verwickelt war, überstieg einfach das menschliche Vorstellungsvermögen.
Sie schaute an der Eingangstür hoch und registrierte, dass der blank polierte Metallteller fehlte. Wahrscheinlich war das Zunftzeichen der Friseure schon die ganze Woche über vergessen worden. Kein Wunder, das morgendliche Aufhängen gehörte seit Jahrzehnten zu den Vorrechten ihres Schwiegervaters Fritz Fisser, und der hatte sich trotz seines fortgeschrittenen Alters am vergangenen Sonnabend, dem Tag der Mobilmachung, freiwillig für die Inselwache gemeldet. Er lebte nun, kaserniert mit rund hundertfünfzig anderen Landwehrsoldaten, die allesamt von Norderney stammten, im Seehospiz. Man befürchtete nämlich, dass die Engländer versuchen würden, Deutschland von See her anzugreifen. Davor sollten die Männer der Inselwache sie schützen beziehungsweise früh genug Meldung machen, damit Verstärkung anrücken konnte.
Frieda erschauderte bei diesem Gedanken. Die fröhliche Schrammelmusik noch im Ohr, die bis vor Kurzem aus den Hotelbars erklungen war, mussten sie auf einmal den Horizont nach feindlichen Kriegsschiffen absuchen.
Der mächtige Backsteinkomplex des Seehospizes, einer Kinderheilstätte, war quasi über Nacht geräumt worden. Die Schwestern hatten dreihundert Kinder zurück aufs Festland gebracht und anschließend selbst – wie die meisten Kurgäste – Norderney fluchtartig verlassen. Alle Schwestern mit Ausnahme ihrer besten Freundin Grete Lehmann. Ach nein, sie hieß ja jetzt Grete Lubinus, weil sie am Montagvormittag den Arzt Dr. Max Lubinus geheiratet hatte, der am Montagnachmittag, einberufen als Stabsarzt, mit einem Dampfer zum Festland abgereist war. Ihre spontane Kriegsheirat hatte alle überrascht, Grete und Max wohl am meisten. Eine Eheschließung nach Kriegsrecht ohne Aufgebot. Und ohne Hochzeitsnacht, die Ärmsten. Frieda seufzte voller Mitgefühl.
Lissy schaute sie fragend an. »Alles in Ordnung, mein Schatz.« Mit einem Lächeln bemühte sie sich, Ruhe auszustrahlen.
Grete stammte aus einer wohlhabenden Berliner Unternehmerfamilie. Sie konnte sogar eine adlige Mutter vorweisen und hatte sich, da junge Damen in ihren Kreisen nicht zu arbeiten pflegten, die Schwesternausbildung und ihren Wirkungsbereich im Seehospiz schwer ertrotzen müssen. Da nun die Soldaten der Inselwache im Hospiz untergebracht waren, wohnte die Freundin vorübergehend bei ihnen, den Fissers. Sie schlief in Hilrichs ehemaligem Zimmer in der Wohnung der Friseurfamilie. Frieda und ihr Ehemann hatten nach ihrer Hochzeit einen eigens für sie angebauten Wohnbereich bezogen.
Hilrich war ebenfalls am Montag seinem Gestellungsbefehl gefolgt. Er hatte ihr schon eine Nachricht geschickt. So wusste sie, dass er derzeit nach einer Zwischenstation in Aurich in Oldenburg stationiert war. Gott sei Dank gehörte er nicht zu jenen Soldaten, die bereits in Belgien an der Front kämpften.
Vor dem Kurpark blieb Frieda kurz stehen und atmete tief durch. Die Luft roch nach Salzwasser, Pferdeäpfeln und Rosen. Es war ein wunderbarer Augusttag, ideales Wetter für den Strand. Doch statt vornehmer Kur- und Badegäste sah man nur Soldaten, Grüppchen debattierender Insulanerinnen und verloren wirkende Saisonkräfte, die wie Grete noch keine Gelegenheit gefunden hatten, die Insel zu verlassen. Schließlich gebührte Militärtransporten nun auf den Fähren und für die Anschlusszüge Vorrang.
Eine Brise umschmeichelte Frieda. Im Gesicht und durch den Stoff ihrer hellen Bluse hindurch spürte sie die Sonne. Was für eine Verschwendung von Wärme und Licht! Sie gab sich einen Ruck. Mit Lissy an der Hand ging sie zügig an der Grünanlage mit dem lang gestreckten klassizistischen Conversationshaus und dem Bazar-Gebäude vorbei durch den Ortskern in Richtung Kaiserstraße.
»Das ist doch gar nicht der Weg zu Oma und Opa«, sagte Lissy in der Strandstraße.
»Richtig, wir wollen noch unseren reparierten Wecker abholen.«
Im Schaufenster des Uhrmachers Simon verkündete ein Schild: Wegen Einberufung zur Armee bleibt mein Geschäft vorläufig geschlossen. Frieda zuckte mit den Schultern. Dann eben nicht.
Eigentlich machte sie diesen Umweg zum Fischerhaus ihrer Eltern sowieso nur, weil sie das Bedürfnis verspürte, aufs Meer zu schauen. Die Nordsee hatte sie noch immer beruhigt. Sie brauchte jetzt deren Kraft, wollte die Wellen rauschen hören, den frischen Geruch und die endlose, glitzernde Weite in sich aufnehmen. Das würde ihr hoffentlich auch diesmal helfen, ihre Gefühle zu ordnen und klarer zu erkennen, was getan werden musste.
»Mama, die sperren den Sommer ein!«
Entrüstet zeigte Lissy auf eine eben noch lichtdurchflutete Veranda, die von zwei Männern mit Brettern vernagelt wurde.
»Das macht nichts, ist sogar besser so«, erklärte Frieda. Innerlich schüttelte sie den Kopf. Wie kam das Kind nur immer auf solche sonderbaren Vergleiche? Lissys Empfindsamkeit und Fantasie gefielen ihr einerseits, gewiss handelte es sich dabei um eine Mitgift ihres Vaters. Andererseits fürchtete sie, ihre Tochter könnte zu sensibel werden. Mehr Robustheit würde ihr besser durchs Leben helfen. Deshalb ging sie möglichst praktisch auf derlei poetische Gedankengänge ein. »Die Hotels und Logierhäuser dürfen, solange Krieg ist, keine Gäste mehr aufnehmen. Viele Besitzer gehen schon jetzt aufs Festland, Lissy, nicht erst im Winter wie sonst. Und auf diese Weise sind ihre Häuser besser vor den Herbststürmen geschützt.«
Sie erreichten die Kaiserwiese. Die Tennisplätze vor den Grandhotels mit Seeblick lagen verwaist da. Auch der Badestrand wirkte einsam, letzte Strandkörbe wurden auf einen Pferdewagen gehievt. Nur an Scherls Lesepavillon schräg gegenüber von Braams Buchhandlung und ein Stück weiter an Ullsteins Pavillon drängten sich Menschen. Dort in den Schaufenstern hingen stets die neuesten Nachrichten aus. Theo Weerts, der Redakteur des Inselboten und Stammkunde im Inselsalon, hatte sie bereits am Morgen, während er vom Lehrling rasiert worden war, über die aktuellen Ereignisse informiert. Besonders betroffen gemacht hatte sie die Nachricht, dass alle Bewohner Helgolands evakuiert und nach Hamburg gebracht worden waren. Wer nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen konnte, musste fortan in Altonaer Auswandererbaracken wohnen.
Helgoland verfügte über einen Kriegshafen, außerdem befand sich auf der Hochseeinsel die größte deutsche Seeflugstation. Im Vergleich damit hatten sie es auf Norderney gut. Sie durften bleiben, denn ihre Insel spielte für die Marine nur eine untergeordnete Rolle. Von den sieben bewohnten ostfriesischen Eilanden, zu denen Norderney gehörte, waren Borkum und Wangerooge in den vergangenen Jahren am stärksten aufgerüstet worden, weil sie in der Nähe der kriegswichtigen Häfen Emden und Wilhelmshaven lagen.
»Gehen wir noch an den Strand?«, fragte Lissy erwartungsvoll.
Frieda nickte. Das Kind rannte los, sie folgte gemessenen Schrittes.
Kurz vor der Holztreppe zum Abstieg brüllte sie ein Wachposten an, den sie vorher nicht bemerkt hatte. »Halt! Name? Woher und wohin?«
Frieda schreckte zusammen, Lissy blieb wie versteinert stehen, Tränen in den Augen. Nun erkannte Frieda den Uniformierten, der wichtigtuerisch aus dem Schatten eines zum Wachhäuschen umfunktionierten Badekarrens hervortrat – Hein de Vries, Schuster aus der Friedrichstraße, nicht gerade die hellste aller Leuchten.
»He, Hein, du kennst mich doch! Wir wollten nur mal …«
Er verzog keine Miene. »Hier ist Sperrgebiet, Zutritt verboten.«
»Nun hab dich nicht so, wir sind doch ganz harmlos.« Frieda hob die Hände. »Ist denn überall gesperrt?«
»Vom Januskopf bis zum Weststrand.«
»Ach so, das war mir nicht klar. Könnten wir nicht trotzdem kurz …«
»Das gilt für alle«, antwortete Hein. »Ich bin im Dienst«, fügte er hinzu, wohl um kundzutun, dass er sich nicht auf ein nachbarschaftliches Geplänkel wie in Friedenszeiten einlassen konnte.
Frieda fand das übertrieben. Doch nun marschierte auch noch ein Trupp Soldaten im Gleichmarsch über die Promenade.
»Na dann, tschüss!« Sie winkte Lissy heran, und sie gingen in Richtung Dünen.
Auf ihren beiden liebsten Aussichtsdünen, der Georgshöhe und der Kaapdüne allerdings standen, wie schon von Weitem zu erkennen war, militärische Posten. Sicher waren auch die jetzt für Zivilpersonen gesperrt. Frieda gab den Plan auf, noch ein paar Minuten in Ruhe aufs Meer hinauszublicken, und beschloss, Lissy auf dem schnellsten Weg zu ihren Eltern zu bringen.
Nach wenigen Minuten hatten sie das efeuüberwucherte alte Fischerhaus erreicht, das sich in die Dünen schmiegte. Im eingezäunten Vorgarten blühten Bauernblumen bunt durcheinander. Die Eingangstür stand auf, alle Schiebefenster waren geöffnet.
»Ich koch gerade die ersten Pflaumen ein«, sagte ihre Mutter, als sie in die Wohnküche traten.
Normalerweise hätte sie an einem Tag wie diesem als Badefrau am Damenstrand gearbeitet, und der Vater wäre mit Sommerfrischlern in seiner Schaluppe auf Vergnügungstour vor Norderney hin- und hergekreuzt. Stattdessen saß er draußen in der begrünten Laube neben dem Eingang.
Friedas jüngste Schwester Rieka brühte Tee auf. »Willst du auch zur Versammlung?«, fragte sie.
Frieda nickte. »Wir gehen alle«, sagte sie, und dann an ihre Mutter gerichtet: »Deshalb wollte ich fragen, ob Lissy wohl heute Nacht hier schlafen kann.«
»Aber natürlich! Immer gern. Komm her, min Tüddi!« Ihre Mutter ging in die Knie und umarmte Lissy, bevor sie sich wieder aufrichtete, um Frieda an sich zu drücken. »Unsere Gäste sind alle abgereist. Wir haben Platz genug.« Die Familie vermietete während der Saison drei Zimmer. »Du kannst aber auch wieder zu mir ins Bett kommen, wenn du willst.« Als sie lächelte, erkannte man trotz des wettergegerbten Teints die Ähnlichkeit mit ihren hübschen Töchtern. Alle Dirks-Frauen hatten ein breites, freundliches Gesicht, flachsblondes Haar, helle blaue Augen und Stupsnasen. »Ihr könnt uns ja hinterher erzählen, was die schlauen Leute gesagt haben.«
Oma Kea, die Mutter von Friedas Vater, füllte gerade Pflaumenmus in Gläser. »Na, min lüttje Sünrooske«, sagte sie zur Begrüßung, und Frieda fühlte sich kurz wieder, als wäre sie in Lissys Alter. Liebevoll küsste sie die alte Frau auf die Wange. »Mhmm … es riecht so lecker fruchtig.«
»Nimm Teetassen mit raus«, bat Rieka.
Frieda holte das Geschirr aus dem Schrank und trug es samt einem Stövchen zum Warmhalten in die Laube. Ihr Vater bastelte dort am Gartentisch an einem Buddelschiff. Dieser Nebenbeschäftigung, die immer noch ein paar Mark einbrachte, ging er sonst nur im Winter nach.
»He!«, grüßte Frieda auf Norderneyer Art und klopfte einmal auf den Tisch.
Die blauen Augen ihres Vaters leuchteten auf. »He! Wir haben in Belgien die Festung Lüttich eingenommen!« Stolz strich er über seinen Vollbart. »Die Russen sind an der Front im Osten zurückgedrängt. Und den Franzosen hat unsere Marine in Nordafrika schon ordentlich Feuer unterm Hintern gemacht.«
»Ja, ich hab’s im Salon gehört.« Frieda deckte den Tisch und setzte sich dann. »Wenn das so weitergeht, haben wir den Krieg bald gewonnen.«
»Was denn sonst?«, brummte ihr Vater, während er eine Gabel in die Hand nahm.
Er hielt seine Pfeife mit den Zähnen im Mundwinkel fest, weil er nun beide Hände brauchte, um dem noch weichen Kitt in der Flasche die Form von Wellen einzuprägen.
»Opa, Opa!« Lissy beobachtete ihn fasziniert. »Darf ich nachher das Meer blau anmalen?«
Er schmunzelte. »Natürlich, min Wicht. Das machen wir zusammen, mit dem langen Pinsel. Der Kitt muss aber erst trocknen.«
Erfreut verschwand Lissy im Haus, bestimmt, um in der Küche Pflaumen zu naschen.
Die Erwachsenen setzten sich zusammen, und sie unterhielten sich beim Tee über den Krieg. »Habt ihr schon was von Hero und Dodo gehört?«, fragte Frieda.
Ihr ältester Bruder Hero befand sich auf großer Fahrt. Ihr Lieblingsbruder Dodo war zur Marine nach Wilhelmshaven eingezogen worden.
Ihre Mutter schüttelte den Kopf. »Vielleicht weiß Hero noch gar nicht, dass wir Krieg haben.«
»Übermorgen wird der Kurbetrieb auf Norderney offiziell eingestellt«, berichtete Rieka. »Dann bin ich meine Arbeit in der Hotelküche los.«
Sie schwiegen eine Weile, jeder hing seinen Gedanken nach. Trotz der großen patriotischen Begeisterung schwebte über allem unausgesprochen eine Sorge: Wovon sollen wir unseren Lebensunterhalt bestreiten, wenn wir kein Geld mehr verdienen können? Das beschäftigte alle Norderneyer, deren Existenz direkt oder indirekt vom Fremdenverkehr abhing. Deshalb fand auch am Abend eine öffentliche Volksveranstaltung im Gasthof Frisia statt. Eingeladen hatten der Königliche Badekommissar, der zugleich Inselkommandant war, der Bürgermeister, der Vorsitzende des Kriegervereins und das Lehrerkollegium. Besprochen werden sollte, wie eine ganzseitige Anzeige im Inselboten ankündigte, die Frage: Was können wir Norderneyer in dieser ernsten und schweren Zeit für unser deutsches Vaterland tun?
Frieda brauchte nicht zu fragen, ob Vater und Mutter die Versammlung besuchen wollten. Es war klar, dass sie fernbleiben würden. Vor fast zwanzig Jahren hatte man Dirk Dirks im Frisia, dem beliebtesten Vereinslokal der Insel, Hausverbot erteilt, weil damals sein Name im amtlichen »Verzeichnis der Trunkenbolde« der Königlichen Landdrostei Aurich gestanden hatte. Auch wenn ihr Vater schon lange keinen Alkohol mehr trank und andere Leute die Flaschen für seine Buddelschiffe leeren ließ, mied er konsequent die Stätte seiner öffentlichen Schande. Und selbstverständlich war sie für seine Frau ebenfalls tabu.
Die Großmutter sprach als Erste. »Kommt Zeit, kommt Rat.«
Der dicke Kandis in Friedas Tasse knisterte, als Rieka allen Tee nachschenkte. »Wir sollten die Kluntjes in Zukunft sparsamer einteilen«, meinte ihre Mutter. »Die Preise sind in den letzten Tagen unverschämt gestiegen.« Wieder machte sich eine ungewohnte Stille breit.
»Hilrich ist jetzt in Oldenburg«, erzählte Frieda dann. »Als Sanitäter im Reservelazarett. Erwin, unser Geselle, übrigens auch.«
»Schön, dann kennt er da schon jemanden«, meinte die Mutter.
»Na ja«, gab Frieda zu bedenken. Sie bezweifelte, dass Hilrich erfreut darüber war. »Erwin ist gerade kein edler Charakter, und nun arbeiten sie plötzlich im gleichen Rang.«
»Habt ihr im Inselsalon denn noch genug zu tun?«, wollte Rieka wissen.
»Doch, schon, nur anders als sonst.« Frieda schilderte kurz die veränderte Situation. »Die beiden Räume für Schönheitsbehandlungen können wir dichtmachen. Die Masseurin und die Kosmetikexpertin sind zurück aufs Festland. Die zwei hätten sicher auch nichts mehr zu tun ohne Kurgäste.« Selbst in Friedenszeiten kamen Insulanerinnen, abgesehen von der einen oder anderen Logierhausbesitzerin vielleicht, überhaupt nicht auf die Idee, für solchen Luxus Geld auszugeben. »Im Salon fehlen uns natürlich mit einem Schlag die wichtigsten Leute.«
Das waren vor allem die beiden Friseurmeister, ihr Schwiegervater und ihr Mann, aber auch die Gesellen Erwin, Willy und Menno, genannt Kruuskopp. Frieda biss sich auf die Lippen. Sie schämte sich ein bisschen. Es klang ja fast, als würde sie ihren Mann nur im Salon vermissen. Natürlich hatte sie ihn lieb, sie sorgte sich um ihn, er fehlte ihr, sie waren für immer miteinander verbunden. Schließlich bewahrte sie sein Geheimnis – so wie er ihres bewahrte. Ihre Mutter und ihre Großmutter wussten etwas davon. Aber nur ein Mensch wusste alles. Das war Grete. Frieda hatte ihr Hilrichs Geheimnis keineswegs verraten, Grete war irgendwann von allein draufgekommen. Na ja, und Gretes Mann Max, der wusste inzwischen auch alles. Was daran lag, dass er ein hervorragender, lebenskluger Beobachter war und es sich auf diese Weise erschlossen hatte. Diese beiden würden ihre Geheimisse jedoch gut bewahren, da war sie sich sicher.
»Hauptsache, sie kommen bald alle heil zurück!«, fügte sie schnell hinzu.
»Jau«, ließ sich ihr Vater vernehmen.
Lissy kehrte mit pflaumenmusverschmiertem Mündchen aus der Küche zurück. »Papa will mal mit mir nach Berlin reisen, wenn der Krieg vorbei ist«, verkündete sie stolz.
»In der Kirche gibt’s jetzt immer um sechs Uhr abends eine Kriegsgebetsstunde«, steuerte Rieka bei.
»Beten kann man überall«, erwiderte ihre Großmutter.
»Ist Grete noch auf der Insel?«, fragte die Mutter.
»Ja«, antwortete Frieda, »und ich wünschte, sie könnte trotz allem bleiben. Ehrlich gesagt, fänd ich es schrecklich, wenn sie nicht mehr hier wäre.« Sie hatten sich zehn Jahre zuvor als Vierzehnjährige während einer Kur der Berlinerin kennengelernt. Und trotz der Kluft hatte sich zwischen dem einfachen Fischermädchen und der reichen Unternehmertochter eine tiefe Freundschaft entwickelt. Seit fast drei Jahren lebte und arbeitete Grete nun schon im Seehospiz auf der Insel, dort hatte sie ihre Berufung gefunden. Friedas Brustkorb fühlte sich schwer an, wenn sie sich vorstellte, dass sie die kommende Zeit ohne Grete durchstehen sollte. Zum Zeichen dafür, dass sie keinen weiteren Tee wollte, legte sie den kleinen Löffel in ihre Tasse. »Ich glaub, wir müssen los, Rieka.«
»Och, geh du schon mal vor. Kannst mir ja einen Platz freihalten«, antwortete ihre Schwester. »Ich räum noch ab und zieh mir was anderes an.«
»Na gut.« Frieda erhob sich. Sie küsste und umarmte Lissy, zog das blaue Haarband in ihren windzerzausten Locken zurecht. »Sei schön brav, mein Schatz. Ich bin schon gespannt auf das Meer in Opas neuem Buddelschiff – ob da wohl auch etwas Grün in den blauen Wellen sein wird?«
Sie verließ das Haus und schlug einen schmalen Dünenweg ein, der sich am Ortsrand entlangschlängelte, als Abkürzung zum Frisia. Unterwegs gewahrte sie das Wickwief, das durch die einsame Landschaft wanderte und, wie Windfetzen ihr zutrugen, mit hoher, zittriger Stimme einen Choral sang. Die alte Jantje hatte gelegentlich einen Vörlopp. So nannten die Ostfriesen eine Vision – von einem Todesfall, einem Schiffsuntergang oder vorüberziehenden Leichenzug –, die sich später stets bewahrheitete. Jantje las auch aus Teeblättern die Zukunft und kannte sich mit allerlei Heil- und Zaubermitteln aus. Den meisten Insulanern war sie unheimlich. Der Pastor wetterte regelmäßig gegen sie. Aber sie genoss doch allgemein Respekt.
Frieda hatte ein gutes Verhältnis zu ihr. Besonders, seit die Hellseherin ihre Schwiegermutter vor sechs Jahren davon überzeugt hatte, dass sie, die kleine Friseurgehilfin Frieda Dirks, Tochter eines trunksüchtigen Fischers, genau die Richtige für ihren Goldjungen Hilrich sei. Eigentlich hatte Jakomina Fisser sich ja immer eine bessere Partie für ihren einzigen Sohn erträumt. Doch sie war auch sehr abergläubisch. Und so hatte Frieda ein wenig nachgeholfen. Sie hatte das Wickwief Jantje um Unterstützung gebeten und versprochen, ihr alle zwei Monate mit der Brennschere zu Hause umsonst das Haar zu ondulieren.
Die geheimnisumwitterte Frau kannte sie schon seit ihrer Geburt. Frieda war nämlich unter einer Glückshaube, sozusagen noch in der Eihülle, in die Welt geglitten, was als ein außerordentlich gutes Omen galt. Jantje hatte damals der Hebamme die Glückshaube abgeluchst, sie getrocknet und einem Norderneyer Seefahrer verkauft, der sich dadurch vor dem Ertrinken geschützt fühlte.
Immer wieder mal hatte das Wickwief Frieda beim Frisieren gefragt, ob sie nicht Anzeichen für hellseherische Fähigkeiten verspüre. Schließlich fänden sich unter Menschen, die mit Glückshaube geboren waren, besonders oft welche mit dieser seltenen Gabe. Frieda hatte wahrheitsgemäß stets verneint. Da könne sie froh sein, hatte das Wickwief ihr daraufhin jedes Mal versichert, denn es sei wirklich kein Zuckerschlecken.
Das Einzige, was Frieda von anderen Menschen unterschied, war ihr Talent, Paare zusammenzubringen. Sie erkannte intuitiv, wer zu wem passte. Und dann half sie eben manchmal ein bisschen nach. Der Erfolg hatte ihr schon mehrmals einen schönen Hut beschert, das übliche Geschenk eines frischvermählten Ehepaars als Dank fürs Verkuppeln. Fünf Hüte zierten bereits zu Hause die Wand am Treppenaufgang. Frieda musste lächeln. Aber ihre Miene gefror, als das Wickwief abrupt stehen blieb und zu singen aufhörte. Hatte Jantje etwa einen Vörlopp?
Frieda verharrte ebenfalls. Mit angehaltenem Atem beobachtete sie aus der Ferne die alte Frau, die eine Weile einfach weiter so dastand. Sie erinnerte sich daran, dass Jantje einmal von einem magischen Ort auf der Insel gesprochen hatte – dort war angeblich das, was noch kommen würde, bereits Vergangenheit. Wer dort stünde, der würde es schon wissen, hatte sie geraunt.
Frieda hatte die Geschichte damals eher ins Reich der Spökenkiekerei verwiesen, denn sie wusste, dass Jantje gern etwas übertrieb und allerlei Hokuspokus machte, um die Erwartungen ihrer Kundschaft zu erfüllen. Aber vielleicht war ja doch etwas dran und dort drüben jene geheimnisumwobene Stelle … Verlockende Vorstellung, einfach kurz in die Zukunft sehen zu können. Vielleicht sollte sie es auch mal ausprobieren.
Jantje senkte den Kopf, hob ruckartig die Unterarme, ließ sie aber gleich wieder fallen. Nun drehte sie sich hastig um und strebte eilig zurück in die Richtung, wo ihr Häuschen stand. Nach einem Vergnügen sah das nicht aus. Frieda lief eine Gänsehaut über den Rücken und die Oberarme, ihr Puls beschleunigte sich. O nein, sie wollte nicht in die Zukunft sehen können! Sie wollte mit frischem Mut von Tag zu Tag tun, was getan werden musste, um ihre Familie und sich durch den Krieg zu bringen. Sie blieb an Ort und Stelle.
Demütig schickte sie ein Stoßgebet gen Himmel. »Lieber Gott, mach, dass wir es heil überstehen. Bring mir meinen lieben Hilrich gesund zurück, lass meine Brüder und meinen Schwiegervater unversehrt, beschütze Lissy und mich, gib uns genug zu essen und ausreichend Kraft, alle Schwierigkeiten zu meistern. Bitte schick Joseph einen Schutzengel extra. Lass Deutschland gewinnen, und beschütze auch unseren Kaiser.« Allmählich normalisierte sich ihr Herzschlag. »Ach, und noch was … Könntest du bitte dafür sorgen, dass Grete auf der Insel bleibt? Amen.«
Grete
Endlich! Grete drückte die Fahrkarten an ihre Brust. Nach einer Woche des vergeblichen Anstehens, Wartens und Nachfragens hatte sie eine Fähr- und eine Zugfahrkarte für die Heimreise nach Berlin ergattert. Obwohl – wenn sie ganz ehrlich war, dann musste sie zugeben, dass sie sich nicht wirklich freute. Gewiss wäre es schön, Mutter und Vater wiederzusehen. Aber ihr Vater hatte bestimmt keine Zeit, weil sich die Lehmann’schen Werke derzeit mit Sicherheit vor Aufträgen für militärische Ausrüstung – Spaten, Zelte, mobile Möbel, Uniformen – nicht retten konnten. Ihr mittlerer Bruder Eduard, im diplomatischen Dienst des Auswärtigen Amtes in Berlin tätig, würde beschäftigter denn je sein. Und ihr großer Bruder Ludwig, genannt Lulu, sowie der jüngere Hans-Heinrich saßen weit entfernt in Deutsch-Südwestafrika fest, wo sie ein Kaufhaus mit Ausrüstungsgegenständen für Diamantensucher aufbauten. Was also sollte sie in Berlin?
Der Gedanke an die Bälle und Teestunden, während derer ihre Eltern sie an den Mann zu bringen versucht hatten wie eine lädierte Ware, bereitete ihr noch immer Übelkeit. Andererseits würden wohl keine Vergnügungsveranstaltungen mehr stattfinden, aus Respekt vor den Soldaten im Feld. Allenfalls langweilige Wohltätigkeitsbasare, in den Augen ihrer Mutter das einzig angemessene öffentliche Betätigungsfeld für verheiratete Frauen – auch das fand sie wenig verlockend. Wahrscheinlich würde ihr Asthma zurückkehren, ebenso die grässlichen Ekzeme, die sie jahrelang geplagt hatten, bis sie endlich dauerhaft im Heilklima Norderneys leben und als Schwester im Seehospiz das tun konnte, was sie für sinnvoll hielt.
Aber das Hospiz war nun zweckentfremdet, sie verfügte weder über ein eigenes Quartier noch über Einkommen. Die Gastfreundschaft der Fissers mochte sie auf keinen Fall überstrapazieren. Grete seufzte. Deshalb war es wohl doch das Vernünftigste, in den Schoß – und die komfortable Villa – der Familie zurückzukehren.
Ihre Eltern wussten noch nichts von ihrer spontanen Heirat mit Max Lubinus. Telefon- und Postverbindungen dienten jetzt vor allem dem Militär und funktionierten für Privatleute nur schleppend. Deshalb hatte sie es gar nicht erst versucht. Eine solche Nachricht sollte man auch besser persönlich mitteilen, fand sie. Die Wahrheit war, dass sie schrecklich dagegen ansah. Immerhin, Max hatte einen Doktortitel. Aber er war ein einfacher Ostfriese, eine Halbwaise, die von einem Pastor adoptiert worden war. Er konnte keinen vorzeigbaren Stammbaum präsentieren und besaß kein Geld. Ihm fehlte der gesellschaftliche Schliff, auf den ihre Mutter so viel Wert legte.
Mit Stipendien und viel Fleiß hatte Max es von seiner Ausgangsposition aus betrachtet weit gebracht. Das würde eventuell die Anerkennung ihres Vaters hervorrufen, jedoch nicht ausreichen, um in den Augen ihrer Familie auch nur annähernd den Anforderungen als ihr Ehemann zu genügen. Es würde also Ärger geben in Berlin.
Grete setzte sich auf eine Parkbank. Nachdenklich schaute sie auf die Schlange der Wartenden vor dem Schalter. Auch an diesem Tag erhielt nicht jeder, der wollte, eine Fahrkarte. Etliche Menschen zogen mit enttäuschter Miene von dannen.
In den vergangenen Monaten war Grete Max’ Assistentin im Seehospiz gewesen. Sie hatten an einem Forschungsprojekt über den Einfluss des Seeklimas auf die Asthmaerkrankungen von Kindern gearbeitet. Noch vor einer Woche wäre ihr nicht im Traum eingefallen, dass sie ihren Vorgesetzten jemals heiraten würde. Dieser Kerl hatte sie ständig nur aufgeregt und geärgert. Sie kannte ihn schon länger. Als er noch angehender Arzt gewesen war und sie als hustender, verschorfter Backfisch zur Kur im Seehospiz, da hatte sie zu seinen ersten Patientinnen gehört. Er hatte ihr damals Bücher über die Reformbewegung geliehen. Die Lektüre hatte ihr Denken allmählich in eine andere als von ihren Eltern und Erziehern gewünschte Richtung gelenkt. Zugegeben, damals hatte es zwischen ihnen schon mal zu prickeln angefangen. Doch nach einem einzigen leidenschaftlichen Kuss am Strand, der wirklich ewig zurücklag, hatte sie bei ihrer erneuten Begegnung in diesem Frühjahr geglaubt, sie würde durchaus sachlich die Tabellen für seine Studien führen können. So lange hatten sie sich aus den Augen verloren gehabt, und mittlerweile war er verlobt gewesen mit der hübschen und klugen Tochter eines Dekans der Universität Leipzig.
Nur Frieda, ihre liebe, gute Freundin, hatte den wahren Grund für ihre Gereiztheit durchschaut. Und obwohl sie ihr ausdrücklich verboten hatte, sich einzumischen, verdankte sie es letztlich Friedas Gespräch mit Max am Tag des Kriegsbeginns, dass er seine Verlobung gelöst und tatsächlich ihr, Grete, seine Liebe erklärt hatte. Schlagartig hatte sie begriffen, dass sie ihn liebte wie noch nie einen Mann zuvor. Nur ihr anerzogener Hochmut hatte sie so lange blind und störrisch gemacht.
Verrückt, wie sich das Leben innerhalb kurzer Zeit gleich zweifach so radikal verändern konnte. Sie hatten Krieg, und sie war verheiratet! Beides wäre ihr noch vor Kurzem völlig absurd erschienen.
Sie dachte die meiste Zeit nicht daran, dass die Welt in Flammen stand. Sie fühlte nur, dass ihr Herz brannte. Vor Liebe und Sehnsucht. Wie dumm, wie dreimal dumm, dass sie ihre Hochzeitsnacht nicht einfach vorgezogen hatten! Max, ihr edler Ritter, hatte nicht gewollt, dass sie unter diesen Umständen schwanger würde, weil sie, im Falle, dass er fiele, schlechter dran sein würde. »Du wärest nicht frei, um arbeiten zu gehen, und du würdest mit einem Kind nicht so leicht einen neuen Mann finden«, hatte er gesagt. Letzten Sonntag war das gewesen. Und doch in einer anderen Zeit. Als er ihr seine Sichtweise erklärt hatte, war sie noch tief berührt gewesen von seiner Selbstbeherrschung und seinem Verantwortungsbewusstsein. Jetzt fand sie es unendlich bedauerlich. Wie gern hätte sie ihn mit allem, was ihr zur Verfügung stand, geliebt. Meine Güte, sie war schon vierundzwanzig und immer noch Jungfrau!
Eine Frau mittleren Alters ließ sich neben ihr auf die Bank plumpsen. Offenbar war sie fertig mit den Nerven. Sie atmete ruckweise ein. Mühsam beherrscht zückte sie ein Taschentuch und betupfte ihre Augen.
»Ham Se ’ne Fahrjelejenheit erjattert?«, fragte sie.
»Ja, hab ich, endlich.«
Verlegen griff Grete sich an den Kopf, um die Schwesternhaube zurechtzurücken. Doch ihre Finger berührten fein geflochtenes Stroh und ein Ripsband. Es war noch ungewohnt, dass sie seit Montag keine Schwesterntracht mehr trug, sondern ein ganz normales Sommerkleid und einen Hut.
»Se Jlückliche!« Mit unverhohlenem Neid sah die Frau sie an. »Ick muss nach Hause, nach Berlin! War hier Köchin im Europäischen Hof, mein Bruder hat sich im Sommer um unsere kranke Mutter jekümmert. Nu issa bei de Soldaten und … und unsere Mutter weeß sich alleene doch nich’ zu helfen …« Sie brach in Tränen aus.
Grete brauchte nicht zu überlegen. »Hier«, sie hielt der Frau ihre Fahrkarten hin, »nehmen Sie meine.«
»Aber … aber det kann ick doch nich’ annehm …«
»Doch! Bei mir kommt’s auf einen Tag mehr oder weniger nicht an. Dann stell ich mich eben morgen wieder an.«
Das war gelogen. In diesem Moment wurde ihr klar, dass sie auf Norderney bleiben wollte. Hier fühlte sie sich Max am nächsten, auch wenn er nicht körperlich anwesend war. Hier lebte ihre beste Freundin. Hier ging es ihrer Seele und ihrem Körper am besten. Es musste eine Möglichkeit geben. Bestimmt würde sich irgendeine bezahlte Tätigkeit für sie finden.
»Aber … dann will ick wenigstens dat Jeld dafür …«, sagte die Frau aufgeregt. Sie kramte in ihrem Portemonnaie und zählte ihr den Betrag passend ab. Mit blanken Augen stammelte sie: »Ick … ick bin Ihnen ja … so dankbar!«
Grete lächelte froh, dann stand sie auf. Die Frau brachte es sonst noch fertig und küsste ihr die Hände. »Gern geschehen.«
»Wissen Se eejentlich«, sagte die Frau bewundernd, »dat Se aussehn wie Schneewittchen?«
Das hörte Grete in der Tat nicht zum ersten Mal. Ihr schwarzes Haar und der helle Teint, vielleicht auch die ovale Gesichtsform hatten ihr schon häufiger ähnliche Komplimente beschert. Dabei war es gar nicht einfach, auf Norderney einen hellen Teint zu bewahren, zumal sie eine Neigung zu Sommersprossen hatte. Aber, ach, das gehörte inzwischen den Eitelkeiten einer vergangenen Ära an.
Sie nickte freundlich. »Ich wünsche Ihnen eine angenehme Heimreise.«
Mit dem Gefühl großer Erleichterung machte Grete sich auf den Weg zur Volksversammlung.
Obwohl sie eine halbe Stunde vor Beginn ankam, war der Saal des Gasthofs Frisia, in den wohl tausend Menschen passten, bereits brechend voll, und es strömten noch immer Besucher aus allen Himmelsrichtungen herbei. Grete schaute sich um. Nach einer Weile erblickte sie Frieda mit Rieka, Jakomina Fisser und deren Tochter Frauke. Die Frauen hatten Stehplätze hinten im Saal. Grete winkte ihnen zu, drängte sich in der schnatternden Menge durch Duftwolken, die mal an Blumen und Seeluft erinnerten, mal an Tabak, Räucherfisch, Bohnerwachs oder Schweiß, und stellte sich neben ihre Freundin.
»Meine Güte, was für’n Andrang«, sagte sie nach der Begrüßung erhitzt.
»Das hab ich auch noch nicht erlebt.« Jakomina Fisser schüttelte den Kopf. »Und ich leb schon seit zweiundfünfzig Jahren auf der Insel.«
»Der letzte Krieg ist dreiundvierzig Jahre her«, steuerte Frauke bei.
»Du, ich will sehen, dass ich bleiben kann«, vertraute Grete Frieda flüsternd ihren neuesten Beschluss an, und Frieda fiel ihr um den Hals vor Freude. »Ja! Du kannst bei uns wohnen, solange du willst.«
Die Veranstaltung begann damit, dass der aktuelle Kaiserliche Erlass an das Heer und die Marine verlesen wurde. »Unsere heiligsten Güter, das Vaterland und den eigenen Herd gilt es, gegen einen ruchlosen Überfall zu schützen. Feinde ringsum! Das ist das Kennzeichen der Lage. Ein schwerer Kampf und große Opfer stehen uns bevor.«
Beklommen wechselten Grete und Frieda einen Blick. Jemand stimmte »Ich hab mich ergeben mit Herz und mit Hand …« an. Alle sangen inbrünstig mit: »… dir, Land voll Lieb’ und Leben, mein deutsches Vaterland.« Als das Lied endete mit »Lass Kraft mich erwerben in Herz und in Hand, zu leben und zu sterben fürs heil’ge Vaterland!«, da gab es wohl keinen Menschen im Saal, der nicht feuchte Augen hatte.
Endlich ergriff Jann Berghaus, der Schulrektor, das Wort. Er erklärte zunächst, auch für einfache Gemüter nachvollziehbar, die Situation. »Mit einem Schlage ist alles, was unser Volk spaltete, hinweggefegt, es gibt keine religiösen, politischen, wirtschaftlichen Gegensätze mehr, es ist ein Volk, ein Vaterland, alle geschart um unseren geliebten Kaiser. Serbischer Mord, Russland als Schützer der Mordgesellen, welsche Tücke, Englands Kriegserklärung ohne Grund! Warum fallen sie alle über uns her?« Grete spürte, wie in ihrem Innern bei diesen Worten Empörung aufwallte. Ebenso gebannt wie die Menge im Saal folgte sie Berghaus’ Rede. »Der Neid und der Hass sind die niedrigen Motive. Lange schon stehen sie mit uns im Kampfe auf wirtschaftlichem, kulturellem und künstlerischem Gebiete und sind unterlegen, jetzt greifen sie zu roher Gewalt, doch wir hoffen auf Gott, dass ihnen auch dieser Versuch nimmer gelingen möge!« Die Zuhörer applaudierten, viele riefen Zustimmendes. »Was können wir nun hier noch tun, auf Norderney?«, fragte Berghaus. »Wir wollen unsere Hände und Herzen erheben, mitarbeiten, mitkämpfen, wollen traute Wacht halten am Meeresstrande, wollen einmütig geloben: Mit Gott für Kaiser und Reich! Unser geliebter Kaiser, er lebe hoch!«
Ein begeistert geschmettertes Kaiser-Hoch hallte durch den Saal. Sie sangen Deutschland, Deutschland über alles, und dann ging es an die ganz praktischen Dinge. Mehrere Redner unterbreiteten ihre Vorschläge. Alle dienstfreien Männer und Frauen wurden aufgefordert, auf dem ostfriesischen Festland bei der Ernte zu helfen. Eine Aufgabe, die Grete nicht sonderlich lockte.
»Ich mach mit!«, rief Rieka aber, die im Frühjahr mit der Schule fertig geworden war.
Der Bäckermeister und der Bürgermeister versicherten, Sorgen wegen der Brotpreise seien völlig überflüssig. Dann diskutierte man darüber, wie jenen armen Familien auf der Insel geholfen werden könnte, deren einziger Ernährer nun im Krieg war, die also aller Voraussicht nach zum Herbst und Winter hin in Not geraten würden. Man beschloss, ein Aktionskomitee zur Linderung der Armut zu gründen. Zwölf Männer wurden gewählt, die versprachen, eng mit dem Vaterländischen Frauenverein zusammenzuarbeiten.
Während Grete lauschte, dämmerte ihr mehr und mehr, wie schwierig es sein würde, jetzt noch einen bezahlten Arbeitsplatz zu finden. Aber als zwei ältere, auf der Insel praktizierende Ärzte begannen, ihre Überlegungen zu Norderney als Station für Verwundete darzulegen, war sie wie elektrisiert. Bestimmte Heime und Häuser hatten die Behörden bereits als Lazarettstationen in Aussicht genommen, und ein Lehrer forderte Kurse zur Ausbildung in der Krankenpflege. Das war genau ihr Metier, auf diesem Gebiet musste sich doch eine Tätigkeit für sie finden lassen! Aufgeregt stupste sie Frieda an, die ihr aufmunternd zublinzelte.
Es sollte im Frisia ein Büro eröffnet werden, in dem man fortan Geldspenden, Lebensmittel und Kleidung für Bedürftige abgeben konnte. Und Wäschestücke, welche die Frauen und Jungfrauen von Norderney in Heimarbeit oder zu bestimmten Stunden auf zwanzig eigens dafür zur Verfügung gestellten Nähmaschinen im evangelischen Gemeindehaus anzufertigen gebeten wurden. Außerdem würde viel Charpie, gezupfte Baumwolle, für die Versorgung von Wunden benötigt werden. Wer ein oder mehrere Zimmer für Soldaten, die sich auf dem Wege der Besserung befänden, frei hätte, sollte sie in dem Büro anmelden.
»Das machen wir!«, tat Jakomina laut vernehmlich kund. »Wir stellen Hilrichs Zimmer zur Verfügung. Das wird ganz in seinem Sinne sein. Grete reist ja ab.«
In Gretes Sinn war das allerdings weniger. Schon wieder wurde es kompliziert. Sie biss sich auf die Unterlippe, hörte weiter konzentriert zu. Nun ging es darum, dass man bei der Meldung angeben sollte, ob man das Zimmer mit oder ohne Pflege anbot. Erneut schöpfte sie Hoffnung.
Schnell kristallisierte sich heraus, dass dieses Angebot kostenlos oder lediglich für ein geringes Entgelt erwartet wurde. Erneut sank Gretes Mut. Wie sollte das gehen? Von nichts konnte sie nicht leben. Dann wiederum kam sie sich schrecklich egoistisch vor. Gern hätte sie in dieser »großen Zeit der Opferfreudigkeit«, die fortwährend beschworen wurde, mehr Freudigkeit empfunden.
Als dann zum Schluss alle das Lied Fest steht und treu die Wacht am Rhein sangen, da riss die Stimmung auch sie mit. Schließlich riskierte der Mann, den sie liebte, sein Leben für das Vaterland. Mit tiefem Ernst gelobte sie, treu und fest am Nordseestrand zu stehen, um ihren Beitrag zum Wohle Deutschlands zu leisten.
Wieder einmal war es Frieda, die ihrem Leben eine entscheidende Wendung gab. Schon in der Teepause des folgenden Vormittags kam sie nach oben und klopfte an ihre Zimmertür. Grete saß an einem Tischchen unter der Dachschräge und schrieb ein paar Zeilen über die Volksversammlung an Max. Sie teilte ihm morgens und abends schriftlich alles mit, was sie erlebte, dachte und fühlte. Durch die Briefe war ihr ein wenig so, als könnte sie sich mit ihm unterhalten.
Regentropfen prasselten gegen das Fenster. Lissy, die wegen des schlechten Wetters nicht draußen spielte, leistete ihr Gesellschaft. Sie lag bäuchlings auf dem Teppich und verschönte mit Buntstiften in einem Malbuch die Soldaten des Alten Fritz.
»Ist ja gemütlich bei euch beiden«, sagte Frieda, die eine Tasse Tee mitgebracht hatte. »Du, Grete, Dr. Seut ist doch Stammkunde bei uns. Solange ich mich erinnern kann, lässt er sich jeden Morgen im Salon rasieren.«
Grete wusste, dass der Inselarzt Dr. Hermann Seut neben dem alten Tabakhändler Jan Gerdes, dem Hotelbesitzer Onno Remmers und dem Redakteur der Inselzeitung Theo Weerts zum legendären politischen Quartett gehörte, das seit Jahren allmorgendlich beim Barbieren mit Fritz Fisser die Ereignisse auf Norderney und in der Welt kommentierte.
»Ja?« Dankbar nahm sie den Tee entgegen.
Frieda setzte sich auf die schön bestickte dunkelgrüne Seidenüberdecke, die auf dem Bett lag. »Er ist doch in das Aktionskomitee gewählt worden, und er gibt die Pflegekurse für Freiwillige. Sie haben schon achtzig Anmeldungen. Ist das nicht unglaublich?«
»Wie will er das denn alles schaffen?«
Grete fragte sich, ob der Arzt vielleicht Unterstützung benötigte. Friedas Blick verriet ihr, dass sie schon die gleiche Überlegung angestellt hatte. Ihre Freundin lüpfte eine Braue.
»Er weiß Bescheid über alles, was mit Medizin auf der Insel zu tun hat. Und heut Morgen hab ich ihm von dir erzählt. Er sagte, die evangelische Kirchengemeinde würde eine fest angestellte Krankenschwester suchen.«
»Nein!« Gretes dunkle Augen weiteten sich.
»Doch! Du sollst ihn morgen eine halbe Stunde vor seiner Nachmittagssprechstunde besuchen. Ich wette, wenn er einen guten Eindruck von dir hat, und daran besteht ja wohl kein Zweifel, dann legt er beim Pastor und dem Kirchenrat ein Wort für dich ein.«
»Oh, Frieda, du bist so ein Schatz! Das wäre die Lösung!«
Lissy, angesteckt von der Aufregung der Frauen, sprang hoch. Grete hob sie aufs Bett, weil sie wusste, dass das Kind zu gern darauf herumhopste.
»He! Nicht so wild!«, protestierte Frieda. Doch Grete zog rasch ihre Schuhe aus und stieg ebenfalls aufs Bett, um mitzuhüpfen. »Untersteh dich, Frau Dr. Lubinus!« Frieda drohte ihr lachend. »Hat man dich dafür auf ein Schweizer Internat geschickt?«
Grete schnappte sich eine Schlummerrolle. »Klar, wir haben jeden Abend eine Kissenschlacht gemacht. In dieser Disziplin bin ich Schweizer Meisterin!«
Frieda zog sie am Rock zu sich runter, um ihr die Rolle zu entreißen, Lissy warf kichernd das Paradekissen zwischen sie. Abwechselnd schlugen sie sich damit, jagten sich Kissen ab, balgten und kitzelten sich gegenseitig durch.
»Dass du so albern sein kannst!«, rief Frieda japsend.
»Selber albern!«
Nach all den Aufregungen und Sorgen, dem Todernst und Pathos der vergangenen Tage bot die Toberei ein befreiendes Ventil. Schließlich lagen alle drei lachend und keuchend ineinander verschlungen auf dem Bett.
»Nicht Oma verraten, ja?«, flüsterte Frieda, als sie sich und Lissy wieder salonfähig machte.
»Nein!« Ihre Tochter umarmte sie stürmisch. »Das ist unser Geheimnis, Mama.« Ihre Augen, die ein dunkleres Blau hatten als Friedas, strahlten glücklich.
Ich möchte auch Kinder, dachte Grete. Sie hatte diesen Wunsch bereits abgeschrieben gehabt, denn sie hatte sich ja um die Kleinen im Seehospiz kümmern können. Überhaupt war der Wunsch nie sehr intensiv gewesen – aber jetzt fühlte sie ihn wie eine Pfeilspitze im Herzen, schmerzhaft und süß zugleich. Ach, wenn Max doch endlich wiederkäme und sie sich endlich richtig lieben könnten! Sie hatten schon so viel Zeit vergeudet.
Frieda hatte wenigstens Lissy. Und Hilrich hatte seiner Familie schon eine Nachricht geschickt, während sie noch immer ohne Botschaft von Max war.
Frieda schien ihre Gedanken zu lesen. »Er ist noch nicht mal eine Woche weg«, sagte sie.
Grete seufzte, dann lächelte sie tapfer. »Du hast ja recht. Ich brauche unbedingt was zu tun, damit ich auf andere Gedanken komme.«
Klug und weitblickend helfen, lindern, sorgen – das war nun die Aufgabe der Frauen. So hörte man es überall, so stand es in den Aufrufen in der Zeitung. Und genau das wollte Grete tun. Deshalb war sie glücklich, als sie die Stelle als Gemeindeschwester bekam und sofort anfangen durfte. Die Bezahlung reichte für eine möblierte Balkonwohnung in einem Logierhaus am Damenpfad. Der Neuzeit entsprechend eingerichtete hohe, luftige Zimmer mit Zentralheizung, vollständig eingerichtete Küche und vorzügliche Betten nur mit Rosshaarmatratzen hieß es im Hausprospekt. Besonders gefiel ihr ein gemütlicher Sessel, von dem aus sie durch hohe Fenster zu beiden Seiten der zweiflügeligen Balkontür aufs Meer hinausschauen konnte. Der Balkon war seitlich verglast und schützte damit vorm Seewind.
Gretes neue Aufgaben waren vielfältig. Der Pastor schickte sie in die Häuser von Gemeindemitgliedern, in deren Familie Pflege benötigt wurde. Sie sollte und musste sich aber auch flexibel auf die Bedürfnisse der Zeit einstellen. Das bedeutete unter anderem, dass sie einmal in der Woche einen Charpie-Abend zu organisieren hatte.
Diese Abende fanden im Gemeindehaus statt, einem modernen vierstöckigen Backsteinbau, und waren auf Anhieb sehr gut besucht. Frieda kam auch. Die Frauen und jungen Mädchen brachten alte Leinwand- und Baumwollstoffe mit, die sie zuvor gründlich ausgekocht hatten. Diese Stoffe wurden in acht bis zehn Zentimeter breite Streifen geschnitten oder gerissen und dann gezupft.
Dabei herrschte eine gute Stimmung. Alle fühlten sich getragen davon, einer großen gemeinschaftlichen Aufgabe zu dienen. Sie tauschten Neuigkeiten aus, und obwohl ihnen der Ernst der Lage bewusst war, lachten sie doch viel. So saßen sie da, redeten und zupften. Manchmal sangen sie auch und zupften. Das Ergebnis war ein hervorragendes, watteähnliches Material für die Wundpflege. Grete empfand Stolz, als sie das erste Paket mit Charpie ans Lazarett nach Aurich aufgeben konnte.
Endlich überwand sie sich und schrieb ihren Eltern. Sie teilte ihnen mit, dass sie Dr. Max Lubinus geheiratet hatte, obwohl sie insgeheim befürchtete, dass ihre Familie sie verstoßen würde. Das wäre durchaus keine unangemessene Reaktion auf ihr Verhalten. Sie wusste von mindestens zwei Fällen sicher und hatte von wesentlich mehr gehört. Töchter aus besseren Kreisen, die es gewagt hatten, mit einem nicht standesgemäßen Mann durchzubrennen, um zu heiraten oder, noch schlimmer, nicht zu heiraten, waren für ihre Eltern gestorben. Ihr Name durfte in Gegenwart von Angehörigen nicht mehr erwähnt werden. Es hieß, diese Strafe müsste sein, um den guten Ruf der Familie zu wahren.
Besorgt wartete Grete nun also auf einen Brief aus Berlin.
Ihre neue Arbeit war ungewohnt. Manche Insulaner murrten, weil der Pastor ihnen eine Auswärtige schickte, mit der sie sich nicht auf Plattdeutsch unterhalten konnten. Grete behandelte solche Nörgler, wie sie im Seehospiz bockige Kinder behandelt hatte. »Gar nicht drum kümmern und klare Anweisungen geben«, wie sie Frieda verriet.
Doch meist lief es gut. Sie vermochte ja tatsächlich zu helfen und zu lindern. Außerdem herrschte in diesem August eine besondere Atmosphäre, im Reich wie auf der Insel. Die Erfolgsmeldungen von der Front beflügelten die Norderneyer. Was an Spenden zusammenkam, verblüffte sogar das Aktionskomitee.
Nur die Abende und Nächte waren schwer, weil sie dann Zeit hatte, an Max zu denken, sich Sorgen um ihn zu machen, vor Sehnsucht fast zu sterben und sich dann auch noch auszumalen, wie ihre Familie sie ächten würde.
Endlich fand Grete einen an sie gerichteten Briefumschlag auf dem Tischchen im Flur des Logierhauses, wo der Postbote immer alle Post ablegte. Schnell ging sie in ihre Wohnung, öffnete die Balkontür, setzte sich noch mit Hut in den Sessel. Sie atmete einmal tief durch, bevor sie den Brief öffnete.
Die Antwort fiel weniger harsch aus als befürchtet. Natürlich hörte sie beim Lesen den beleidigten Unterton in der Stimme ihrer Mutter, die einen anderen Schwiegersohn vorgezogen und liebend gern die Hochzeit ihrer einzigen Tochter ausgerichtet hätte. Aber angesichts der besonderen Umstände und der Tatsache, dass Max nun immerhin Stabsarzt war, schien sie bereit zu sein, den harten Brocken zu schlucken. Vielleicht hatte sie auch schon vor einiger Zeit die Hoffnung, Grete zu verheiraten, ganz aufgegeben gehabt und war deshalb erleichtert, was sie selbstverständlich nie zugeben würde.
Warum musstet Ihr ausgerechnet am Tag der Mobilmachung heiraten?, schrieb ihre Mutter. Das trägt den Beigeschmack einer unüberlegten Handlung. In den Stand der heiligen Ehe sollte man zu jeder Zeit nur mit Bedacht treten.
Sie könne nur hoffen, dass ihr Mann gut für sie sorgen werde. Und dass sie ihren Schritt niemals bereuen müsse.
Dein Vater lässt ausrichten, da Ihr es nicht für nötig befunden habt, der altmodischen Sitte zu folgen und ihn vorher um seine Zustimmung zu bitten, geht er davon aus, dass Ihr auch auf so altmodischen Firlefanz wie eine Mitgift verzichten möchtet.
Ach, dachte Grete halb beschämt und halb aufgebracht, ihr habt noch immer nicht verstanden, was mir wirklich wichtig ist. Gleich darauf fragte sie sich, ob sie damit eigentlich auch enterbt war. Und sie musste etwas weinen. Vor allem, weil sie ihre Eltern enttäuscht hatte.
Der Brief ging auf der Rückseite weiter. Was Deine Brüder in Deutsch-Südwest angeht, teilte die Mutter weiter in ihrer eleganten gleichmäßigen Schrift mit, so müssen wir uns um sie gottlob keine allzu großen Sorgen machen. Dein Vater verfügt über beste Kontakte in die Region, er hat entsprechende Erkundigungen eingezogen. Auch Eduard, der noch nicht im Felde ist, weil man seine Dienste im Auswärtigen Amt mehr benötigt, hat uns diesbezüglich beruhigt. Ludwig und Hans-Heinrich wird der Krieg dort unten wohl nicht gefährlich werden.
Pass gut auf Dich auf.
Deine Mutter
Na, immerhin. Klang das nicht ein bisschen nach einem Waffenstillstand? »Pass gut auf dich auf« – das bedeutete doch wohl, dass sie nicht gestorben war für ihre Eltern und sie sich trotz allem weiter um sie sorgten. Grete putzte sich die Nase.
Jetzt war erst mal Krieg. Ihn zu überstehen, darauf mussten sie ihre ganze Kraft richten. Alles andere würde sich später klären.
Es klopfte an der Tür. Eine Dame aus dem Vorstand des Vaterländischen Frauenvereins trat ein. Grete bot ihr einen Platz und Tee an.
Es hatte sich herumgesprochen, dass sie Dr. Seut bei seinen Pflegerinnenkursen zur Hand ging. Er unterrichtete immer nur zwanzig Teilnehmerinnen gleichzeitig. »Wäre es Ihnen wohl möglich, auch uns behilflich zu sein? In Zusammenarbeit mit Dr. Seut und dem Roten Kreuz möchten wir Freiwillige zu Hilfsschwestern und Helferinnen ausbilden.«
»Selbstverständlich, sehr gern!«, antwortete Grete.
Je mehr sie zu tun und je weniger Zeit sie zum Nachdenken hatte, desto besser.
Und so arbeitete sie rund um die Uhr. Weil vieles neu war, hatte sie ein anderes Zeitgefühl. Als vier Wochen seit Kriegsbeginn vergangen waren, schienen es in ihrer Wahrnehmung schon Monate zu sein.
Wenn sie noch genügend Energie aufbringen konnte, erinnerte sie sich abends im Bett an die einzige Nacht, die sie mit Max verbracht hatte. Angekleidet, aber Arm in Arm, Körper an Körper. Sie rief sich jede Kleinigkeit ins Gedächtnis zurück, ging dafür jeden Sinn einzeln durch. Und dann vergoss sie vor Sehnsucht ein paar Tränen. Er hatte ihr noch immer nicht geschrieben, und sie wusste nicht, wo er sich derzeit mit seinem Lazarett befand.
Im Inselsalon
Jakomina fand die Situation äußerst unangenehm. Die vier Stammkunden, die es gewohnt waren, gleichzeitig barbiert zu werden und sich dabei gegenseitig die Welt zu erklären, konnten nur nacheinander bedient werden. Es ging nicht anders, weil ihr Mann, der Meister Fritz Fisser, am Strand für die Inselwache Patrouille lief. Und alle ihre Gesellen und Gehilfen waren zu den Waffen geeilt. Nur noch Emil, der erst seit Ostern eine Lehre machte, konnte rasieren. Jakomina wäre technisch-handwerklich zwar durchaus in der Lage gewesen, die Herren von ihren Stoppeln zu befreien – schließlich hatte sie zigtausendmal zugeschaut. Ebenso wäre es Frieda möglich gewesen, die Männer zu rasieren. Doch der Anstand verbot es. Sie waren ja keine billigen Barbiermädchen. In der Stadt, so hörte man, gaben sich junge Frauen dafür her, und wohl auch für manches andere. Aber solche Sitten passten nicht in einen angesehenen Inselsalon.
Deshalb saßen nun also Jan, Onno und Hermann in der Warteecke, sahen zu, wie Emil Theo um den Spitzbart herumschabte, und kommentierten von dort aus die ungewöhnlichen Zeiten. Jeder Vormarsch der Deutschen wurde bejubelt, selbstverständlich gab es keinen Zweifel an ihrem Sieg. Und niemand glaubte ernsthaft, dass der Krieg jemals Norderney erreichen könnte. Wer fertig rasiert war, setzte sich, sofern er es sich zeitlich erlauben konnte, zurück in die Warteecke, bis alle Wangen glatt, alle Schnurrbärte gekämmt, das Haar pomadisiert und vor allem die Themen des Tages ausreichend durchgehechelt waren. Dadurch verlängerte sich natürlich das Ritual, und andere Kunden mussten ebenfalls länger als üblich warten.
Jakomina nahm sich vor, mit Fritz zu sprechen, wenn er das nächste Mal einen Tag oder ein paar Stunden Freigang hatte. Vielleicht konnten sie über die Handwerkskammer in Aurich aus kriegsbedingt komplett geschlossenen Betrieben schon ältere Gesellen oder auch Friseurgehilfen übernehmen. Einfach ordentliche Handwerker, Künstler brauchten sie nicht. Die Militärhaarschnitte waren zwei Zentimeter kurz – wie sollte man da noch kreativ werden?
Jakomina sah sich im Frisierspiegel und richtete das goldblond gefärbte Haar, das sie wie immer rundum eingerollt und hochgesteckt trug. Sie strich über ihren weißen Friseurkittel, der ein wenig spannte, weil sie in letzter Zeit abends zum Trost mehr naschte als sonst. Aber Fritz mochte es ja, wenn was dran war an einer Frau.
Verrückt – ihr Mann führte noch nicht einmal zwei Kilometer von ihr entfernt, freiwillig kaserniert, ein komplett anderes Leben. Er und auch ihr Sohn Hilrich fehlten ihr. Plötzlich musste sie die Abrechnungen machen und mit Dingen fertigwerden, auf die sie nicht vorbereitet war. Am meisten vermisste sie es, Fritz, den sie in zärtlichen Stunden seiner markanten Schneidezähne wegen Mucki nannte, morgens den Tee ans Bett zu bringen. Und am zweitmeisten fehlte ihr die Atmosphäre des gemütlichen Disputierclubs, die sich sonst immer um ihn herum morgens im Salon entfaltet hatte.
Damit wenigstens ein wenig von der gewohnten Stimmung aufkam, überließ Frieda die Honoratioren nicht völlig Emil, dem Anfänger, sondern stellte sich in die Nähe und redete ein wenig mit.
»Autsch!« Theo griff nach seiner Wange, entdeckte Blut an den Fingern.
»Wir müssen alle Opfer bringen«, blödelte Onno aus seiner Ecke.
Jakomina verpasste dem Lehrling eine Backpfeife. »Pass doch auf!«
»Sei nicht so s-treng mit deinem S-tift, Jakomina«, brummelte Jan, der immer besonders schön über den s-pitzen S-tein s-tolperte, mit unbewegter Miene. Nur das Glitzern in seinen Augen verriet, wie unterhaltsam er den Zwischenfall fand. »Sonst meldet sich der Junge noch freiwillig.« Emil grinste.
»Oder ich probier den Sicherheitsrasierer aus Amerika, den Hobel von diesem Mr. Gilette«, drohte Theo im Scherz. »Dann spar ich mein Barbierabonnement. Wir müssen alle unser Geld zusammenhalten. Die Preise explodieren.«
»Stimmt es, dass der Inselbote nicht mehr jeden Tag erscheint?«, lenkte Jakomina ab.
»Ja«, antwortete Theo, »nur noch bei Bedarf. Wir haben in den ersten vier Kriegswochen schon so viele Extrablätter wie noch nie herausgebracht. Das geht richtig ins Geld.«
»Viele Leute glauben tatsächlich, dass sie ihre Schulden nicht mehr bezahlen müssen, weil wir Krieg haben«, steuerte Jan bei. »Oft gerade solche, die genug besitzen.«
Über die schlagartig abgestürzte Zahlungsmoral klagten alle Geschäftsleute. Zudem beunruhigten wilde Gerüchte die Bevölkerung.
»Wir können auch nicht mehr jedes Extrablatt an sämtliche Abonnenten austragen lassen. Das wird zu aufwändig. Aber es gibt jetzt über zwanzig Anschlagtafeln auf der Insel, da könnt ihr alle Neuigkeiten sofort lesen.«
»Unsinn. Man erfährt nix«, beschwerte sich Onno. »Ihr veröffentlicht doch nur offizielle Kriegspropaganda. Das ist Zensur.«
»Wir dürfen zum Kriegsverlauf nur Meldungen drucken, die vom Wolff’schen Telegrafenbüro stammen.«
Diese Nachrichtenagentur wurde von staatlichen Stellen kontrolliert. Theo war im Grunde seines Herzens Sozialdemokrat. Das wusste Jakomina, auch wenn er dem Kaiser begeistert zugestimmt hatte, als jener in seiner Rede am Tag des Kriegsbeginns gesagt hatte: »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche.«
Unangenehm berührt wand sich der Zeitungsmann auf seinem Stuhl. »Mir stinkt das am allermeisten, das kannst du mir glauben.«
»Find ich völlig in Ordnung«, meinte Jan, der als Veteran des Krieges von 1870/71 Ehrenmitglied im Kriegerverein war. Er streckte sein steifes Bein vor. »Der Feind darf nicht wissen, wo unsere Truppen s-tehen oder hinwollen. Überall sind jetzt ausländische S-pione unterwegs.« Vorsichtig sah er sich um. »Man sollte sich auch in der Öffentlichkeit hüten auszuplaudern, was man zum Beis-piel aus der Feldpost von Verwandten über die Truppenbewegungen erfahren hat.«
Jakomina musste daran denken, dass Fritz bereits vor englischen Spionen an der ostfriesischen Küste gewarnt hatte, als andere seine Befürchtungen noch als Hirngespinste abgetan hatten. Jetzt mahnten Plakate: DEUTSCHE MÄNNER UND FRAUEN, HÜTET EURE ZUNGEN! Einmal vor Jahren, das war das größte Abenteuer ihres Lebens gewesen, da hatten sie und ihr Mann gemeinsam nach einer Verfolgungsjagd per Segelboot geholfen, dass auf der Insel Borkum zwei englische Offiziere verhaftet werden konnten, die dort in den Befestigungsanlagen herumschnüffeln wollten. Jakomina seufzte. Wenn sie doch damals schon gewusst hätte, dass es ihre glücklichste Zeit war! Aber seine besten Jahre lebte der Mensch wohl aus dem Vollen, ohne darüber nachzudenken. Und gerade deshalb waren sie so intensiv.
Onno brüstete sich damit, dass er die Eierproduktion seiner siebzig Hühner, die normalerweise fürs Frühstück seiner Hotelgäste bestimmt war, dem Aktionskomitee gespendet hatte. Hermann beklagte, dass die Zahnarztpraxis bis auf Weiteres geschlossen blieb, und Jan, dass der Milchwagen nicht mehr fuhr.
»Kann eigentlich einer von euch imkern?«, fragte Jakomina unvermittelt. Alle schüttelten den Kopf. »Zu dumm. Fritz hat nicht die Zeit, sich um seine Bienenvölker zu kümmern. Und ich glaube, die Körbe müssten jetzt bald mal aus den Dünen geholt und der Honig müsste geschleudert werden. Der Strandflieder hat dieses Jahr gut geblüht, das wird wohl ’ne ordentliche Tracht ergeben.«
»Ich könnte mal meinen Schwiegersohn fragen«, bot Onno an, »der imkert auch.«
Die Tür des Damensalons, der eine Stufe höher gelegen vom Verkaufsraum abging, öffnete sich, und Frieda begleitete eine Kundin zum Tresen. »Doch, das kriegen Sie allein hin, bestimmt!«, beteuerte sie, während sie ihr an der Kasse den Preis für ein Haarteil aus deutschem Echthaar berechnete. Wie Jakomina registrierte, nur den Preis dafür. Ganz umsonst hatte ihre Schwiegertochter der Kundin gezeigt, wie sie das Haarteil zu Hause selbst, ohne professionelle Hilfe, einarbeiten konnte. Das war nicht einfach, normalerweise hatte eine Dame dafür ihre Zofe, oder man ging in einen Salon. Und natürlich kostete es etwas. Viele Stammkundinnen kamen in erster Linie, um sich frisieren zu lassen. Gut, es brachte nicht viel, aber Kleinvieh machte auch Mist. Doch Frieda hatte Anzeigen geschaltet, in denen sie beim Kauf eines Haarteils die kostenlose Anleitung zum Selbstfrisieren versprach.
Jakomina fand dieses neue Angebot unsäglich. Erziehung der Kundschaft zur Selbstständigkeit! Sie schüttelte den Kopf. Wo kämen sie denn hin, wenn sich vornehme Damen in Zukunft allein frisierten?
Womit sollten sie in Zukunft ihr Geld verdienen? Nur vom Shampoonieren, Haareschneiden und Ondulieren würden sie wohl kaum existieren können. Doch auch sie lächelte freundlich, als die Kundin den Salon verließ.
Die Fensterscheiben erzitterten. Zuerst glaubte Jakomina, es läge daran, dass die Kundin die Tür ein wenig zu heftig zugeschlagen hatte. Das ferne Donnergrollen von der See her kündigt wohl ein Sommergewitter an, dachte sie. Nur – zum einen war das Wetter nicht danach, und zum anderen wiederholte sich das Fensterzittern, begleitet von einem feinen Klirren der Haarwasserfläschchen auf der Etagere neben dem Waschbecken. Und wieder grollte es. Im Inselsalon wurde es ganz still. Die Männer sahen einander bedeutungsvoll an, Jakomina atmete flacher.
»Das klingt nach ’nem Seegefecht.« Der alte Jan sprach als Erster. Er zwirbelte beunruhigt eine Spitze seines grauen Kaiser-Wilhelm-Barts. Erneut grummelte es seltsam, wohl von ziemlich weit her. »Schätze, in der Deutschen Bucht werden gerade Schiffe versenkt.«