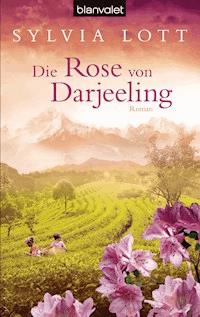9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Norderney-Reihe
- Sprache: Deutsch
Norderney in den Goldenen 20ern: Aus Lissy ist eine junge hübsche Frau geworden. Noch arbeitet sie im Friseursalon, doch eigentlich träumt sie von der weiten Welt …
Die hübsche, sensible Lissy macht in den Goldenen Zwanzigern auf Norderney eine Lehre im familieneigenen Friseursalon. Schon immer fühlt sie eine unbestimmte Sehnsucht, ihr fehlt etwas, das sie nicht benennen kann. Glamour und Elend liegen in diesen Jahren im Seebad nah beieinander. Lissys Mutter Frieda spezialisiert sich auf Bubiköpfe, ihre Freundin Grete hilft bedürftigen Kindern. Lissy aber wird das Inselleben zu eng. Nach ihrer Lehre darf sie in einem führenden Salon Berlins arbeiten, um sich den Feinschliff zu holen. Dort genießt sie ein ausgelassenes freies Leben und begegnet dem charismatischen Ivo Sartorius …
Die Norderney-Saga von Sylvia Lott:
Die Frauen vom Inselsalon
Sturm über dem Inselsalon
Goldene Jahre im Inselsalon
Neue Träume im Inselsalon: in Vorbereitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Friedas Tochter Lissy wächst zu einer hübschen jungen Frau heran. In den Goldenen Zwanzigern lernt sie auf Norderney im familieneigenen Friseursalon. Glamour und Elend liegen zu dieser Zeit im Seebad so nah beieinander wie sonst kaum irgendwo. Frieda spezialisiert sich auf Bubiköpfe, ihre Freundin Grete hilft bedürftigen Kindern. Lissy aber wird das Inselleben zu eng. Nach ihrer Lehre besteht sie darauf, dass sie in einem führenden Salon Berlins arbeiten darf, um sich den Feinschliff zu holen. Dort genießt sie ein ausgelassenes freies Leben, die Begegnung mit dem reichen Ivo Sartorius verändert ihr Leben …
Autorin
Die freie Journalistin und Autorin Sylvia Lott ist gebürtige Ostfriesin und lebt in Hamburg. Viele Jahre schrieb sie für verschiedene Frauen-, Lifestyle- und Reisemagazine, inzwischen konzentriert sie sich ganz auf ihre Romane, die regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste zu finden sind. Bei der Recherche zu einem ihrer Romane faszinierte sie die glanzvolle und wechselhafte Geschichte Norderneys, und die Idee entstand, eine mehrbändige Saga zu schreiben. »Die Frauen vom Inselsalon« und »Sturm über dem Inselsalon« sind die ersten beiden Teile einer vierbändigen Reihe um einen Friseursalon auf Norderney in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
SYLVIA LOTT
Goldene Zeiten im Inselsalon
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Verlag dankt dem Stadtarchiv Norderney und besonders Matthias Christian Pausch für die Bereitstellung der historischen Fotos.
Dieser Roman wurde mit einem Stipendium der VG WORT gefördert.
Copyright © 2023 der Originalausgabe by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Margit von Cossart
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: George Marks/Retrofile RF/Getty Images; www.buerosued.de
LH · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-25797-2V002
www.blanvalet.de
Die Hauptpersonen rund um den Inselsalon
Frieda Merkur, geb. Dirks, verwitwete Fisser
Die flachsblonde Fischertochter mit den blauen Augen führt voller Leidenschaft den Inselsalon Fisser, in den sie vor dem Krieg eingeheiratet hat. Ihr Mann Hilrich ist gefallen, und da sie den Betrieb nur mit einem Meister weiterführen darf, aber kein Geld hat, einen einzustellen, heiratet sie kurzerhand den gleichaltrigen, dreißigjährigen Friseurmeister Paul Merkur. Von ihm weiß sie kaum mehr, als dass er aus Lüneburg stammt und kein Geld hat. Dennoch, und trotz der Sorgen um ihre Tochter Lissy, die ihren ganz eigenen Kopf hat, bleibt Frieda zuversichtlich.
Grete Lubinus, geb. Lehmann
Grete, Tochter eines Berliner Fabrikanten, hat Norderney, wo sie früher Urlaube mit der Familie verbrachte, zu ihrer Heimat gemacht. Die Seeluft tut ihr gut, von den Ekzemen und ihrem quälenden Asthma ist fast nichts mehr zu spüren. Sie hat im Seehospiz eine Schwesternausbildung absolviert und den Arzt Dr. Max Lubinus geheiratet, der allerdings erst mehr als ein Jahr nach Kriegsende aus der Gefangenschaft zurückkehrt. Endlich ist sie glücklich. Grete wird schwanger, doch Max findet auf Norderney keine Arbeit, und sie möchte nicht aufs Festland ziehen …
Jakomina Fisser
Die Matriarchin der Friseurfamilie spricht abends auf dem Sofa mit dem Foto ihres verstorbenen Mannes Fritz »Mucki« Fisser. Auch der Tod ihres Sohnes Hilrich macht ihr noch immer das Herz schwer. Im Salon muss sie weniger aushelfen, dafür hat sie mehr Zeit, sich um die Verpflegung von Familie und Belegschaft zu kümmern. Die Entwicklung von Gerichten aus ungewöhnlichen Zutaten wird deshalb mehr und mehr zu Jakominas Passion. Ihre größte Freude sind die Enkelkinder, denen sie gern Sagen von Rittern und Burgfräulein vorliest, und die Brieffreundschaft mit dem früheren Altgesellen Rudolf.
Lissy Fisser
Friedas Tochter Lissy wächst zu einer hübschen jungen Frau heran. Sie lernt das Friseurhandwerk im Inselsalon, doch eigentlich träumt sie von einem aufregenden Leben in Berlin und einem modernen kultivierten Mann von Welt. Einem, der so ganz anders ist als ihr ungeliebter Stiefvater Paul. Seit ihrer Kindheit schon sehnt Lissy sich nach etwas, das sie nicht näher benennen kann. Ist es nur Fernweh? Nach ihrer Lehre setzt sie durch, in einem Salon in Berlin arbeiten zu dürfen. Dort hofft sie, das zu finden, was sie vermisst …
Dr. Max Lubinus
Nach der spontanen, überraschenden Hochzeit mit Grete – natürlich war es Frieda, die das ungleiche Paar zusammenbrachte – und nach langen Jahren als Stabsarzt im Krieg und in französischer Gefangenschaft, kehrt der Mediziner endlich auf die Insel zurück. Der charmante Ostfriese ist Pazifist geworden und immer noch Anhänger der Reformbewegung, für die er auch seine Frau begeistert. Als er erfährt, dass er Vater wird, beschließt er, eine Arbeitsstelle auf dem Festland anzunehmen, um die kleine Familie ernähren zu können.
Paul Merkur
Der gepflegte, sympathisch wirkende Friseurmeister hat den Krieg an der Front unversehrt überstanden, doch als er in seine Heimatstadt Lüneburg zurückkehrt, ist der Salon seiner Eltern pleite und seine Verlobte Rosemarie schwanger von einem anderen Mann. Paul lernt über eine Anzeige die ersehnte »Dame mit eigenem Friseursalon zwecks baldiger Heirat« kennen. Die junge Witwe Frieda Fisser verlangt allerdings, dass er sich in ihrer Ehe an ein paar unkonventionelle Regeln hält und lässt ihn einen Vertrag unterschreiben.
Erwin Eils
Der Altgeselle Erwin war überzeugt, dass Frieda nach dem Tod ihres Mannes ihn heiraten würde. Als sie dann einen anderen Kandidaten präsentiert, schwört er sich, es ihr heimzuzahlen. Er beginnt an der empfindlichsten Stelle der Friseurfamilie, bei Lissy, der er etwas über ihren Vater verrät.
Jantje, das Wickwief
Die Witwe lebt allein in einem Häuschen in den Dünen. Sie gilt als Wahrsagerin, liest aus Teeblättern die Zukunft und hat manchmal Visionen. Weil ihre Zauber, Heilkräuter und Rituale schon vielen Insulanern geholfen haben, genießt sie allgemein Respekt. Die abergläubische Jakomina ist eine treue Kundin. Zu Frieda hat das Wickwief eine ganz besondere Beziehung, nicht nur, weil sie ihr immer das Haar umsonst zuhause onduliert – sie weiß, dass Frieda unter einer Glückshaube geboren wurde, und das gilt als ein gutes Omen.
… wie du einen Menschen liebst, das ist schon weitgehend festgeschrieben, bevor du ihm begegnest. Ob’s dir passt oder nicht – in deine Art zu lieben spielt immer mit hinein, wie deine Eltern und deine Großeltern geliebt haben oder andere Menschen, die dir in jungen Jahren nahestanden.
Jantje, Wickwief
Frieda
Norderney, Februar 1920
Als Frieda am Morgen nach ihrer Hochzeitsnacht erwachte, glaubte sie einen Moment lang, sie befände sich auf dem Fischerboot ihres Vaters. Doch der vermeintliche Wellenschlag gegen schwankende Planken war in Wirklichkeit das Pulsieren ihres Blutes. In ihrem Schädel pochte es, sie hatte einen Riesenkater. Vorsichtig öffnete sie die Augen und blinzelte auf die andere Seite. Gott sei Dank – sie lag allein im Bett. Ihr frisch angetrauter Ehemann Paul hatte sich wie vereinbart, ohne sie zu bedrängen, für den Rest der durchfeierten Nacht in sein Zimmer zurückgezogen.
Sie setzte sich mit dem Rücken gegen das Betthaupt und stöhnte auf, weil nun wahre Wellenbrecher durch ihren Kopf krachten. Auf dem Nachttisch stand ein Glas Wasser, das sie gierig austrank. Allmählich beruhigten sich die schmerzenden Wogen. Frieda schloss erneut die Augen, dachte an die Ereignisse des Vortags und musste lächeln.
Geschafft! Sie durfte zufrieden sein. Der Inselsalon Fisser war gerettet. Sie brauchte keine Angst mehr zu haben, dass sie, ihre zehnjährige Tochter Lissy und ihre Schwiegermutter Jakomina demnächst auf der Straße stehen würden.
Ohne einen Friseurmeister hätten sie den Betrieb schon im kommenden Monat schließen müssen. Da sie es sich aber finanziell nicht leisten konnten, eine teure Fachkraft einzustellen, war es ihr wie ein Wink des Schicksals erschienen, als sie vier Monate zuvor in der Friseurzeitung eine ungewöhnliche Anzeige entdeckt hatte: Friseurmeister wünscht die Bekanntschaft einer Dame mit eigenem Friseursalon zwecks baldiger Heirat.
Rasch hatte sie geantwortet und bald darauf einige Auskünfte über den Kandidaten, einen Mann namens Paul Merkur, eingeholt. Er kam aus Lüneburg, war wie sie selbst dreißig Jahre alt und unversehrt, obwohl er vier Jahre als Soldat an der Westfront gedient hatte. Der elterliche Friseurbetrieb in Lüneburg hatte im letzten Kriegsjahr Insolvenz anmelden müssen, und seine Verlobte Rosemarie war schwanger geworden von einem älteren Bierbrauer. Im November hatte Frieda ihn zu einer Probearbeitswoche in den Inselsalon nach Norderney eingeladen. Sie hatte ihn in einem der Fremdenzimmer ihrer Eltern untergebracht, wo er, ohne es zu ahnen, die Charakterprüfung durch ihre Mutter, Meta Dirks, bestanden hatte. Seine fachlichen Leistungen waren ebenfalls überzeugend gewesen, und so hatte Frieda ihm am Ende der Probewoche ihre Bedingungen für eine Verbindung unterbreitet.
Auf jeden Fall wollte sie nach der Eheschließung im Salon weiterarbeiten, bei wichtigen Entscheidungen gefragt werden und gleichberechtigt mitbestimmen. Da sie ihren Beruf liebte und weiter ausüben wollte, wünschte sie vorerst keine Kinder. Nach der entbehrungsreichen Kriegs- und Nachkriegszeit wollte sie endlich das Leben genießen – und an Weiterbildungskursen sowie Frisurenwettbewerben auf dem Festland teilnehmen. Sowohl aus Freude an der Herausforderung als auch weil sie hoffte, die eine oder andere Auszeichnung zu erhalten. Damit würde sich der Inselsalon weiterhin als der führende unter Norderneys Friseurläden behaupten können.
Vor dem Krieg hatten zur Stammkundschaft des Salonbegründers, ihres vor einem Jahr an der Spanischen Grippe verstorbenen Schwiegervaters Fritz Fisser, einheimische Honoratioren und vornehme Kurgäste beiderlei Geschlechts gehört, darunter kein Geringerer als der damalige Reichskanzler Bernhard von Bülow. Jeden Sommer pflegte er ihren Salon zu beehren. Frieda hatte ihm die Fingernägel manikürt, der Prinzipal sich um Haupthaar, Bartschnitt und Rasur gekümmert. Es galt also, einen Ruf zu verteidigen und ihn an die neue Zeit anzupassen.
Ihr erster Mann Hilrich Fisser, der 1916 an der Ostfront gefallen war, hatte ihr leider – obwohl sie die Leidenschaft für alles, was mit Haarkunst zusammenhing, verband – die Teilnahme an Fortbildungen und Wettbewerben nicht erlaubt.
Frieda sackte langsam tiefer und ließ den Kopf zurück aufs Kissen sinken. Sie zog die Decke hoch bis über beide Ohren, als könnte sie so die Gedanken verscheuchen, die sich ihr nun aufdrängten. Erinnerungen an ihren schönen, eleganten blonden Hilrich.
Sie hatten sich gemocht, geschätzt, ja, auch liebgehabt. Als Backfisch hatte sie sogar leidenschaftlich für ihn geschwärmt. Seiner heiteren, liebenswürdigen Art war es zu verdanken, dass der Inselsalon immer noch eine besondere Strahlkraft besaß. Der Kitt ihrer Ehe war jedoch ein doppeltes Geheimnis gewesen. Sie hatten einander versprochen zu schweigen. Darüber, dass ihre Tochter Lissy nicht sein leibliches Kind war. Und darüber, dass er in Wahrheit Männer liebte statt Frauen.
Ihr im Alltag recht harmonisches Verhältnis hatte erst Risse bekommen, als Hilrichs Wunsch nach einem Sohn immer dringlicher geworden, sie jedoch noch nicht bereit gewesen war. Eines Abends hatte er sich stark alkoholisiert gegen ihren Willen »sein Recht genommen«.
Körperlich war die Nacht folgenlos geblieben, seelisch nicht. Die Wut, der Ekel, das Gefühl der Demütigung und Hilflosigkeit, die sie durchlitten hatte, wirkten nach. Etwas in ihrer Beziehung war unwiederbringlich zerstört worden.
Aus diesem Grund enthielt der Ehevertrag, den Paul neulich bei einem Notar in der Stadt Norden hatte unterschreiben müssen, auch ausdrücklich die Klausel: Die Erfüllung ehelicher Pflichten setzt das Einverständnis beider Eheleute voraus. Gott, was hatte es sie für Überwindung gekostet, dieses Thema überhaupt zur Sprache zu bringen! Aber es war ihr gelungen. Und Paul hatte sich, sogar ohne große Überredungskunst ihrerseits, einverstanden erklärt.
In der vergangenen eisigen Februarnacht hatte er sie bei Mondschein auf dem schneebedeckten Rasen im Garten umarmt, gewärmt und geküsst, was ihr nicht unangenehm gewesen war. Doch dann hatte er ziemlich abrupt aufgehört und geflüstert, weiter ginge es erst, wenn sie ihn anflehen würde. In seinen Augen hatte sie ein kleines amüsiertes Glitzern beobachtet. Phh! Was der sich einbildete! Sie war nicht die Spur verliebt in diesen Kerl aus Lüneburg, der keinen Pfennig auf der Naht hatte.
Grete, ihre beste Freundin, die als einziger Mensch all ihre Geheimnisse kannte, verstand nicht, dass sie ihr Jawort ganz ohne Liebe gegeben hatte. Dabei war es ja nicht so, dass Frieda keine romantischen Gefühle kannte. Aber das Quantum, das ihr für dieses und mindestens zwei weitere Leben zur Verfügung stand, hatte sie bereits für den Mann aufgebraucht, der Lissys leiblicher Vater war. Fortan würde es ihr genügen, sich an den Liebesgeschichten anderer zu erfreuen. Vielleicht gelang es ihr deshalb so gut, Verliebte zusammenzuführen. Jedenfalls sagte man ihr nach, sie habe ein Talent zum Verkuppeln. Aber sie war eben auch Realistin, zumindest, soweit es ihr eigenes Leben betraf. »Es ist schon viel gewonnen, wenn ein Mann seine Frau nicht einschränkt, sondern sie einfach machen lässt«, hatte sie Grete zu erklären versucht.
Und was ist das gestern Nacht gewesen?, fragte sie sich. Als Paul ihr von der Tanzfläche aus zugezwinkert und wie sie, beschwingt von den schönen Aufregungen des Tages und schon reichlich beschwipst, auf einmal gedacht hatte: Na, das wollen wir doch mal sehen, wer hier wohl noch wen anfleht! Nein, das war ohne Bedeutung gewesen. Von einer solchen Stimmung fühlte sie sich an diesem Morgen himmelweit entfernt. Darum ging’s ja auch überhaupt nicht.
Frieda spürte Übelkeit aufsteigen. Hoffentlich hatte sie sich nicht zu viel zugemutet. Plötzlich wurde ihr erschreckend klar, dass sie gerade alles riskierte – für die Familie, den Salon und ihren Traum, sich in ihrem Beruf als Friseurin zu vervollkommnen. Es konnte durchaus schiefgehen. Was, wenn sich ihr neuer Ehemann als Tyrann, Nichtsnutz oder Nervensäge entpuppte? Wie sollten sie eigentlich ihre Abende verbringen? Vielleicht würden sie nur in der Stube sitzen, voller Anspannung oder gelangweilt, und sich nichts zu sagen haben.
Nein, nein, redete Frieda sich selbst Mut zu, du hast doch Menschenkenntnis. Jetzt ist erst mal wichtig, in diesen stürmischen Zeiten nicht unterzugehen. Alles andere wird sich finden. Du bist unter einer Glückshaube auf die Welt gekommen, vergiss das nicht, das wird dir auch diesmal helfen.
Wieder blitzten vor ihrem geistigen Auge Bilder vom Vortag auf. Sie sah Paul und sich im geschmückten Pferdeschlitten mit Glöckchenklang unter einem strahlend blauen Himmel auf der Promenade am Meer vorübergleiten. Wie märchenhaft schön der schneebedeckte Strand im Sonnenlicht geglitzert hatte … Und dann fiel ihr die Überraschung des Tages ein – ihr Lieblingsbruder Dodo war zurückgekehrt! Unverletzt aus der britischen Gefangenschaft in Scapa Flow. Die Familie hatte ihn nach seiner Rückkehr einige Tage lang versteckt gehalten, um ihn als das schönste Hochzeitsgeschenk zu präsentieren. Wie wunderbar!
Sie streckte sich. Auf einmal schienen alle Beschwerden wie weggeblasen. Dodo ging es gut, er lebte jetzt wieder mit ihnen auf der Insel. Frieda warf die Decke zur Seite und stand auf. Sorgfältig machte sie sich im Bad zurecht. Sie kämmte den flachsblonden Bubikopf, den Pony, kniff sich in die Wangen, gab einen Hauch Rouge darauf, puderte dezent die Stupsnase und tupfte etwas rosafarbene Lippenpomade auf den Mund. Sie nahm einen frisch gestärkten weißen Friseurkittel aus dem Schrank, um ihn nach dem Frühstück überzuziehen. Die Georgette-Bluse, die sie zu einem grauen Rock trug, schimmerte in sanftem Rosé. Dieser Farbton brachte das helle Blau ihrer Augen zum Strahlen. Hoffentlich wirkt es auch heute, dachte sie, als sie ins Erdgeschoss hinunterging.
In der großen Küche mit Gartenblick, die zugleich als Aufenthaltsraum für das Personal diente, brummte es schon vor Leben. Else, die Haushälterin, spülte das letzte Geschirr vom Fest ab. Das Teewasser kochte. Der geflieste Boden glänzte vom Feudeln. Ihre Schwiegermutter hatte, sicher zusammen mit dem Lehrling und den Gesellen, die bereits im Salon werkelten, wo sie die Nacht zuvor gefeiert hatten, alles wieder auf den rechten Platz gerückt.
»Oh, ihr seid fleißig gewesen … Danke schön!«
Ein schlechtes Gewissen beschlich Frieda. Einige Nachbarinnen hatten schon in der Nacht mit den Aufräumarbeiten angefangen und dafür die Reste des Hochzeitsmahls eingepackt bekommen. Sie erinnerte sich nur dunkel daran, ihr Kopf funktionierte noch nicht wieder einwandfrei.
Lissy, mit blauer Haarspange in den kinnkurzen braunen Locken, schien während des Frühstückens ein Gedicht auswendig zu lernen. Jedenfalls hielt sie eine Hand auf eine Schulbuchseite, sah nicht hin und murmelte: »Festgemauert in der Erden …«
»Guten Morgen, Frau Merkur«, sagte Paul.
Er saß auf dem Stuhl, der früher der von Hilrich gewesen war. Der Platz am Kopfende des Tisches, den ihr Schwiegervater Fritz Fisser innegehabt hatte, blieb tabu. Eine ewige Leerstelle. Ihre Schwiegermutter pflegte dort eine Vase mit Blümchen oder kleine Fundstücke aus der Natur zu drapieren. Jeder verstand, dass es sich um eine Art Gedenkstätte handelte.
Frieda spürte, wie ihr die Hitze in die Wangen schoss. Sollte sie Paul mit einem Küsschen begrüßen? Sicher glaubten die anderen, dass sie die Nacht zusammen verbracht hatten. Aber allein zu wissen, dass die Gesellen sich vorstellten, was in der Hochzeitsnacht geschehen sein könnte, machte sie verlegen. Noch dazu, wo doch in Wirklichkeit nichts passiert war. Ein wenig kam sie sich vor wie eine Betrügerin.
Paul lächelte. Er war schon rasiert. Wieder dachte sie, dass er ohne den Schnurrbart, den er noch bei ihrem Kennenlernen im November getragen hatte, jünger und moderner aussah. Das dunkelbraune, seitlich gescheitelte Haar über der hohen, breiten Stirn war akkurat mit Pomade zurückgekämmt.
»Ausgeschlafen, Frau Merkur?«
»Guten Morgen!« Frieda begriff nicht sofort, dass er sie angesprochen hatte.
»Frau Merkur …«, wiederholte ihre Schwiegermutter gedehnt. »Wird dauern, bis die Leute sich dran gewöhnt haben. Schließlich warst du gut elf Jahre lang Frau Fisser.«
Gekonnt überprüfte sie den Sitz ihrer silbergrauen Pompadourfrisur, und es schien Frieda, als wollte die Patronin damit sagen: Eigentlich gibt es ja sowieso nur eine Frau Fisser, seit Jahrzehnten schon, und das bin ich. Aber vielleicht bildete sie sich das auch nur ein.
Frieda setzte sich. »Die meisten nennen mich ohnehin nur beim Vornamen«, warf sie ein. »Lissy, du sollst doch nicht deine Bücher auf den Tisch legen, wenn aufgedeckt ist.«
»Gestern konnte ich aber nicht lernen«, antwortete ihre Tochter mit einem trotzigen Ausdruck in den schönen dunkelblauen Augen. »Du musstest ja heiraten.«
»Ich musste nicht, ich wollte.«
»Müssen is’, wenn was Kleines unterwegs is’«, ließ sich Else von der Spüle her vernehmen.
»Du willst doch jetzt nicht etwa in den Salon und arbeiten?« Ihre Schwiegermutter zeigte kopfschüttelnd auf den Friseurkittel. »Unser Haus ist voll mit Gästen, die hier übernachtet haben. Und das deiner Eltern auch. Ihr werdet sie ja wohl nach dem Frühstück zur Fähre bringen und verabschieden …«
»Liegen alle noch in Sauer«, merkte Else beruhigend an.
»Natürlich«, erwiderte Frieda entschuldigend. Sie würde nichts runterbekommen können außer Tee und Zwieback. »Die Macht der Gewohnheit …«
»Gibt’s keinen Kaffee?«, fragte Paul mit Blick auf die Teekanne. »Ich brauch morgens zum Wachwerden ’ne starke Bohne. Und heut besonders.« Offenbar brummte ihm auch der Schädel.
»Else, kannst du eigentlich Kaffee kochen?«, fragte Frieda. »Wir werden wohl ein paar neue Gewohnheiten einführen.«
»Ich hab meinem Fritz jeden Morgen seine erste Tasse Ostfriesentee ans Bett gebracht.« Schwärmerisch klärte ihre Schwiegermutter Paul auf. »Jeden Morgen, bis zu seinem letzten Tag. Ich war natürlich immer schon fertig zurechtgemacht.« Sie seufzte, Tränen stiegen ihr in die Augen. »Unser kleines Ritual. Fritz hat es sehr geliebt. Und ich auch.«
»Guter Anfang ist halbes Glück«, sagte Paul. Er massierte sich beide Schläfen.
»Lissy, lauf doch schnell mal zum Kaufmann und hol uns ein paar Salzheringe«, bat Frieda. Die halfen am besten gegen einen Kater. »Aber lass dich nicht von Minna-Überbiss aushorchen. Wenn sie fragt, wie das Fest gewesen ist, sagst du einfach nur, es war ganz wunderbar.«
»Die haben noch gar nicht auf.«
»Dann klingel. Wach werden sie schon sein.«
»Und wenn sie keine Salzheringe haben?«
»Nimmst du Matjes oder Rollmops, ein Dutzend, wenn du kriegen kannst«, antwortete Frieda. »Aber keinen Bückling.« Geräucherten Hering konnte sie an diesem Morgen nicht mal riechen, außerdem steigerte Bückling die Wollust, und sie wollte wahrlich nichts forcieren. »Nimm die Lebensmittelkarten mit und guck auch, ob du Kaffee bekommst.« Paul schenkte ihr einen dankbaren Blick. »Minna ist die Tochter der Kaufleute …«, erklärte sie ihm.
»… eine alte Jungfer«, steuerte ihre Schwiegermutter bei.
»… sie hat einen Überbiss, deshalb der Beiname. Tut immer ganz freundlich, ist aber eine fürchterliche Tratschtante.«
Er grinste. »Solche Minnas gibt’s überall. In Lüneburg hatten wir auch eine, sie hieß Alma. Du wirst mich sicher noch ins Bild setzen über die anderen Originale der Insel.«
Frieda lächelte zurück. »Na, klar. Am besten nehme ich dich mit in die Vereine, und du suchst dir ein paar aus, bei denen du Mitglied werden möchtest. Gemischter Chor und Kegelverein, natürlich gibt’s noch den Männergesangverein, Feuerwehr …« Die Idee war ihr gerade erst gekommen, und sie erleichterte sie. »Wir werden auch ein paar Besuche bei Freunden und Verwandten machen.«
»Kriegerverein«, schlug ihre Schwiegermutter vor. »Fritz und Hilrich waren im Kriegerverein. Bei Fritz’ Beerdigung haben seine Kameraden Kanonenschüsse abgegeben und seinen Sarg unter nachlassendem Trommelwirbel ins Grab gelassen. Sehr ergreifend …« Sie schluckte schwer.
»Seenotretter«, steuerte Lissy schnell noch von der Tür aus bei, »Fokkos Papa sitzt immer im Rettungsboot am Ruder.«
»Nee«, erwiderte Paul skeptisch. »Ich glaub, das Wasser ist nicht so mein Element. Gibt’s hier auch einen Turnverein?«
Frieda nickte. »Und eine richtig gute, moderne Turnhalle. Überhaupt viele Sportmöglichkeiten, jedenfalls in der Saison.«
»Hervorragend«, antwortete er zufrieden. »Sport ist meine große Leidenschaft. Ich turne für mein Leben gern.«
»Tatsächlich?«
Wir wissen eigentlich noch gar nichts voneinander, dachte Frieda.
Jakomina
»Ich muss mich loben«, sagte Jakomina, als sie am Abend allein in ihrer Stube saß und halblaut mit Fritz redete, dessen Augen sie von seinem Porträtfoto aus in jede Ecke des Wohnzimmers zu begleiten schienen. »War doch ’ne gute Idee, die Friseurzeitung mit der Anzeige ›zufällig‹ auf der Anrichte zu platzieren.« Verschmitzt lächelte sie dem Foto zu. »Dieser Paul Merkur macht sich ganz gut, Mucki. Natürlich ist er nicht so witzig und versiert wie du, er hat auch nicht die Raffinesse und Eleganz unseres Sohnes. Aber er nützt dem Inselsalon.« Sie nickte zur Bekräftigung, bevor sie sich wieder über eine Näharbeit für Lissy beugte.
Ein klein wenig bedauerte sie es, dass Paul und Frieda fast jeden Abend unterwegs waren. Dadurch fühlte sie sich noch einsamer. Früher hatten ihre Schwiegertochter und sie zwei oder drei Abende in der Woche gemeinsam verbracht. Das war vorbei. Aber andererseits beteiligte sich der Mann aus der Heide, den sie kurz den Heidjer nannten, nach Kräften am wieder aufblühenden Vereinsleben der Insel, und das konnte nur gut sein fürs Geschäft. Zunehmend erwies er sich als angenehmer Zeitgenosse. Die meisten Norderneyer begegneten ihm so aufgeschlossen, wie sie einem Nichtinsulaner gegenüber nur sein konnten. Schon allein deshalb, weil Frieda beliebt war und man ihr ein neues Glück gönnte.
Jakomina sorgte sich allerdings um ihre Enkeltochter. Lissy, die im April elf geworden war, schien nicht richtig warm zu werden mit ihrem Stiefvater. Manchmal gab sie pampige Antworten, sie sprach ihn nie direkt an. Obwohl Paul sich bemühte, freundlich zu ihr zu sein. Wahrscheinlich brachte das Kind es nicht über die Lippen, Papa oder Vater zu ihm zu sagen. Das war ja auch verständlich, wenn man bedachte, was für einen wundervollen Vater sie verloren hatte. Aber so langsam wäre es doch an der Zeit, dass Lissy ihren Widerstand aufgab.
Zuweilen tat dem Nachwuchs eine harte Hand ganz gut. Auch deshalb war es zu begrüßen, dass wieder ein Mann im Haus lebte.
»Kinder sind wie junge Bäume, sie müssen von Zeit zu Zeit beschnitten werden. Das hast du immer gesagt, nicht wahr, Mucki?« Sie seufzte.
Es war einigermaßen hellhörig im Haus. Jedenfalls, wenn man wie sie jahrzehntelang darin gewohnt hatte, konnte man den Geräuschen ganze Geschichten ablauschen. Ihre Wohnung war zwar durch eine dicke Zwischentür im Flur von dem Anbau getrennt, in dem ihre Schwiegertochter mit Paul und Lissy wohnte, doch trotzdem verriet ein Knarren hier, ein Quietschen dort oder das Rauschen der Wasserleitung zu ungewöhnlicher Zeit ihr alles, was wichtig war. Zum Beispiel, wer wann wessen Zimmer betrat oder verließ. Frieda hatte ihr anvertraut, dass Paul ebenso wie einst Hilrich schnarche und sie deshalb getrennte Schlafzimmer vorzögen. Nun gut, dagegen war nichts einzuwenden, man konnte sich schließlich besuchen. Doch das, was die Geräusche ihr bislang verraten hatten, beunruhigte sie. Denn es war – nichts. Wenn sie die akustischen Zeichen von nebenan richtig deutete, dann teilten Frieda und Paul noch immer nicht das Bett miteinander.
»Da waren wir zwei von ganz anderem Kaliber, was?«
In ihrem Innern hörte sie, wie Fritz ihr beipflichtete. Wenn sie die Augen schloss, sah sie ihn sogar auflachen und seine Hasenzähne entblößen, die ihm stets ein charmantes, gewitztes Aussehen verliehen hatten.
Aber dass du dich bitte zurückhältst, mein Minchen, sagte er nun streng. In diesem Punkte solltest du dich wirklich nicht einmischen. Erneut seufzend nickte sie ergeben und konzentrierte sich auf ihre Näharbeit.
Noch etwas Gutes hatte Pauls Anwesenheit – sie musste weniger im Salon mitarbeiten und hatte mehr Zeit, sich um die Verpflegung von Familie und Belegschaft zu kümmern. Noch immer waren Nahrungsmittel knapp, viele Norderneyer litten Hunger. Die Entwicklung von Gerichten aus ungewöhnlichen Zutaten wurde deshalb mehr und mehr zu Jakominas Passion. Morgen würde sie ausprobieren, was ihr neulich eine alte Insulanerin erzählt hatte. Angeblich war es früher üblich gewesen, die Wurzeln von Stranddisteln zu kochen und wie Spargel zuzubereiten. Sie sollten nicht nur nahrhaft sein, sondern auch schmecken.
Als sie den Mädchenrock durch Auslassen und Umnähen des Saums fertig verlängert hatte, griff sie nach einem Buch mit Sagen vom Rhein. Eigentlich lag es hier, weil sie Lissy daraus vorlesen wollte. Es war ein Hochzeitsgeschenk ihres früheren Altgesellen Rudolf, der in der Nähe des Loreleyfelsens ein Schiffsrestaurant geerbt hatte. Wahrscheinlich hatte Frieda ihm auf seine letzte Postkarte hin von ihrer Wiederverheiratung geschrieben.
»Ach, Mucki, sei still, ich denk überhaupt nicht mehr dran!«, beteuerte sie entrüstet. Rudolf hatte ihr damals vor dem Krieg so niedlich unbeholfen den Hof gemacht – bis ihr Mann ihn hochkant rausgeschmissen hatte. Sie unterdrückte ein geschmeicheltes Kichern. »Das ist doch eine Ewigkeit her …«
Aber es freute sie, dass Rudolf den Krieg überstanden und noch eine Frau, die Kriegerwitwe eines Kameraden, gefunden hatte. Sein Lokal lief offenbar auch auskömmlich.
Sie konnte ja schon mal ein bisschen vorab in dem Buch lesen, damit sie wusste, welche Geschichte sich für welches ihrer Enkelkinder eignete. Die Kleinen ihrer Tochter Frauke und ihres Schwiegersohns Felix Rosenau, der ein Juweliergeschäft auf der Insel betrieb, liebten es, wenn Oma ihnen vorlas. Helmi war sechs Jahre alt, und Annelieschen mit ihren sechs Monaten würde sicher schon Freude an den bunten Bildern haben. Aufmerksam studierte Jakomina die Illustrationen und versank dann in der Lektüre. Nur zu gern ließ sie selbst sich von Geschichten über verwunschene Ruinen und spukende Burgfräulein, von tapferen Rittern und weinseligen Gelagen in eine andere Welt entführen.
Grete
Juni 1920
Max löste die Spange, die ihr Haar zusammenhielt. Grete wusste, wie sehr er den Augenblick liebte, wenn die schwarzen Wellen sanft über ihre Schultern fielen. Unwillkürlich schüttelte sie den Kopf ein wenig, um den Moment zu verlängern.
»Es macht mich wahnsinnig«, flüsterte er mit rauer Stimme. »Aber als zukünftiger Vater und als Arzt muss ich …« Er stöhnte auf, gequält von der selbst verordneten Enthaltsamkeit, presste sie kurz noch enger an sich, womit er natürlich auch ihr Begehren weiter steigerte, schob sie aber gleich darauf von sich. Mit ein paar Schritten floh er zur Balkontür.
»Ich komme mir langsam vor wie der Teufel in Menschengestalt«, sagte sie halb spöttisch, halb liebevoll und legte lächelnd eine Hand auf ihren schon leicht gerundeten Bauch. »Jetzt mal ehrlich, Dr. Lubinus … Unser Kind hat ein Tauchbad in der Nordsee im tiefsten Winter überstanden – meinst du wirklich, es wäre immer noch gefährlich?«
Er schaute aus dem Fenster über den Damenpfad aufs Meer hinaus. Sie folgte seinem Blick. Der mit Badekörben bestückte Strand war jetzt im Juni von Tag zu Tag mehr bevölkert, diese Saison würde besser werden als die des Vorjahres.
»Du bist nun mal mit deinen dreißig eine späte Erstgebärende, Grete«, antwortete Max betont vernünftig. »Da sollten wir jedes Risiko vermeiden.«
»Soweit ich das während meiner Schwesternausbildung gelernt habe«, sagte sie und ging aufreizend langsam auf ihn zu, »ist eine gewisse Anfälligkeit nur in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft erhöht. Inzwischen bin ich doch schon im vierten Monat.«
»Aber sicher ist sicher.«
»Ach, wie sicher ist schon sicher? Könnte sein, dass ich vor Sehnsucht sterbe, bevor unser Sohn zur Welt kommt.«
»Ein Mädchen … wäre mir ebenso lieb«, versuchte Max ihren Verführungskünsten verbal etwas entgegenzusetzen.
»Ich fände es am schönsten, wenn wir erst einen Sohn bekämen und zwei Jahre später eine Tochter.«
»Wie … wie du meinst«, entgegnete er kurzatmig.
»Und wenn wir ganz vorsichtig sind?« Nur wenige Zentimeter trennten sie noch, in Max’ braunen Augen sah Grete die mühsam unterdrückte Leidenschaft funkeln. »Gaaanz ganz vorsichtig?«, hauchte sie, bevor ihre Lippen seinen Mund berührten.
»Je, den Düwel ook!«, brach es da aus dem Ostfriesen hervor. Er packte sie, hob sie auf seine Arme und trug sie zum Bett.
»Halt«, flüsterte er nach einer Weile beschwörend, »beweg dich jetzt bloß nicht.« Schweißbedeckt, ineinander verschlungen, lagen sie da. Es war verdammt schwer, dem natürlichen Trieb nicht nachzugeben. Sie atmete gegen ihr Temperament an, ganz bewusst langsam tief ein und aus und unterdrückte den Impuls, in sich hineinzukichern.
»Was soll unser Kind nur von uns denken?«
»Es denkt noch nicht«, antwortete Max.
»Aber es fühlt.«
Er küsste sie. Und sie hoffte unbedingt, dass ihr Kind es spüren und sich merken würde, für immer und ewig, dass es einst in einem Meer aus Lust und Liebe getrieben war.
Der Höhepunkt rollte in Wellen näher, nahm einen neuen Anlauf, Grete konnte sich nicht länger beherrschen, sie wollte, sie musste sich bewegen. Doch Max hielt sie fest umklammert, zwang sie stillzuhalten. Gleichzeitig begann er mit einer der Atemübungen, die sie für ihre Arbeit im Seehospiz entwickelt hatten. Sie tat es ihm nach. Holte ebenfalls tief Luft, beobachtete und lenkte ihren Atem, wie sie es oft gemeinsam geübt hatten.
Sie beruhigten sich, fanden den gleichen Rhythmus, sahen sich dabei tief in die Augen, verbunden durch Körper und Seele – bis sie in einem nie gekannten Gefühl explodierten, abhoben und sich auflösten.
Hinterher sprachen sie nicht über dieses ekstatische Erlebnis. Kein Wort sollte es entweihen.
Als sie etwas geschlafen, sich frisch gemacht und angezogen hatten, bereitete Grete einen Tee zu. Sie öffnete die Balkontür weit und deckte das Tischchen draußen. Wolken trieben am Himmel. Die verglasten Seitenwände schützten sie vor dem Seewind, immer wieder kam die Sonne durch und wärmte sie.
»Warst du heut schon bei Hans-Heinrich?«, fragte Grete, als sie den Tee einschenkte.
Ihr Bruder Hans-Heinrich bewohnte vorübergehend eine Wohnung im selben Haus wie sie. Er war gemütskrank nach mehreren Jahren in einem Gefangenenlager aus Deutsch-Südwestafrika zurückgekehrt. Das Kaufhaus, das er und ihr gefallener ältester Bruder Lulu vor dem Krieg in der Nähe von Windhuk aufgebaut hatten, war enteignet worden. Hans-Heinrich sollte nun von ihrem Vater die Leitung der Lehmann’schen Werke in Berlin übernehmen. Das Fabrikunternehmen hatte mit der Produktion von Uniformen, Zelten und Ausrüstungsgegenständen für Soldaten viel Geld verdient. Böse Zungen nannten Ludwig Lehmann einen Kriegsgewinnler. Doch zuerst musste Hans-Heinrich wieder gesund werden. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland verhielt er sich antriebslos. Manchmal sprach er tagelang kein Wort, wollte keinen Menschen sehen. Einige Monate hatte Hans-Heinrich in Melancholie versunken in ihrem einstigen Zuhause in Berlin verbracht.
Grete war mit ihren Eltern zerstritten, weil sie den mittellosen Max Lubinus geheiratet hatte, der keiner angesehenen Familie entstammte, und weil sie Mitglied der Sozialdemokratischen Partei geworden war.
Schließlich hatte ihre Mutter, eine geborene von Wingenhorst, sich aber keinen anderen Rat mehr gewusst, als ihr trotz ihres Zerwürfnisses zu schreiben. Sie hatte Grete gebeten, sich um den Bruder zu kümmern, wenn sie ihn zur Erholung nach Norderney schickten, in die Sommerfrische seiner glücklichen Kindheit und Jugend, als letzten Versuch, bevor sie ihn in eine Nervenheilanstalt einweisen lassen müssten. Selbstverständlich lag es Grete sehr am Herzen, ihm zu helfen.
Max, der erst im Januar – mehr als ein Jahr nach Kriegsende – aus französischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, hatte gleich erkannt, dass Hans-Heinrich selbstmordgefährdet war. Er unternahm mit ihm jeden Tag, bei jedem Wetter, einen Spaziergang durch die Dünen und am Meer entlang. Manchmal, das wusste sie aus den Schilderungen ihres Mannes, musste er den Schwager regelrecht vor sich hertreiben, mit Beschimpfungen oder unter Androhung von Gewalt durch die Natur scheuchen.
Max hatte im Krieg als Sanitätsarzt gedient. Er verarbeitete die schrecklichen Erlebnisse, die ihn manchmal nachts im Schlaf brüllen ließen, auf seine Art. Dazu gehörte, dass er anderen half. Seine Therapie, die Lebensgeister Hans-Heinrichs zu wecken, diente ebenso der eigenen Gesundung. Als Anhänger der Reformbewegung schwor er auf die Kräfte der Natur, auf die regulierende und stärkende Wirkung von Wasser, Wind und Sonne und den Wechsel von heiß und kalt.
Max schüttelte den Kopf. »Er hat nicht aufgemacht.«
Erschrocken sah Grete ihn an. »Meinst du, es ist was Ernstes?«
»Nein, ich glaube, das Schlimmste ist überstanden. Wahrscheinlich war er vorhin nicht da. Wir haben heute gutes Segelwetter.« Er lächelte. »Es war genau die richtige Idee, ihn aufs Segelboot zu lassen.« Seit einigen Wochen fuhr Hans-Heinrich häufig mit dem alten Segelboot des verstorbenen Fritz Fisser auf die Nordsee hinaus. Jahrelang hatte es eingemottet in einer Werfthalle an der Wattseite gelegen. Es gab in der Friseurfamilie Fisser niemanden mehr, der die Minchen zu segeln verstand.
Jetzt unterrichtete Hans-Heinrich, der in seiner Jugend oft auf dem Wannsee herumgekreuzt war, Fissers Tochter Frauke und deren Mann Felix Rosenau. Seltsamerweise verstand sich ihr Bruder gut mit dem Paar. Vielleicht lag es daran, dass die Rosenaus ein Juweliergeschäft besaßen und sich gern mit ihm über sein geliebtes Südwestafrika und über Diamanten und Farb-Edelsteine unterhielten, von denen es dort große Vorkommen gab.
Grete mochte Frauke nicht sonderlich. Sie hielt sie für eine eingebildete Ziege. Auch ihre Freundin Frieda hatte ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Schwägerin, obwohl in der schlimmsten Hungerszeit sogar sie etwas Demut gelernt hatte.
»Wusstest du, dass sie manchmal Lissy zum Segeln mitnehmen?«, fragte Max. »Sie begreift die Kommandos schneller als ihre Tante, sagt Hans-Heinrich.«
»Ach! Nein, das hat sie mir noch gar nicht erzählt.« Eigentlich hatte Grete einen sehr guten Draht zu Friedas Tochter. Lissy vertraute ihr Dinge an, die sie ihrer Mutter verschwieg. »Ich weiß nur, dass sie ab und zu ihre Hausarbeiten bei Hans-Heinrich macht. Sie hat dort mehr Ruhe, und ich bin dann immer ganz froh, dass jemand bei ihm ist. Wenn er einen guten Tag hat, erzählt er ihr von Afrika, das mag sie gern.«
»Ich glaube, sie will ihre Oma überraschen«, erklärte Max. »Sie hat ihr wohl mal versprochen, dass sie segeln lernen werde, um sie davon abzuhalten, das Boot zu verkaufen.«
»Wie süß!«
»Ja, natürlich hängt Jakomina an dem Boot. Ihr Mann hat es schließlich eigenhändig für sie gebaut.«
»Es wäre sicher auch für Lissy schön, wenn sie Spaß daran fände«, überlegte Grete. »Sie hat’s gerade nicht leicht. Ich glaube, sie fürchtet, dass ihre Mama bald wie wir ein Kind bekommt.«
»Darüber sollte sie sich doch freuen«, entgegnete der sonst so verständnisvolle Max.
»Na ja, sie hat ihre Mutter viele Jahre für sich allein gehabt«, gab Grete zu bedenken. »Und plötzlich ist da Paul, der sie übrigens neulich mal als verwöhntes Einzelkind beschimpft hat. Wenn nun noch ein Baby käme …«
»Ich finde Paul ja ein bisschen schlicht«, sagte Max.
»Er ist unkompliziert«, erwiderte Grete.
Sie schwiegen eine Weile. Vom Strand wehte der Lärm spielender Kinder herüber. Möwen schrien, Geschirr klapperte. Es roch nach Salzwasser und frisch gebackenen Waffeln aus einem nahen Lokal, in dem Leute auf einer Veranda unter ausgespannten Segeltüchern saßen und plauderten.
»Herrlich!« Grete genoss die frühsommerliche Stimmung. »Und wir haben jeden Tag Urlaub.«
»Na ja«, antwortete Max. Sie spürte, dass er ihr etwas sagen wollte, was ihm nicht leichtfiel.
»Na ja?«, wiederholte sie fragend.
»Grete, wir können nicht ewig vom Ersparten leben. Die Inflation macht es auch nicht besser. Ich brauche beruflich eine Perspektive. Erst recht, da ich nun bald Familienvater sein werde.«
Sie nahm ihre Tasse und nippte am heißen Tee. Es stimmte, die Vorträge, die Max einmal in der Woche im Conversationshaus zum Thema Der heutige Stand der Meeresheilkunde hielt, brachten zwar etwas Renommee, aber nur wenig Honorar ein. Zum Selbstständigmachen fehlte ihm das Kapital, und die Banken wollten ihm nichts leihen.
»Die Gemeinde hat doch zwei Häuser in der Marienstraße gekauft, um ein modernes Krankenhaus zu errichten«, sagte sie dann. »Das wäre eine Perspektive.«
»Nein, leider nicht. Es dauert zu lange, bis die Entwürfe fertig sind und sie alles entsprechend umgebaut haben.«
Alarmiert sah sie ihren Mann an. Er wusste doch, dass sie unbedingt auf der Insel bleiben wollte. Nur hier hatte sie ihr Asthma unter Kontrolle, nur hier bekam sie nicht diese grässlichen Hautausschläge, die sie jahrelang gequält hatten.
»Was ist mit dem Seehospiz?«, fragte sie. Die letzten Monate vor dem Krieg hatten sie dort zusammengearbeitet. Sie als seine Assistentin bei einer einzigartigen Studie über die Heilfaktoren des Nordseeklimas, untersucht an kranken Kindern, die zur Erholung auf die Insel geschickt worden waren. Damit hätte Max sich in der Fachwelt einen Namen gemacht. Doch die Mobilmachung war dazwischengekommen, die Unterlagen galten inzwischen als verschollen. »Du könntest deine Studie mit neuen Probanden wiederholen und diesmal zu Ende führen. Oder auch erst mal nur als Arzt im Hospiz arbeiten.«
Vielleicht würde sie dann wieder wie vor ihrer Assistenzzeit mit den jüngsten Patienten singen und spielen können. Beruflich war das ihre erfüllendste Zeit gewesen.
»Grete, wann hast du dir die Gebäude das letzte Mal angesehen?«, fragte er gereizt.
Fünf Jahre lang waren sie als Kaserne zweckentfremdet worden. Nun stand der Backsteinkomplex seit Monaten leer, was den Zustand auch nicht gerade verbesserte.
»Aber im Juli kommt eine Kommission der Regierung«, erwiderte sie aufgeregt. »Wenn die befindet, dass man das Seehospiz restaurieren müsste, kann’s ganz schnell gehen.«
Max griff nach ihrer Hand. »Grete, versteh doch. Ich trage die Verantwortung. Deshalb werde ich eine Anstellung im Krankenhaus von Aurich übernehmen. Ab September oder Oktober. Es ist keine leitende Funktion, allerdings mit Aussicht darauf. Immerhin könnten wir uns dann ein kleines Häuschen zur Miete leisten und unser Kind wird in einem Garten spielen.«
»Aber … Ach, nein, bitte, Max!« Flehentlich sah sie ihn an. Gerade noch war sie so glücklich gewesen. Und nun diese Nachricht! »Bitte!« Sie drückte seine Hand, ihre Augen wurden feucht. »Hast du etwa schon fest zugesagt? Max, lass uns doch wenigstens noch abwarten, was der Besuch der Kommission ergibt. Die Experten kommen direkt von der Reichsregierung. Das ist nicht irgendein Provinzgremium ohne Einfluss. Bitte …«
Schwer atmend neigte Max den Kopf. Er verzog den Mund. »Also gut. Ich will versuchen, die Zusage noch etwas hinauszuzögern.«
Sie presste die Lippen aufeinander. Mit den Augen dankte sie ihm. Wie es ausgehen würde, wusste sie nicht. Aber eines wusste sie gewiss – sie würde alle Register ziehen, um auf der Insel bleiben zu können.
Schweigend tranken sie ihren Tee, jeder seinen Gedanken nachhängend. Auf einmal hörte sie unten auf dem Damenpfad einen Mann von Herzen laut lachen. Die Stimme kam ihr bekannt vor. Grete erhob sich und lugte neugierig über die Brüstung. Es war Hans-Heinrich. Ihr Bruder lachte! Und die Frau neben ihm, ihre Freundin Katharina, lachte ebenfalls. Die beiden spazierten aus Richtung Weststrand näher, er trug Segelschuhe.
Erfreut hob Max seine buschigen Brauen. »Dein Bruder lacht wieder.« Ein Strahlen ging über sein Gesicht.
»Ich fass es nicht«, murmelte Grete. Sie winkte. »He! Wir haben gerade Tee fertig. Kommt doch rauf auf ein Tässchen. Wenn ihr mögt, bringt noch ein paar Waffeln mit!«
»Geht in Ordnung!«, rief Hans-Heinrich.
»Ob mein Bruder weiß, dass Katharina geschworen hat, niemals zu heiraten?«, fragte Grete Max nachdenklich.
Ihre Freundin war Lehrerin und arbeitete im Lehrerinnenerholungsheim, für das sie unter anderem ein anspruchsvolles Vortragsprogramm organisierte. Als eine der ersten Frauen auf Norderney hatte sie sich im Inselsalon einen Bubikopf schneiden lassen – und nebenbei mit ihren emanzipatorischen Ansichten Frieda auf die Idee gebracht, einen Ehevertrag aufzusetzen.
»Ob Frieda sich vielleicht schon wieder einen Hut verdienen will?« Schmunzelnd stopfte Max seine Pfeife.
Bei ihrer Hochzeit hatte sie nämlich Katharina als Tischdame neben Hans-Heinrich platziert, genau genommen hatte sie die Lehrerin sogar nur seinetwegen eingeladen, damit er sich gebildet unterhalten konnte.
»Na, ich glaube, so schnell wird Katharina ihren Grundsätzen nicht untreu«, gab Grete zurück.
Wenig später saßen sie etwas beengt, aber gemütlich zu viert auf dem Balkon um den kleinen runden Tisch herum und verputzten warme Waffeln.
»Mhmm … genau wie sie sein sollen«, lobte Katharina, »dick, innen weich, außen knusprig, nicht zu süß. Und die frischen Erdbeeren dazu schmecken herrlich.«
»Waffeln müssen eigentlich knusprig und so dünn sein, dass man durch sie hindurchsehen kann«, behauptete Max. »Und man darf sie nur an den Tagen rund um Neujahr essen.«
Grete lächelte, er meinte ostfriesische Krüllerkes, die sie auch gern mochte, die aber furchtbar krümelten. »Wie schön, dass ihr Ostfriesen so weltoffen seid«, neckte sie ihn.
Während sich Hans-Heinrich und Katharina bei der lebhaften Schilderung ihres Segelausflugs abwechselten, stibitzten sie sich gegenseitig Früchte, Löffelspitzen Sahne und Vanilleeis von den Tellern. Beide hatten sonnengerötete Gesichter.
»Hans-Heinrich erzählt so spannend von Afrika«, schwärmte Katharina. »Die gewaltige Natur, die wilden Tiere … Ich wünschte, eines Tages könnte ich das auch alles einmal erleben.«
»Wer weiß«, antwortete Hans-Heinrich vieldeutig. »Ich hab gerade gelesen, dass deutschsprachige Südwester, die ausgewiesen wurden, zurückdürfen, wenn unsere frühere Kolonie erst ein Mandatsgebiet des Völkerbundes geworden ist.«
»Aha, und wann könnte das sein?«, erkundigte sich Max.
»Vielleicht zum Ende des Jahres.«
In Katharinas Augen blitzte es abenteuerlustig. »Wer weiß, wer weiß«, antwortete sie kokett.
Grete konnte das Knistern zwischen den beiden beinahe hören. Sie und Max wechselten einen Blick. »Das wird unseren Eltern aber gar nicht gefallen«, sagte sie. »Papa wartet doch darauf, dass du die Firma übernimmst.«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte ihre Bruder jetzt mit Grabesstimme.
»Ach herrje.« Grete ahnte, dass ein Problem auf sie zukam.
»Unsere Eltern haben sich auch schon angesagt«, eröffnete ihr Bruder ihr.
»Wie? Wo?«, fragte sie verwirrt.
»Sie kommen im Juli nach Norderney. Samt Eduard mit Familie. Und sie steigen wieder im Kaiserhof ab.«
»Wie nett, dass ich davon erfahre.«
»Der Brief von Maman ist gestern eingetroffen. Sie möchten endlich wieder Urlaub machen wie vor dem Krieg. Und unser Bruder will seinen Kindern zeigen, wo wir unsere schönsten Ferien verbracht haben.«
Ihr mittlerer Bruder Eduard, der im Auswärtigen Amt in Berlin arbeitete, hatte inzwischen zwei Söhne und zwei Töchter.
Grete musterte Hans-Heinrichs früh gealtertes Gesicht. »Aber du glaubst nicht, dass sie nur deshalb kommen, oder?«
Max und Katharina hielten sich plötzlich auffallend zurück.
»Natürlich nicht«, antwortete Hans-Heinrich. »Sie drängen darauf, dass ich nach Berlin zurückkehre und unseren Herrn Vater in der Geschäftsleitung ablöse. Was ich allerdings nicht möchte.«
»Das fällt dir reichlich spät ein.«
»Ich hab’s ja auch erst allmählich begriffen. Bei den langen Spaziergängen mit diesem … Sklaventreiber hier.« Er sah Max halb anklagend, halb dankbar an. »Weißt du, mein Herz ist immer noch in Afrika. Es sind schlimme Dinge passiert, ja. Aber das Land, die Weite, das Klima, die Mentalität der Menschen, die Möglichkeiten dort … Es ist schwer, das in Worte zu fassen.«
»Hast du’s Papa schon gesagt?«
»Nicht in dieser Deutlichkeit«, gestand er. »Ich glaube sogar, dass meine Melancholie oder wie immer man das nennen will, was mir die Seele verdüstert hat, damit zusammenhängt.«
»Puh!« Grete kannte aus eigener Erfahrung das Gefühl, den Eltern eine tiefe Enttäuschung zuzufügen. Es schmerzte sehr. »Da steht dir was bevor.«
»Ich fürchte, du hast recht«, sagte Hans-Heinrich leise. »Und ich hoffe auf deinen Beistand.«
Hilflos hob Grete die Schultern. »Mit mir reden sie doch gar nicht mehr. Was kann ich schon tun?«
»Maman kriegt immer eine zittrige Stimme, wenn sie von dir spricht«, vertraute er ihr an. »Ich habe ihr auch geschrieben, dass du ein Kind erwartest. Man müsste ihr nur eine goldene Brücke bauen. Sie würde dir zu gerne verzeihen.«
Im Inselsalon
Juli 1920
»Seit Monaten liegt meine Frau mir in den Ohren«, dröhnte Lübbo, jener Nachbar, der auf ihrer Hochzeit Akkordeon gespielt hatte, »ich soll mir endlich den Schnauzbart abnehmen lassen.«
Frieda musste lächeln. Sie und Paul hatten eine Wette abgeschlossen, wann es wohl so weit sein würde, nachdem sie seiner Frau Agnes vorgeschwärmt hatte, wie gut Küsse ohne kratzige Barthaare schmeckten.
»Gut, Lübbo, wird erledigt.« Paul legte ihm den Frisierumhang um. »Und wenn’s dir nicht gefällt – wächst ja nach.«
»Wie geht’s eurem Jüngsten?«, erkundigte sich Frieda. Der kleine Lambertus hatte im vergangenen Jahr wegen Unterernährung um sein Leben gekämpft.
»Der Bursche tobt wieder rum wie ’ne Seerobbe.«
»Wunderbar, das freut mich«, sagte Frieda. »Und sonst so?«
Lübbo erzählte von seiner Arbeit für ein ausländisches Schiff, das wegen – seit dem Krieg immer noch – fehlender Seezeichen vor der Insel auf Grund gelaufen war.
»Die hatten Säcke mit Mandeln an Bord. Die Havarieschäden sind natürlich alle ordnungsgemäß gemeldet worden.« Er senkte die Stimme. »Aber falls ihr mal Mandeln braucht … ’n paar sind bei der Bergung irgendwie danebengegangen.«
»Gut zu wissen«, antwortete Frieda augenzwinkernd. Sie verriet ihm nicht, dass Agnes ihr schon vor Tagen eine große Tüte mit Mandeln im Tausch gegen eine Flasche mit wohlriechendem Shampoo gegeben und dass sie am Morgen drei Backbleche voller herzförmig ausgestochener Mandelkekse gebacken hatte. Versehentlich stieß sie gegen Pauls Rücken. »Oh, tut mir leid«, murmelte sie.
»Alles gut, nix passiert.«
Er drehte sich um, strich zur Beruhigung kurz über ihren Arm, was jedoch im Gegenteil kleine Schauer in ihr auslöste. Sie hoffte, dass er es nicht bemerkte.
Schnell bat sie eine wartende Kundin in den Damensalon. Es handelte sich um eine jüdische Insulanerin, die häufiger die Synagoge in der Schmiedestraße aufsuchte als den Inselsalon. Sie trug, wie bei verheirateten orthodoxen Jüdinnen üblich, eine Perücke. Ihre war altmodisch frisiert, schimmerte aber in einem hübschen Kastanienbraun.
»Meine Scheitelmacherin in Norden ist krank«, sagte sie. »Vielleicht können Sie die Perücke auffrischen und mein Haar kurz scheren. Das macht sonst eigentlich immer meine Schwägerin bei uns zu Hause. Allerdings ist die verreist, und es wird mir jetzt im Sommer zu warm mit dem wachsenden Haar unter der Perücke.«
»Selbstverständlich«, antwortete Frieda höflich, während sie den Vorhang der Kabine zuzog. »Möchten Sie die Perücke hierlassen? Haben Sie noch eine?«
»Ja, in meiner Einkaufstasche. Ich möchte Sie aber bitten, direkt auf meinem Kopf auszuprobieren, ob man diese hier etwas moderner umfrisieren könnte. Verstehen Sie? Damit wir gleich sehen können, ob’s mir auch steht …«
»Ja, natürlich, sehr gern. Wir finden eine schöne neue Frisur, und dann lassen Sie die Perücke einfach zur Reinigung hier.«
»Fein.« Während ihr kurzes brünettes, von grauen Strähnen durchzogenes Haar noch weiter gekürzt wurde, blätterte die Kundin in einem Magazin für Damen. Ab und zu schaute auch Frieda auf die Seiten. In einem Feuilleton, das offenbar besonders fesselnd geschrieben war, ging es um die ehelichen Pflichten. Als sich ihre Blicke im Spiegel trafen, war es Frieda etwas peinlich, beim Mitlesen ertappt zu werden, ausgerechnet bei diesem Thema. Doch die Kundin lächelte nur. »Das ist in unserer Religion keine Sünde«, sagte sie milde, »sondern Verpflichtung und Freude. Einmal in der Woche, jeden Freitagabend zum Sabbatbeginn, sollte man. So sagen unsere Vorschriften.« Frieda konnte ihr Erstaunen kaum verbergen, und das Lächeln ihrer Kundin vertiefte sich. »Davon haben viele falsche Vorstellungen. In der Ehe schmiedet es doch Mann und Frau zusammen. Das ist, wie wenn man Jacke und Hose zusammenheftet, oder? Ein Anzug hält einfach besser.«
Frieda lächelte zurück. Und die Kundin beschäftigte sich wieder mit ihrer Lektüre.
Frieda dachte an Paul. Seit Monaten umschlichen sie einander, scheuten die Zweisamkeit zu Hause. Fast jeden Abend waren sie unterwegs, zu Vereinsversammlungen oder bei Freunden und Verwandten, um ihn weiter einzugemeinden. Er trieb viel Sport. Bei gutem Wetter zeigte sie ihm die schönsten Winkel der Insel.
Entgegen ihrer Erwartung hatte er sie aber nie wieder so geküsst wie am Tag ihrer Hochzeit, als sie geglaubt hatte, der schneebedeckte Rasen unter ihren Füßen müsste schmelzen. Sie war ja durchaus nicht abgeneigt. In Gedanken hatte sie schon durchgespielt, wie sie Paul beim nächsten Mal großzügig signalisieren würde, dass sie bereit wäre für mehr.
Ein Blick würde wohl reichen, oder? Aber vielleicht sollte sie auch besser laut und deutlich Ja sagen. Oder wäre es schicklicher, es nur zu hauchen? Hoffentlich glaubte er am Ende nicht etwa, er bräuchte ihr Einverständnis schriftlich. Wie unromantisch und lusttötend wäre das!
Andererseits war sie so viele Jahre ohne es ausgekommen. Die Woche mit Joseph, Lissys leiblichem Vater, war inzwischen derart glorreich überstrahlt, dass sie sich gar nicht mehr richtig erinnern konnte, wie es eigentlich gewesen war. Und der Akt gegen ihren Willen mit Hilrich, nein, daran wollte sie sich nicht erinnern. Manchmal dachte sie schon, am besten wäre es, überhaupt nichts zu wollen und zu erwarten. Doch dann machte Grete manchmal Andeutungen, wie überirdisch schön und erfüllend sie diesen Teil ihrer Ehe erlebte. Andererseits – Grete und Max liebten sich. Sie und Paul waren nicht mal verliebt ineinander.
In was für eine verzwickte Situation hatte sie sich nur mit diesem Ehevertrag hineinmanövriert! Grundsätzlich stand sie natürlich weiter dazu. Aber so rein praktisch auch irgendwie wieder nicht.
Sie hatte mit Grete über ihr Dilemma gesprochen. »Es ist nicht einfach mit der Gleichberechtigung«, hatte ihr die Freundin bestätigt. »Wir müssen quasi den Sprung aus dem vergangenen Jahrhundert in die Zukunft machen, und dabei möchten wir auch bitte noch anmutig aussehen.« Ein bisschen hatte Grete sie sogar aufgezogen. »Was machst du, wenn er nicht will? In eurem Vertrag steht ausdrücklich, dass beide einverstanden sein müssen.«
Frechheit! Frieda hatte ihr die Zunge rausgestreckt. Erstens wollten Männer immer, und zweitens: Einen normal gepolten Mann, der sie nicht wollte, den gab’s doch gar nicht. Oder etwa doch? Hatte sie womöglich ausgerechnet den geheiratet? Je länger Paul und sie umeinander herumscharwenzelten, desto unsicherer wurde sie. Er schlief in Hilrichs früherem Zimmer neben dem Bad, und manchmal stand seine Tür offen. Anfangs hatte sie noch gedacht, dass sie zur Not einfach die ewige Eva in sich gewähren lassen sollte. Sie kannte schließlich alle, na gut, die meisten weiblichen Tricks. Grete hatte auch gemeint, ihr würde schon was einfallen. Aber das ging Frieda gegen den Strich, es weckte ihren Widerspruchsgeist. Obwohl sie manchmal nicht ganz widerstehen konnte und Paul bat, ihr eine Halskette im Nacken zu schließen oder ein Kleid im Rücken zuzuknöpfen. Ohne nennenswerten Erfolg.
Nüchtern betrachtet, könnte sie ihn einfach fragen: Ich möchte jetzt gern, wie sieht’s bei dir aus? Das erschien ihr jedoch reichlich verwegen. Was, wenn er gerade nicht in Stimmung war? Sie wollte sich auf keinen Fall einen Korb holen.
Wenn er nur ein Abenteuer hätte sein können und wie ein Kurgast die Insel bald wieder verlassen würde, wäre sie risikofreudiger gewesen. Schließlich – wenn sie sich selbst half, eine gewisse Anspannung loszuwerden, sehnte sie sich einfach nach einem Mann, einem richtigen Mann. Da waren ihr romantische Gefühle schnurzpiepegal. Aber angenommen, der intime Kontakt mit Paul endete in einer Katastrophe, dann wäre sie ja anschließend immer noch mit ihm verheiratet, und er lebte weiter mit im Haus. Das musste alles bedacht werden.
Sobald er ein wenig getrunken hatte, wurde er lockerer. Doch er trank nie so viel, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hatte, was sie letztlich natürlich auch sehr schätzte. Beschwipst nahm er sie durchaus mal in den Arm und liebkoste sie ein wenig. Gemeinerweise oft vor den Augen anderer. So musste er schon aus Gründen des Anstands abbrechen, bevor es richtig spannend wurde. Zu Hause verhielt er sich überaus korrekt. Frieda schüttelte den Kopf. In ihrem ganzen Leben hatte sie sich noch nie über ein Thema so viele Gedanken gemacht.
Abgesehen von diesem unbefriedigenden Aspekt aber war sie ganz zufrieden mit ihrer Wahl. Die Atmosphäre im Inselsalon hatte sich verändert. Noch immer kamen früh am Morgen die vier Stammkunden, die sich schon seit einer Ewigkeit jeden Morgen rasieren ließen und dabei die aktuelle Lage der Welt und der Insel kommentierten. Inzwischen waren sie alte Männer. Auch im Salon spürte man, dass eine ganze Generation fehlte. Über hundertfünfzig Söhne Norderneys hatten im Großen Krieg ihr Leben gelassen. Und die meisten der Heimgekehrten hatten ihre Gesundheit, ihren Seelenfrieden, ihre Leichtigkeit verloren. Die Älteren, die Zurückgebliebenen waren verbittert. Sie fühlten sich um den Lohn ihrer Lebensleistung betrogen und wie wohl jeder Deutsche durch den Schmachfrieden erniedrigt. Nicht nur das Porträt des Kaisers im Verkaufsraum fehlte inzwischen, auch das Flair seiner Epoche war unwiederbringlich dahin.
Theo, der Redakteur der Inselzeitung und Jüngster im Quartett, trug nach wie vor das Haar zurückgekämmt wie August Bebel und einen Spitzbart wie sein Vorbild, das einst die Sozialdemokratische Partei mitbegründet hatte. Der inzwischen ergraute, früher blonde Hüne Onno Remmers schien geschrumpft zu sein, seit er sein Hotel hatte verkaufen müssen, um einer Zwangsversteigerung zuvorzukommen. Ebenso wie der Älteste, der erzkonservative, aber herzensgute Tabakwarenhändler Jan Gerdes legte Onno weiter großen Wert auf seinen hochgezwirbelten Schnurrbart. Der bürgerlich-liberale Kurarzt Dr. Hermann Seut, der Frieda mit seinem Charakterstärke ausdrückenden Bart immer an ein freundliches zerknautschtes Walross erinnerte, hatte seit seiner Gallenoperation sehr gelitten. In ihren Gesprächen schwangen statt der heiteren, gutmütigen Selbstzufriedenheit von einst in diesen Tagen häufig Schmerz und Enttäuschung mit. Da war es klüger, man sprach über Unverfängliches.
Und nun arbeitete Paul im Inselsalon. Er war jung, er verbreitete Lebensfreude und Zuversicht. Statt auf einen politischen Streitpunkt einzugehen, lenkte er gern das Gespräch auf sein Lieblingsthema, den Sport.
»Lassen Sie mich Ihr Profil ansehen«, bat Frieda, nachdem sie der jüdischen Insulanerin die Perücke wieder aufgesetzt hatte.
Sie löste das ondulierte Haar, kämmte es durch und steckte es anders, nicht mehr hoch auf dem Wirbel zu einem runden Knoten, sondern am Hinterkopf längs gesteckt wie eine Banane. Diese Variante gefiel der Kundin. Als Frieda die Frau verabschiedet hatte, kam ihre Schwiegermutter in den Salon.
»Du musst los«, mahnte sie mit einem Blick auf die Uhr. »Du sollst doch das Komitee im Seehospiz bewirten helfen.«
»Ach herrje«, antwortete Frieda, »das hätte ich beinahe verschwitzt. Danke!« Sie schaute in die halb volle Warteecke. »Ihr kommt ohne mich klar, nicht?«
Ihre Schwiegermutter nickte nur. Frieda zog schnell den Kittel aus, machte sich etwas frisch und schlüpfte in ihre Ausgehjacke. Sie schnappte sich die Blechdose mit den Mandelherzkeksen und eilte zum Seehospiz. Dort waren bereits die anderen Helferinnen versammelt, die Grete aus ihrer Turngruppe zusammengetrommelt hatte, um Kaffee und Tee zuzubereiten. Sie winkten ihr zu – Katharina, die beiden Kapitänstöchter Hetty und Netty, die alte Badefrau Herta, ihre Schulfreundin Lieske, die inzwischen als Hausschneiderin die Familienkasse aufbesserte, und Emmi Behrends vom Hotel Behrends.
Grete
»Die Veranden könnte man auch zumauern«, meinte einer der Herren, die zum Komitee gehörten.
Als sie anfingen, ausführlich die Vor- und Nachteile einer solchen baulichen Veränderung zu erörtern, schweiften Gretes Gedanken ab. Ihre Eltern hatten es seit ihrer Ankunft nicht für nötig erachtet, sie über ihren Aufenthalt auf Norderney zu informieren. Geschweige denn, sie einzuladen oder sonst irgendwie ein Treffen mit ihr zu planen.
»Ruf doch einfach im Hotel an und bitte sie um ein Wiedersehen«, hatte Hans-Heinrich vorgeschlagen, »oder gib am Empfang eine Karte ab.«
»Phh! Auf gar keinen Fall«, hatte sie trotzig erwidert. »Nach dem Rausschmiss im vergangenen Jahr in Berlin? Da müssen sie schon auf mich zukommen.« Immer noch stieg Groll in ihr auf, wenn sie daran dachte. Andererseits fehlte ihr der Kontakt, besonders, seit sie wusste, dass sie schwanger war und sie ihrer Mutter gerne viele Fragen gestellt hätte.
Die Lehmanns befanden sich bereits seit einer Woche auf der Insel. Grete hoffte, dass sie wenigstens ihren Bruder Eduard mit Frau und Kindern zu Gesicht bekommen würde.
»Wünschenswert wäre auch ein modernes Labor im neuen Seehospiz«, hob nun ein anderer Mann hervor. Max pflichtete ihm bei.
Gretes Handrücken juckte. Wahrscheinlich lag es daran, dass sie ihre eigens für diesen Anlass hervorgekramten Glacéhandschuhe im Benzinbad hatte reinigen lassen. Aber das war jetzt unwichtig. Sie drehte leicht ihren eleganten Hut in Position, strich über den offenen Sommermantel, der wie das Umstandskleid nicht mehr verbergen konnte, dass sie guter Hoffnung war, und konzentrierte sich auf die Gegenwart. Die Witwe von Dr. Hartmann, dem einstigen ärztlichen Direktor des Seehospizes, der in Belgien gefallen war, und sie waren die einzigen Frauen in der Norderneyer Abordnung, welche die Kommission bei der Begehung begleitete. Erneut versuchte sie, näher an den Reichstagsabgeordneten heranzukommen, um den sich alle scharten.
Dieser Mann von vielleicht Anfang vierzig strahlte eine auffallende Autorität aus. Dabei war er nicht besonders groß. Sein glänzender Quadratschädel trug nur noch einen spärlichen Haarkranz, ein unscheinbares Bärtchen zierte die Oberlippe. Er hatte etwas hervortretende Augen und einen klaren, durchdringenden Blick. Man spürte gleich, dieser Mensch verfügte über Intelligenz und Horizont. Wenn sie ihn davon überzeugen konnten, dass das Seehospiz wieder eine Erholungsstätte für kranke Kinder werden musste, hatten sie gewonnen.
Doch die Honoratioren der Insel belegten den Mann aus Berlin mit Beschlag. Und die Witwe Hartmann redete immerzu auf sie ein und ließ sie nicht aus ihrer gut gemeinten Obhut.
»Als ich damals schwanger war …«, begann sie von Neuem.
Grete hörte nicht hin. Sie war betroffen vom Ausmaß der erforderlichen Reparaturen. Das alte Kesselhaus, das sie gleich am Anfang besichtigt hatten, musste komplett erneuert werden. Auch viele andere Vorrichtungen waren defekt. Max steuerte immer wieder Beispiele über die unvergleichliche Wirkung des Klimas auf die Gesundheit bei, vor allem in Verbindung mit fortschrittlichen Therapien wie der Atemgymnastik, die sie hier vor dem Krieg erprobt hatten.
»Medizin und Meteorologie …«, setzte er gerade wieder an.
Grete hörte einen Mann dagegenreden, er vertrat einen Großinvestor, der das Hospiz zu einem Kur-Grandhotel ausbauen wollte. Ein anderer Herr meinte, es sei doch auch denkbar, eine Lehranstalt, »ein Internat oder ein Fortbildungszentrum«, in dem Komplex einzurichten.
Als sie das Hauptgebäude betraten, wurde Grete von Erinnerungen überwältigt. Sofort meinte sie, wieder die typische Mischung aus Kampfer und Desinfektionsmitteln zu riechen. Entscheidende Jahre ihres Lebens hatte sie hier verbracht, erst als blutjunge Patientin, dann als Schwester.
Sie gab sich einen Ruck und schob sich durch die Phalanx der wichtigen Herren. Als sie schon fast auf Tuchfühlung mit dem Reichstagsabgeordneten war, der sie, wie sein offener interessierter Blick verriet, nun auch wahrnahm, drängte sie jemand vom »Verein der Kinderheilstätten an den deutschen Seeküsten« zur Seite und öffnete die Tür, die hinaus auf die offene, efeuumwucherte Veranda führte. Und dann hakte sich die Witwe Hartmann bei ihr ein, zog sie an die Brüstung, zeigte auf die Direktorenvilla, in der sie früher mit ihrem Mann gelebt hatte, und schwelgte wortreich im Angedenken an ihn. Es war zum Verzweifeln!
Grete unterdrückte ein Aufstöhnen. Sie kam einfach nicht ran an den Reichstagsabgeordneten. Da fiel ihr Blick auf eine Frauengestalt, die sich hastig dem Hospiz näherte. Es war Frieda. Rettung nahte.
Frieda
Der Plan bestand darin, der Kommission während des – im Protokoll vorgesehenen – Spaziergangs durch die Kiefernschonung zum Strand an der Bank, wo sich früher die Hospizschwestern nach Feierabend getroffen und gesungen hatten, eine kleine Erfrischung anzubieten. Kaffee, Tee, Waffeln und Mandelkekse. Das war Gretes Idee gewesen. »Eine kleine angenehme Überraschung nur. Nichts Großes. Sie gehen anschließend sowieso ins Café Lehmkuhl.« Das Café des einst Königlichen Hofkonditors Hoegel im kleinen Logierhaus hatte gerade den Besitzer gewechselt. Otto Lehmkuhl würde sich ordentlich ins Zeug legen, um die Herrschaften zufriedenzustellen. »Aber meine liebe Frieda«, hatte ihre Freundin sie beschworen, »du musst unbedingt in der Nähe sein, wenn die Begehung stattfindet. Egal, was du machst, sei einfach nur da und stimm die Götter gnädig!«
»Ich weiß wirklich nicht, was ich tun könnte«, hatte Frieda abgewehrt, sich auf Gretes Drängen hin aber doch bereit erklärt, mitzuhelfen und Kekse beizusteuern.
Dieser Julitag hätte wirklich freundlicher sein können, dachte sie, als sie nun den anderen Frauen zuwinkte. Es war windig, es sah nach Regen aus. Die Frauen begaben sich in die provisorisch eingerichtete Küche.
Katharina schaute aus dem Fenster. »Da sind sie!«
Sie machte eine Kopfbewegung in Richtung Hauptgebäude. Die Verantwortlichen des Seehospizes, der Vorsitzende des Trägervereins und dessen Kurator, außerdem der Bürgermeister, der neue Badedirektor, der früher Kapitän gewesen war, die Witwe des letzten ärztlichen Direktors, ein paar ihr unbekannte Herren sowie Grete und Max bewegten sich gemessenen Schrittes auf der Veranda des Hauptgebäudes. Dann gingen sie wieder hinein, spazierten wohl durch den großen Saal und etliche Nebenräume, kamen wieder ins Freie, um jeden der Backsteinpavillons einzeln zu inspizieren.
»Sie müssen auch noch ins ehemalige Spielhaus«, wusste Lieske, die ihre wunderschöne rotblonde Naturkrause zu Friedas Bedauern, wie die meisten Fischerfrauen schlicht verknotet trug. Mit ihr zusammen brachte sie die Kannen hinaus zur Bank, neben der schon zwei weiß gedeckte Tische im Dünensand standen. Die Waffeln und Kekse ordneten sie ansprechend auf Etageren und Tellern an. »Dr. Lubinus hält noch einen kleinen Vortrag über die Heilerfolge.«
Frieda nickte. Sie wusste, dass Grete ihren Mann und den Bürgermeister auf die Idee dazu gebracht hatte. »Poppe Folkerts, der Maler, macht es doch vor«, hatte Grete Max erklärt. »Er zeigt den Insulanern mit seinen Gemälden, was das Besondere an Norderney ist. Genau das musst du auch machen, mit deiner Kunst eben. Dann werden sie dich zu schätzen lernen.«