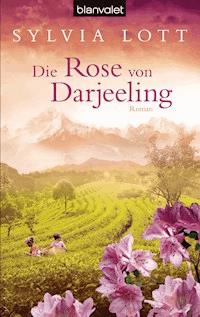9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Norderney-Reihe
- Sprache: Deutsch
Dramatische Zeiten für die Frauen vom Inselsalon! Doch ihr Zusammenhalt ist und bleibt ungebrochen …
Norderney, 1935 bis 1955: Nach einem Schicksalsschlag hat Lissy auf ihrer Heimatinsel Zuflucht gefunden. Aber nur zögernd kann sie sich wieder für ein neues Glück öffnen. Ihre uneheliche Tochter Marina ist ein fröhliches, unkompliziertes Kind und rührt zu gern im Salon Farben an. Während des Kriegs gelangte sie 1941 als Zwölfjährige mit der Kinderlandverschickung nach Österreich. Mit Resi, ihrer neuen Freundin, sammelt sie für deren Mutter Heilpflanzen, aus denen Cremes und Tees bereitet werden. Zurück auf der Insel wird auch Marina Friseurin. Nach dem Krieg, als Norderney Erholungszentrum für britische Soldaten und ein Schmugglerparadies wird, mixt sie eigene Pflegeprodukte und verkauft sie auf dem Schwarzmarkt. Ihr Freund Siebo hilft ihr dabei. Doch als bei einer großen Polizeirazzia das Conversationshaus umstellt wird, droht Ungemach …
Die Norderney-Saga von Sylvia Lott:
Die Frauen vom Inselsalon
Sturm über dem Inselsalon
Goldene Jahre im Inselsalon
Neue Träume im Inselsalon
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Norderney, 1935 bis 1955: Nach einem Schicksalsschlag hat Lissy auf ihrer Heimatinsel Zuflucht gefunden. Aber nur zögernd kann sie sich wieder für ein neues Glück öffnen. Ihre uneheliche Tochter Marina ist ein fröhliches, unkompliziertes Kind und rührt zu gern im Salon Farben an. Während des Kriegs gelangt sie 1941 als Zwölfjährige mit der Kinderlandverschickung nach Österreich. Mit Resi, ihrer neuen Freundin, sammelt sie für deren Mutter Heilpflanzen, aus denen Cremes und Tees bereitet werden. Zurück auf der Insel wird auch Marina Friseurin. Nach dem Krieg, als Norderney Erholungszentrum für britische Soldaten und ein Schmugglerparadies wird, mixt sie eigene Pflegeprodukte und verkauft sie auf dem Schwarzmarkt. Ihr Freund Siebo hilft ihr dabei. Doch als bei einer großen Polizeirazzia das Conversationshaus umstellt wird, droht Ungemach …
Autorin
Die Autorin Sylvia Lott ist gebürtige Ostfriesin und lebt in Hamburg. Viele Jahre schrieb sie für verschiedene Frauen-, Lifestyle- und Reisemagazine, inzwischen konzentriert sie sich ganz auf ihre Romane, die regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste zu finden sind. Bei der Recherche zu einem ihrer Romane faszinierte sie die glanzvolle und wechselhafte Geschichte Norderneys, und die Idee entstand, eine mehrbändige Saga zu schreiben. Nach »Die Frauen vom Inselsalon«, »Sturm über dem Inselsalon« und »Goldene Zeiten im Inselsalon«, ist »Neue Träume im Inselsalon« das lang erwartete Finale der Reihe um einen Friseursalon auf Norderney während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
SYLVIA LOTT
Neue Träume im Inselsalon
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 der Originalausgabe
by Blanvalet, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Margit von Cossart
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: George Marks/Retrofile RF/Getty Images; www.buerosued.de
Umschlaginnenseite hinten:
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Norderney Chronik, www.norderney-chronik.de: Bild 1 – Postkarte, Nordstrand 1956, Bild 2 – Tracht 1938, Bild 4 – Werbeplakat 1956, Bild 5 – Badestrand 1937
Ullstein Bild: Bild 3 – modische Frisur (Joffe); Bild 6 – Frisuren Dauerwellenapparat (James E. Abbe)
LH · Herstellung: sam · lor
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-25798-9V003
www.blanvalet.de
Die Hauptpersonen rund um den Inselsalon
Frieda Merkur, geborene Dirks, verwitwete Fisser
Frieda, aufgewachsen als Tochter eines Fischers und einer Badedienerin, hält die Familie zusammen und führt mit großem Engagement gemeinsam mit ihrem zweiten Ehemann Paul den angesehenen Inselsalon. Die Mittvierzigerin geht immer mit der Zeit – ihr Salon soll dem internationalen Vergleich standhalten können. Trotz wiederkehrender Sorge um ihre Familie bleibt sie stets optimistisch.
Lissy Fisser
Friedas Tochter, die attraktive Lissy, ist mit einem unehelichen Kind aus Berlin nach Norderney zurückgekehrt und arbeitet wieder im familieneigenen Inselsalon. Sie liebt ihre Marina über alles, von der großen weiten Welt allerdings kann sie nur noch träumen. Lissy braucht viel Zeit, um den Unfalltod ihres Geliebten Ivo Sartorius zu verwinden. Doch das Wickwief, die Hellseherin der Insel, hat ihr prophezeit: Du wirst wieder glücklich werden.
Paul Merkur
Der Lüneburger mit einer Vorliebe für Sprichwörter ist mittlerweile verwurzelt auf der Insel, wo man ihn als Friseur, Puppendoktor und Vereinskameraden schätzt. Mit Frieda und ihrem gemeinsamen Sohn Bonno genießt er ein harmonisches Leben.
Marina Fisser
Lissys Tochter Marina ist ein fröhliches kleines Mädchen, das seine Großmutter Frieda besonders liebt. Sie möchte unbedingt ein Kätzchen. Es gibt nur eines, was sie sich noch mehr wünscht, und das ist ein Papa.
Grete Lubinus, geb. Lehmann
Friedas beste Freundin Grete, die aus einer Berliner Unternehmerfamilie stammt und sich einst mit ihren Eltern überwarf, weil sie SPD-Mitglied wurde, ist glücklich verheiratet mit dem Inselarzt Dr. Max Lubinus. Ehrenamtlich kümmert sich die Mutter von Lubi, Wally und Siebo auch noch um kranke Kinder im Seehospiz. Zunehmend machen ihr jedoch die Nationalsozialisten das Leben schwer.
Dr. Max Lubinus
Der vertrauenerweckende und charmante Inselarzt, ein Anhänger der Reformbewegung, ist eigentlich der perfekte Ehemann, er gerät aber schwer in Versuchung, als eine hübsche, intelligente Verlegertochter zur Kur auf die Insel kommt und ihn ausdauernd anhimmelt.
Joseph Graf Ritz zu Gartenstein
Der österreichische Adlige, der einst Friedas Herz höherschlagen ließ, hat Norderney vor langer Zeit verlassen, um eine reiche Erbin zur Frau zu nehmen. Er musste eine gute Partie machen, um seine verarmte Familie vor dem Bankrott zu bewahren. Aus Friedas Gedanken ist er allerdings nie verschwunden.
Erwin Eils
Er hat im Inselsalon gelernt, wurde aber wegen seiner Lügen und Aufschneiderei von Frieda gefeuert, was er ihr nie verziehen hat. Inzwischen ist er mit der Klatschbase Minna verheiratet und betreibt einen Konkurrenzsalon. Ebenso hinterhältig wie missgünstig denkt er sich weiter Fiesitäten aus, um Frieda, Paul und Lissy zu schaden.
Jantje, das Wickwief
Die Witwe lebt allein in einem Häuschen in den Dünen. Sie gilt als Wahrsagerin, liest aus Teeblättern die Zukunft und hat manchmal Visionen. Weil ihre Zauber und Rituale schon vielen Insulanern geholfen haben, genießt sie allgemein Respekt. Zu Frieda hat das Wickwief eine ganz besondere Beziehung, wurde sie doch unter einer Glückshaube geboren.
Monde und Jahre vergehen, und sind auf immer vergangen, aber ein schöner Moment leuchtet das Leben hindurch.
Franz Grillparzer (1791 – 1872)
Norderney Im Inselsalon
Sommer 1935
»Da is’ wieder der Kerl, der nur von Fräulein Fisser bedient werden will«, posaunte Olli breit grinsend in die Küche hinein.
Gerade hatte sich Lissy nach einem turbulenten Morgen im Friseursalon zum Elführtje, dem Elf-Uhr-Tee, neben ihre Mutter an den großen Tisch sinken lassen, an dem noch drei Mitarbeiter pausierten, und Else schenkte ihr einen frisch aufgebrühten Ostfriesentee ein. Die Ankündigung des Lehrlings löste in ihrem Bauch ein eigenartiges Flackern aus, doch sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.
»Danke, Else, den kann ich jetzt wirklich gut vertragen.«
Sie griff nach dem Schwanenlöffel des Sahneschälchens, das in der Tischmitte neben einem Teller mit gebutterten und zuckerbestreuten Zwiebäcken stand, um sich ein Wölkchen in den Tee zu zaubern.
»Oltmann!«, sagte der Altgeselle Etzel vorwurfsvoll, während Lissy den Blick auf das Sahnewulkje gerichtet hielt, das nun in ihrer Tasse explodierte.
In letzter Zeit war häufig ein gut aussehender, wortkarger Urlauber ihr Kunde gewesen. Sie kannte eigentlich nur seinen Namen – Winter. Selbstverständlich behandelte sie ihn wie jeden anderen Kunden. Doch er war nicht wie jeder andere. Zwischen ihnen schwang etwas Besonderes, Verwirrendes.
»Der Mann?«, korrigierte sich Olli unsicher. Etzel sah ihn weiter streng an, und dem Lehrling war anzumerken, dass er fieberhaft überlegte, was er denn bloß schon wieder falsch gemacht hatte. »Der Herr!«, stieß er schließlich erleichtert hervor. »Alle unsere Kunden sind Damen und Herren«, wiederholte er den Satz, den man ihm schon am ersten Tag im besten Friseursalon Norderneys eingebläut hatte, und grinste erneut. »Sogar Ed Lummert und Ida Bort.«
Der Lumpenhändler und die Verkäuferin mit dem Damenbart, zwei Inseloriginale, gehörten zwar nicht zum Kundenstamm der Fissers, doch Etzel nickte zufrieden. Der Enddreißiger war nach dem Krieg selbst als ungeschliffener Jüngling in den Salon gekommen und sah es als seine Aufgabe an, dem Nachwuchs Manieren beizubringen.
»Soll sich gedulden, der Herr«, sagte Lissys Mutter, Frieda Merkur, freundlich, »oder von meinem Mann bedienen lassen.«
Paul war gerade erst gestärkt in den Salon zurückgekehrt. Sie legten ihre Teepausen zeitlich versetzt ein. In der Hochsaison arbeitete eine mehr als zwanzigköpfige Belegschaft in Fissers Friseurbetrieb für Damen und Herren mit angegliedertem Schönheitssalon. Da war es gut, wenn immer einer von der Familie vorn im Laden ansprechbar war.
»Der Meister hat schon wieder Kundschaft«, erwiderte Olli. »Is’ viel los.«
Lissy nahm noch einen Schluck Tee und stand mit einem Ruck auf. »Lass nur, ich komm schon.«
Doch Frieda klopfte auf die karierte Wachstuchdecke. »Nein, bleib. Ich wollte noch was mit dir besprechen.« Sie blickte zu Olli. »Bitte den Kunden um etwas Geduld.«
Der Lehrling verschwand, ohne die Tür ganz zu schließen, und Lissy setzte sich wieder. Im Treppenhaus hörte sie ihre Tochter, die fünfjährige Marina, mit ihrem besten Freund Siebo herumtoben. Siebo war schon acht und hatte Schulferien, deshalb konnte er an diesem Julitag bereits am Vormittag mit ihr spielen.
Eine ungewöhnliche Freundschaft verband die Kinder, seit sie, Lissy, mit dem Säugling auf dem Arm als ledige Mutter aus Berlin nach Norderney zurückgekehrt war. Am Boden zerstört. Ihr geliebter Ivo, Marinas Vater, war durch einen Autounfall ums Leben gekommen – kurz nach dem Schwarzen Freitag, an dem er sein gesamtes Vermögen verloren hatte. Ohne ihre Familie und die Unterstützung von Freunden und Verwandten, überhaupt ohne ihre Insel, das Meer, die Natur, davon war Lissy überzeugt, hätte sie die schreckliche Zeit danach nicht überlebt.
Natürlich waren da auch Insulaner gewesen, die sich die Mäuler zerrissen hatten. Die gab’s immer noch. Allen voran Erwin Eils und seine Frau Minna, die sich moralisch überlegen fühlten und hinter ihrem Rücken auf sie zeigten. Diese Schande, ein uneheliches Kind! Erwin hatte einst bei ihnen gelernt, sein übler Charakter war ihnen aber erst im Laufe der Zeit offenbar geworden. Er hatte die Kaufmannstochter Minna, einer auffallenden Kieferfehlstellung wegen Minna-Überbiss genannt, geheiratet und mit ihrem Erbe einen Konkurrenzsalon eröffnet. Die beiden verbreiteten allzu gern Gerüchte über Lissys angeblich liederlichen Lebenswandel. Nicht genug damit, dass sie in Erwins und Minnas Augen ein gefallenes Mädchen war, nein – statt reumütig in Sack und Asche zu gehen, färbte sie sich seit ihrer Rückkehr aus Berlin auch noch das Haar blond, trug nur reinseidene Friseurkittel und rauchte. Dabei rauchte doch die deutsche Frau nicht, oder jedenfalls nicht mehr.
Lissy war sechsundzwanzig. Sie wurde umschwärmt von Männern, Insulanern wie Badegästen, doch bislang hatte sie keinen erhört. Sie liebte ihre Freiheit. Und das war erst recht skandalös. Man bezichtigte sie des Hochmuts. Der ist doch keiner gut genug, hatte Minna, wie eine Bekannte Lissy zugetragen hatte, erst kürzlich wieder behauptet.
Ihre Mutter wurde nicht müde, anderen Menschen zu erklären, dass sie und Ivo doch geplant hatten zu heiraten. Dass er eine Woche vor dem standesamtlichen Termin ums Leben gekommen war. Dass er sie ja schon lange vorher hatte ehelichen wollen, ihre dickköpfige Tochter Lissy sich jedoch aus Protest gegen die Konventionen monatelang geweigert hatte.
Selbstverständlich sprach ihre Mutter nicht in ihrer Gegenwart darüber. Aber auf einer Insel erfuhr man immer hintenrum, wer wann was über einen gesagt hatte. Und schließlich kannte Lissy ihre Mutter. Ihr war klar, dass der Makel – ein uneheliches Kind in der Familie – sie belastete. Seit Ivos Tod hatte sie ihr deshalb jedoch keinen Vorwurf mehr gemacht, was Lissy ihr hoch anrechnete. Es tat ihr leid, dass ihrer Mutter die Gehässigkeiten von Minna und Konsorten zu schaffen machten, mehr als ihr selbst. Allerdings, wenn sie so wie jetzt an derlei Klatsch dachte, legte sich doch Ärger wie ein dicker dreckiger Feudel um ihren Magen. Blöde Kuh, schalt sie sich selbst, warum verschwende ich überhaupt Gedanken daran? Sollen die Leute doch reden!
Zum Glück gab’s auch andere Kaliber unter den Norderneyern – klare, geradeaus denkende Menschen. Von denen waren sie mit offenen Armen aufgenommen worden. Sie hatten sich liebevoll um sie und ihr Kind gekümmert. Besonders Tant’ Grete, die beste Freundin ihrer Mutter, Ehefrau des Inselarztes Dr. Max Lubinus und Mutter von Siebo. Tant’ Grete, die auf ihren Jugendfotos aussah wie Schneewittchen und immer noch eine schöne Frau war, auch wenn ihr Teint nicht mehr so weiß wie Milch schimmerte. Sie stammte aus einer reichen Berliner Unternehmerfamilie, mit der sie sich überworfen hatte. Man merkte ihr manchmal noch die vornehme Erziehung an, obwohl sie sich seit Jahren für die Reformbewegung und eine freiere Lebensweise begeisterte. Von ihr hatte Lissy sich schon als kleines Mädchen oft besser verstanden gefühlt als von ihrer Mutter. Tant’ Grete hatte selbst drei Kinder – den vierzehnjährigen Lubi, Wally, die gerade dreizehn geworden war, und eben Siebo.
Das Nesthäkchen Siebo hatte damals sofort sein Herz für die süße kleine Marina entdeckt und es genossen, endlich der Große, ein Beschützer sein zu können. Und obwohl er sich mittlerweile in einem Alter befand, in dem Jungen normalerweise Mädchen doof fanden, konnte nichts seine Zuneigung trüben. Die Kinder alberten immer lauter im Flur herum.
»Dass ihr mir nicht mit meinen Hüten spielt!«, rief ihre Mutter in Richtung Tür.
»Was wolltest du besprechen?«, fragte Lissy und nahm noch einen Schluck Tee.
Die Altgesellen Etzel und Heye sowie Holger, ein Friseurgehilfe vom Festland, der nur die Saison über bei ihnen arbeitete, erhoben sich und gingen in den Garten, um dort eine Zigarette zu rauchen. Else werkelte ungerührt weiter am Spülbecken. Sie kannte mehr Familiengeheimnisse als Lissy und ihre Mutter zusammen, denn sie war, schon gleich nachdem sie die Volksschule verlassen hatte, von den Salongründern eingestellt worden, von Lissys Großeltern Fritz und Jakomina Fisser. Beide lebten nicht mehr. Ebenso wenig wie deren einziger Sohn Hilrich – ihr Vater, der erste Ehemann ihrer Mutter, der im Großen Krieg gefallen war. Die Lücke, die er hinterlassen hatte, spürte sie noch immer jeden Tag. Besonders schmerzte es sie, dass ihrer Tochter das gleiche Schicksal widerfuhr wie ihr und auch sie ohne Vater aufwachsen musste.
Aber wenigstens hatte Marina jede Menge Spielkameraden. Und zum Glück hatte sie nicht ihre zuweilen etwas grüblerische Art geerbt, sondern das sonnige Gemüt ihrer Großmutter Frieda.
Frieda wusste, dass sie ihr Vorhaben behutsam angehen musste. »Deine Freundin Mia aus Berlin macht doch gerade Ferien auf der Insel«, begann sie und schaute durchs Fenster hinaus. »Es klart auf, heut Nachmittag werden wir das schönste Badewetter haben. Da kommt nicht viel Laufkundschaft, und die Anmeldungen schaffen wir auch ohne dich. Geh doch mit Mia an den Strand.«
»Meinst du wirklich?« Lissy sah ihre Mutter zweifelnd an. »Aber wenn wenig los ist, kann ich dir endlich die neue Frisur machen.«
Lissy trug ihr Haar seit einem Schulungskurs in Oldenburg bereits nach dem letzten Schrei, wie vom Pariser Coiffeur Guillaume als »Engelfrisur« entworfen. Es fiel bis zur Hutlinie glatt und glänzend, wirkte dadurch am Hinterkopf fast wie ein Spiegel, weshalb manche von der Spiegelfrisur sprachen, und sprang ums Gesicht herum in einem Kranz sanfter Locken auf. Das schmeichelte ungemein. An diesem Tag hielt ein feiner Reif Lissys Haar zurück, manchmal bürstete sie es auch aus der Stirn. Ob Lilian Harvey, Camilla Horn oder Marlene Dietrich – alle großen Filmstars zeigten sich inzwischen in diesem weichen weiblichen Stil. Viele Männer kommentierten mit Erleichterung und Spott, dass »der grässliche Bubikopf« aus der Mode kam.
Frieda trug ihr flachsblondes Haar seit Jahren vom Seitenscheitel aus in handgelegten Wasserwellen und ohrläppchenkurz. Nun hatte sie es allerdings bis zum Kinn wachsen lassen für die neue Frisur. Natürlich musste sie modisch immer ein Beispiel geben. Schon ihr Schwiegervater, der alte Fritz Fisser, hatte gesagt: »Die Frauen vom Inselsalon sind unsere beste Reklame.« Sie freute sich auch durchaus auf die Veränderung, mit Mitte vierzig musste man ja nicht aufhören, sich schön zu machen. Aber an diesem Sommertag verspürte sie so gar keine Neigung, sich unter den Dauerwellapparat zu setzen. Da mochte der neue »Junior« von Wella, den sie kürzlich angeschafft hatten, noch so angenehm und leicht zu bedienen sein. Der Verkäufer hatte ihnen versichert, es gäbe damit praktisch keinen Kurzschluss und keine Verbrennungen mehr.
Kurz nach dem Weltkrieg hatte Frieda mit dem ersten Bubikopf auf Norderney Furore gemacht und später für ihre Haarkunst bei Wettbewerben jede Menge Auszeichnungen errungen. Sie war die leidenschaftlichere Friseurin von ihnen beiden. Nur hatte sie neulich, als die Schulung in Oldenburg stattfand, nicht fahren können, weil ihr Sohn Bonno die Windpocken hatte, und deshalb Lissy entsandt.
Dafür kannte ihre Tochter sich auf kosmetischem Gebiet besser aus. In Berlin hatte sie sogar Erfahrungen als Maskenbildnerin beim Film gesammelt. Aber selbstverständlich sprang sie im Familienbetrieb überall ein, wo sie gebraucht wurde. So wie neulich im Herrensalon, als gerade kein männlicher Kollege Zeit gehabt hatte, einen gut aussehenden, schweigsamen Herrn zu bedienen. Den hatte Lissy dann eben übernommen. Er war von Kopfschmerzen geplagt gewesen, die sich während des Besuchs im Salon gelegt hatten.
»Auf einen Tag mehr oder weniger kommt’s mir mit der neuen Frisur wirklich nicht an«, betonte Frieda. »Nutzt lieber das schöne Wetter. Bald muss Mia wieder zurück in die Stadt.« Ihr ging noch was ganz anderes im Kopf herum. Schon vor knapp sechs Jahren, als sie Lissys damalige Kollegin Mia in Berlin kennengelernt hatte, war es ihr vorgekommen, als könnte diese patente, fröhliche Frau – ein paar Jahre älter als Lissy, klein und auf eine appetitliche Art mollig –, genau die Richtige sein für ihren Bruder Dodo. Doch dann hatten sich die Ereignisse überschlagen, und es hatte sich keine Gelegenheit mehr ergeben, die Idee weiterzuverfolgen. Jetzt witterte Frieda eine neue Chance. Seit einer enttäuschten Liebe hatte Dodo Probleme mit Frauen, und langsam ging er auf die fünfzig zu. »Danach bringst du Mia mit zum Abendessen. Ich würde …«
In diesem Moment stieß Else einen schrillen Schrei aus und sprang auf einen Tritt. »Iiihh! Eine Maus!«
Frieda schlug eine Hand vor den Mund, auch Lissy konnte sich das Lachen kaum verkneifen. Elses Angst vor Mäusen war legendär. Ihre Haushälterin fürchtete nichts und niemanden, zupfte seit Jahrzehnten tapfer gegen ihre wuchernden Augenbrauen an, sie nahm jeden Fisch aus, ohne mit der Wimper zu zucken, ihr Mann gehorchte tadellos, ebenso die vier Kinder, die tagsüber von ihrer Schwägerin betreut wurden – aber sobald irgendwo ein kleiner Nager auftauchte, verlor sie die Fassung. Frieda stand auf und öffnete die Tür zum Garten, wo sich Etzel, Heye und Holger sichtlich amüsierten, weil auch sie den Schrei gehört hatten.
»Grad eben ist sie rausgehuscht, Else«, behauptete sie einfach und unterdrückte ein Lächeln. »Ich hab’s genau gesehen. Beruhig dich wieder.«
»Nee, ist sie nicht!«
»Doch, bestimmt.«
Angelockt vom Geschrei stürmten die Kinder in die Küche. »So’n kleines Mäuschen tut doch nix, Else!«
Marina kicherte, während Siebo, wie immer in kurzer Lederhose, auf die Knie ging und alle Ecken gründlich absuchte.
Else japste, berappelte sich aber langsam.
»Setz dich, trink erst mal ’ne Tasse Tee«, ordnete Frieda an.
Nun ließ sich auch Bonno blicken. Mit windzerzaustem Blondschopf und rosigen Wangen kam er durch die Hintertür vom Garten herein. Frieda staunte wieder mal, wie wenig Ähnlichkeit er mit seinem Vater Paul hatte. Der Elfjährige schlug ganz nach ihrer Linie, der Fischerfamilie Dirks.
»Ich hab Hunger!«, verkündete er und begrüßte Siebo mit einem lässigen »He!«
»Nimm dir einen Zwieback«, sagte sie.
»Hast du Lust, heut Nachmittag mit mir und Tant’ Mia an den Strand zu gehen?«, fragte Lissy ihre Tochter.
»Ja!«, jubelte Marina. »Übst du schwimmen mit mir?«
»Mal sehen. Eigentlich lernst du das besser an der Angel im Hallenbad. Mia kann auch nicht schwimmen. Vielleicht planschen wir heute einfach nur.«
»Hast du auch an der Angel schwimmen gelernt, Mama?«
»Nein. Das Schwimmbad gab’s damals noch nicht.«
»Europas einziges Seewasserhallenwellenbad«, steuerte Siebo altklug bei.
»Onkel Dodo hat es deiner Mama und mir beigebracht«, erklärte Frieda lächelnd. Sie erinnerte sich daran, wie viel Mut es sie gekostet hatte, gegen den Willen ihres ersten Ehemanns Hilrich Schwimmunterricht zu nehmen. Es war ihr erster Schritt in ein selbstbestimmteres Leben gewesen.
»Onkel Dodo war früher Rettungsschwimmer am Strand«, fügte Lissy hinzu.
»Weiß ich doch«, antwortete Marina. »Darf Siebo mitkommen, Mama?«
»Na klar.«
»Dürfen wir auch einen Zwieback haben?«
»Nur zu. Kommst du mit uns an den Strand, Bonno?« Geschickt ordnete Lissy mit einer Hand das Haar ihres Halbbruders, und er ließ es sich tatsächlich gefallen.
»Nö«, erwiderte er, »ich helf Opa Dirk an Bord. Die Lustfahrt heut Nachmittag ist schon ausverkauft.« Friedas Vater Dirk Dirks fuhr nicht mehr oft zum Fischen raus, aber er umrundete im Sommer mit Badegästen auf seiner alten Schaluppe die Insel.
»Wir könnten auch mal wieder segeln gehen.« Lissy neigte nachdenklich den Kopf. »Die Minchen ist schon lange nicht mehr bewegt worden.«
»Gute Idee!« Frieda nickte.
Das Segelboot hatte ihr Schwiegervater vor dem Krieg eigenhändig auf einer Norderneyer Werft gebaut, heimlich nach Feierabend, um seine Jakomina damit zu überraschen. Für ihre Schwiegermutter war es das Geschenk ihres Lebens gewesen. Sie hatte das Boot auch nach dem Tod ihres Mannes, obwohl sie nicht allein segeln mochte, hoch in Ehren gehalten. Lissy hatte schon als junges Mädchen das Segeln erlernt, um ihrer Großmutter eine Freude zu machen.
Frieda lag wenig an dieser Freizeitbeschäftigung. Immer in einer Nussschale zu sitzen, sich kaum bewegen zu können, ständig den Kopf einziehen müssen, weil gleich wieder bei einem Wendemanöver irgendein Mast geschwenkt werden würde – das fand sie nicht sonderlich verlockend. Man konnte so gar nichts nebenbei erledigen, für sie war das vertane Zeit. Manchmal unternahmen auch ihre Schwägerin Frauke und deren Mann Felix Rosenau einen Törn mit der Minchen. Doch während der Hochsaison hatten die beiden mit ihrem Juwelierladen viel um die Ohren. Außerdem hielten ihre drei Kinder sie auf Trab. In letzter Zeit hatte es wohl auch öfter Anfeindungen im Seglerverein gegeben wegen der jüdischen Familie, aus der Felix stammte. Er selbst war schon lange zum Christentum übergetreten. Beklemmend, das Ganze, dachte Frieda. Und das Klima verschlechterte sich zusehends.
Mit Frauke hatte sie sich nie von Herzen gut verstanden, ihre Schwägerin, Hilrichs Schwester, konnte manchmal schon eine eingebildete Pute sein. Doch diese herabwürdigende Behandlung verdienten sie und ihre Familie nicht. Frieda seufzte. Gut, dass Jakomina das nicht mehr miterleben musste!
Ihr fiel wieder ein, dass sie doch Dodo und Mia einander näherbringen wollte. Schon lange hatte sie nicht mehr Amor gespielt. Dabei war das ihre besondere Begabung – wohl darauf zurückzuführen, dass sie unter einer Glückshaube, quasi noch in der Eihülle, auf die Welt geglitten war, was allgemein als ein außerordentlich gutes Omen galt. Erklären konnte Frieda es nicht. Sie überkam eben manchmal eine Vision von einem künftigen Paar. Dann sah sie sekundenlang über einem der beiden eine Art Hochzeitsfoto schweben. Mit Intuition und Geschick hatte sie schon einige Ehen gestiftet. An der Stirnseite des Treppenaufgangs hingen mehr als zehn Hüte, die ihr Jungvermählte im Laufe der Jahre aus Dankbarkeit für ihre Vermittlung geschenkt hatten.
Zur neuen Frisur, überlegte Frieda, würde sie einen neuen Hut brauchen. Eine Mode wirkte schließlich nur dann, wenn sie von Kopf bis Fuß stimmig war. Es gab also einen weiteren Grund, sich mal wieder einen Hut zu verdienen. Das Wichtigste war natürlich, ihren Lieblingsbruder zu verheiraten. Er hatte sich mit Fleiß vom einfachen Fischer zum Besitzer eines schmucken Hotels hochgearbeitet und es verdient, sein privates Glück zu finden.
Sie wandte sich wieder an Lissy. »Bring Mia mit zum Abendessen«, sagte sie noch mal. »Ich würde dann auch Dodo einladen.«
Alarmiert hoben sich Lissys Augenbrauen. »Nein!«, entgegnete sie heftig. »Mama, hör endlich mit der Kuppelei auf! Ich find das so peinlich. Außerdem ist Mia eine Großstadtpflanze, die geht ein ohne ihren Ku’damm. Hier auf der Insel würde sie auf Dauer kreuzunglücklich werden.«
»Aber ich hab doch so ein Gefühl …«, wandte Frieda ein.
Marina machte große Augen vor Neugier. Aufmerksam verfolgte sie den Wortwechsel, wobei sie geräuschvoll an ihrem Zuckerzwieback knabberte.
»Bitte, Mama!« Lissy schüttelte den Kopf. »Misch dich nicht immer in das Liebesleben anderer Leute ein. Dodo wär auch viel zu alt für Mia, er ist doch zwanzig Jahre älter. Das geht nicht.«
»Ich hab sie!«, rief Siebo triumphierend dazwischen. Er hielt die Maus zwischen beiden Händen.
»Ob sie wohl Zwieback mag?«, fragte Bonno und kam grinsend näher. »Gib her, die nehm ich mit an Bord. Das wird für Unterhaltung sorgen.«
»Nö!« Siebo wandte sich ab. »Mausi bleibt bei mir.«
»Wehe!« Else drohte beiden Jungen mit dem Zeigefinger. Und Marina kicherte.
»Es geht doch nichts über eine erholsame Teepause.« Wider Willen musste Lissy lächeln. »Ich geh nach vorn. Mein Kunde wartet schon viel zu lange.«
Herr Winter saß zeitunglesend neben der Garderobe des Herrensalons vor dem Fenster, durch das man Kurgäste in weißer Sommerkleidung den Laubengang entlangschlendern sah. Ein Pärchen blieb stehen, um die üppige rot blühende Kletterrose zu bewundern, die ein Fenster des Eckgeschäfts umrankte. Lissys Stiefvater Paul Merkur hatte einst den Rosenableger aus seiner Heimatstadt Lüneburg in die Ehe eingebracht – beide waren mittlerweile gut verwurzelt auf der Insel. Und inzwischen hatte sie sich mit dem Mann, den sie nach wie vor nur »Meister« nannte, arrangiert. Im Grunde war er ein feiner Mensch und zudem ein wunderbarer Opa für Marina.
Als sie hinter dem Tresen des Verkaufsraums hervortrat und weiterging in den nicht abgetrennten Herrensalon, schaute Herr Winter hoch. Seine blaugrauen Augen leuchteten auf.
»Guten Tag«, sagte sie, »tut mir leid, dass Sie warten mussten.«
»Guten Tag! Warum komme ich auch ausgerechnet zu Beginn Ihrer Pause, Fräulein Fisser?«, antwortete er, während er sich erhob.
Ein bartloser, großer, schlanker Mann von Mitte bis Ende zwanzig, geschmackvoll angezogen. Die Haut nicht mehr rötlich sonnenverbrannt wie bei seinem ersten Besuch gut drei Wochen zuvor, sondern gleichmäßig gebräunt. Rasiert war er bereits, das braune Haar hatte er mit Frisiercreme zum Glänzen gebracht.
»Was kann ich heute für Sie tun?«
Er erwiderte ihre Frage mit einem Blick, den sie nicht recht zu deuten wusste. Leicht verlegen schaute Lissy an ihm vorbei auf die Kristallfläschchen mit Shampoo, Öl, Festiger, Haar- und Rasierwässern, die auf einem runden Messingtablett neben dem Waschbecken standen. Wie alle Friseure in Deutschland hatten die Fissers wirtschaftlich schwere Jahre hinter sich. Der Inneneinrichtung, die noch kurz vor dem Schwarzen Freitag erneuert worden war, sah man das zum Glück nicht an. Die Frisiertoiletten aus Eiche mit Kanten und Fußstützen in Messing, die italienischen Marmorplatten und die Profilleisten aus kaukasischem Nussbaum um die Spiegel wirkten gediegen.
»Einmal waschen und schneiden, bitte.« Herr Winter räusperte sich.
»Aber Ihr Haar ist doch schon sehr kurz«, wandte Lissy ein. Eigentlich längst zu kurz, hätte sie beinahe angefügt, denn er kam zweimal pro Woche.
»Ein paar Millimeter hier und da werden’s sicher noch besser machen«, behauptete er. »Und eine Kopfmassage, bitte.«
Sie wies auf einen Friseurstuhl, er nahm Platz und ließ sich einen Schutzumhang umlegen.
»Brummt der Schädel wieder?«, fragte sie mitfühlend. Er presste die vollen Lippen zusammen, antwortete lediglich mit einem unterdrückten Knurrlaut. Sie hielt ihm zum Schnuppern zwei unterschiedliche Ölfläschchen unter die Nase. »Welches möchten Sie?« Er entschied sich für das mit Pfefferminze und Rosmarin. »Gute Wahl«, sagte sie, »das hilft gegen Kopfschmerzen, die Durchblutung wird angeregt.«
Sie verrieb einige Tropfen zwischen den Handflächen und begann mit der Massage.
Herr Winter schloss die Augen. Nase und Ohren waren groß, aber wohlgeformt. Schon bald entspannte er sich, und seine klaren Gesichtszüge erinnerten sie wieder an den amerikanischen Schauspieler Gary Cooper. Er strahlte etwas von der schüchternen, ehrlichen Art des Hollywoodstars aus. Sie mochte das verhaltene Lächeln und die hohe Stirn. Er wirkte energisch und empfindsam zugleich.
Lissy ging oft ins Kino. Das war genau genommen ihre einzige Abwechslung. Dorthin konnte sie abends auch allein gehen, im dunklen Saal vor der Leinwand fühlte sie sich zurückversetzt in ihre unbeschwerte Berliner Zeit.
Ihre besten Freundinnen Elke und Trienchen waren schon lange verheiratet. Beide hatten bereits drei Kinder. Natürlich traf man sich noch in Vereinen oder bei Festen. Doch oft fühlte Lissy sich dabei von anderen Frauen beobachtet, als wäre sie eine gefährliche Schlange, die sich an naive Ehemänner heranschleichen wollte.
Ihre Mutter und Tant’ Grete redeten ihr zu, sie solle sich doch nun endlich mal wieder verlieben. Als ob das so einfach wäre! »Das geht nicht auf Kommando«, hatte sie erst neulich wieder ärgerlich entgegnet. »Doch, das geht«, hatte Tant’ Grete behauptet. »Du musst nur innerlich bereit sein und deine Antennen ausrichten, dann passiert’s.« Ihre Mutter hob auch gerne mal die Vorzüge einer Vernunftehe hervor. »Mit gutem Willen und gegenseitigem Wohlwollen kommt die Liebe irgendwann von allein.«
Eine Kundin, die sie von Kindesbeinen an kannte, hatte ihr vergangene Woche ganz treuherzig geraten: »Sieh man zu, dass du bis zu Marinas Einschulung unter der Haube bist und dass deine Tochter adoptiert wird, damit ersparst du ihr einige Peinlichkeiten bei der Abfragerei fürs Klassenbuch.« Der Nachname von Marinas verstorbenem Vater Ivo, Sartorius, wich von ihrem, Fisser, ab.
Lissy atmete schwer aus. Sie hatte es doch versucht, mindestens zwei Mal in den vergangenen Jahren auch wirklich ernsthaft. Ohne Erfolg. War sie also innerlich nicht bereit?
Während ihre Finger geübt mit kleinsten kreisenden Bewegungen Herrn Winters Schläfen bearbeiteten, schaute sie sich im Spiegel an. Ihre von dichten schwarzbraunen Wimpern umkränzten dunkelblauen Augen blickten ernst. Der Teint wirkte abgesehen von einem gut abgedeckten Pickel, der sich wie immer kurz vor ihrer Periode am Kinn zeigte, glatt und feinporig, leicht gebräunt bis rosig. Ihr Gesicht war schmaler geschnitten als das ihrer Mutter und der Verwandten aus der Dirks-Linie. Eher oval und klassisch als breit mit Stupsnase und himmelblauen Augen. Man sah ihr die Ostfriesin nicht an. War das vielleicht auch ein Grund, weshalb sie sich blond färbte?
Begonnen hatte sie damit in Berlin, nachdem sie es als Nachwuchstalent auf die Gehaltsliste einer Filmproduktionsfirma geschafft hatte. Ivo hatte ihr damals zum Blondieren geraten. Er war ein echter Frauenkenner gewesen. Andere Männer ließen sich schnell blenden, aber Ivo hatte genau gewusst, wie eine Frau entsprechende Hilfsmittel einsetzen konnte, um ihr schönstes Ich sichtbar zu machen. Seit dem Farbwechsel erregte sie mehr Aufmerksamkeit, als wäre nun stets ein Scheinwerfer auf sie gerichtet.
Doch vom Wesen her erfüllte sie nicht das, was man einer Blondine zuschrieb. Sie wünschte sich, sie könnte das Leben leichter und lustiger nehmen. Damals in Berlin hatte alles gepasst. Heute empfand sie es anders.
Derzeit trug sie eine kühle Blondnuance. Immerhin diente es dem Geschäft, denn eine Schönheitsberaterin sollte durch das eigene Beispiel überzeugen. Und das derzeitige Frauenideal war eindeutig blond. Nicht nur bei den Nazis, was für sie eher ein Grund gewesen wäre, ihr Haar dunkler zu färben, nein, auch in Amerika eroberten blonde Frauen die Titelseiten der Illustrierten und spielten in glamourösen Filmen die Hauptrollen. In den Zwanzigern hatte man Bubiköpfe gern schwarz gefärbt, um sich ein verruchtes Flapper-Flair zuzulegen. Aber Sünde war nicht mehr en vogue.
Herr Winter legte seine feingliedrigen Hände locker auf die Armlehnen. Lissy schaute, ob er eine Maniküre benötigte. Nein, definitiv nicht. Die Nägel waren gepflegt. Einen Ring trug er nicht. Was er wohl beruflich machte? Vielleicht etwas Künstlerisches. Ihr war der Beruf ihres zukünftigen Mannes eigentlich egal. Nur einen Friseur wollte sie nicht. Denn dann würden sie sich wie ihre Mutter mit dem Meister vom Aufstehen bis zum Schlafengehen nur über Waschen, Schneiden, Legen unterhalten.
Auf der Insel wurden neuerdings wieder militärische Anlagen ausgebaut, auch der Segelflughafen und eine Wetterwarte auf der Aussichtsdüne Georgshöhe. Ob er damit etwas zu tun hatte? Wie ein typischer Urlauber kam er ihr jedenfalls nicht vor, dafür war er zu angespannt.
Der belebende würzig-frische Duft des Haaröls stieg ihr in die Nase. Vielleicht, so ging es ihr durch den Kopf, versuche ich ja unbewusst, mich besser in meine Ahnenreihe einzufügen?
Ihre Mutter, ihre Tanten, ihre Großmütter, ihr Vater Hilrich – sie alle waren blond geboren, die Dirks-Familie überwiegend flachsblond, ihr Vater goldblond. Nun gut, bei Oma Jakomina hatte es nur zu einem schlappen Aschblond gereicht, dem jahrelang auf handwerklich hohem Niveau zu güldenem Glanz verholfen worden war. Darüber hatte sich nie jemand aufgeregt. Aber wie sie, von Natur aus brünett, war nur ihr Großvater Fritz Fisser gewesen.
Sie wollte dazugehören, wollte sein wie alle in der Familie, wie die meisten Norderneyer und die begehrenswertesten Frauen weltweit – blond, hell, heiter.
Nun erreichten ihre Finger den Hinterkopf von Herrn Winter. Sie trommelte leicht mit den sorgfältig manikürten Nägeln auf und ab. Seine Lippen öffneten sich etwas. Sie spürte durch ihre Fingerspitzen, wie er es genoss. Die letzten Male hatte er ihr meist an dieser Stelle ein entwaffnendes, befreites Lächeln geschenkt.
Kräftig, auf keinen Fall zu privat oder gar zärtlich, massierte sie die Nackenpartie unter dem Haaransatz. Wenn sie nicht alles täuschte, dann durchliefen Herrn Winter jetzt wohlige Schauer. Seine Reaktion freute sie. Die Augen hielt er weiter geschlossen. Ein Energiestrom floss zwischen ihnen, jetzt spürte sie selbst ein Kribbeln, es lief von den Oberarmen bis in ihren Nacken.
Der Klangteppich um sie herum hatte eine angenehme, beruhigende Wirkung. Doch es wurde Zeit für die Wäsche. Sie schäumte das Haar gründlich ein, spülte es mit einem sanften lauwarmen Wasserstrahl aus. Das Gemurmel und leise Gelächter, das Schaben der Rasierer und Geklimper der Scheren, dazu die Wärme, seifige Düfte und feiner Tabakrauch, machten den Salon zu einem Wohlfühlort. Erneut schweiften Lissys Gedanken ab.
Auch vom Wesen her war sie anders als ihre Verwandten und die Insulaner. Bereits als Kind hatte sie sich nach der großen weiten Welt gesehnt, von der ihr Vater ihr oft vorgeschwärmt hatte. Durch den Aufenthalt in der Hauptstadt war die Kluft noch größer geworden. Zuweilen fühlte sie sich eigentümlich fremd in der eigenen Heimat und wurde von einer tiefen Sehnsucht nach etwas Unbekanntem erfasst. Dann wusste sie sich gegen die schier unerträgliche Spannung nicht anders zu helfen, als in die kalte Nordsee zu springen oder doch mal – sehr diskret – die Nacht mit einem Badegast, von dem sie wusste, dass er die Insel bald wieder verlassen würde, durchzufeiern. Hing das alles damit zusammen, dass ihr Vater so früh gestorben war, gefallen für Kaiser und Vaterland in der Ukraine?
Meist bemühte sie sich, diese Leerstelle in ihrem Leben, ihr gefühltes Anderssein, zu verbergen.
Lissy schlang ein Frotteetuch um Herrn Winters Kopf, rubbelte das Haar behutsam trocken. Dabei betrachtete sie den Schwung seiner Oberlippe. In diesem Moment öffnete er die Augen. Der Ausdruck darin hatte noch etwas Verträumtes, Entrücktes. Sie sahen sich im Spiegel an. Für Sekunden verhakten sich ihre Blicke, konnten sich nicht losreißen wie Klettengräser, ergründeten staunend und fasziniert im jeweils anderen Vertrautes und Unbekanntes, beides gleichermaßen verlockend. Er atmete tief durch, wollte offenbar etwas sagen.
»Mama!«, hörte sie da durch das Stimmengewirr Marina so laut flüstern, dass es eigentlich kein Flüstern mehr war.
Ihre Tochter stand in der Tür hinterm Tresen, wie sie es ihr eingeschärft hatte, denn sie durfte nicht durch den Salon laufen und die Abläufe stören. Wenn etwas Wichtiges war, sollte sie unterm Türrahmen warten, bis sie zu ihr kam. Hibbelig trat die Kleine von einem Bein aufs andere.
Mit einer Geste gab Lissy ihr zu verstehen, dass sie gleich bei ihr sein würde. Sie legte das Handtuch zur Seite. Herr Winter setzte sich aufrechter. Seine Miene verriet Überraschung und noch etwas, das Enttäuschung sein mochte oder vielleicht sogar Arroganz.
»Ihre Tochter?«, fragte er betont sachlich.
»Ja«, antwortete sie mit trotzigem Stolz.
»Oh, verzeihen Sie bitte, dass ich Sie mit Fräulein angesprochen habe.«
»Ist in Ordnung«, erwiderte sie und straffte die Schultern. Es gab nichts, wofür sie sich zu schämen hatte. Und erklären musste sie auch nichts. Aber sie spürte, wie ihre Wangen heiß wurden. Er räusperte sich. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie, »ich frag kurz, was los ist.« Mit wenigen Schritten war sie bei Marina.
»Mama, Mama«, flüsterte sie aufgeregt. »Tant’ Frauke sitzt in der Küche und weint ganz doll.«
»Ach du meine Güte! Weißt du, warum?« Marina schüttelte den Kopf. »Ist Oma bei ihr?«
Die Tür zum Damensalon, der etwas erhöht von der anderen Seite des Verkaufsraums abging, war geschlossen. Sie konnte nicht erkennen, wer sich gerade darin aufhielt.
»Nein. Aber Else.«
In diesem Moment kam ihre Mutter die Treppe herunter.
»Was ist denn?«, fragte sie noch im Flur.
»Frauke braucht Beistand«, sagte Lissy knapp. Sie eilten in die Küche.
»Diese Scheißnazis!«, fluchte Frauke und betupfte mit einem zerknäulten spitzenumhäkelten Taschentuch ihre verweinten Augen.
»Psst! Nicht so laut!« Else schob ihr einen Kräuterlikör neben die Teetasse. »Wenn einer mithört! Heye ist in der Partei.«
»Ist was mit deiner Familie? Jemand krank oder verletzt?«, fragte Lissy erschrocken.
Frauke schüttelte den Kopf. »Nur neue Schikane!«
»Ach herrje!«
»Ich kümmre mich schon, Lissy«, sagte ihre Mutter. »Geh ruhig wieder an die Arbeit.«
»Na gut.«
Lissy kehrte zurück zu Herrn Winter, dessen Haar schon beinahe trocken war. Die Atmosphäre hatte sich verändert. Wortlos machte sie weiter, kürzte sein Haar hier und dort einen Millimeter, vor allem an den Schläfen, denn Koteletten trug man kurz. Den Nacken rasierte sie aus, das Deckhaar ließ sie länger und kämmte es, nachdem der akkurate Seitenscheitel fast von allein gefallen war, mit Haaröl glatt zurück. Die Frisur stand ihm gut, er hatte ein attraktives Profil. Sie nahm einen Spiegel und hielt ihn so, dass er seinen Hinterkopf sehen konnte. Sein Haar glänzte wie eine frische Kastanie.
»Hm, gut geworden«, sagte er. »Wie schnell wächst es eigentlich nach?«
»Man sagt, pro Monat einen Zentimeter«, antwortete sie.
Noch einmal tauschten sie einen Blick, der ihr Herzklopfen bereitete. Warum fragt er nicht, ob wir mal einen Kaffee zusammen trinken können oder wohin man auf Norderney am besten zum Tanzen ausgeht oder sonst irgendetwas Unoriginelles? Traut er sich nicht, oder will er nicht?
»Schade.« Das war alles, was er sagte.
Sie rätselte, ob er damit zu verstehen geben wollte, dass er in einem Monat nicht mehr auf der Insel war. Oder bezog sich sein Bedauern auf etwas anderes?
»Was machen die Kopfschmerzen?«, fragte sie an der Kasse.
»Vorhin waren sie plötzlich weg«, antwortete er.
Was für eine blöde mehrdeutige Antwort. Sie waren schon verschwunden, und jetzt sind sie auf einmal zurückgekehrt? Weil er erfahren hat, dass sie ein Kind hatte, oder was? Konnte dieser Mann sich nicht normal ausdrücken?
»Dann wünsche ich Ihnen weiter gute Erholung, Herr Winter«, sagte Lissy eine Spur gereizt, doch mit ihrem liebenswertesten Lächeln.
Frieda
»Kein Mensch kauft mehr bei uns. Dabei bin ich eine waschechte Insulanerin, ich bin auf Norderney geboren und konfirmiert worden, mein Mann ist ebenso getauft wie ich, wir haben hier in der Kirche geheiratet!« Frauke – zwei Jahre älter, etwas fülliger als Frieda und stets bemüht zu wirken, wie es sich für sie als die Gattin eines seriösen Juweliers gehörte – verlor plötzlich alle Contenance und brach in lautes Schluchzen aus. »Was sollen wir denn bloß machen? Warum hetzen sie die Leute so gegen uns auf? Wir wollen doch nur in Frieden leben und arbeiten!«
Frieda legte ihr eine Hand auf den Arm. Es war ihr nicht entgangen, in diesem Sommer schwappte eine neue Welle des Judenhasses über die Insel. Ausgerechnet über Norderney, einst jahrzehntelang eine Hochburg wohlhabender jüdischer Kurgäste. Bekannt für die gute Infrastruktur mit eigener Synagoge, koscherem Schlachter, etlichen jüdisch geführten Pensionen und Hotels aller Preiskategorien. Gleich nach der Machtergreifung waren einige üble »Exempel statuiert worden«, wie die Braunen es nannten. »Wir lassen uns die freche Vorherrschaft der Juden auch auf Norderney nicht mehr gefallen!«, hatte es geheißen.
Frieda fehlten die Worte. Mit Grausen erinnerte sie sich an den vorübergehenden Boykott jüdischer Geschäfte, der am 1. April 33 als grässlicher Aprilscherz begonnen und die Stimmung der Inselgemeinschaft vergiftet hatte. Im Sommer hatten die Unterkünfte jüdischer Vermieter leer gestanden. Und da sie wie alle Betriebe bereits durch die Wirtschaftskrise geschwächt waren, hatten sie kurze Zeit später schließen müssen. Den meisten jüdischen Einwohnern war nichts anderes übrig geblieben, als alles zu verkaufen und die Insel zu verlassen, um woanders ihr Brot zu verdienen. Der angesehene Hotelier Julius Hoffmann, jahrelang Vorsitzender des Vereins Norderneyer Gastwirte, hatte noch versucht, sich aufzulehnen gegen die Ungerechtigkeit und einen Schadenersatzprozess angestrengt. Aber auch er war gescheitert, hatte ruiniert aufgeben und fortziehen müssen. Sein traditionsreiches Familienhotel und sein Privathaus sollten in diesen Wochen unter den Hammer kommen.
»Letzten Sonntag … da haben sie am Nord- und am Weststrand … Schaukästen aufgestellt«, erzählte Frauke, von Schniefern unterbrochen, während sie nervös eine Kameebrosche betastete, die ihren Kragen aus feinster Brüsseler Spitze zusammenhielt. In der Zeitung hatte Frieda von der feierlichen Einweihung gelesen. Sie konnte sich lebhaft vorstellen, wie theatralisch und lächerlich das Ganze abgelaufen war. Ihr wurde schon übel, wenn sie zufällig das zackige Gehabe beim Morgenappell am Rathaus beobachtete, mit dem die Hakenkreuzfahne gehisst wurde. Furchtbar, all diese symbolischen Akte! Wie sie bei der Sonnwendfeier die Fahnen der Weimarer Republik, Schwarz-Rot-Gold, Bücher jüdischer Schriftsteller und andere »antideutsche Geistesprodukte« ins Feuer geworfen hatten. Oder wie der Kultusminister Rust bei einer Kundgebung vor dreitausend Zuhörern auf dem Sportplatz an der Marienstraße getönt hatte: »Es kann nicht angehen, dass ein Prozent die übrigen neunundneunzig Prozent führt und knechtet!« Mit Paul war sie dort gewesen und hatte eine Gänsehaut bekommen beim Jubel über seine per Lautsprecher verbreitete Ankündigung, sie würden »die Juden ein für alle Mal von der Insel vertreiben«.
Frauke schnäuzte sich heftig. »Vorhin hab ich mir den Schaukasten am Weststrand angesehen«, berichtete sie dann erbittert. »Da stehen nur Parolen aus dem Stürmer, diesem ekeligen Hetzblatt. Immer nach dem Motto: ›Die Juden sind unser Unglück‹.«
Betroffen lauschte Frieda. Der Friseur Löwy, der, solange sie denken konnte, mit seinem Salon zur Insel gehörte und wie ihr Schwager evangelisch konvertiert war, hatte sich im vergangenen Jahr entschlossen, mit seiner Familie nach Italien auszuwandern. Sie hätten ihm einiges Friseurzubehör günstig abkaufen können. Aber zum einen wollte sie sich nicht an seinem Niedergang bereichern, und zum anderen musste man vorsichtig sein. Vor ein paar Tagen hatte erst in der Inselzeitung gestanden, was der NSDAP-Ortsgruppenleiter öffentlich von sich gegeben hatte: »Kann es etwa einem deutschen Volksgenossen zugemutet werden, sich in einem Friseurgeschäft mit dem gleichen Messer rasieren zu lassen, mit dem kurz zuvor einem Juden der Bart bearbeitet wurde?«
Sie seufzte laut. »Herrjemine!«
Auch Else hörte aufmerksam zu. Gleich würden wieder einige Mitarbeiter zur Teepause in die Küche kommen. Gewiss war es besser, das Gespräch unter vier Augen fortzusetzen.
»Else, besorgst du uns bitte fürs Abendessen eine große Portion Krabben?«, bat Frieda. »Ich erwarte noch zwei Gäste. Und wir gehen nach oben, Frauke. Den Tee nehmen wir mit.«
Nachdem ihre Schwägerin im Wohnzimmer auf dem lindgrünen Polstersofa und sie selbst in ihrem Lehnsessel Platz genommen hatten, schüttete Frauke ihr das Herz aus, wie sie es in all den Jahren nicht getan hatte. Es musste ihr wirklich sehr schlecht gehen.
»Der Gruppenleiter hat bei der Einweihung der Schaukästen gesagt, Norderney hätte ja nur noch zwei oder drei Judenfamilien. Es wäre ein Leichtes für alle Kaufleute, Geschäfte jeglicher Art mit ihnen abzulehnen.«
»Ach Frauke«, entgegnete Frieda hilflos, »ich hatte so gehofft, dass sich die Situation wieder entspannt.«
Im Geiste ging sie die noch auf der Insel ansässigen Juden durch. Da war Frau Bergheim, die Inhaberin eines Spielwarengeschäfts, die man vor anderthalb Jahren mal verhaftet und in Norden vor Gericht gestellt hatte. Angeblich, weil sie staatsfeindliche Gerüchte verbreitete – in Wirklichkeit nur, um ihr einen Schrecken einzujagen. Die Witwe Lemmersmann fiel ihr ein, der Schlachter Müller und seine Frau, die Kaufmannsfamilie Wollenstein, die Privatiere Frau Rosenstamm, Familie Klompus, vielleicht noch die Fotografin Ulrika Schultenkötter, wenn man die überhaupt mitrechnen konnte, weil sie ja zum Katholizismus übergetreten war, und die kleinwüchsige Margot Levy, die bei christlichen Pflegeeltern, dem schon älteren Ehepaar Harms aufwuchs. Keiner von denen schien ihr auch nur im Entferntesten eine Gefahr für das deutsche Volk darzustellen.
Im Juni vor zwei Jahren hatte die Badeverwaltung JUDEN-UNERWÜNSCHT-Schilder am Strand aufgestellt – doch nach zahlreichen Protesten, vor allem aus dem Ausland, wenig später wieder einen Rückzieher gemacht und verlauten lassen, die Einstellung der Kurverwaltung gegenüber jüdischen Kurgästen habe sich nicht geändert. Nach dieser Kehrtwende war Frieda überzeugt gewesen, dass es beim Kurz-mal-erschrecken-Wollen bleiben würde. Auch die Siegelmarken mit der Aufschrift Nordseebad Norderney ist judenfrei, die unter anderem Erwin eifrig freiwillig in den Geschäften verteilt hatte, durften nicht mehr neben Briefmarken auf Briefumschläge geklebt, sondern mussten an die Gemeindeverwaltung zurückgegeben werden.
Doch dann war der Gemeindevorsteher seines Amtes enthoben worden, seitdem gab es in den Ratssitzungen keine geheimen Abstimmungen mehr. Frau Bergheim war wohl auch noch mal in Hannover angeklagt worden, seitdem hatte Frieda sie, das ging ihr erst jetzt durch den Kopf, gar nicht mehr gesehen.
Frieda musste an den früheren Schulrektor und Bürgermeister Norderneys, Jann Berghaus, denken, der es bis zum Regierungspräsidenten des Regierungsbezirks Aurich gebracht hatte. Jede Gemeinde, auch die Gemeinde Norderney, so hatte er das Ergebnis der letzten freien Wahl von 1932 kommentiert, habe einen berechtigten Anspruch auf eine gewisse Zahl dummer Leute. Wenn aber ein Drittel aller Stimmen für die NSDAP abgegeben worden sei, dann sei damit die erlaubte Grenze erheblich überschritten. Seine Mahnung hatte nichts gefruchtet. Inzwischen war auch er kaltgestellt, aller öffentlichen Ämter enthoben und die Bürgermeister-Berghausstraße auf Norderney in Hindenburgstraße umbenannt worden.
Ihr Stammkunde Theo Weerts, der langjährige Hauptschriftleiter der Inselzeitung, hatte sich nach der Gleichschaltung der Presse in den Ruhestand zurückgezogen. Er konnte von Glück sagen, dass sie ihn nicht wie andere Sozialdemokraten wochenlang eingesperrt und gequält hatten. Frieda machte innerlich eine Verbeugung vor ihrem Schwiegervater Fritz Fisser. Wie gut, dass sie damals seinem letzten Willen gefolgt und nach nur kurzer Mitgliedschaft wieder aus der SPD ausgetreten war. An seinem Sterbebett hatte sie ihm versprechen müssen, dass niemand aus dem Inselsalon je Mitglied einer Partei sein würde. Und Paul hatte es ihr deshalb vor ihrer Hochzeit in einem Ehevertrag schriftlich geben müssen.
Dass jetzt doch ihr langjähriger Altgeselle Heye in die NSDAP eingetreten war, brachte sie in Gewissenskonflikte. Erst hatte sie ihn feuern wollen, dann aber der alten Zeiten wegen davon wieder Abstand genommen. Und Paul hatte gemeint, es könnte eventuell sogar ein gewisser Schutz für den Betrieb sein, wenn sie einen Parteigenossen beschäftigten. Sie hatten aber ein ernstes Wort mit Heye geredet, und der hatte versprochen, das Parteiabzeichen während der Arbeit nicht zu tragen.
»Es wird nur immer noch schlimmer«, klagte Frauke mit bleichem Gesicht. »Wer von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großeltern abstammt, gilt als Jude.« Sie schluckte. »Das trifft auf Felix zu.«
»Ach Frauke!«
Selten hatte sich Frieda so ohnmächtig gefühlt. Sie erinnerte sich noch an Felix’ Großeltern väterlicherseits, die in den Zwanzigerjahren zu Besuch auf der Insel gewesen waren. Die alte Frau Rosenau, eine originelle kleine Person, hatte ihre Perücke, die sie Scheitel nannte, wie einen verrutschten Kaffeewärmer spazieren geführt und ständig gejammert: »Lieber dreimal für Pessach putzen als noch einmal so eine Reise!« Ihr Ausspruch hatte seitdem bei ihnen zum Familienschatz lustiger Redewendungen gehört, in letzter Zeit gebrauchte ihn allerdings niemand mehr.
»Das Allerschlimmste kommt noch«, fuhr Frauke bitter fort. »Der Gruppenleiter hat angekündigt, dass sie jetzt einen Antrag einbringen wollen: Wer mit Juden verkehrt und bei Juden kauft, soll keine Aufträge mehr von der Gemeinde erhalten.«
»Es ist zum Kotzen!«, brach es aus Frieda heraus. Sie spürte die Beklommenheit, die ihrer Schwägerin das Herz abschnürte, selbst körperlich. »Das Unrecht geschieht in diesen Tagen nie, ohne dass sie vorher schnell noch ein Gesetz erlassen, wonach es dann angeblich rechtens ist.«
»Damit würden unsere letzten Geschäftspartner vergrault«, erklärte Frauke. »Wir leben jetzt schon von der Substanz. Erst haben sie Felix vorgeworfen, dass er judet. Nun haben wir Festpreise und lassen nicht mehr mit uns handeln. Das gefällt auch nicht. Wovon sollen wir denn unseren Lebensunterhalt bestreiten?« Ihre Stimme brach, sie schluchzte erneut auf, fing sich dann aber wieder. »Ich … ich … wollte dich um einen Gefallen bitten, Frieda. Also … ähm … Könnten wir euch vielleicht etwas verkaufen?«
Überrascht und betreten schwieg Frieda. Sie fragte sich, was ihre Schwägerin erhoffte, in welcher Dimension sich wohl ein Kauf bewegen sollte, der für sie hilfreich genug wäre. Reichte es, den Rosenaus etwas Goldschmuck abzukaufen, oder dachte sie an die südafrikanischen Diamanten, die Felix direkt einführte? Wollte sie vielleicht ihren Anteil an der Minchen zu Geld machen, oder schwebte ihr am Ende ein Verkauf ihres Hauses vor? Der Laden, in dem sich ihr Juweliergeschäft befand, war schließlich nur gepachtet.
»Ich rede mit Paul«, versprach sie. »Wir werden euch bestimmt unterstützen.« Allerdings waren ihre Möglichkeiten begrenzt. Eine Ewigkeit hatten sie den Kredit für die neue Saloneinrichtung abbezahlt, wegen der schlechten Geschäfte die Laufzeit zweimal verlängern müssen. Auch jetzt standen sie neben den üblichen Personal- und Nebenkosten nicht ohne Verpflichtungen da. Paul murrte jeden Monat, wenn die Rate für die neuen Pumpfriseurstühle fällig war. Trotzdem bemühte sie sich, Frauke aufmunternd anzulächeln. »Wir finden schon einen Weg.«
»Aber …«, Frauke schluckte schwer, »… wir bringen euch genau wie unsere Freunde in Gefahr. Allein dadurch, dass wir miteinander verkehren.« Sie konnte nur noch flüstern. »Wer will denn so was ausgerechnet den Menschen antun, die er mag?«
Frieda war gerührt. »Ihr werdet auf keinen Fall verhungern. Und ihr findet zur Not auch hier, in deinem Elternhaus, immer ein Bett und ein Dach überm Kopf.« Natürlich hoffte sie inständig, dass es dazu niemals kommen würde. »Mach dir mal nicht zu viele Sorgen, Frauke. Jeder auf der Insel weiß, dass ihr rechtschaffene Leute seid.«
»Genau wie Julius Hoffmann …«, bemerkte Frauke sarkastisch.
Frieda ging darauf nicht ein. »Dein Mann hat ja sogar im Weltkrieg für Deutschland gekämpft und Tapferkeitsauszeichnungen erhalten. Dem werden sie nichts tun. Außerdem ist er durch dich geschützt. Ihr führt doch eine … wie heißt das noch mal?«
»Privilegierte Mischehe.« Verächtlich spuckte Frauke den Begriff aus. »Na, hoffentlich behältst du recht.«
Sie verabschiedeten sich mit einer Umarmung, das war ungewohnt und ihnen beiden etwas peinlich. Frieda dachte an ihre Schwiegermutter Jakomina. Ihr und dem alten Fritz war sie es schuldig, Frauke samt Familie jetzt nicht im Stich zu lassen. Aber selbstverständlich durfte sie dabei auch ihre eigene Familie nicht gefährden. Wenn sie dem Wickwief, der alten Wahrsagerin der Insel, das nächste Mal bei einem Hausbesuch die Haare ondulierte, würde sie um ihren Rat bitten und sich aus den Teeblättern lesen lassen. Das nahm sie sich fest vor.
Marina
Nachdem Siebo die zahme Maus seines großen Bruders nach Hause in ihren Käfig zurückgebracht und mit seiner Familie zu Mittag gegessen hatte, kam er in Badehose mit Turnhemd, Angelrute und Eimer zu Fissers zurück. Noch herrschte Mittagsruhe.
Marina und er schlichen sich in den abgedunkelten Lagerraum, wo es zwischen gewaschenen Handtüchern und Friseurkitteln immer interessante Dinge zu erkunden gab – Seifen, Haarfärbeprodukte, Bleichmittel und andere Chemikalien, die eigenartig rochen, lustige Halbperücken oder märchenhafte Glitzerkämme.
»Wir können’s ja noch mal machen. Das mit Mausi, meine ich«, schlug Siebo im Flüsterton vor. »Sie ist inzwischen auch bei mir ganz zutraulich.«
Marina, die im Spielhöschen mit Trägerlatz ebenfalls schon strandfertig war, kicherte aufgekratzt. Mit Siebo erlebte sie Streiche, die sie und ihre Freundinnen sich nie getraut hätten und sie allein sowieso nicht. Die Sache mit Mausi war Siebos Idee gewesen.
»Hat Lubi was gemerkt?«, fragte sie.
Siebos Bruder war während der Sommerferien zu Hause, sonst wohnte er wie inzwischen auch Wally, das mittlere der drei Lubinus-Kinder, die Woche über auf dem Festland in der Stadt Norden, wo er und seine Schwester das angesehene Ulrichsgymnasium besuchten. Lubi konnte besonders gut mit Tieren umgehen. Neben Mausi besaß er noch einen fröhlichen Hamster namens Dieter.
»Nö.« Siebo zuckte mit den Achseln. »Ich hab Mausi ja auch nur kurz ausgeliehen. Aber bestimmt darfst du nun doch bald eins von Onkel Lübbos Kätzchen haben.«
Seit Langem wünschte Marina sich ein eigenes lebendiges Schmusetier. Ihr alter Plüschhase mit den rosa Ohren war schon arg zerliebt, und die Katze ihres Nachbarn, des Segelmachers Lübbo Ennen, hatte sieben süße, noch blinde Junge zur Welt gebracht. Für zwei Kätzchen hatten sich Abnehmer gefunden. Die übrigen sollten demnächst alle in einen Sack gesteckt und ertränkt oder mit einem Knüppel erschlagen werden, hatte Onkel Lübbo gesagt, wenn sie keiner haben wollte. Marina bettelte deshalb schon seit Tagen Mutter und Großmutter an, aber beide waren strikt gegen ein Haustier. »Es gibt Kunden, die reagieren allergisch auf Katzenhaar«, hatte ihre Mutter zur Begründung erklärt. »Dann müssen sie niesen oder bekommen Hautausschlag. Das fällt auf uns zurück.«
»Aber Katzen sind die saubersten Tiere überhaupt, die lecken sich den ganzen Tag das Fell«, hatte Marina erwidert. »Außerdem sind sie nützlich, weil sie Mäuse fangen.«
»Ach Kind!«, hatte ihre Mutter nur geantwortet. »Es geht nicht, basta.«
Marina hoffte trotzdem, dass ihr Widerstand schwächer wurde. »Das kleinste Katzentier ist ein Meisterstück«, befand dagegen Opa Paul. »Woar sück een Puss in’t Sün räkelt, doar is dat jümmers gemütlich.« Dass sich bei ihnen eine Mieze in der Sonne räkeln sollte, fand auch Bonno. Und Else hatten sie sowieso schon längst auf ihrer Seite.
Die Tür des Lagerraums öffnete sich, ihre Mutter hatte sie wohl doch gehört.
»Ihr sollt hier nicht spielen«, mahnte sie. »Geht lieber schon langsam vor zum Weststrand. Wir treffen uns an Mias Strandkorb, der steht in der ersten Reihe auf Höhe der Rettungsbootstation.«
»Weiß ich.« Marina war schon dort gewesen.
»Tant’ Klärchen hat kein Telefon in ihrer Pension. Ich hole Mia ab. Sie hat Vollpension gebucht, bestimmt ist sie jetzt in der Mittagszeit dort.« Siebo schnappte sich sein Angelzeug und stapfte voran.
Im Flur lief ihnen Oma Frieda über den Weg. Sie war gerade vom Mittagsschlaf aufgestanden, den sie jeden Tag eine halbe Stunde eng an Opa Paul geschmiegt oben auf dem Sofa hielt.
»Unterwegs könnt ihr eben noch bei Onkel Dodo vorbeigucken«, trug sie ihnen auf, »und ihn zum Abendbrot einladen. Sagt ihm, heut gibt’s Krabben mit Kräuterrührei, so wie er’s am liebsten mag.«
Marina nickte. Bewundernd warf sie noch einen Blick auf die zahlreichen Hüte an der Wand. Am liebsten mochte sie den ältesten, einen Strohhut mit gelber Seidenrose daran. Ab und zu durfte sie unter Aufsicht eine der Kopfbedeckungen aufsetzen, und ihre Oma erzählte ihr dann die dazugehörende Liebesgeschichte. Wenn ich groß bin, dachte Marina, will ich auch Friseurin werden und Liebespaare verkuppeln. Oder vielleicht studiere ich Chemie, wenn das für Mädchen geht. Siebo hatte das vor, er wollte Apotheker werden. Manchmal zeigte er ihr Experimente aus seinem Chemiebaukasten für Kinder – das war wie Zauberei!
Sie marschierten los, schoben sich durch Pulks flanierender Badegäste. Alle wirkten gepflegt, trugen helle Sommerkleidung, die meisten Frauen auch Hut, Handschuhe und Handtasche. In der Grünanlage auf dem Kurplatz, der jetzt Adolf-Hitler-Platz hieß, strahlte das lang gestreckte weiße Kurhaus, das die älteren Leute Conversationshaus nannten. Sicher wollten die meisten sich jetzt schon vorm Musikpavillon einen Platz für das Nachmittagskurkonzert sichern, einige versuchten, draußen im Kaffeehaus HAG einen freien Platz auf der Terrasse zu ergattern. Die Poststraße in der entgegengesetzten Richtung war ebenfalls von heiteren Menschen bevölkert. Alle schienen sich zu freuen, dass die Sonne wieder hervorgekommen war.
Marina mochte die Berliner Freundin ihrer Mutter. Nicht nur, weil sie ihr eine Tafel Schokolade mitgebracht hatte und fröhlich war. Sondern auch, weil sie sie schon als Baby auf dem Arm gehabt und das einzige Foto geknipst hatte, das sie und ihre Mutter mit ihrem Vater zusammen zeigte. Kurz darauf war er ums Leben gekommen.
Unterwegs begegneten sie einigen Inselkindern, die in kleinen Banden umherstromerten und sie einluden, mit ihnen zu kommen. Aber sie hatten ja schon was anderes vor.
Onkel Dodos Hotel lag an der Viktoriastraße nahe dem Weststrand. Es war mittelgroß, kein Riesenklotz und deshalb in Marinas Augen besonders schön. Nicht so respekteinflößend wie der Kaiserhof oder das Hotel Germania an der Kaiserstraße, sondern überschaubar und zum Wohlfühlen. Aus den Zimmern zur Seeseite blickte man durch große, oben abgerundete Fenster, sodass das Meer immer aussah wie eines der Gemälde, die im Sommer von Kunstgalerien auf der Insel ausgestellt wurden, nur mit dem Unterschied, dass diese Bilder sich bewegten und ihre Farben ständig veränderten. Marina und Siebo gingen zum Lieferanteneingang an den Mülltonnen vorbei, wo ein Kochlehrling gerade hungrige Möwen verscheuchte.
»He, Marina!«, grüßte er sie auf Norderneyer Art. Die Insulaner sagten im Gegensatz zu anderen Ostfriesen nicht »Moin«.
»He, Heinzi!«, grüßte sie zurück. »Ist Onkel Dodo da?«
»Ja, hab ihn gerade in seinem Büro gesehen.«
Onkel Dodo musste sie durch ein geöffnetes Fenster gehört haben. »Wer ist denn da?«, hörte sie seine tiefe Stimme. Er kam nach draußen, ein kräftiger Mann, und wie immer, wenn nicht gerade Gäste in der Nähe waren, sprang sie mit Anlauf an ihm hoch, umschlang ihn mit Armen und Beinen. Er hielt sie fest und drückte ihr einen Schmatz auf die Wange. »He, min Muuske! Bald wirst du mir aber zu groß dafür!«
Er hatte seine Anzugjacke abgelegt, trug nur Hemd und Weste, die Ärmel hochgekrempelt. Man konnte sich gut vorstellen, dass er früher bei der Marine gewesen war. Auch wenn er jeden Morgen zum Rasieren in den Inselsalon kam und das rotblonde Haar mit Pomade glättete, hatte er noch immer was von einem Seebären.
»Nö«, widersprach sie aus voller Überzeugung, »das mach ich auch noch, wenn ich schon ’ne ganz alte Oma bin.«
»Dann muss ich wohl zusehen, dass ich bei Kräften bleibe, was? He, Siebo! Alles klar?« Er schielte in den Eimer. »Schon was gefangen?«
Siebo grinste. »Wir wollen noch. Gleich an der Segelbuhne.«
Marina lächelte stolz. Am Weststrand hatten sie schon Scholle und Aal gefangen. Obwohl, wenn sie ehrlich war, sie hatte immer nur die Angel gehalten. Köder auf den Haken zu pieken und zappelnde Fische anzupacken, das überließ sie lieber Siebo.
Onkel Dodo wollte sie ins Hotelgebäude lotsen, doch Marina blieb stehen. Sie richtete ihm die Einladung zum Abendbrot aus und erklärte, dass sie gleich weiterwollten, weil ihre Mutter und deren Freundin aus Berlin sie erwarteten.
»Tja.« Onkel Dodo fuhr sich über sein von ersten grauen Strähnen durchzogenes Haar. »Eigentlich hab ich keine Zeit, das Haus ist rappelvoll.« Seine Wangen waren wie immer von winzigen Äderchen rötlich gefärbt. »Aber Elses Kräuterrührei ist unübertroffen. Und Appetit auf Krabben hätte ich auch mal wieder. Na, ich könnte kurz rüberkommen.«
»Gut.« Marina nickte zufrieden. »Schade«, fuhr sie dann mit einem treuherzigen Augenaufschlag fort, »dass du nicht mehr Rettungsschwimmer bist. Dann könntest du mir schwimmen beibringen, und ich müsste nicht abwarten, bis Oma mich irgendwann ins Hallenbad mitnimmt.«
»Du könntest doch auch mal kurz ans Wasser kommen«, schlug Siebo verschmitzt vor. Er blinzelte gegen die Sonne, seine sommersprossige Nase kräuselte sich.
Dodo lachte nur. Er gab Marina einen Klaps. »Bis heut Abend, viel Spaß am Strand!« Siebo klopfte er auf die Schulter und scherzte: »Deine letzte Stiege ist für mich, is’ ja wohl klar, nicht?«
Sollte heißen, den letzten Fang, den frischesten Fisch, wollte er haben.
»Nö, ich bring alles meiner Mutter.«
Lissy
Im Verandavorbau der weiß verputzten Pension Klärchen, die sich am Dorfrand nahe der Franzosenschanze befand, wurde gerade abgeräumt. Lissy ging ums Gebäude herum, an blau blühenden Hortensien vorbei, in den Garten. Wie sie gehofft hatte, war Mia noch da. Sie lag im Halbschatten eines Mirabellenbaums auf einem Liegestuhl und blätterte im Monatsmagazin Die Dame. Es war nicht wirklich Mias Welt, aber sie bediente in einem Friseur- und Schönheitssalon am Ku’damm jede Menge Kundinnen, die darin zu Hause waren. Vor einiger Zeit war sie aufgestiegen, sie durfte nun Termine vergeben und entscheiden, wer welche Kundin bediente.
»Lissy, was machst du denn hier?«, rief sie freudig überrascht. »Musst du nicht arbeiten?« Lissy erklärte ihr den spontan geschmiedeten Plan für diesen Nachmittag und Abend. »Oh, bitte keine Segeltour«, flehte Mia übertrieben dramatisch. »Die ganze Hinfahrt über hab ich auf der Fähre gegen Übelkeit angekämpft. Aufm Wannsee geh ich ja gern mal segeln, aber nicht bei euren Monsterwellen!«
»Na gut, dann faulenzen wir eben in deiner Strandburg und lästern ein bisschen«, schlug Lissy vor.
»Klingt fabelhaft! Ich will nur schnell ein paar Sachen packen.«
Mia sagte ihrer Wirtin, dass sie nicht zum Abendbrot erscheinen würde. Die bot daraufhin an, ihr ein kleines Fresspaket für den Strand mitzugeben, was Mia dankend annahm.
Neugierig folgte Lissy ihrer Freundin aufs Zimmer. Es war klein und dunkel, mit Dachschrägen, spärlich und altmodisch eingerichtet. Über dem Bett hing ein Haussegen, der vermutlich noch aus dem vergangenen Jahrhundert stammte:
Mag draußen die Welt
ihr Wesen treiben,
Mein Haus soll meine
Ruhstatt bleiben.
Während Mia ihre Badetasche vollstopfte, in einen gesmokten, rot-weiß-getüpfelten Badeanzug mit Nackenhalter schlüpfte und eine weite weiße Hose darüber anzog, plauderten sie.
»Wenn du das nächste Mal kommst«, bat Lissy, »dann sagst du aber früher Bescheid. Ich würde dir was Schöneres besorgen, entweder im Hotel meines Onkels …«
»… das für mich sicher zu teuer wäre.«
»Er würde dir einen Sonderpreis machen. Oder bei uns. Aber wir hatten das Zimmer im Anbau unten leider schon vergeben.«
»Ach, egal. Ich bin genügsam«, antwortete Mia vergnügt. »Es ist sehr sauber hier, das ist die Hauptsache.«
»Ja, dafür sind wir Norderneyer bekannt.« Lissy lachte auf. »Sie sind reinlich, arbeitsam und schnarchen sämtlich. So stand es schon vor Jahrzehnten in einem Reiseführer.«
Mia strahlte. »Ich finde es sagenhaft, dass ich’s überhaupt geschafft hab, endlich mal nach Norderney zu reisen. Du musst mir ganz viel von deiner Insel zeigen!«
Sie zog ein helles Bolerojäckchen mit Puffärmeln an, dessen Schnitt ihre bei allen Rundungen schlanke Taille betonte, und setzte eine Baskenmütze schräg aufs brünette Haar. Sie traute sich doch tatsächlich, es glatt und offen wie Greta Garbo in Königin Christine zu tragen. Die nur mit einer leichten Innenrolle geföhnte Frisur wirkte an ihr modern und frech, ohne ihr etwas von der weiblichen Ausstrahlung zu nehmen.