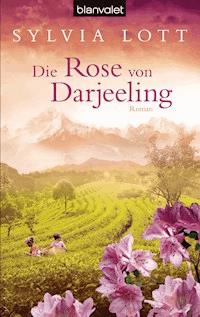5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am anderen Ende des Himmels wartet das Glück
Ostfriesland, 1932. Die junge Marie wächst in einfachen Verhältnissen auf. Als sie sich in den falschen Mann verliebt, wird sie von ihren Eltern zu Verwandten nach Amerika geschickt. Im Gepäck hat sie ein gebrochenes Herz – und das Rezept für einen köstlichen Käsekuchen. Sie ahnt nicht, dass sie damit New York im Sturm erobern wird … Jahrzehnte später begleitet die Hamburger Fotografin Rona ihren Großvater nach Long Island, wo er seine Schwester Marie zu ihrem 90. Geburtstag besucht. Diese vertraut ihrer Großnichte eine Geschichte an, die deren Leben verändert…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Ostfriesland, 1932. Die junge Marie hat sich in einen Mann verliebt, der nicht den Vorstellungen ihrer Eltern entspricht, und wird kurzerhand zu Verwandten in New York geschickt. Sie soll ihr Glück in der Ferne finden – und den guten Ruf der Familie bewahren. In ihrem Koffer trägt sie nur wenige Habseligkeiten bei sich. Doch ihr kostbarster Schatz ist das Rezept für den wunderbaren Käsekuchen ihrer Tante. Schon bald wird sie damit New York erobern …
Autorin
Die freie Journalistin und Autorin Sylvia Lott ist gebürtige Ostfriesin. Sie schreibt für verschiedene Frauen-, Lifestyle- und Reisemagazine und veröffentlichte bei Blanvalet bereits den Roman Die Rose von Darjeeling. Seit sie vor vielen Jahren bei einer Reisereportage ihren ersten »Cheese Cake New York Style« probierte, ist sie süchtig nach diesem ganz besonderen Käsekuchen. Sylvia Lott lebt in Hamburg-Winterhude.
Weitere Informationen zur Autorin finden Sie unter
www.facebook.com/Sylvialott.romane.
Von Sylvia Lott bei Blanvalet außerdem lieferbar:
Die Rose von Darjeeling
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet
und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
Sylvia Lott
Die Glücksbäckerinvon Long Island
Roman
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden.
Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
1. Auflage
Taschenbuchausgabe August 2014 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe
Random House GmbH, München.
Copyright © 2014 by Blanvalet Verlag, in der
Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: plainpicture/Folio Images/Tina Axelsson
Redaktion: Margit von Cossart
ES · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-12486-1V002
www.blanvalet.de
Habe ich Dir nicht befohlen:
Sei mutig und stark?
(Josua 1,9)
Prolog – Long Island
Juni 2002
Marie war schon hoch in den Achtzigern, als sie spürte, wie es bei ihr begann. Sie hatte es häufig bei anderen alten Menschen beobachtet. Wie sie mehr und mehr in ihrer Vergangenheit lebten, sich an längst vergessen geglaubte Kindheitserlebnisse erinnerten– und plötzlich durch Konflikte von einst bedrängt fühlten, als duldeten sie keinen weiteren Tag Aufschub mehr.
Zuerst blitzten ganz unvermittelt Bilder und Szenen aus ihrer Kindheit auf, dann auch Szenen aus ihrer Jugend, meist ausgelöst durch aktuelle Ereignisse. An diesem Junitag war es besonders stark. Ein paar Jungen prügelten sich auf dem Gehweg vor ihrem Fenster– und vor ihrem geistigen Auge sah sie eine Rangelei auf dem Schulhof in ihrem Heimatdorf, die über siebzig Jahre zurücklag.
Holt Fräulein Wiemkes!, rief der Lehrer, statt selbst einzugreifen. Marie war damals nur wenige Jahre älter als die Jungen gewesen und erteilte als Aushilfslehrerin einmal in der Woche in der Dorfschule Handarbeitsunterricht. Sie war bestimmt nicht kräftig, aber sie brauchte sich nur vor das balgende Knäuel zu stellen, einmal »Hey, Jungs, seid doch vernünftig!« zu rufen, dann hielten sie beschämt inne, und es herrschte wieder Frieden. Marie schaute jeden Einzelnen an, nicht vorwurfsvoll, sondern eher ernst, vernünftig. Wie man eben so guckte, wenn man sagen wollte: Das hast du doch überhaupt nicht nötig, lass doch den Unsinn. Diese Wirkung hatte Marie schon immer auf Menschen gehabt.
Jetzt fielen ihr die ersten Beispiele wieder ein. Wie Werbespots im Fernsehen immer ihre Lieblingsserien unterbrachen, so schoben sich ungebeten immer öfter Einblendungen aus der Vergangenheit in Maries Alltag. Das irritierte sie. Sie hatte ja nichts gegen Erinnerungen, aber doch bitte auf Einladung!
Ihre Haushaltshilfe kam und begrüßte sie. Doch Marie war noch so in Gedanken versunken, dass sie deren Stimme für die einer verstorbenen Nachbarin in Deutschland hielt.
»Marie, ich hab Ärger mit meiner Schwiegermutter. Kannst du mir nicht deinen Käsekuchen backen? Ich bring dir auch die Eier und alle Zutaten.«
Alle Zutaten? Marie lächelte versonnen. Wie viel Aufregung es doch später um die entscheidende, geheime Zutat gegeben hatte…
Du hast deinem jüngsten Bruder seine Zukunft gestohlen, dachte sie dann wie aus heiterem Himmel. Sie versuchte, den Vorwurf wieder in eine dunkle Ecke des Vergessens zu drängen– es war lange her. Aber er bohrte sich in ihren Kopf und zwang sie zu weiteren unangenehmen Überlegungen. Sein Leben wäre völlig anders verlaufen, wenn sie damals nicht… Grollte ihr Jonny, wie sie ihn nannte, seit sie in Amerika lebte, noch? Nie hatte sie sich getraut, ihn zu fragen. Solche Fragen konnte man nicht in Briefen stellen oder in einem teuren Telefonat über den großen Teich.
Außenstehende sahen es völlig falsch. Man vergaß nicht im Alter, im Gegenteil, man erinnerte sich nur. Mehr als einem manchmal lieb war.
Marie suchte Halt in ihrer täglichen Routine. Um acht Uhr aufstehen, sich waschen und anziehen, die lila getönten Haare frisieren. Noch vor dem Frühstück zog sie sorgfältig ihre Lippen nach und ging an die frische Luft. Wer anfängt, sich zu vernachlässigen, ist schon verloren, lautete eine ihrer goldenen Regeln. Den Weg von ihrem Häuschen zum See pflegte Marie zu Fuß und ohne Rollator zu gehen. Es dauerte immer länger, aber sie schaffte es noch.
So ließ sie sich auch an diesem Junimorgen auf der von Linden beschatteten Holzbank am See nieder, öffnete einen Stoffbeutel mit Brotresten und fütterte die Enten. Es duftete angenehm. Marie sog tief die Luft mit den lieblichen Aromen ein. Sie assoziierte Farben– Hellgrün mit gelblichen Einspritzern. Im kommenden Jahr würde sie neunzig werden. Neunzig!
Die ungebetenen Gedanken ließen ihr keine Ruhe mehr. Ich muss mich mit Jonny aussprechen. Und noch dringlicher: Was wird aus meinem Rezept? Warum habe ich es bislang nicht weitergegeben? Natürlich, wegen Anna. Sie hätte längst, vor Jahren schon, eine Lösung finden sollen. Warum nur hatte sie diese Dinge, die sie so bewegten, so lange vor sich hergeschoben?
Marie schnupperte wieder. Weshalb rollten ihr Tränen die Wangen hinunter? Es war dieser Duft… Er löste etwas in ihr aus, sie spürte ein sehnsüchtiges Ziehen in der Herzgegend. Er roch nach Heimat, Honig und verliebten Küssen… Das altbekannte Heimweh, ihr lebenslanger Begleiter– die Sehnsucht nach zu Hause, nach ihrer Kindheit in Ostfriesland. Heute war sie vermischt mit einer schmerzlichen Vorfreude. Darauf, dass sie bald im Jenseits ihren geliebten Mann, ihre Tochter Anna und hoffentlich auch Tante Frieda, ach, und ihre Eltern und die anderen Geschwister wiedersehen würde. Ich habe solche Sehnsucht nach euch, dachte sie, ich vermisse euch schon so lange…
Die Tränen tropften auf die Weißbrotkugeln in ihrer Hand. Was passierte da mit ihr?
Marie, du lebst nicht ewig, sagte sie sich. Das ist auch gut so. Aber die Zeit drängt. Solange du lebst, solltest du endlich Ordnung schaffen. Klären, was noch geklärt werden muss.
Ihr Kleid knisterte, es haftete an der Bank. Marie legte den Kopf in den Nacken und blinzelte nach oben. Ach, das war’s! Die Linden blühten, wie wunderbar! Zum ersten Mal! Sie hatte sie pflanzen lassen, als sie vor Jahren ihren Ruhesitz auf Long Island bezog, obwohl der Gärtner sie gewarnt hatte, dass es lange dauern könnte, bis sie blühen würden. Jetzt versprühten die Linden ihren Nektar. Und wie sie dufteten! Marie atmete noch einmal tief durch. Genau wie früher…
Eilig wackelte sie dann zurück in ihr Haus. Sie suchte das Luftpostbriefpapier, setzte sich auf ihre Veranda und schrieb einen Brief an ihren einzigen noch lebenden Bruder, an Jonny in Deutschland. Dieses Mal hielt sie sich nicht mit dem üblichen Geplänkel– dem Dank für den letzten Brief, irgendwelchen Glückwünschen nachträglich und guten Wünschen im Voraus– auf, sondern kam gleich zur Sache.
Lieber Jonny,
im nächsten Mai werde ich nun neunzig Jahre alt. Es wäre mein allerschönstes Geschenk, wenn wir zwei uns noch einmal wiedersehen könnten. Willst Du mich nicht besuchen kommen? Bitte versprich mir, dass Du ernstlich darüber nachdenkst.
Platz habe ich genug, eine Begleitperson könnte im Gästehaus unterkommen, falls Du jemanden mitbringen möchtest. Ich schreibe Dir früh, damit Du Zeit genug hast zu buchen.
Auf ein baldiges Wiedersehen hoffend grüßt Dich
Deine Schwester Marie
Marie ging an ihren Wohnzimmerschrank. Sie suchte ein Foto von ihrem Häuschen, das sie dem Brief beilegen wollte. Ihr jüngster Sohn, der in Florida lebte, hatte bei seinem letzten Besuch schöne Aufnahmen gemacht. In einer großen alten Pralinenschachtel hob sie die Fotos auf, die sie irgendwann, wenn sie einmal Zeit hatte, sorgfältig in ein Fotoalbum einkleben wollte. Marie lachte auf. Wenn sie einmal Zeit hatte… Wann würde das je sein?
Plötzlich hielt sie ein altes Foto von sich selbst in den Händen. Ihr fiel ein, dass es sich neulich aus einem alten Album gelöst hatte. Es musste aus ihren letzten Monaten in Deutschland stammen, aus dem Jahr 1932. Aufmerksam studierte Marie das nachträglich colorierte Bild wie das einer entfernten Bekannten.
Die Neunzehnjährige mit den kinnlangen blonden Haaren war gut genährt. Das Erste, was auffiel, war ihr Blick. Die tiefliegenden, eng zusammenstehenden hellblauen Augen schauten eindringlich. Sie hatte rosige Wangen und einen hellen Teint, dessen Reinheit vermutlich, außer auf ihre Jugend, auf den Gebrauch von Regenwasser zurückzuführen war. Marie hatte das schmale ovale Gesicht ihres Vaters geerbt, auch den Mund mit der ausgeprägten Oberlippe, und seinen entschlossenen Ausdruck, allerdings nicht dessen Strenge. Von der Mutter hatte sie die hohen Wangenknochen. Dass ihr damals schon gern mal der Schalk im Nacken saß, verriet diese Aufnahme nicht– sie blickte ernst. Dass man für Fotos lächelte, hatte Marie erst in Amerika gelernt. Aber wie alle Wiemkes-Kinder besaß sie von Natur aus ein offenes Lächeln, das sie den meisten Menschen auf Anhieb sympathisch machte.
Marie legte das Foto zur Seite. Wie hübsch– und wie naiv sie gewesen war! Wie viel von dieser Frau mochte heute noch in ihr stecken? War man am Ende seines Lebens ein ganz und gar anderer Mensch als am Anfang?
Sie legte sich auf ihr Sofa und schloss für einen Moment die Augen. Ja, es existierte immer noch eine geheimnisvolle Verbindung zwischen der jungen und der alten Marie. Die Enten, die duftenden Linden… ein Junitag, der viele Jahrzehnte zurücklag… Sie sah ihn genau vor sich– so deutlich als wäre alles erst gestern geschehen.
Long Island
Mai 2003
Schon vor meiner Einschulung habe ich oft auf der Kanalbrücke am Ortsausgang gestanden und sehnsüchtig den Autos nachgeschaut, die unser kleines Moordorf verließen. Vielleicht hielt ja endlich mal einer an und nahm mich mit? Hinaus in die große weite Welt! Nach Oldenburg … Oder noch weiter, nach Bremen. Oder in die richtig weite Ferne bis nach Amerika, wohin die älteren Geschwister meines Großvaters vor langer Zeit, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, ausgewandert waren, um ihr Glück zu machen. Sie schickten regelmäßig Fotos und Briefe aus den Vereinigten Staaten. Obgleich ich sie nur selten zu Gesicht bekam, wuchs ich doch mit ihnen auf, sie prägten mein Leben.
Und nun befand ich mich tatsächlich auf dem Weg zu ihnen, oder, um genau zu sein, zu meiner Großtante Marie. Rona, hatte mein Großvater erst vor wenigen Wochen gesagt, ich würde gern zum neunzigsten Geburtstag meiner Schwester nach Amerika fliegen. Willst du mich nicht begleiten? Mir ging es gerade ziemlich schlecht, privat und beruflich. Vielleicht bringt die Reise mich auf andere Gedanken, hatte ich gedacht und deshalb Ja gesagt. Ich war mir sicher, dass wir drei sehr intensive Wochen miteinander erleben würden.
Nun saßen wir schon einige Stunden im Flieger, der uns von Hamburg nach New York bringen sollte. Über Neufundland schlief mein Großvater endlich ein. Seit dem Start hatte er von seinem Fensterplatz aus die Welt von oben bestaunt und Fotos gemacht, die vermutlich hauptsächlich den linken Tragflügel in verschiedenen Lichtverhältnissen zeigten. Es war sein erster Flug. Den mit dem zerschossenen Bein, als die Verletzten aus dem Kessel von Stalingrad geflogen wurden, hatte er gemeint, kann man ja nicht mitzählen, damals war ich bewusstlos.
Die Nacht zuvor hatten wir in meinem Hamburger Loft verbracht, schon dort hatte mein Großvater vor Aufregung kaum geschlafen. Gut, dass er vor der Reise bei seinem Hausarzt gewesen war, sonst hätte ich mir vielleicht langsam Sorgen um seine Gesundheit gemacht. Doch der Doktor hatte ihm bestätigt: »Johann Wiemkes, du bist fitter als mancher Sechzigjährige.«
Ich hörte Opa leise und regelmäßig schnarchen, ich selbst konnte überhaupt nicht schlafen. Denn ich war wütend. Immer noch. Es hörte gar nicht wieder auf. Ein dicker Wutball rotierte in meinem Bauch. Unsere Medizinredakteurin hatte einmal in einer Themenkonferenz erklärt, scheinbar grundlose Wut sei das vorherrschende Gefühl der Wechseljahre. Unser Gehirn fängt Feuer, hatte sie referiert. Die Hormone sorgen dafür, dass im Hirn ähnlich wie in der Pubertät die Leitungen umgestöpselt werden.
Begannen jetzt etwa schon meine Wechseljahre? Frechheit! Dafür fühlte ich mich mit Mitte vierzig noch viel zu jung.
Abgesehen davon hatte ich sehr berechtigte Gründe, wütend zu sein. Ich hatte vor Kurzem meinen Job als Fotochefin eines Frauenmagazins verloren. Ohne Vorwarnung war ich von der Überholspur in einer Sackgasse gelandet und hatte keine Ahnung, wie und wohin es weitergehen sollte. Der Rauswurf nagte noch gewaltig an mir, auch wenn ich mich inzwischen mit dem Verlag auf eine Abfindung geeinigt hatte. Wie konnten die nur einfach so auf mich verzichten? Wegen einer neuen Anstellung hatte ich schon mal meine Fühler ausgestreckt und nur Entmutigendes erfahren. Die alte Clique aus meiner Zeit als freie Fotografin, die ich, zugegeben, in den zurückliegenden beiden Redaktionsjahren sehr vernachlässigt hatte, existierte praktisch nicht mehr. Ein Kollege war nach Berlin zu seiner Wochenendbeziehung gezogen, weil er so wenigstens die Miete sparen konnte. Ein anderer, einst Vielflieger mit diversen Business-Lounge-Zugangsberechtigungen, war in seine schwäbische Heimat zurückgekehrt, um nun für die regionale Tourismuszentrale zu arbeiten. Eine Kollegin hatte in Hamburg eine Tagesbar mit Galerie eröffnet, die sich aber nicht rentierte. Eine andere war nach einer Auszeit in Australien dabei, in einem Bauernhaus an der Ostsee ein Yogastudio zu eröffnen. Von den vielen arbeitslosen Journalisten, die nun fast alle irgendetwas mit Coaching versuchten, hatte mindestens jeder Zweite geheiratet. Offenbar brachte die Krise locker verbandelte Paare enger zusammen. Alle, außer Robert und mich! Ich musste die Hand auf meine blubbernde Galle legen, um sie zu besänftigen.
Noch wütender als auf die Redaktion, den Verlag oder die Krise im Allgemeinen war ich schließlich auf Robert. Auf diesen undankbaren, faulen, schwanzgesteuerten Betrüger! Natürlich auch auf seine kurzhaarige Schlampe!
Andererseits, so lange wie mit Robert war ich noch nie mit einem Mann zusammen gewesen. Deshalb wollte ich jetzt nichts überstürzen, sondern in Ruhe ergründen, wie viel gekränkte Eitelkeit in meiner Wut steckte und ob es sich lohnte, um unsere Beziehung zu kämpfen.
Wir befanden uns im Landeanflug. Ich schloss die Augen.
Tante Maries ältester Sohn Jim und seine Frau Cora holten meinen Großvater und mich am JFK-Airport in New York mit einem schicken Geländewagen ab und fuhren uns in das Easy Village genannte Rentnerdorf auf Long Island, in dem Tante Marie seit dem Tod ihres Mannes lebte. Mein Großvater saß vor mir. Seine großen Ohren leuchteten rot vor Aufregung. Fünfunddreißig Jahre lag die letzte Begegnung der Geschwister zurück.
»Mom hätte euch gern hier schon in Empfang genommen. Aber sie ist nicht mehr so mobil und wartet zu Hause auf euch«, erklärte Jim, ein gut aussehender grauhaariger Mann, der als Arzt gearbeitet hatte und jetzt im Ruhestand lebte.
Ich fühlte mich zerschlagen, die Klimaanlage im Auto gab mir den Rest. Aber mein Großvater war wieder hellwach, Entdeckerfreude und Neugier blitzten aus seinen Augen, und er zeigte sich hervorragend vorbereitet.
»Long Island ist hundertneunzig Kilometer lang und bis zu zweiunddreißig Kilometer breit«, erklärte er mir. »Was sie dieHamptons nennen, das ist ein fünfzig Kilometer langer Landstrich mit einem Dutzend Ortschaften an der Ostspitze der Insel. Viele von denen enden auf -hampton, wie Southhampton oder Westhampton.«
Ich nickte gelehrig. Zwei- oder dreimal war ich für Fotoreportagen auf Long Island gewesen, einmal in einem Ferienhaus im Shabby Chic, und das andere Mal in einem supercoolen Designerhaus. Jedes Mal hatte der schreibende Kollege die Termine so eng gesetzt, dass keine Zeit für Verwandtenbesuche geblieben war.
»Verstehe. Westhampton und Southampton, das ist so wie Westrhauderfehn oder Südrhauderfehn.«
»Genau«, Großvater schmunzelte. »Nur kosten die Häuser und das Land hier etwas mehr.«
Jim verstand Deutsch, doch er konnte es nicht sprechen, und so übersetzte ich, als er aufzählte, welche Promis Sommerhäuser in den Hamptons besaßen, eine beeindruckende Liste von Millionären, Künstlern, Designern, Schauspielern. Seine Frau berichtete stolz, dass sie neulich im Kino neben Barbra Streisand gesessen habe. Sie bot sich an, uns das Walfängermuseum in Sag Habour zu zeigen und mit uns und Tante Marie bis an die äußerste Spitze der Insel zu fahren, zum Leuchtturm von Montauk. »Der ist wirklich ururalt«, sagte Cora begeistert, »von 1797! Wir wandern dort gern.«
Der Höhepunkt, so versprach Jim, würde das Festessen zum neunzigsten Geburtstag seiner Mutter im früheren Restaurant seiner Eltern in den Hamptons sein.
»Wir haben es verpachtet, es ist immer noch in Betrieb, direkt am Wasser gelegen. Alle Verwandten werden kommen, es wird eine große Familienfeier.«
Cora nickte. »Und es hat immer noch eine hervorragende Küche!«
Ich hoffte inständig, dass ich nicht jeden Tag diesen ominösen Käsekuchen würde essen müssen, von dem ich immer wieder gehört hatte. Wenn der nur halb so gehaltvoll war wie die selbst gemachte Buttercremetorte meines Großvaters, dann würde ich die nächsten drei Wochen nicht überleben.
Je länger wir fuhren, desto ländlicher wurde die Umgebung. Manchmal konnten wir einen Blick auf den Atlantik und endlos lange Sandstrände werfen, dann wieder kamen wir durch gemütliche Ortschaften mit Boutiquen und Cafés.
»Das waren früher Fischerdörfer«, erklärte Cora, die ebenfalls als Ärztin gearbeitet hatte. »Heute liegen hier mehr Segelboote als Kutter.«
Wir streiften Naturschutzgebiete und durchquerten weite Kartoffeläcker. Am Straßenrand boten Farmer ihr Obst, Gemüse und selbst gemachte Marmelade zum Verkauf an.
Endlich hielt Jim vor einem eingezäunten parkähnlichen Areal an einem Schlagbaum. Er winkte dem Uniformierten in einem Kontrollhäuschen zu. Der erkannte ihn, salutierte und ließ die Schranke hochfahren. Bremsschwellen auf der Straße sorgten dafür, dass wir nur im Schritttempo durch Easy Village rollen konnten, ein Bilderbuchdorf für gut betuchte Menschen im Ruhestand. Weiße Holzhäuschen, Gemeinschaftseinrichtungen in einheitlichem Stil, Swimmingpool und ein Golfplatz – eingebettet in gepflegte Gartenanlagen.
»Hier brauchen ältere Herrschaften keine Angst vor Einbrüchen oder Überfällen zu haben«, erklärte Jim. »Je nach Bedarf stehen auch Ärzte und Pfleger bereit. Es gibt Putz- und Gartenhilfen. Ich bin wirklich froh, dass Mom hier lebt. Sie ist weiter selbstständig, aber bestens versorgt.«
Jim parkte an einem mit Blumenrabatten umpflanzten Rasenrondell. Wir stiegen aus und hörten eine helle Frauenstimme.
»Jonny! Endlich bist du da!«
Auf der Veranda eines hübschen Häuschens saß eine alte Dame mit lilafarbenen, sorgfältig toupierten Haaren, die sich nun umständlich erhob, mit unsicheren Schritten auf uns zuging und meinem Großvater die Arme entgegenstreckte.
»Marie! Mensch, Mariechen!«
Opa Johann eilte die Stufen zum Holzdeck empor, die beiden fielen sich in die Arme, sie drückten sich und küssten sich auf die Wangen. Dann trat mein Großvater zurück, nahm seine Schwester an den Oberarmen, sie schauten sich ungläubig an – und umarmten sich erneut. Ihre Oberkörper schaukelten wie zu einem schwungvollen Walzer. Die Geschwister lachten und weinten gleichzeitig. Marie nahm ihre beschlagene Brille ab.
»Dat wi dat noch beleevt!« Dass wir das noch erleben dürfen … Sie verfielen in die Sprache ihrer Kindheit, das Plattdeutsche.
Opa und Tante Marie hatten die gleichen blauen Augen, die so verblüffend jung wirkten und in denen jetzt Freudenfünkchen tanzten. Sollte ich je Zweifel gehabt haben, ob unsere Reise sinnvoll wäre – dieser Moment hätte sie ein für alle Mal ausgelöscht. Gerührt putzte ich mir die Nase. Cora wischte sich verstohlen über die Augen, Jim tupfte sich Schweißperlen vom Gesicht. Erst jetzt wurde mir bewusst, wie heiß es hier Mitte Mai schon war. In der schwülen Luft lag der Geruch von frisch gemähtem Rasen, von Ozon und Meer, obwohl der Sund noch einige Kilometer entfernt lag.
»Und du bist Rona. Herzlich willkommen!«
Tante Marie umarmte mich. Ich mochte sie auf Anhieb und war entzückt von ihrem Parfüm. Sie roch wie damals bei ihrem letzten Deutschlandbesuch in den späten Sechzigerjahren. Diesen Duft hatte ich bewundert und später vergeblich in den Duty-free-Parfümerien dieser Welt gesucht.
»So, nun aber rein mit euch!«, sagte Tante Marie.
Für fast neunzig hielt sie sich recht gut. Das fiel mir gleich auf. Ein sommerliches Hemdblusenkleid umspielte locker ihre breiten Hüften und die schmalen vorgebeugten Schultern. Tante Marie führte uns ein wenig herum, ihr Drei-Zimmer-Häuschen war hell und stilvoll eingerichtet. An den Wänden hingen ausdrucksstarke Ölgemälde – Seestücke und Blumenstillleben. Sie hatte sich mit Absicht verkleinert, wie sie betonte. Man müsse sonst nur mehr putzen und fühle sich in einem kleinen Haus doch weniger einsam, hatte sie uns erklärt. Aber es war nicht schwer herauszuhören, dass sie ihr Haus direkt am Meer vermisste.
Für ihren Bruder hatte sie ihr Gästezimmer hergerichtet, ich wurde in ein Apartment im Gästehaus des Easy Village ganz in der Nähe einquartiert. Jim half mir, mein Gepäck dorthin zu bringen. Anschließend saßen wir in Tante Maries Wohnzimmer beisammen. Sie betrachtete mich aufmerksam.
»Ich freue mich so, Rona, dass du mitgekommen bist«, sagte sie bewegt, mit amerikanischer Färbung im Tonfall, und tätschelte meine Hand. »Du hast Ähnlichkeit mit meiner Mutter Tabea. Nicht die Haare, aber das Gesicht und manchmal der Ausdruck in den Augen … Es ist seltsam, in einem jüngeren Menschen etwas von der eigenen Mutter wiederzufinden.«
Sie wies auf ein altes Foto auf ihrem Sekretär, das ich kannte. Im Gegensatz zu Tabea mit ihrem strengen Dutt trug ich meine mittelblonden schulterlangen Haare meist offen.
Der Vergleich mit meiner Urgroßmutter war mir zwar nicht ganz unbekannt, stimmte mich aber irgendwie schüchtern. Man fühlt sich auf einmal verantwortlich für die Gemütslage desjenigen, der jemand anderen in einem sieht. Und außerdem wollte ich Tabea posthum keine Schande machen. So verhielt ich mich anfangs zurückhaltender, als es sonst meine Art ist.
In den ersten beiden Tagen, als Tante Marie und Opa sich tausend Dinge erzählten, beschlich mich das Gefühl, ihre Geschichten gingen nur sie etwas an, und ich zog mich häufig zurück. Während meiner Spaziergänge durch das seltsame, gut abgeschirmte Rentnerdorf erhielt ich Dutzende SMS von Robert. Mein Herz blutete, aber ich antwortete nicht.
Ich dachte wieder an das Ende unserer letzten Aussprache in Hamburg. Wir hatten uns so angebrüllt, dass wir schließlich beide weinend auf dem Fußboden hockten, unfähig, eine Entscheidung zu treffen.
Ich wollte erst mal mit meinem Großvater in die USA reisen. Der Abstand würde hoffentlich einiges klären. Aber hier und jetzt auf Long Island merkte ich, dass ich noch nicht bereit war, über unsere Beziehung nachzudenken. Es tat einfach zu weh.
»Bleib doch bei uns, Rona«, forderte mich Tante Marie am dritten Tag auf. Sie saß mit ihrem Bruder beim Nachmittagstee auf der überdachten Veranda. »Es ist gut, dass noch einer in der Familie die alten Geschichten kennt, wenn wir einmal nicht mehr da sind.« Ich nahm in einem bequemen Korbsessel Platz. »Wir sprachen gerade über die Familie von Imke Wilken.«
Ich zuckte mit den Achseln. »Die kenn ich nicht.«
Ich war schließlich in einer Ortschaft zwanzig Kilometer entfernt von Südrhauderfehn aufgewachsen, wo meine Eltern ein Textilgeschäft hatten, und war immer nur zu Besuch oder in den Ferien bei meinen Großeltern im Elternhaus meiner Mutter gewesen – das allerdings sehr gern.
»Wilken«, sagte mein Großvater mit Nachdruck, als müsste ich mich erinnern, »das sind die mit dem verwilderten Fehnhaus!«
»Ach«, jetzt fiel bei mir der Groschen, »diese seltsame Familie, die völlig zurückgezogen lebte, und deren Haus am Ende nur noch vom Efeu zusammengehalten wurde – meint ihr die?«
»Genau. Sie haben eine Tochter verloren«, erklärte Tante Marie, »Imke war ihr Name.«
»Deshalb sind ihre Eltern und die Schwester so komisch geworden«, fügte mein Opa hinzu.
»Ich hab Imke gekannt, sie war derselbe Jahrgang, wir haben zusammen im Chor gesungen.«
»Die Familie ist nie darüber hinweggekommen. Das muss Anfang der Dreißiger gewesen sein. Der Sommer, bevor du nach Amerika bist, oder?«
Ernst schaute Tante Marie in eine imaginäre Ferne. »Ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag«, sagte sie bedächtig. »Ich weiß sogar noch, dass es ein Dienstag war, ein Dienstag im Juni 1932 …«
»… und du warst in den lüttje Schoolmester verliebt.«
Tante Marie nickte.
Ostfriesland
Juni 1932
Eigentlich hasste Marie das frühe Aufstehen, die Kälte, das schwere Schleppen, den intensiven Viehgeruch schon vor dem Frühstück. Aber an diesem Morgen machte ihr das Melken überhaupt nichts aus. Sie hatte vor Aufregung kaum schlafen können und war froh gewesen, dass sie in aller Herrgottsfrühe nach draußen hinaus auf die Weide konnte, um die beiden Kühe ihrer Familie und die drei bei ihnen – gegen die Hälfte der Milch – untergebrachten Kühe eines Nachbarn zu melken.
Als Marie die Stalltür neben dem großen Scheunentor öffnete, um ihr Fahrrad hinauszuschieben, leuchtete ihr der Himmel durch den Türrahmen wie ein Gemälde entgegen. Am Horizont über dem Hochmoor kündigte ein ins Lachsrosa spielender Streifen den Sonnenaufgang an, während hoch oben am Firmament noch einige Sterne klar und golden im samtigen Nachtblau funkelten. Die ersten Vögel tirilierten, Amsel, Rotkehlchen, Zaunkönig. Marie nahm die Stimmung als gutes Zeichen. Der liebe Gott war auf ihrer Seite, Schwierigkeiten würde ihr wahrscheinlich nur ihr Vater bereiten. Marie atmete tief durch. Vielleicht schätzte sie ihn falsch ein, vielleicht zeigte ihr Vater ja Verständnis oder wenigstens Einsicht. Und überhaupt, noch hatte der neue Junglehrer sie nicht einmal geküsst. Aber tief in ihrem Innern wusste Marie, dass bald etwas passieren würde. Sie war erst neunzehn und hatte wenig Erfahrung mit Männern. Doch so etwas spürte man einfach.
Der gut ausehende Rudolf Meiners unterrichtete seit dem Winter an der Dorfschule. Seine sanften grauen Augen konnten sie mit einem Blick über die Köpfe der Schüler hinweg so streicheln, dass ihr die Härchen an den Unterarmen und im Nacken zu Berge standen. Manchmal glomm darin auch etwas ganz und gar nicht Sanftes, sondern etwas Geheimnisvolles, Feuriges, das Unruhe in ihr auslöste. Marie seufzte sehnsüchtig. Ach, Rudolf. Rudolf Meiners – Marie Meiners … wie herrlich das klang, das passte doch perfekt!
Die Luft roch nach taufrischem Grün und süßlich nach Lindenblüten. Acht Lindenbäume standen um das Vorderhaus herum. Ihre Kronen, rechteckig beschnitten, gingen ineinander über, waren miteinander verflochten und verwachsen – wie Liebende. Und alle Blätter sahen aus wie Herzen. Noch ein Zeichen, dachte Marie lächelnd. Natürlich wusste sie auch, dass Linden viel Wasser brauchten und den Grundwasserspiegel niedrig hielten, dadurch versackten die Häuser in dieser moorigen Gegend nicht so leicht. Jeder Moorkolonist hatte Linden um sein Haus gepflanzt. Ob Rudolf wohl einmal ein Herz mit ihrer beider Initialen in eine Rinde schnitzen würde?
Die beiden großen Milchkannen schepperten an Maries Fahrrad, als sie auf dem Trampelpfad zur Weide fuhr. Sie machte ihre Fahrradlampe nicht an, um Karbid zu sparen. Marie kannte den Weg ohnehin in- und auswendig.
Bodennebel schwebte über den sattgrünen Weiden. Aprikosenfarbene Schwaden tanzten zwischen Wiesenkerbel und Lupinen an den Gräben rechts und links des schmalen Grundstücks. Sie verwandelten auch das Unterholz in fernen Wallhecken zu Kulissen für märchenhafte Begegnungen zwischen Feen und Erdmanntjes. Kurz bevor das Hochmoor begann, schimmerten die Umrisse der aufgestapelten Torfstücke durch den Dunst wie schwarze Iglus. Bei dem Wetter würde es wohl noch dauern, bis sie getrocknet waren. Wenigstens besaß ihre Familie eine kleine Lore für den Transport und musste den getrockneten Torf nicht die gesamte Strecke bis zum Kanal mit der Schubkarre schieben.
»Muuh!«
Die schwarzbunten Kühe kamen Marie schon entgegen. Sie sprang vom Rad, stapfte in den Holzschuhen, die sie mit dicken selbst gestrickten Wollsocken trug, durch den Matsch, kroch durch das hölzerne Gatter und stellte den Schemel, der wie immer im Melkunterstand neben einem Melkeimer parat lag, an die Seite der ungeduldigsten Kuh. Es war noch empfindlich kalt und etwas windig. Fröstelnd zog Marie den grauen Wollmantel enger um sich.
Die Tiere begrüßten sie mit freundlichen Kopfstupsern, ihre Leiber dampften vor Wärme.
»Guten Morgen, ihr Schönen!«
Marie klopfte jeder Schwarzbunten den Hals, drängte die Tiere etwas zurück. Wie immer rieb sie sich die Hände mit Melkfett ein und stellte den Eimer unter das pralle Euter, bevor sie sich breitbeinig hinhockte. Sie raffte den Rock, stopfte ihn von vorne unters Gesäß, dann klemmte sie den weiß emaillierten Eimer fest zwischen ihre Oberschenkel. Beherzt griff Marie mit beiden Händen um zwei Zitzen, und die Milch traf mit scharfem, rhythmisch wechselndem Strahl den Eimer an seiner Innenwand, sodass er eine blecherne Musik von sich gab. Ru-dolf, Ru-dolf, Ruu-dolf …
Die anderen Kühe mampften zufrieden das von Löwenzahn durchsetzte Gras und käuten es hingebungsvoll wieder. Die gemolkene Kuh schlug mit ihrem Schwanzende nach einem Insekt und traf Marie am Kopf. Sie tastete nur einmal kurz mit der Hand nach ihrer Frisur – sie hatte ihr Haar am Tag zuvor mit Wellenreitern geformt –, aber sie ließ sich nicht aus der Stimmung bringen. Dort hinten, wo jetzt orangegolden glühend die Sonne aufging, lag der tote Arm des Flusses, auf dem sie und Rudolf sich zum ersten Mal nähergekommen waren.
Es war im Februar gewesen. Die Kanäle, alle überfluteten Weiden und viele Flüsse waren zugefroren. Das junge Volk aus der Nachbarschaft und einige frühere Schulfreundinnen hatten Marie am Abend abgeholt, zum Mondscheinschöfeln. Marie hatte sich ihre von einem Kunstschmied aus Breinermoor gefertigten Schlittschuhe über die Schulter gehängt, sie am Ufer fix um die Schuhe geschnürt, und dann waren sie gemeinsam bei Vollmond übers Eis gelaufen. Marie lehnte ihren Kopf gegen den warmen Bauch der Kuh und schloss die Augen. Während sie unermüdlich weitermolk, erlebte sie diese Nacht noch einmal wie schon so oft seitdem.
Sie, ihre Freundin Soffie und Imke machten den Anfang. Nach alter Sitte verschränkten sie ihre Arme vor dem Bauch, reichten einander überkreuz die Hände und liefen auf drei mit dem rechten Bein los. Auf diese Art verbunden, konnten sie elegante Kurven ziehen und dabei je nach Bedarf wie eine menschliche Ziehharmonika den Abstand zwischen sich verändern. Unter Johlen und Gelächter schlossen sich rechts und links an den Seiten immer mehr Läufer an, junge Männer, Mädchen und Frauen. Schließlich glitten sie zu zwölft im Gleichklang mit langen, weiten Schritten übers Eis. Der Vollmond beleuchtete die Eisfläche, ab und zu schoben sich Wolken geheimnisvoll davor, doch das Licht reichte völlig aus. Am Ufer stand Bernd Engelius an einem Lagerfeuer und spielte auf seinem Akkordeon Tanzmusik. Und sie fühlten sich wie ein Schwarm, wie ein einziger Körper … Marie spürte die frische klare Luft bis tief in die Lunge. Die Bewegung und der dicke Schafwollpullover unterm Mantel sorgten dafür, dass sie nicht fror. Es war wie in einem schönen Traum.
Schließlich ermüdeten einige aus der Zwölferkette und gaben auf, andere liefen zu dritt oder oder fünft oder paarweise weiter. Es hatte, ebenfalls nach alter Sitte, nichts zu bedeuten, mit wem man lief. Es verpflichtete niemanden zu irgendetwas. Aber natürlich flüsterten die Mädchen und die alten Weiber später immer noch tagelang darüber, wer mit wem …
Plötzlich waren von der Läuferkette nur noch zwei Personen übrig: der neue Lehrer und Marie. Er machte eine galante Verbeugung, als wolle er sie zu einem richtigen Tanz auffordern. Gleich darauf fand sich Marie auch schon in seinen Armen wieder, vom Ufer klang jetzt der Schneewalzer herüber, und sie drehten sich im Dreivierteltakt auf der weiten Eisfläche. Wie gut sie miteinander harmonierten! Als hätten sie schon viele Winter lang zusammen getanzt. Rudolf Meiners lachte sie voller Begeisterung an, Marie fühlte sich ganz leicht und einfach wunderbar.
Einige Pärchen verschwanden zeitweilig hinter dem mannshohen Reet. Bei diesen Temperaturen konnte nicht viel passieren. Doch die roten Wangen, die man hinterher am Lagerfeuer beim Punsch und noch später in den Wohnstuben beim Ostfriesentee sah, waren wohl nicht nur auf die Temperaturunterschiede zurückzuführen gewesen.
Der Kuhschwanz streifte Marie erneut und holte sie zurück in die Gegenwart. Sie seufzte erwartungsvoll. Rudolf Meiners hatte sich ihr gegenüber ganz und gar anständig verhalten. Aber in dieser Nacht hatte sich zwischen ihnen eine zarte, angenehm kribbelnde Spannung aufgebaut, die sich seither mit jeder Begegnung verstärkte. Einmal in der Woche sahen sie sich, jeden Dienstag, wenn Marie als Aushilfslehrerin den Mädchen in der Dorfschule Handarbeitsunterricht erteilte. Und heute war Dienstag.
»Du bist früh dran«, sagte ihre Mutter verwundert, als Marie die kleine Wohnküche betrat. Es roch nach Apfelpfannkuchen mit Speck. Tabea Wiemkes stand am blank geputzten Eisenherd und ließ noch eine Kelle Teig in die Pfanne fließen. Sie warf einen Blick durchs Fenster über die Buchsbaumhecke auf den Sandweg, der parallel zum Kanal verlief. »Die Milchkannen stehen ja schon vorm Haus.«
Marie lächelte. »Ooch, ich konnte nicht mehr schlafen.«
»Du hast Flöhe im Bett, gib’s zu!«
Ihr jüngster Bruder Johann, ebenso blond und blauäugig wie sie, saß schon am Frühstückstisch. Marie schnitt ihm eine Grimasse, während sie ihre kalten Hände über dem Herd rieb. Der Teekessel begann zu summen, sein heller Ton vermischte sich mit dem Ticken der Pendeluhr über dem Sofa.
»Warum hast du denn deine Haare heute gekniffen?«, zog Johann sie weiter auf. »Waren sie nicht brav?«
»Das trägt man jetzt so!«
Marie setzte sich mit Absicht schwungvoll neben ihn auf das kleine Friesensofa. Die Sprungfedern waren so elastisch, dass ihrem Bruder der Happen von der Gabel sprang. Marie kicherte, und er stach im Spaß mit der Gabel in der Luft nach ihr.
»Kinder, lasst den Unsinn! Esst, bevor die Pfannkuchen kalt werden«, mahnte die Mutter.
Ernst und gottesfürchtig sollten sie sich betragen. Das verlangte der Vater stets von ihnen. Mit verhaltenem Schmunzeln schmierte Tabea für Johann Brote zum Mitnehmen. Zwischendurch schob sie mit dem Feuerhaken Eisenringe zur Seite, stocherte in der Glut und legte Torf nach.
Marie rollte sich für später einen Pfannkuchen in Pergamentpapier ein. »Ich hab jetzt keinen Hunger.«
Besorgt warf ihre Mutter ihr einen Blick zu. »Du wirst doch nicht krank?«
Doch Maries Anblick schien sie zu beruhigen, jedenfalls entspannten sich ihre Züge gleich wieder.
Johann angelte sich den Pfannkuchen seiner Schwester. »Wenn sie nicht will, nehm ich den. Marie hat doch genug Speck auf den Rippen!«
»Genau. Die Frauen in den Versandkatalogen sind alle viel schlanker als ich.«
»Unsinn! Du bist genau richtig«, widersprach die Mutter. »Falls du krank wirst, muss dein Körper von etwas zehren können.«
»Johann könnte auch nur von Luft und Liebe leben, nicht?«, frotzelte Marie.
Ihrem Bruder flogen die Mädchenherzen zu, obwohl er erst siebzehn war. Schon jetzt wurde er oft »der flotte Jonny« genannt.
Die Mutter bereitete ihm nun noch eine Thermoskanne mit Malzkaffee zu. Johann ging dem Besitzer der Fahrradwerkstatt im Dorf zur Hand. Eine Lehre konnten sie sich nicht leisten, dafür hätten sie bezahlen müssen. Aber der jüngste Sohn war geschickt und lernte mit den Augen, er guckte sich einfach alles ab – und erhielt als Hilfsarbeiter sogar einen kleinen Lohn, von dem er den größten Teil zu Hause als Kostgeld ablieferte. Marie ging, abgesehen von den Dienstagen in der Schule, der Mutter in Haus und Hof zur Hand.
»Die Kühe geben gut Milch, mehr als sonst«, sagte Marie. »Darf ich was für Jantje Mö und für ein paar Schüler mitnehmen?«
Normalerweise verkauften sie die Milch, die sie nicht selbst brauchten. Das brachte ein bisschen Bargeld in die Kasse, für Tee, Kandis, Zucker oder Kernseife und andere Dinge, die sie nicht selbst erzeugten.
»Ja, nur zu.«
Die Mutter drückte beide Augen zu. Sie wischte ihre feuchten Hände an der Schürze ab, wie immer eine selbst genähte dunkelblaue mit winzigen weißen Pünktchen darauf. Und wie immer trug sie darunter ein sackartig geschnittenes dunkles Kleid, das bis zu den Knöcheln reichte. Sie war vor der Zeit gealtert, doch sie besaß, was man »die Schönheit des Alters« nannte. Hohe Wangenknochen prägten ihr breites Gesicht mit der kurzen Nase, ein Strahlenkranz aus Falten umgab ihre meist gütig blickenden hellblauen Augen, die in einem bestimmten Licht fast türkisfarben wirkten.
»Ach, die arme Jantje Mö…«, murmelte sie, während sie mit der Linken eine Haarsträhne um den grauen Haarknoten hoch am Hinterkopf wickelte und mit der Rechten Tee in die zierliche Tassen schenkte.
Der Blick der Mutter sagte Marie: Das mit der Milch müssen wir Vater ja nicht unbedingt erzählen. Marie verstand auch ohne Worte.
»Wann kommt Vater eigentlich zurück?«, fragte sie nun.
Er transportierte mit seinem Muttschiff getrockneten Torf als Brennmaterial für die Ziegeleien nach Leer und ins Rheiderland, auf der Rücktour brachte er wahrscheinlich wieder Schlick als Dünger mit.
»Wenn alles gut läuft, ist er Freitag wieder da«, meinte die Mutter, während sie sich in ihren Lehnstuhl an die Stirnseite des Tisches setzte.
Manchmal kam dem Vater etwas dazwischen. Wenn zum Beispiel tagelang Flaute war und kein Wind die braunen Segel blähte, dann brauchte er jemanden, der ihm beim Treideln half. Früher hatten Tabea und die Kinder das sechzehn Meter lange und vier Meter breite Schiff vom Ufer aus gezogen. Marie war froh, dass sie das nicht mehr tun musste. Das Torfstechen allein war schon Knochenarbeit, doch das Treideln machte den Menschen krumm und schief. Da taten einem Tag und Nacht das Kreuz, die Schultern und der Nacken weh. Da schmerzten die Hände, weil schnell mal das Tau hindurchrutschte und die Haut verbrannte, wenn man sich auf einem der schmalen Treidelpfade rechts und links der Kanäle mit dem ganzen Gewicht ins Geschirr warf.
Doch auch zu Hause hörte die Arbeit nie auf. Und seit die größeren Geschwister fort waren, musste Marie ihrer Mutter helfen. Die fünfundzwanzig Tagwerke Torf, die ihre Familie laut Vertrag jedes Jahr zu stechen hatte, besorgte die Mutter meist ohne den Vater, der ja mit dem Schiff unterwegs war. Fast den ganzen Sommer über war sie damit beschäftigt, die schweren feuchten Torfstücke zum Trocknen in endlos langen Reihen zu stapeln. Natürlich arbeiteten die Kinder mit und auch Nachbarn, bei denen man sich revanchierte. Meist, indem sie ihnen halfen, die getrockneten, auf Backsteingröße geschrumpften Torfstücke zu hohen runden »Bülten« zusammenzusetzen. Alle Familien hier waren stolz auf das, was sie leisteten. Sie entwässerten mit den anderen Kolonisten die sumpfige Ödnis und trotzten dem Moor fruchtbaren Boden für die eigene Landwirtschaft ab.
Keine Dienstboten, weder Knecht noch Magd zu sein, sondern ihr eigener Herr – das war für Maries Eltern der Antrieb gewesen, sich vor vierzig Jahren um eine der schmalen Parzellen im Moor, um ein sogenanntes Kolonat, zu bewerben. Dafür waren sie aus dem angrenzenden katholischen Oldenburger Münsterland ins evangelische Ostfriesland gezogen, quasi in Feindesland, religiös gesehen. In den weiten Moorgebieten, wo das Dorf Südrhauderfehn entstehen sollte, gab es keine Zivilisation. Zwischen den Kolonaten und der alten Heimat lagen immer noch unwegbare Moore. Man orientierte sich im Alltag an den nächst größeren, schon älteren ostfriesischen Ortschaften wie Westrhauderfehn oder dem Städtchen Leer, wo die Evangelischen überwogen, und wo neben wenigen Katholiken auch einige Juden und Mennoniten, Nachkommen von Glaubensflüchtlingen aus den Niederlanden, friedlich zusammenlebten. Jeden Sonntag gingen die Wiemkes in die katholische Kirche. Sie kamen gut aus mit Andersgläubigen, verhielten sich anständig und verlässlich, suchten jedoch privat deren Nähe nicht. Und wenn man unter sich war, wurde über die anderen gelästert, was das Zeug hielt.
Deshalb war es für Maries Vater auch so ein Schlag gewesen, dass ausgerechnet seine Lieblingsschwester Frieda einen jüdischen Viehhändler in Leer, Jacob Levy, geehelicht hatte. Seitdem verkehrten sie nicht mehr miteinander, sahen sich nur noch bei ganz großen Familienereignissen. Bei einem dieser seltenen Treffen hatte Frieda, die selbst nur Söhnen das Leben schenkte, Marie in ihr Herz geschlossen. Tabea Wiemkes mochte ihre Schwägerin Frieda. Sie glaubte, dass der liebe Gott großzügiger war, als ihr Mann Heinrich annahm. Deshalb erlaubte sie ihrer jüngsten Tochter, ab und an ihre Tante Frieda in Leer zu besuchen.
Maries Mutter meinte, es könnte kaum schaden, wenn sie einen wohlhabenden Haushalt in der Stadt von innen kennenlernte. Und ganz bestimmt könnte es nicht schaden, einen Viehhändler gut zu kennen. Sie alle hatten noch den Steckrübenwinter gleich nach dem Krieg in Erinnerung. Und einen schrecklichen Winter in der Inflationszeit, als der Vater statt mit Geld für den Torf mit einer Ladung Weißkohl nach Hause gekommen war und sie sich monatelang von selbst eingelegtem Sauerkraut hatten ernähren müssen.
Vom Frühjahr bis zum Herbst, wenn ihr Vater unterwegs war, um den Torf zu verkaufen, fuhr Marie alle sechs bis acht Wochen mit der Kleinbahn nach Leer. Tante Frieda steckte ihr stets diskret das Fahrgeld zu. Marie verband die kleine Reise mit Besorgungen für die Schule, besuchte auch manchmal die öffentliche Bücherei. Die Bücher studierte sie im Lesesaal. Sie interessierte sich besonders für Literatur über die Vereinigten Staaten von Amerika und verschlang jedes Buch, jeden Artikel, den sie über das ferne Land in die Finger bekommen konnte.
Johann nahm sich noch zwei Pfannkuchen, über die er zähen dunklen Zuckerrübensirup goss. »Ist keine neue Post von den Amerikanern gekommen?«, fragte er mit vollem Mund. »Wann darf ich denn endlich auch rüber? Wenn ich achtzehn bin?« Natürlich zweifelte er nicht eine Sekunde daran, dass er in den Staaten ein erfolgreicher Geschäftsmann werden würde.
Die Mutter seufzte schwer. Geräuschvoll rührte sie den Kandis in ihrer Teetasse um. Marie entging nicht, dass ihr Tränen in die Augen stiegen. Sie wusste, was ihre Mutter bewegte. Zu Beginn war ihre Ehe nicht mit Kindern gesegnet gewesen. Schließlich hatte sie doch noch insgesamt zehn Töchtern und Söhnen das Leben geschenkt. Nun waren ihr nur Johann und sie, Marie, geblieben, und es war beschlossene Sache, dass auch der Jüngste eines Tages in die USA auswandern sollte. Die Mutter mochte nicht daran denken. Aber es musste sein. Denn in der Heimat hatten junge Leute nicht viele Möglichkeiten. Wenn sie mit vierzehn die Volksschule verließen, konnten die Jungen entweder zur See fahren, bei einem Binnenschiffer anheuern oder Landarbeiter werden. Die Mädchen kamen meist als Haushaltshilfe oder Bauernmagd unter. Die Wirtschaftskrise, die seit zweieinhalb Jahren die ganze Welt im Würgegriff hielt, verschärfte auch in Ostfriesland die Situation noch weiter.
Die Landwirtschaft, die sie nun auf ihrem drei Hektar großen Grundstück betrieben, machte aber nur eine Familie satt, wenn überhaupt. Auch die Fehnschifffahrt hatte ihren Höhepunkt überschritten, ihr Ende zeichnete sich bereits ab. Viele Kolonisten heuerten nach dreißig Jahren Moorarbeit, wenn der Torf auf ihrem Grundstück abgetragen war, als Seeleute auf großer Fahrt an, aber dafür war Heinrich Wiemkes schon zu alt. Auf jeden Fall konnte nur ein Kind Haus und Hof übernehmen.
Eines der Kinder, Magdalena, war schon mit elf Jahren gestorben. Der älteste Sohn, Heinrich junior, war im Weltkrieg gefallen. Die älteste Tochter Katharina rackerte sich als Bauersfrau auf einem kleinen Hof im zehn Kilometer entfernten Saterland ab. Die Drittgeborene, Elisabeth, war schon 1924, frisch verheiratet mit einem aufstrebenden Münsterländer Bauunternehmer, nach Amerika gegangen. Sie fanden ein gutes Auskommen und schrieben, die Geschwister sollten nachkommen, jeder, der fleißig sei, könne es dort zu etwas bringen. So wanderten nach und nach alle Wiemkes-Kinder aus. Engelbert ging als Schwarzbrotbäcker nach Iowa. 1928 segelten Wilhelm und Friedrich nach New York. Beide heuerten auf einem Frachter als Matrosen an, weil sie nicht genügend Geld für die Überfahrt besaßen. Sie gingen illegal von Bord, besorgten sich an Land Arbeit, segelten zurück und wanderten dann regulär mit allen erforderlichen Unterlagen ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten ein. Die beiden betrieben inzwischen, wie sie in ihren Briefen schrieben, einen florierenden Coffee-Shop im Hafen von New York. Nur Lukas blieb in Amsterdam hängen, weil er sich dort in eine Frau verliebte.
»Mutter, ich könnte doch Fritz und Willi in ihrer Kaffeeklappe helfen«, hakte Johann nach. »Bestimmt ist es besser, ich fahre so bald wie möglich. Wenn man jung ist, lernt man fremde Sprachen schneller.«
»Ein oder zwei Jahre mehr oder weniger werden wohl nichts ausmachen«, erwiderte die Mutter, »mit zwanzig kannst du noch ebenso gut lernen.«
Marie schenkte Tee nach und spürte erneut das angenehme Flattern im Bauch. Bald würde sie Rudolf wiedersehen! Sie spürte nicht einen winzigen Hauch von Bedauern mehr darüber, dass alle Geschwister nach Amerika durften, nur sie nicht. Sie sollte ja bei den Eltern bleiben, ihnen im Alter beistehen und später alles erben. Marie konnte einen Haushalt versorgen, außerdem sagte man ihr ein besonders ausgleichendes Wesen nach.
Als sie ein kleines Kind gewesen war, hatte ihre Mutter sie zum Schlafen immer in die Mitte der Geschwisterschar gelegt, weil es dann am wenigsten Streit und Gekabbel gab. Acht Kinder schliefen in einem Zimmer, je zu viert in einer der beiden strohgepolsterten Butzen. Manchmal spürte Marie noch im Traum die warmen Leiber ihrer Geschwister, die Zärtlichkeit und die Knüffe im Halbschlaf, ab und zu das Piksen eines Strohhalms. Wenn ein Kind sich umdrehte, drehten sich die anderen auch. Nie hatte Marie frieren müssen. Selbst wenn am Fenster Eisblumen wuchsen, nicht. Und wie viel Spass sie gehabt hatten! Eine ihrer schönsten Erinnerungen war, wie Willi eine Maus entdeckte, die sich im Bett verirrt hatte, und zuerst die Kinder, dann auch die durch den Lärm geweckten Eltern auf Mausejagd gingen. Mitten in der Nacht rannten sie alle, atemlos keuchend und kichernd von einer Ecke der Kammer in die andere hinter der kleinen Maus her, die immer wieder entwischte – der Vater in Nachtgewand und Zipfelmütze mit einem Besen bewaffnet, die Mutter mit dem Teppichklopfer. Zum Schluss lagen sie alle über- und untereinander in einer Butze und krümmten sich vor Lachen. So unbeschwert wie damals hatte Marie ihren Vater nie wieder erlebt.
Die Uhr schlug siebenmal. Johann sprang auf, er musste sich sputen. Wenn er Glück hatte, nahm ihn der Milchwagen ein Stück zur Arbeit mit.
Marie verabschiedete sich bald nach ihm. Beschwingt radelte sie die fünf Kilometer bis zur Schule auf dem Sandweg immer am Kanal entlang. Während sie zwischen den tiefen Spurrillen wechselte, die die Pferdefuhrwerke hinterlassen hatten, und so manche Pfütze umkurvte, sang sie Küchenlieder vor sich hin und genoss den weiten Blick. Am Horizont tauchte mal ein Kirchturm, mal eine Windmühle auf. An der zweiten Inwieke, einem der Entwässerungskanäle, die vom Hauptkanal abgingen, machte sie einen kleinen Umweg. Mit Mariechen saß weinend im Garten erreichte sie die ärmliche, aus Torfsoden bestehende Kate von Jantje Mö. Die alte Frau hockte vor ihrem Haus und entblößte mit einem Lächeln den letzten Zahn, der ihr geblieben war. Mühsam rappelte sie sich hoch, obwohl der krumme Rücken sich auch im Stehen nicht aufrichten ließ. Sie humpelte mit dem Stock in ihr düsteres Häuschen, das nur aus einem Raum bestand. Das Dach war notdürftig mit Heidekraut und Stroh abgedichtet. Es war eines der letzten seiner Art. Aber die arme alte Frau hatte ihr ganzes Leben nie anders gewohnt. Als Jantje Mö wieder herauskam, hielt sie Marie erwartungsvoll einen Blechtopf entgegen. Marie goss ein Drittel der Milch ein, die sie in einer Zwei-Liter-Kanne mitgenommen hatte, sagte ein paar freundliche Worte und schwang sich wieder aufs Rad.
Gruselig! Marie überlief jedes Mal ein Schauer, wenn sie am Haus von Jantje Mö vorbeikam. Sie fühlte sich ihren Eltern gegenüber zutiefst verpflichtet, weil sie für ihre Kinder so viele Entbehrungen auf sich genommen hatten. Auch Heinrich und Tabea Wiemkes hatten wie die meisten Kolonisten in den ersten Jahren in einer elenden Hütte übernachtet. So lange, bis sie vom vorderen Teil ihres Grundstücks so viel Torf abgebaut hatten, dass sie auf Sand stießen und ein richtiges Backsteinhaus auf festem Grund bauen konnten.
Die Nebel hatten sich inzwischen aufgelöst. Fröhlich radelte Marie durch den herrlichen klaren Junitag weiter an Fehnhäusern, kleinen Werften und ein paar Kapitänshäusern vorüber. Auf den Wiesen zwischen den Häusern lagen Tisch- und Bettwäsche zum Bleichen ausgebreitet, in gebührendem Abstand grasten angepflockte Schafe. Es wurde dörflicher, die Häuser standen enger beieinander, und die ersten Geschäfte tauchten auf.
Schon von Weitem sah Marie, wie die weiße Zugbrücke am Hauptkanal hochgeklappt wurde, und sie sah einen Pulk Menschen. Zuerst dachte sie, es handle sich um Kinder. Sobald ein Schiff die Brücke passierte oder durch eine der Schleusen kam, blieben die Fehnkinder stehen und winkten. Sie kannten ja jedes Schiff, die Plattbodentorfmuttjes und die Tjalken, die hölzernen und die eisernen, die Binnenschiffe und die Seeschiffe, die mit Motor und die ohne. Sie wussten genau, wer darauf welche Ladung fuhr und wohin.
Überall auf der Welt fand man Fehntjer Fahrensleute. Wenn sie zurückkehrten, hatten sie spannende Geschichten zu erzählen, in den Gastwirtschaften oder zu Hause. Dabei hockten die Kinder, die oftmals nicht unterscheiden konnten zwischen echten Abenteuern und Seemannsgarn, unter den Tischen und lauschten. Während die Binnenschiffer je nach Naturell Flüche, Desinteresse oder eine Tüte mit Pfefferminzbruch für sie übrig hatten, brachten die Seeleute aufregende Souvenirs mit – ein ausgestopftes Gürteltier aus Brasilien zum Beispiel oder Porzellantassen aus China, Tongefäße aus Indien oder balinesische Schnitzarbeiten. Sogar einen Schrumpfkopf aus Amazonien hatte Marie neben allerlei anderen Kuriositäten bei Nachbarn und Familien ihrer Freundinnen gesehen. Sie verstand nur zu gut, dass die Kinder jeden Ankömmling neugierig erwarteten.
Als Marie auf ihrem Rad näher kam, bemerkte sie, dass sich in der Menge auch Erwachsene aufgeregt hin und her bewegten. Unten am schilfbewachsenen Kanalufer standen Männer und stocherten mit einer langen Stange im Wasser, oben sah sie Frauen. Einige umklammerten ihre Kinder, andere hielten sich in den Armen und weinten. Marie wurde ganz flau im Magen.
»Sieh nicht hin, Marie!«, rief ihr einer der Nachbarn zu, als sie vom Fahrrad stieg. »Sieh nicht hin!«
Aber natürlich sah sie trotzdem hin. Ihr Herz begann zu rasen – im Wasser am Brückenpfeiler trieb eine Frau in einem weißen Nachtgewand. Ihre langen Haare hatten sich im Ufergestrüpp verfangen. Die Beine schienen in den sanften Wogen zu schweben, das Nachthemd war blutdurchtränkt.
»Imke!«, schrie Marie entsetzt. »Imke! Nein!«
Das war Imke aus der zweiten Ostwieke, sie sang mit ihr im gemischten Chor!
Marie ließ ihr Rad mit der Milchkanne fallen und rutschte den kleinen Abhang zum Treidelpfad hinunter, doch die Männer, die dort versuchten, das Mädchen aus dem Kanal zu ziehen, drängten sie zurück. Eine Frau warf eine Schere hinunter. Damit schnitt einer Imkes Haare aus dem Gewirr von Ästen und Wurzelgeflecht. Sie schleppten die leblose Gestalt hoch auf den Sandweg. Ein Schwall Wasser ergoss sich aus ihrem Mund. Marie sah entsetzt Imkes glanzlose Augen unter den halb geschlosssenen Lidern.
Imke, ausgerechnet die lebenslustige Imke, die so gern feierte! Beim Handwerkertag in Westrhauderfehn, als jedes Schiff für den Korso festlich geschmückt war, hatten sie zusammen einen Kanon gesungen.
Zwei Männer versuchten, Erste Hilfe zu leisten. Doch bald winkten sie ab, einer drückte die Augen zu.
»O Gott, Imke …«, flüsterte Marie und ließ sich gegen einen Brückenpfeiler sinken.
Erst vor wenigen Wochen noch hatten sie auf dem Fehntjer Markt nebeneinander am Festzelt gestanden, als ein paar betrunkene Arbeitslose das verbotene Horst-Wessel-Lied zu grölen begannen. Marie hatte sie mit ihrem Blick zum Schweigen gebracht. Lasst den Unsinn Jungs, das habt ihr doch gar nicht nötig!, hatte der Blick ausgedrückt, und Imke hatte mit jedem von ihnen getanzt, womit die bedrohliche Situation in lustige Feierstimmung umgeschlagen war.
Imkes Mutter schrie nun vor Schmerz, andere Frauen jammerten laut. Gleichzeitig begannen unter den Zuschauern auch schon die ersten Geschichten zu kursieren. Die glaubwürdigste besagte, dass die unverheiratete Imke schwanger und bei einer Engelmacherin gewesen sei. Ganz offensichtlich hatte es hinterher Komplikationen gegeben, es war zu heftigen Blutungen gekommen.
»Sie hat gesagt, sie kann mit der Schande nicht leben«, schluchzte eine junge Frau. Marie erkannte Imkes Schwester. »Sie wollte es doch nur wegmachen lassen!«, rief sie verzweifelt und schlug die Hände vors Gesicht. »Warum ist sie denn in den Kanal gegangen?«
Nachbarn kümmerten sich um die Familie, zwei Männer trugen die Tote fort. Die Ansammlung löste sich allmählich auf.
In der Ferne hörte Marie die Schulglocke läuten. Der Unterricht fing an! Sie war völlig durcheinander, doch die Pflicht rief. Eilig lief sie zu ihrem Rad, hob es aus der Milchlache und brauste damit zur Schule.
Die Eingangstür war schon geschlossen. In den drei Klassenräumen wurden hundertfünfzig Kinder aus acht Jahrgängen unterrichtet. Marie warf einen Blick durchs Fenster. Verwundert nickte der alte Hauptlehrer Theodor Onken ihr kurz zu und fuhr dann mit dem Erdkundeunterricht fort.
»Guten Morgen, Kinder!«
Marie grüßte tonlos, als sie ihren Klassenraum betrat. Die Mädchen hatten schon ihre Handarbeiten herausgeholt und unter der Aufsicht der ältesten Schülerin mit dem Häkeln begonnen. Aus dem Nebenraum klangen männliche Stimmen, Hämmern, Klopf- und Sägegeräusche. Rudolf Meiners gab den Jungen Werkunterricht.
Marie holte den Unterrichtsanfang nach. Alle Mädchen standen auf, sie beteten und sangen ein Lied. Ohne Erklärung für ihre Verspätung ging Marie zur Tagesordnung über. Sie prüfte die Hausarbeiten, die Fertigstellung zweifarbiger Topflappen. Danach zeigte sie den kleinen Mädchen noch einmal, wie man Luftmaschen häkelte. Die Mädchen stupsten sich gegenseitig an. Ihnen entging wohl kaum, dass ihr Fräulein Wiemkes heute anders war als sonst.
In der Pause zog sich Marie in den Kartenraum zurück. Sie musste einen Augenblick allein sein und sich sammeln. Es roch nach Kreide und säuerlich nach getrockneten Tafelschwämmen. Sie öffnete das Fenster, in der Hoffnung, die frische Luft werde das flaue Gefühl in ihrem Magen vertreiben. Auf dieser Seite des Schulgebäudes bekam man wenig mit vom Pausenlärm und vom Geratter der Pferdefuhrwerke auf der geklinkerten Hauptstraße. Eine Eiche überschattete das Lehrergärtchen. Ihre Blätter filterten das Licht grünlich. Der Duft eines weißen Fliederstrauchs, der direkt neben dem Fenster blühte, schwebte in den Kartenraum. Marie seufzte tief. Sie hockte sich auf eine Trittleiter gegenüber der Regalwand.
Warum nur hatte Imke sich das Leben genommen? Natürlich, ein Mädchen durfte sich nie so weit vergessen, dass sie vor der Ehe … Der Pfarrer, ihre Eltern, Lehrer Onken, ach, alle Leute hatten sie von Kindesbeinen an gemahnt und gewarnt. Sie sollten ihre Unschuld, das Kostbarste, was sie besaßen, aufheben für ihren Ehemann. Willst du etwa ins Heim?, hieß es schnell drohend, wenn Marie oder eine ihrer Freundinnen um Erlaubnis baten, länger auf einem Fest zu bleiben. Willst du in der Gosse landen oder von der Fürsorge abgeholt werden? Und man zeigte mit dem Finger auf unverheiratete Frauen, die »ein Kind der Sünde« zur Welt gebracht hatten. Die taugt nichts, sagten die Leute.
ENDE DER LESEPROBE