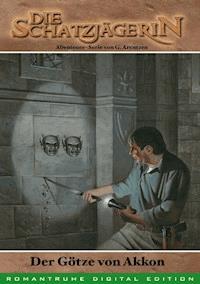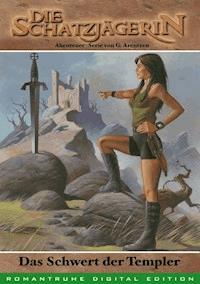
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Romantruhe-Buchversand Joachim Otto
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Schatzjägerin
- Sprache: Deutsch
Das Rätsel um den verfluchten Skarabäus wurde erfolgreich gelöst, wenn auch zu einem sehr hohen Preis. Noch während sich Jaquelines Freunde im Krankenhaus von ihren schweren Verletzungen erholen, wird sie beauftragt, ein weiteres Geheimnis zu lüften. Auf der Suche nach einem verschollenen Templerschwert muss sie viel riskieren. Nicht nur der in Aussicht gestellte Gewinn ist ungleich höher als beim letzten Abenteuer, auch ihre Auftraggeber spielen ein falsches Spiel. Und noch ist sie alleine. Oder?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE SCHATZJÄGERIN
Abenteuer-Roman
Band 02
DAS SCHWERTDER TEMPLER
DIE
SCHATZJÄGERIN
Abenteuer-Roman
Herausgeber: ROMANTRUHE-Buchversand.
Cover: Romantruhe.
Satz und Konvertierung:
ROMANTRUHE-BUCHVERSAND.
© 2018 Romantruhe.
Alle Rechte vorbehalten.
Die Personen und Begebenheiten der
Romanhandlung sind frei erfunden;
Ähnlichkeiten mit lebenden oder
verstorbenen Personen sowie mit tatsächlichen
Ereignissen sind unbeabsichtigt.
Abdruck, auch auszugsweise,
Vervielfältigung und Reproduktion sowie
Speichern auf digitalen Medien zum
Zwecke der Veräußerung sind untersagt.
Internet: www.romantruhe.de
Kontakt:[email protected]
Produced in Germany.
Prolog
New York City – 21. Mai 1996/11:50 Uhr
Es ist eine Dummheit, hier zu sitzen und auf den Italiener zu warten. Eine verdammte Torheit, die ich eines Tages bitter bereuen werde!
Diese Gedanken schossen mir durch den Kopf, während ich mit einem Becher Kaffee von Starbucks auf der Bank am Reservoir im Central Park saß und mir die Skyline der Stadt anschaute. Die Sonne schien an jenem Mai-Nachmittag, und eigentlich wäre ein Softeis mit Schoko-Geschmack besser gewesen als der Cappuccino der Kaffee-Kette. Doch nun dampfte das Getränk im Becher, angereichert mit doppelt Zucker, doppelt Milch sowie einem Hauch Schokolade, und kühlte einfach nicht ab.
Vor mir, auf meinem Schoß, lag der X-1. Jener kleine Universal-Computer, den mir Roger Müller für viel Geld verkauft hatte. Er konnte Dinge, die das Gerät in der Grundausstattung nicht beherrschte, doch an diesem Vormittag nutzte ich ihn lediglich, um meinen Bericht zu tippen. Normalerweise wurden Texte per Stift auf das Display gekritzelt, doch dies wäre zu umständlich gewesen. Darum hatte das Genie, wie ich Müller nannte, ein kleines Mäuseklavier entwickelt, über das ich, nachdem ich mich an die Mini-Tasten gewöhnt hatte, Buchstaben und Zahlen einfach eintippen konnte.
Trotzdem – was auf einem normalen PC eine Sache von knapp 60 Minuten gewesen wäre, hatte mich nun geschlagene drei Stunden gekostet. Andererseits war die Zeit nicht verschwendet gewesen, denn ich hatte sie auf genau dieser Bank verbracht, den See im Auge behalten und war nur hin und wieder aufgestanden, um Kaffee, Bagels und eine New York Times zu kaufen. Inzwischen war der Bericht fertig und beschrieb das, was sich in der jüngsten Vergangenheit ereignet hatte.
Der Fluch – Eine Schnitzeljagd mit Tücken
Nachdem ich den Auftrag angenommen hatte, einen goldenen Chepri (Skarabäus-Käfer) mit eingraviertem Fluch aus dem Grab des Tut-ench-Amun zu finden, musste ich nicht nur meinen Partner Bob Andrews nach Ägypten beordern, damit er dort erste Nachforschungen anstellt, sondern auch meine Freundin Joyce La Fayette aus den Fängen eines Triaden-Bosses in Hongkong erretten. Mit einem waghalsigen Manöver und unter Waffeneinsatz gelang es uns dank des Britischen Geheimdienstes, Hongkong zu verlassen.
In Ägypten trafen wir wieder auf Bob, der inzwischen den Verbleib des Fluch-Chepris klären konnte. Doch damit tat sich ein weiteres Problem auf, denn laut seinen Hinweisen befand sich das Amulett in einem Haus, das während des Baus des Assuan-Stausees versank.
Joyce und ich tauchten bei Nacht hinab auf den Grund des Sees, um das Amulett zu bergen, während Bob mit einem gemieteten Flugzeug über dem Terrain kreiste, um uns später aufzulesen. Wir fanden auch einen Beutel an besagter Stelle, doch wir bemerkten ziemlich schnell, dass dieser keinen Chepri enthielt. Dennoch tauchten wir auf, um an einem besseren Ort wie dem See das weitere Vorgehen zu beratschlagen.
An der Oberfläche angekommen bemerkten wir mehrere Polizeiboote sowie Polizisten am Ufer des Sees. Nach einem heftigen Kampf gelang es uns, den See mittels einer Strickleiter, befestigt an Bobs Flugzeug, zu verlassen und gleichzeitig unseren Häschern zu entkommen. Leider wurde ich während der Kämpfe verwundet, und diese Verletzung ist bis zum heutigen Tag nicht vollständig verheilt.
In einem Hotelzimmer in Israel fanden wir statt des erhofften Amuletts einen Zettel im Innern des Beutels, der uns zum einen darüber aufklärte, dass wir an einer Art Schnitzeljagd teilnehmen würden, der Skarabäus nicht existieren würde und uns im Falle eines Sieges dieser Jagd ein extrem gut dotierter Auftrag erwarten würde. Wir sollten uns also entscheiden: Uns darauf einlassen oder das Rennen an dieser Stelle beenden. Der Zweite Teil des auf dem Zettel aufgedruckten Textes stellte ein Rätsel dar, welches uns den weiteren Weg weisen sollte.
Wir beschlossen gemeinsam, die Suche fortzusetzen. Dazu musste das Rätsel jedoch gelöst werden.
Letztlich kamen wir zu der Überzeugung, dass uns der Zettel nach Deutschland schickte, wo wir nahe der Stadt Halle einen zweiten, unter Eichen vergrabenen Hinweis finden mussten. Weiterhin wies der Text auf das genaue Versteck hin – einer der beiden Ruinen, die zu den Burgen »Drei Gleiche« gehörte. Wir traten die Reise an und fanden in der Tat den zweiten Hinweis, verborgen unter einem Stein und abermals verpackt in einen Lederbeutel. Vor Ort stellte sich aber auch heraus, dass wir nicht die einzigen Teilnehmer an dieser kleinen Rallye waren, denn wir machten Bekanntschaft mit unseren Mitbewerbern – zwei Wissenschaftlern und vier Söldnern, die uns ziemlich zusetzen. Zwar gelang uns die Flucht, doch trotzdem schafften es unsere Konkurrenten, Bob zu entführen und dabei den Wortlaut des zweiten Hinweises – abermals ein Rätsel – zu erfahren.
Joyce und ich flohen nach Frankfurt, zum Elternhaus meiner Freundin, um dort das weitere Vorgehen zu besprechen sowie den zweiten Fingerzeig zu entschlüsseln. Bob war an einer Autobahnraststätte ausgesetzt worden, unsere Konkurrenten entkamen.
Dank Bobs Hilfe fanden wir heraus, dass sich unser Zielort bei dieser Schnitzeljagd in einer Kirche in London, der Stadt London in Kanada, befand.
Dort trafen wir wieder mit Bob zusammen, wurden aber gleichzeitig von einer uns nicht bekannten Partei vor der Fortsetzung der Suche und der Übernahme des in Aussicht gestellten Auftrags gewarnt. Nichtsdestotrotz begaben wir uns zur angegebenen Zeit in die Kirche, um dort die Hintermänner der Schnitzeljagd zu treffen. Noch ehe uns diese aber erklären konnten, um was es eigentlich ging, wurde das Gotteshaus von mehreren bewaffneten Männern gestürmt. Bei dem Schusswechsel starben sowohl die Angreifer als auch unsere Auftraggeber. Joyce und Bob wurden schwer verletzt und kamen nur knapp mit dem Leben davon.
Ich selbst wurde nach einem Verhör auf freien Fuß gesetzt und sah den Fall als abgeschlossen an. Doch dann meldete sich ein ›Kollege‹ meiner ursprünglichen Auftraggeber und stellte mir die Fortsetzung des Auftrags in Aussicht – sofern ich mich mit ihm am 21. Mai in New York treffe – 12 Uhr am Reservoir im Central Park.
Diesem Treffen sehe ich nun wider besseren Wissens entgegen, denn anders als bei der ersten Schnitzeljagd bin ich vorerst auf mich gestellt. Sowohl Joyce als auch Bob sind im Moment nicht in der Lage, an einer weiteren Schatzsuche teilzunehmen.
– Ende des Berichts –
Der Bericht war eine Abhandlung dessen, was sich seit dem Besuch meiner ursprünglichen Auftraggeber in meiner Villa in Grosseto ereignet hatte. Zwei Italiener aus Rom, wie ich vermutete, denn ihr Dialekt war mir vage vertraut erschienen. Nun waren sie tot, doch offenbar gab es noch mehr von ihnen. Wie sonst hätte mich ein dritter Italiener anrufen und zu diesem Treffen bestellen können?
Um was geht es hier, wenn Menschen sterben müssen? Was, in drei Teufels Namen, soll ich suchen, das es wert ist zu töten?
Ich hatte mir den Kopf zermartert, ohne eine wirklich schlüssige These zu finden. Letztlich blieb nur eins – das, was ich finden sollte, war verdammt viel wert. Mehr als alles, hinter dem ich je her war. Keine Vase oder Statue. Nicht einmal, wenn diese aus purem Gold bestand.
Ein Schatz vielleicht? Es gab einige Wracks, die nie gefunden worden waren. Ging es darum?
Wenn, dann wäre diese Schnitzeljagd etwas überzogen gewesen. Die Italiener wollten die besten Abenteurer, die sie bekommen konnten. Nur, um einen Schatz zu heben war ein solcher Aufwand wohl nicht gerechtfertigt.
Es brachte nichts, herumzuraten. Nun war es kurz vor zwölf, und wenn nichts dazwischen kam, würde ich in ein paar Minuten all diese Fragen jemandem stellen können, der ganz genau wusste, um was es hier ging.
Ich schaltete den X-1 ab, leerte meinen Kaffeebecher und ließ meinen Blick kreisen. Zwei junge Frauen fuhren auf Rollerskates vorbei, etwas entfernt hockten zwei Jungs im Teenager-Alter, mit einem Ghetto-Blaster zwischen sich. Die Musik, die aus den Boxen kam, zog mir fast die Schuhe aus, aber ihnen gefiel es offensichtlich.
Noch einmal schaute ich auf die Uhr. Es war nun genau zwölf. Doch noch war der Italiener nicht zu sehen.
Langsam erhob ich mich und schlenderte schließlich zu einem Geländer, das den See vom Weg trennte. Zwischen einer Lücke im Baumbestand konnte man die hohen Türme der Stadt sehen, was wirklich imposant wirkte.
Langsam schlich sich ein ungutes Gefühl bei mir ein, das mit jeder Minute, die verstrich, stärker wurde. Was, wenn die Typen auch diesem Italiener auflauerten? Was, wenn diese Terroristen und das waren sie für mich, jeden Kontakt zwischen ihm und mir verhindern wollten?
Langsam, und lässiger, als ich mich fühlte, schlenderte ich mal in die eine Richtung, dann in die andere.
Nichts.
Also ging ich zu einem Eisstand und kaufte mir ein Softeis, lief zurück zum Aussichtspunkt – noch immer nichts. Den X-1 legte ich auf eine Parkbank, schließlich konnte ich den Mini-Computer nicht ständig tragen.
Meine Nervosität nahm zu, und auch der Kakao im Eis schaffte es nicht, meine Nerven zu beruhigen. Misstrauisch versuchte ich, möglichst unauffällig meine Umgebung zu sondieren. Die beiden Teens hörten noch immer ihre Musik, die Skaterinnen waren weg, und etwas weiter entfernt ging eine ältere Frau mit ihrem Hund vorbei. Sie blieb nur einmal stehen, als das Vieh ein Bein hob und sein Revier markierte, dann liefen die beiden weiter.
Keiner, der auf mich schießen wollte.
Aber auch kein Italiener, der sich hier mit mir treffen wollte.
Ich fühlte mich zunehmend unwohler. Sicherheitshalber ließ ich meine freie Hand über die dünne Jacke gleiten, die meine Waffe verbarg. Es war nicht schwer gewesen, an eine Pistole zu kommen. Zumindest fühlte ich mich so nicht völlig schutzlos.
Das kalte Metall war durch den Stoff zu spüren, strahlte etwas Beruhigendes aus. Zumal ich mich an einem öffentlichen Ort befand, an dem die Terroristen nicht einfach das Feuer eröffnen konnten. Irgendwo im Park waren berittene Polizisten unterwegs, um die Politik der Null-Toleranz des Bürgermeisters durchzusetzen. Dazu zählten sicherlich auch Feuergefechte.
Wieder tastete mein Blick die Umgebung ab. Die Burschen mit dem Ghetto-Blaster ließen nun eine in Papier verpackte Flasche kreisen.
Die Hunde-Lady war weg, der Eisverkäufer mit seinem mobilen Stand ebenfalls weitergezogen. Vermutlich orientierte er sich nun in Richtung der Spielplätze. Es wurde wärmer, Kindermädchen und Mütter zog es nun mit den Kleinen ins Freie.
Es war wahrlich nicht mein erster Besuch in New York City, und inzwischen kannte ich mich hier mit den Gegebenheiten einigermaßen aus.
Für einen Moment wurde es still, als auch die Musik aus der Anlage der Halbwüchsigen verklang. Nur ein Vogel schrie irgendwo sein einsames Lied.
Der Sommer schien in greifbarer Nähe, es war warm, friedlich und das Eis schmeckte hervorragend.
Dann brach die Hölle über mich herein.
Woher die Männer plötzlich kamen, wusste ich nicht. Vielleicht kamen sie aus dem Gebüsch wie Strauchdiebe. Auf jeden Fall waren sie plötzlich da, hatten mich regelrecht in der Klammer – und schossen. Entgegen meiner Annahme, dass sie dies nicht tun würden und trotz der Polizei im Park.
Mein Eis flog in hohem Bogen durch die Luft, während ich mich geistesgegenwärtig nach hinten über das Geländer warf, und so einem Treffer entging. Reines Glück, das war mir klar, denn mit Sicherheit war ich nicht schneller gewesen als eine Kugel. Doch viel Zeit, um mich über meine erste Rettung zu freuen, blieb mir nicht. Direkt hinter der Eisenstange, über die ich mich gewuchtet hatte, befand sich die Böschung des Sees. Diese purzelte nun ich hinunter, über Stock und über Stein, wie man so schön sagt, um schließlich am flacheren Uferbereich zum Liegen zu kommen. Mein Körper schmerzte, da es zum einen ein harter Aufprall gewesen war, zum anderen die Steine ihre Spuren auf meinem Körper hinterlassen hatten.
Abermals zerrissen Schüsse die kurze Stille der Feuerpause. Aber auch hektische Schritte waren zu hören.
Sie kamen.
Ich riss meine Waffe hervor und schoss zurück, während ich gleichzeitig Schwung nahm und mich über die Uferböschung in den See rollen ließ. Sofort tauchte ich unter und schwamm so schnell es ging nach links zu einem Streifen mit Wasserpflanzen. Um mich herum peitschten Kugeln in das Wasser, doch die Schüsse drangen in der Tiefe des Sees nur noch entfernt an mein Ohr, kurz darauf gar nicht mehr, da ich fast den Grund des Reservoirs erreicht hatte. Schon spürte ich den Druck in der Lunge sowie den stummen Schrei meines Hirns nach Sauerstoff. Aber noch durfte ich nicht nach oben, denn sobald die meinen Kopf sahen, war es vorbei mit mir.
Erst, als ich mich zwischen die Pflanzen geschoben hatte, stieß ich mich auf dem schlammigen Grund ab und stieg auf. Niemand war mir in den See gefolgt, aber mit Sicherheit warteten sie am Ufer auf mich. Entsprechend vorsichtig musste ich sein.
Die Halme des Schilfes bewegten sich. Verräterisch, wie ich erkannte. Kam ich hier hoch, hatten sie mich sofort. Also musste ich wieder runter. Wegen des Sauerstoffmangels fühlte ich einen riesigen Druck im Kopf – ich hatte das Gefühl, als würden meine Augen nach außen gepresst und jeden Moment aus ihren Höhlen springen. Es war ein Kampf gegen meinen Atemreflex, nicht einfach den Mund zu öffnen. Noch einmal zischte eine Kugel neben mir ins Wasser. Also wussten sie, wo ich mich befand und was ich vorhatte. Verzweifelt hielt ich nach einer anderen, einigermaßen sicheren Möglichkeit zum Auftauchen Ausschau – und fand sie einige Meter entfernt. Bäume, deren Wurzeln teils ins Wasser ragten. Sie würden sicherlich nicht wackeln, sobald ich mich ihnen näherte. Dazwischen dichter Bewuchs. Zumindest sah es so von unten aus.
Ich begann mit hastigen Schwimmbewegungen. Die Entfernung schmolz zwar, aber der Druck in Kopf und Brust wurde unerträglich. Alle meine Sinne schrien nach Sauerstoff, das Blut pochte in meinem Schädel und schon schoben sich Schatten vor meine Augen.
Rauf. Nur rauf und Luft holen. Sonst säufst du ab wie die Katze im Sack.
Fast war ich bereit, es zu tun. Aller Vorsicht zum Trotz, doch im letzten Moment gelang es mir, mich noch einmal zusammenzureißen und mit letzter Kraft den Bäumen zuzustreben.
Schließlich, nach mir endlos erscheinender Zeit, berührten meine Finger die ersten Wurzeln. An ihnen orientierte ich mich, stieg an den Wasserpflanzen, die hier ebenfalls wuchsen empor und durchstieß die Wasseroberfläche. Sofort schnappte ich nach Luft, sog sie gierig in meine Lunge.
Keuchende Geräusche entstanden, doch der Druck in mir ließ nach und auch mein Blick klärte sich wieder. Meine Kleider hingen nass und schwer an mir, Erinnerungen an unseren Tauchgang in Ägypten wurden wach. Nur, dass wir damals vor der Polizei hatten fliehen müssen, ich die Gesetzeshüter heute aber herbei sehnte.
Und sie enttäuschten mich nicht.
Ohne mich zu bemerken ritten vier von ihnen an mir vorbei hinüber zum Aussichtspunkt. Von dort waren noch einmal Schüsse zu hören, die aber unmöglich mir gelten konnten.
Dann herrschte Ruhe.
Vorsichtig watete ich ans Ufer, versank teils im Morast und schaute mich um. Meine Gegner waren nicht zu sehen. Weder suchten sie den See nach mir ab, noch lauerten sie irgendwo. Schließlich, als ich fast schon wieder den Weg erreicht hatte, sah ich einen von ihnen tot auf dem Boden liegen, ein Teil des Schädels zerfetzt. Wer hatte ihn erschossen?
Trotz der warmen Temperaturen begann ich zu frieren. Das Wasser lief von mir hinab und bildete bereits eine große Lache auf dem Boden, meine Waffe war vermutlich nicht einsatzbereit.
Du musst zu den Cops. Das ist deine einzige Chance, hier lebend raus zu kommen. So dachte ich zumindest. Doch dann kam aus dem Gebüsch mir gegenüber eine junge Frau hervor. Ihre Augen blitzten, als sie mich sah, und mit einem raschen Kopfnicken bedeutete sie mir, ihr zu folgen.
Könnte eine Falle sein, überlegte ich, wollte aber nicht so Recht daran glauben. Diese Fremde hatte nicht den Eindruck erweckt, es auf mein Leben abgesehen zu haben. Wäre es ihr Plan gewesen, mich zu erschießen, hätte sie es bedeutend leichter haben können.
Noch einmal drehte ich den Kopf. Der Weg beschrieb an dieser Stelle eine leichte Biegung, und erst dahinter lag der eigentliche Tatort. Obwohl die Leiche auf dem Boden kaum zu übersehen war, schienen sich die Cops um den Toten hier nicht oder noch nicht kümmern zu wollen. Etwas anderes, jenseits meines Sichtfeldes, war offenbar wichtiger.
»Komm schon!«, rief mir die Fremde nun ungeduldig zu, ehe sie wieder im Gebüsch verschwand.
Ich lief los. Das heißt, es wurde eher ein eiliges Schlurfen, denn noch immer war ich nass bis auf die Knochen.
Kurz darauf drückte ich mich hinter eine Hecke, um dort nicht nur auf die Fremde zu treffen, sondern auch auf einen Mann in dunklem Anzug.
»Scusi, Signorina Berger«, presste er hervor, deutlich geschockt von den jüngsten Ereignissen. »Ich wollte sie schon früher treffen, Aber Signorina Stern meinte, es sei zu gefährlich. Sie wollte auch Sie aus der Schusslinie holen, aber dann waren da schon die Männer und …« Er ließ den Satz unvollendet, wischte sich aber mit einem großen Stoff-Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Die Angst stand ihm noch immer ins Gesicht geschrieben, er zitterte fast und schaffte es trotzdem noch, so etwas wie Würde auszustrahlen. Seine Kleidung jedoch, der Anzug, die Krawatte, das alles passte nicht zu den Temperaturen und auch nicht zu seinem Versteck im Gebüsch des Parks. Er wirkte völlig deplaziert.
»Sie also wollten mich treffen«, erwiderte ich knapp, wandte mich aber dann dieser Stern zu. »Und Sie? Geht der Tote da draußen auf Ihre Kappe? Was haben Sie für ein Interesse an dieser Sache?«
Es wurde komplizierter mit jeder Sekunde, die verstrich. Es war falsch gewesen, hierher zu kommen. Falsch, falsch und nochmals falsch. Der Zorngott kam mir in Erinnerung. Diese Figur stand noch immer in meinem Bungalow in Grosseto, sollte mich eigentlich daran erinnern, keine Dummheiten mehr zu begehen.
Dabei war das hier die größte Dummheit, zu der ich fähig war. Ich verfluchte mich in diesem Moment. Und auch diesen Typen hier im dunklen Anzug.
»Das«, riss mich die Stern aus meinen rüden Gedanken, »müssen wir ein andermal klären. Ihr solltet nun verschwinden. Und ja – der Tote geht auf meine Kappe. Aber halten Sie sich mit Dank noch zurück.«
Damit übergab sie mir meinen X-1, den ich vollkommen vergessen hatte.
Sie winkte, trat dann auf den Weg und war weg, noch ehe ich sie aufhalten konnte. »Aufbrechen – stimmt, das sollten wir wohl«, erklärte der Italiener nachdenklich. Erst jetzt fiel mir auf, dass er einen Koffer neben sich stehen hatte, nach dem er nun griff. »Kommen Sie – ich habe einen Wagen in der Nähe.«
Wir schlugen uns erst tiefer ins Gebüsch, kamen dann auf der anderen Seite heraus und verließen den Park durch einen Seitenausgang. Hinter uns wurde das Gelände großzügig abgeriegelt, doch dies bekamen wir schon nicht mehr richtig mit, denn ehe die Maßnahmen uns betreffen konnten, waren wir weg. Obgleich den Beamten bei genauem Hinsehen die Spur hätte auffallen müssen, die ich quer über den Weg hinterlassen hatte. Aber manchmal ist das Glück eben mit den Dummen …
Am Seitenstreifen, unscheinbar und klein, stand ein Renault. Auf ihn steuerte der Italiener zu, öffnete die Tür furchtsam und überzeugte sich erst, dass keine Bombe angebracht worden war, ehe er einstieg und mich aufforderte, es ihm gleichzutun.
Dann fuhren wir los, ließen den Park hinter uns und nahmen schließlich den Weg nach Chelsea. Während der Fahrt fiel kein Wort. Aber ich nahm mir vor, dass dies die letzten Minuten seien, bevor wir reinen Tisch machen würden. Er musste mit der Sprache rausrücken, um was es hier verflixt noch mal ging.
Kapitel 1
New York City – 21. Mai 1996/15:00 Uhr