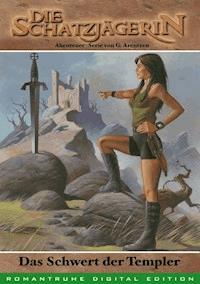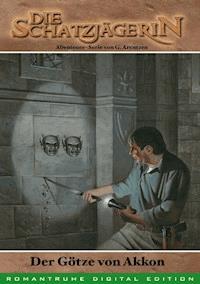
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Romantruhe-Buchversand Joachim Otto
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Schatzjägerin
- Sprache: Deutsch
Die Jagd geht weiter! Nachdem Jaqueline Berger und ihre Freunde auf Glastonbury den nächsten Hinweis fanden, stehen sie vor einem neuen Rätsel. Was will ihnen die kurze Botschaft "In diesem Zeichen wurden sie besiegt – suche nach Akkon" sagen? Als sie das Rätsel schließlich lüften, wähnen sie sich bereits auf der Siegerstraße. Doch auch ihre Mitbewerber sind wieder obenauf, nachdem sie von unerwarteter Seite Hilfe erhalten haben. Ganz zu schweigen von jener geheimnisvollen Gruppe, die den Schatzsuchern nach dem Leben trachtet. Während ihres Aufenthalts auf Zypern gerät Jaqueline in ein Abenteuer, das sie an ihre Grenzen bringt – und ein Stück darüber hinaus. Sie und Nadine Berger werden in die Wüste von Libyen verschleppt. Unter der Folter erlebt Jaqueline die schlimmsten Stunden ihres Lebens …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE SCHATZJÄGERIN
Abenteuer-Roman
Band 03
DER GÖTZEVON AKKON
DIE
SCHATZJÄGERIN
Abenteuer-Roman
Herausgeber: ROMANTRUHE-Buchversand.
Cover: Romantruhe.
Satz und Konvertierung:
ROMANTRUHE-BUCHVERSAND.
© 2018 Romantruhe.
Alle Rechte vorbehalten.
Die Personen und Begebenheiten der
Romanhandlung sind frei erfunden;
Ähnlichkeiten mit lebenden oder
verstorbenen Personen sowie mit tatsächlichen
Ereignissen sind unbeabsichtigt.
Abdruck, auch auszugsweise,
Vervielfältigung und Reproduktion sowie
Speichern auf digitalen Medien zum
Zwecke der Veräußerung sind untersagt.
Internet: www.romantruhe.de
Kontakt:[email protected]
Produced in Germany.
Prolog
Andernach – 8. Juni 1996 / 13:00 Uhr
Missionstagebuch – Lanze I – 08.06.1996
Die erste Etappe meines neuen Auftrags liegt hinter mir. Auch wenn er nicht so reibungslos verlief, wie ich es mir gewünscht hatte. Aber dies war aufgrund der Umstände auch nicht zu erwarten gewesen. Hier nun der Ablauf des ersten Teilstücks:
Nachdem Bob Andrews, Joyce La Fayette und ich das Rätsel um den Skarabäus lösen konnten, meine Freunde am Ende der Suche jedoch schwer verletzt wurden, traf ich mich in der Folge mit einem Pater des Opus Dei in New York. Wie sich zeigte, verfügt die katholische Kirche über kryptische Dokumente, die bei richtiger Entschlüsselung zu einem noch unbekannten Objekt führen. Sicher scheint lediglich zu sein, dass es sich um einen Gegenstand aus den Anfängen des Christentums handelt. Die Lanze des Longinus wird als Möglichkeit gehandelt, aber auch der Querbalken vom Kreuz Christi oder andere, mit der Passion im Zusammenhang stehende Gegenstände.
Das Opus Dei beauftragte mich ganz offiziell mit der Suche nach diesem geheimnisvollen Objekt; ein Auftrag, den ich sowohl aufgrund der ausgelobten Belohnung von 10 Millionen Dollar je Teilnehmer meiner Expedition als auch aufgrund meiner Neugier annahm. Natürlich war ich mir dabei der Tatsache bewusst, dass sowohl Joyce als auch Bob vorerst nicht in der Lage sein würden, mich bei dieser Suche zu begleiten.
Temporäre Helfer fand ich in Paolo Rossi (ein befreundeter, italienischer Abenteurer) sowie in Nadine Weyer (eine deutsche Historikerin).
Noch während der Rekrutierungsphase dieser beiden Helfer traf ich Sarah Stern – eine Mitarbeiterin des Israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Beth (Schabak). Auch die Regierung in Israel zeigte Interesse an dem zu suchenden Gegenstand. Um ihren guten Willen zu zeigen und mich in meiner Suche zu unterstützen, gab mir Sarah Stern eine Dienstwaffe sowie einen auf meinen Namen ausgestellten Ausweis des Schabak. Sie machte mir jedoch auch mehrere Dinge klar.
Die katholische Kirche wird nicht zahlen. Selbst wenn wir finden, was sie suchen.
Der Staat Israel wird ebenfalls keine 10 Millionen Dollar pro Teilnehmer zahlen.
Über die erste These kann man streiten, da es sich wohl lediglich um eine Vermutung von ihr handeln wird. Der zweite Punkt hingegen ist unstrittig, da sie für die Regierung dieses Staates arbeitet.
Ich sagte Frau Stern zu, sie über meine Erfolge auf dem Laufenden zu halten. Weitere Zusagen gab es zu diesem Zeitpunkt nicht.
Da die Hinweise, die letztlich zum gesuchten Objekt führen, wie eine Schnitzeljagd aufgebaut sind, müssen wir uns von Station zu Station hangeln. Der erste Fingerzeig deutete unserer Meinung nach auf ein Schwert hin, welches von einem Templer in der Schlacht um Askalon benutzt wurde. Tatsächlich konnten wir das Schwert finden. Dieses führte uns wiederum nach Glastonbury (Avalon) und dort zu den Ruinen der ehemaligen Abtei. Unserer Suche war jedoch gespickt mit Fallen und Fährnissen. So ließ es sich das Opus Dei angelegen sein, auch eine zweite Gruppe, bestehend aus Söldnern und Wissenschaftlern, mit der Suche zu beauftragen. Wir stehen also in einem Wettstreit, da nur die siegreiche Truppe das Preisgeld erhalten wird. Hinzu kommt, dass eine uns noch unbekannte Organisation versucht, die Suche zu unterbinden. Sie schrecken dabei auch nicht vor Mord zurück, wie wir und auch unsere Mitbewerber schmerzlich erfahren mussten. Von der ehemaligen Söldnergruppe ist lediglich der Anführer (Ellis), dessen Stellvertreterin (Sharon) sowie ein Wissenschaftler namens Sandoz übrig. Allerdings steht es zu befürchten, dass die Söldner weitere Mitglieder in der Hinterhand haben. Auch einen neuen Wissenschaftler zu finden, dürfte ihnen nicht allzu schwer fallen. Somit können sie keineswegs als ausgeschaltet gelten.
Am Ende unserer Suche um das Schwert der Templer waren wir erfolgreich und konnten den zweiten Hinweis finden. Er enthält wie der erste Fingerzeig eine simple Botschaft, dessen Sinn sich uns noch nicht vollständig erschlossen hat.
Sie lautet: ›In diesem Zeichen wurden sie besiegt – Suche nach Akko.‹
Nadine Weyer hat die Aufgabe übernommen, das Rätsel zu entschlüsseln. Zumindest, soweit dies vorerst möglich ist. Sie weilt hierzu in Frankfurt, bewacht von Paolo, während ich mich zurzeit in Andernach aufhalte. Obwohl die Suche wichtig und Zeit kostbar ist, gibt es hier eine traurige Pflicht zu erfüllen, der ich mich trotz aller Eile nicht entziehen kann. Klar ist jedoch, dass der nächste Hinweis irgendwo auf uns wartet. Leider trifft es ebenso zu, dass weder unsere Mitbewerber noch unsere Gegner ruhen werden. Gedanken, die meine Stimmung nicht gerade zu steigern vermögen. Ganz im Gegenteil …
– Ende des Tagebuch-Eintrags –
»Liebes – kommst du? Wir müssen in die Kirche!«
Die Stimme meiner Mutter schallte durch die Wohnung. Seufzend speicherte ich den Eintrag und schaltete den X-1 anschließend ab. Die Sonne schien durch das offen stehende Fenster. Es war warm, der Himmel schimmerte in einem sanften Blau. Kein guter Tag für eine Beerdigung. Sollte es bei solchen Anlässen nicht stürmen? Oder zumindest regnen, um der Trauer einen passenden Background zu verleihen?
»Goodbye my friend, it's hard to die,
when all the birds are singing in the sky.
Now that the spring is in the air …« (Terry Jacks – »Seasons In The Sun«)
Natürlich hatte Tante Elisabeth auch nicht damit gerechnet, im Alter von nur 53 Jahren zu sterben. Noch dazu nach einem Martyrium, das man nicht einmal seinem ärgsten Feind wünschen würde. Ihr Tod war letztlich eine Erlösung gewesen. So die Ärzte, die nichts mehr für sie hatten tun können und so auch meine Mutter, die nun um ihre Schwester trauerte.
Mein Blick fiel auf das alte Bett. Noch immer hingen Poster irgendwelcher Sänger an der Wand darüber. In den Regalen standen die Bücher meiner Jugend, in den Schränken hingen Kleider, die schon lange aus der Mode waren. Oder schon wieder modern wurden – je nachdem.
Meine Eltern hatten ihr gesamtes Leben gearbeitet und auf ein kleines Häuschen im Grünen gespart. Sie waren weder sonderlich reich noch in besonders verantwortlichen Positionen beschäftigt. Mama verdiente ihr Geld als Verkäuferin, Papa arbeitete bei einer lokal ansässigen Fabrik. Dennoch hatten sie mich stets in meinen Bemühungen unterstützt, Archäologie zu studieren. Als ich schließlich meinen Abschluss machte und später habilitierte waren sie derart stolz, dass sie mein Bild von der entsprechenden Feier an alle Bekannten verteilten. Ihre Tochter, die Doktorin der Archäologie.
Noch immer glauben sie, ich würde für ein kleines Blatt schreiben und manchmal Expertisen anfertigen. Weder ahnten sie etwas von meinen wahren Aufträgen noch davon, dass mich manche Leute als Diebin betrachteten. Ich hatte nie bereut, ein Land, eine Region oder auch ein Museum zu bestehlen. Meine Eltern zu belügen allerdings war eine ganz andere Sachen. Sie hatten sich sehr viel Mühe gegeben, mir meine Träume zu erfüllen. War es nun Verrat an ihnen, all meine Ideale und Vorstellungen für den schnöden Mammon verkauft zu haben?
Vielleicht.
Andererseits verdiente ich bedeutend mehr als meine ach so ehrenwerten Kollegen. Mein Name besaß in gewissen Kreisen einen Ruf, hin und wieder veröffentlichte ich tatsächlich kleine Artikel in einem englischen Blatt und mein Bungalow in Italien war einer der schönsten Flecken, an denen man leben konnte.
Möglich, dass ich meine Ideale über Bord geworfen hatte. Aber sie waren nicht umsonst gestorben. Und das Häuschen, das meine Eltern gerade bauen ließen, war auch nicht allein mit ihrem Bausparvertrag finanziert worden. Eigentlich gehörte es zu mehr als 50 % mir, da sie so auf eine Kreditaufnahme verzichten konnten.
Tante Elisabeth, zu deren Beerdigung wir nun mussten, war meiner Meinung nach umsonst gestorben – im Gegensatz zu meinen Idealen. Ihr Sterben hatte niemandem etwas gebracht. Nur Leid und Schmerz.
Sie starb in einem kleinen Zimmer mit Holzkreuz an der Wand. Ein Raum, in dem die Sterbenden ihre letzten Minuten oder auch Stunden verbringen und von ihren Angehörigen Abschied nehmen konnten. Eine sinnvolle Einrichtung, die noch nicht sehr lange existierte. Als meine Großmutter gestorben war, hatte man ihre Mitpatienten auf den Flur geschoben, wo sie begafft wurden wie die Affen im Zoo. Aber damals hatte auch noch nicht der neue Bau existiert, in dem die Kranken nun behandelt wurden. Im Altbau war es etwas rustikaler und rattiger zugegangen, um es mal dezent zu umschreiben.
Auf dem Weg hinaus aus dem Zimmer nahm ich die handliche Pistole vom Schreibtisch und ließ sie in den Halfter gleiten, den ich wiederum am Gürtel befestigt hatte. Es handelte sich um eine israelische Baby Eagle – ein kleiner Bruder der Desert Eagle. Normalerweise wurden diese überwiegend in den Kalibern .357, .50 AE und .44 verkauft. Inzwischen war der Hersteller jedoch dazu übergegangen, auch 9 Millimeter anzubieten. Noch waren diese Versionen nicht offiziell im Handel. Ein interner Test, wie mir Sarah erklärt hatte. Ich solle mich geschmeichelt fühlen, an ihm teilnehmen zu dürfen.
Um ehrlich zu sein – eine Beretta wäre mir lieber gewesen. Das Magazin der Eagle fasste lediglich sieben Kugeln; bei der amerikanischen Waffe wären es 15 gewesen. Andererseits gehörte zu der Waffe auch ein Ausweis, der mich quasi berechtigte, eine Pistole zu tragen. Auch in Deutschland. Wobei ich die tatsächliche juristische Frage lieber nicht klären wollte. Sollte es zu einem Scharmützel kommen, konnte es schlecht laufen.
Ehe ich den Raum verließ, warf ich einen letzten Blick in den Spiegel. Die schwarze Hose bestand aus Leder und war nicht unbedingt für eine Beerdigung geeignet. Ebenso wenig das Oberteil, das gleichsam an eine Abendgarderobe erinnerte. Andererseits wollte ich die Kleidungsstücke auch außerhalb solcher Anlässe tragen. Hinzu kam, dass eine dünne Jacke sowohl die Bluse als auch die Pistole verdeckte. Selbst wenn mir der Schweiß über den Rücken laufen würde, konnte ich nicht darauf verzichten. So lange dort draußen Fanatiker rum liefen, die mir nach dem Leben trachteten, waren Schweiß und Hitze zweitrangig.
Meine Eltern nickten mir zu, als ich in den Gang trat. Die Haustür stand bereits offen, mehrere Menschen hatten sich im Vorgarten eingefunden. Mutter war Elisabeths nächste Angehörige gewesen, nachdem deren Mann – Onkel Theo (der dicke Theo) – bei einem Autounfall drei Jahre zuvor ums Leben kam. Darum waren die Beileidsbekundungen, Blumen und Anrufe bei Mama eingegangen und sie hatte auch für die Beerdigung zu sorgen.
Wir gingen zu Fuß, denn die Kirche lag nicht weit entfernt in der Hochstraße. Gegenüber befand sich ein kleines Museum, daneben das Krankenhaus. Auf der anderen Seite ging es in die Stadt, schräg gegenüber zum Rhein. Andernach lebte schon immer von Industrie und Tourismus, wie diverse Hotels am Ufer des großen Flusses zeigen. Im Sommer konnte man keine zwei Schritte tun, ohne über Fremde zu stolpern. Mir war das nur Recht, denn so erhielt das Städtchen etwas Aufgeschlossenes.
»Geht es?«, wollte ich von Mutter wissen. Sie hielt sich tapfer, zitterte allerdings auch. Dennoch nickte sie schweigend.
Hin und wieder schaute ich mich um. Die meisten Menschen kannte ich mehr oder weniger. Nur wenige waren absolut fremd. Aber keiner von ihnen sah aus, als würde er in der nächsten Sekunde die Pistole ziehen und auf mich feuern.
So blieb es auch, nachdem wir die Kirche betreten und in der vordersten Reihe Platz genommen hatten. Meine Tante war evangelisch gewesen. Meine Mutter ursprünglich auch. Aber früher war es eben Sitte gewesen, die Konfession des Ehemanns anzunehmen. Und Vater war katholisch. So wenig wie ich machte er Gebrauch davon. Ein Freizeit-Katholik, der an Weihnachten lieber ein Bierchen trank, als in die Kirche zu gehen. Vermutlich war dies das erste Mal seit vielen Jahren, dass er ein Gotteshaus von innen sah.
Während das erste Kirchenlied erklang und der Pfarrer andächtig die Trauergemeinde musterte, trieben meine Gedanken zu einem unbestimmten Punkt in meiner Vergangenheit. Bilder wurden lebendig und plötzlich schien ich wieder die siebzehnjährige Göre zu sein, die mit einem Buch über das alte Ägypten auf dem Bett lag und fasziniert verschiedene Berichte über die Mumifizierung der Pharaonen las. Es gab schon damals keine Frage, was ich eines Tages tun wollte. Oder besser – die Richtung stand bereits fest. Meine Noten sprachen für ein Studium, Medizin oder Jura kamen nicht in Frage. Lehrerin wäre ebenfalls nichts für mich gewesen, Sozialarbeiter mochte ich nicht und Betriebswirtschaft war ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Geschichte und Archäologie hingegen riss mich förmlich mit. Die Vorstellung, im heißen Sand nach den Resten längst vergangener Kulturen zu graben schien mir erstrebenswerter als alles andere, was noch an Berufen in Frage kam.
Ich erinnerte mich plötzlich wieder an eine Debatte in der Schule. Über Berufe ging es und darum, was wir aus unserem Leben machen wollten. Als ich von Ägyptologie begann – es war das erste Mal, dass ich dieses Wort überhaupt benutzte – schüttelte der Herr Oberstudienrat den Kopf. Archäologen, so sagte er, seien die Bettler der Wissenschaft. Ohne Zuschüsse würden sie verhungern und ihr Wissen sei lediglich von theoretischem Nutzen. In einer Welt, die zunehmend auf Kosten-Nutzen-Rechnungen schaute, seien solche Disziplinen ohne Wert und somit vom Aussterben bedroht. Wenn ich mein Leben lang eine Hungerleiderin bleiben wollte, solle ich Archäologin werden.
Mein Jahreseinkommen 1995 hatte nach Abzug von Steuern und sonstigen Ausgaben knapp 5 Millionen Dollar betragen. Ob der Herr Oberstudienrat da mithalten konnte?
Doch es gab auch andere Erinnerungen. Der dicke Theo zum Beispiel schenkte mir mein erstes Geschichtsbuch über das Alte Reich, jene erste, große Epoche des alten Ägyptens, in der die Pyramiden von Gizeh entstanden. (2707 bis 2216 v. Chr. Als Beginn dieser Epoche wird u.a. der Bau der Stufenpyramide des Djoser angesehen.)
Meine Eltern hatten mir ein Fahrrad geschenkt, aber das war nicht so viel Wert gewesen wie dieses Buch. Zumindest nicht für mich. Der Funke war während des Geschichtsunterrichts übergesprungen. Aber mit diesem Buch wurde er zu einem Feuer. Vielleicht war dies der Start meiner Karriere. Obwohl noch einiges geschehen musste, ehe aus einer Schülerin eine Abenteuerarchäologin wurde. Das erste Mal, als Joyce und ich einen Chepri außer Landes schafften etwa.
Oder jener Tag in der Wüste, als mich drei aufgebrachte Tuareg verfolgten. Eine Zeit lang glaubte ich, ihnen entkommen zu können. Doch dann waren sie plötzlich da, und nun musste ich meine Waffe einsetzen. Es war der Tag, an dem ich meine Unschuld zum zweiten Mal verlor. Erst Jahre zuvor im Bett eines Jungen, der sich anschließend eine Kerbe in den Nachttisch ritzte. Später eben in Afrika. Beide Male waren schmerzhaft, blutig und auf beide Abenteuer folgten Tränen.
Bis zu diesem Tag hatte ich geglaubt, niemals töten zu müssen. Mehr noch – ich hatte es mir geschworen. Umso bitterer war es, diesen Schwur brechen zu müssen. Für Monate war ich ein von Schuld zerfressenes Bündel gewesen, drauf und dran, mich den Behörden zu stellen. Dass ich es am Ende nicht getan hatte, war mein Glück. Ich kam aus dem Tal der Tränen heraus, suchte mir einen Partner und stieg mit neuem Elan und neuer Vehemenz wieder in das Geschäft ein.
Eine letzte Erinnerung huschte an meinem inneren Auge vorbei. Ein kleines Mädchen auf einem großen Fahrrad.
Ich.
Es war mein neunter Geburtstag gewesen, ich hatte eine Puppe bekommen und außerdem ein paar Freundinnen einladen dürfen. Wir spielten im Freien, aßen Kuchen und gingen später ins Freibad. Vivianne war dabei – eine Freundin, die später Ärztin werden wollte. Dann noch Klara, die neben mir gesessen hatte und Kerstin – ein Mädchen, das ich eigentlich nicht hatte leiden können. Sie mich hingegen umso besser. Darum war ich auf ihrer Feier gewesen und Mutter hielt es für geboten, sie einzuladen. Im Grunde war sie nicht einmal so übel gewesen. Auch wenn sie nur wenige Freunde hatte, konnte man gut mit ihr spielen. Als sie sechzehn wurde, lud sie mich abermals ein. Wir feierten mit Alkohol und AC/DC im Partykeller ihrer Eltern. Um zehn verschwand sie und kam nicht mehr zurück. Als ich eine halbe Stunde später auf die Toilette musste, fand ich sie. Erhängt, ohne Abschiedsbrief und ohne den leisesten Hinweis darauf, warum sie sich das angetan hatte. Es war mein erster Kontakt mit dem Tod, der nicht friedlich zu alten Leuten kam, wie er zu meiner Oma und meinem Opa gekommen war. Er hatte eine Freundin von mir – eine Bekannte, um es besser zu sagen – aus dem Leben gerissen. Mit Gewalt und ohne den geringsten Sinn. Niemand begriff es. Aber es markierte den Beginn einer Welle. Ab diesem Zeitpunkt suchten viele Jugendliche das frühe Aus. Das Bild von Kerstin, ihre weit aufgerissenen Augen und die hervorgequollene Zunge, das Blut auf ihrer Kleidung und die im Schritt nasse Hose, wurde ich seither niemals richtig los. Noch heute erscheint mir diese Szene hin und wieder in meinen Träumen.
»Jaqueline – wir gehen.«
Erschrocken schaute ich auf. Inzwischen war die Trauergemeinde dabei, das Gotteshaus zu verlassen. Mutter stand bereits im Gang, Vater ging gerade zu ihr. Durch die offene Tür konnte ich sehen, dass sich einige Trauergäste bereits im Freien befanden.
Auch wir verließen die Kirche. Ein Mann trat auf Mutter zu, um ihr die Hand zu reichen. »Mein Beileid, Frau Berger«, nuschelte er dabei. Dann wandte er sich rasch ab und eilte davon.
»Wer war das?«, wollte ich wissen.
»Ein Arzt. Doktor Keind heißt er. Seine Praxis befindet sich ganz in der Nähe. Dein Vater geht hin und wieder zu ihm.«
Ich ließ es damit bewenden. Mein Arzt wohnte in Grosseto, war schätzungsweise 150 Jahre alt und ein Mediziner der alten Schule. Es gab ein paar Gläser in seiner Praxis, in denen Blutegel wohnten und wer nicht auf den Brustwarzen in seine Ordination gekrochen kam, war nicht ernsthaft krank.
Wir machten uns auf den Weg zum Friedhof. Leises Gemurmel begleitete uns. Hin und wieder tauchte am Wegesrand ein bekanntes Gesicht auf. Jemand winkte, aber da ich mich bei meinen Eltern untergehakt hatte, konnte ich den Gruß nicht erwidern. Um ehrlich zu sein – so genau wusste ich ohnehin nicht, wer das gewesen war. So viele Menschen waren im Treibsand der Zeit versickert.
Die Beerdigung und auch der anschließende Leichenschmaus verliefen ohne den geringsten Zwischenfall. Abgesehen davon, dass mich hin und wieder die Erinnerungen an meine Jugend einholten, ich mich mit Leuten unterhielt, die ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen hatte und es sich ein Typ in meinem Alter angelegen sein ließ, mit mir zu flirten.
Aber da biss er auf Granit. Zum einen ist die Beerdigung der Tante nicht der perfekte Platz zum anbaggern. Zum anderen gab es an diesem Nachmittag nur einen Menschen, der meine Gedanken und mein Herz auszufüllen vermochte.
Sarah Stern.
Die Agentin des Schabak hatte mir mehrere Nachrichten zukommen lassen. Manche enthielten nur wenige Worte, andere ganze Sätze. Keine einzige davon drehte sich um die Suche. Rein persönliche Texte à la ›I Love you‹ oder ›Kiss‹. Es war deutlich zu sehen, dass sie sich vollkommen in mich verschossen hatte. Eine junge, zarte Liebe, die mich mehr verwirrte, als dass sie mein Blut in Wallung brachte. Sie war eine Frau und ich war eine Frau. Auch wenn die Gesellschaft bedeutend liberaler war als noch vor Jahren, hatte ich Probleme damit. Nicht, dass sie sich in mich verliebt hatte sondern vor allem, dass ich diese Gefühle erwiderte. Schon auf Bayron Manor waren wir unzertrennlich gewesen. Als sie schließlich nach Israel, ich hingegen nach Deutschland fliegen musste, spielten sich in Heathrow rührende Szenen zwischen uns ab. Mit etwas Abstand allerdings wurden die Schmetterlinge in meinem Magen zunehmend durch Selbstzweifel und irrationale Ängste getötet. Ich konnte mir nicht eingestehen, was in meinem Kopf nicht sein durfte. Gefühlsverirrung war mein beliebtestes Wort, wenn ich an Sarah dachte. Komm runter, Jack. Nichts als Gefühlsverirrungen. Der Stress, die Gefahr – du hast dich zu was hinreißen lassen. Außerdem willst doch niemanden lieben. Du bist ein Freigeist. Also hör auf, dich wie ein Teenager zu benehmen.
Das Problem war nur, dass sich mein Herz gerne wie das eines Teenagers benahm und bei jeder noch so kleinen SMS von der Israelin einen kleinen Hüpfer tat. Ob Medikamente das Herzleiden beseitigen konnten?
Der Friede der kleinen Stadt endete, als wir nach Hause kamen. Im Briefkasten lagen mehrere Trauerkarten. Dazwischen steckte allerdings auch ein an mich adressierter Brief ohne Absender oder Marke. Er musste wie all die anderen Umschläge auch persönlich eingeworfen worden sein.
Schon beim Aufreißen des Kuverts beschlich mich ein dumpfes Gefühl. Dieses verwandelte sich in einen regelrechten Schock, als ich die mit einem Drucker geschriebene Nachricht las.
›Schwöre der Suche ab und bleibe in Andernach. Brichst du auf, um gegen diesen Rat zu verstoßen, werden wir dich töten! Sei klug und lebe. Oder sei gierig – und bereite deiner Mutter neuerliche Trauer. Du willst doch nicht wie Tante Elisabeth in kühler Erde liegen. Oder?‹
Mein Job war mit Brachialgewalt in die kleine, friedliche Welt meiner Kindheit eingebrochen. Das Schreiben war nicht unterzeichnet. Dennoch bestand für mich kein Zweifel daran, dass es von den Killern stammte, die schon mehrfach uns und auch unseren Mitbewerben nach dem Leben getrachtet hatten.
»Alles in Ordnung, Liebes?«
Meine Mutter kam und legte ihren Arm auf meine Schulter. Ich nickte knapp, wandte mich dann ruckartig ab und lief in mein Zimmer. Es wurde Zeit, zu gehen. Nicht, dass am Ende auch noch meine Eltern in die Schussbahn gerieten.
»Ich packe und fahre. Meine Kollegin braucht meine Hilfe«, log ich. »Wir telefonieren später.«
Es kam plötzlich. Vermutlich ahnte Mama, dass nichts in Ordnung war. Aber sie schwieg und nahm es hin. Schließlich war ich trotz der Schmetterlinge im Magen, den Kindheitserinnerungen in meinem Kopf und all der Liebe, die mir meine Eltern noch immer entgegenbrachten eine erwachsene Frau und Doktorin der Archäologie. Dass ich auch eine wandelnde Zielscheibe war, konnten sie nicht wissen. Auf jeden Fall jedoch bedurfte es weitaus mehr, um mich von dieser Suche abzuhalten, als ein Brief.
Hätte ich zu diesem Zeitpunkt geahnt, was mich mein Sturkopf alles kosten würde, wäre ich in Andernach geblieben oder hätte einen einfacheren Job angenommen. Etwa, die drei goldenen Haare des Teufels aus der Hölle zu holen. Doch ich hatte keinen Schimmer, und so fuhr ich noch an diesem Nachmittag nach Frankfurt.
Damit begann ein Horror, wie er mir bis dato unbekannt gewesen war.
Kapitel 1
Frankfurt – 8. Juni 1996 / 21:00 Uhr
»Bist du sicher, dass wir nach Zypern müssen?«, fragte ich Nadine müde. Die Beerdigung, der Stress im Vorfeld und auch die Fahrt mit dem Leihwagen nach Frankfurt hatten mich schläfrig gemacht. Nun hockte ich in meinem Hotelzimmer am Hauptbahnhof auf dem Bett und schaute meine temporäre Partnerin gelangweilt an. Sie hatte keine wie auch immer gearteten Drohbriefe erhalten. Dafür war es ihr gelungen, Sinn in den kurzen Text zu bringen: ›In diesem Zeichen wurden sie besiegt – Suche nach Akko.‹
»Ja, ich bin mir sicher«, bestätigte die Historikerin. »Die Tatsache, dass das Wort Akko unterstrichen ist, kann nur so gedeutet werden. Es geht darum, was die Templer nach dem Fall von Akko taten. Die Antwort fand ich hier in der Bibliothek. Sie gingen nach Zypern, um sich dort neu zu formieren. Ihr letzter Großmeister brach von dort auf, um die Verantwortlichen in Europa von einem neuen Kreuzzug zu überzeugen. Aber zum einen war die Stimmung dort gegen ein solches Unterfangen. Zum anderen bereitete Philipp von Frankreich bereits seine Intrigen gegen den Templerorden vor. Er hatte den Papst mehr oder weniger in der Hand, so dass der Heilige Vater der Anklage gegen den Orden zustimmte. Sie wurden verhaftet und vor Gericht gestellt. Das Ende des Templerordens ist ziemlich genau dokumentiert.«
In der Tat war es das. Am 13. Oktober 1312 wurden der Großmeister Jacques de Molay sowie alle Templer in Frankreich festgenommen. Die Anklage lautete unter anderem auf Ketzerei und Homosexualität. Angeblich waren sie von einem Ordensbruder verraten worden, der sich sein Gewissen hatte erleichtern wollen. In Wahrheit ging es dem König um das Gold der Templer. Zudem waren sie in seinen Augen viel zu mächtig. Er fühlte sich durch sie bedroht und darum ließ er sie auf diese Art ausschalten. In der Folge wurden die Templer in vielen Ländern verhaftet und vor Gericht gestellt. Manche verurteilte man zum Tode – vor allem jene, die nicht geständig waren oder ihre Geständnisse widerriefen. Andere konnten gehen, nachdem man ihren Besitz konfisziert hatte. In einigen Ländern jedoch wurden die Templer gar nicht verfolgt oder wurden als Kämpfer und Helfer gerne aufgenommen. In Schottland etwa. Jacques de Molay nützte das nichts mehr, denn er starb am 19. März 1314 auf dem Scheiterhaufen in Paris.