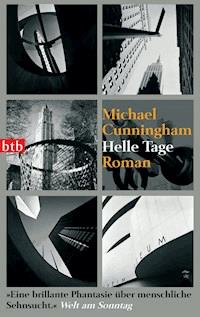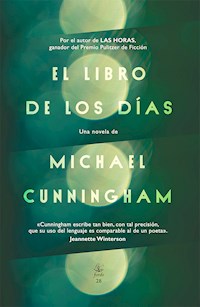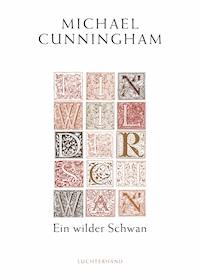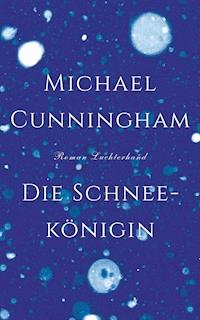
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Hans Christian Andersens Märchen »Die Schneekönigin« zerbricht ein Zauberspiegel in tausend Scherben. Trifft ein Splitter einen Menschen im Auge, so sieht er fortan alles um sich herum nur noch hässlich und böse. Wird ein Mensch dagegen im Herzen getroffen, wird es so kalt wie Eis … Michael Cunningham spielt auf brillante Weise, voller Poesie und mit einem guten Schuss Ironie versehen, mit Motiven aus Andersens Märchen. Und während er vor dem Hintergrund eines winterlichen New York eine Welt voll Eis, Schnee und Kälte heraufbeschwört, ist sein Roman in Wahrheit eine Hymne auf den Glauben an die Liebe und das Leben.
Der New Yorker Stadtteil Bushwick liegt jenseits von Brooklyn. In dieser Gegend sind die Mieten noch einigermaßen bezahlbar, die Häuser alt und die Leute nicht ganz so schick. Hier teilen sich die Brüder Tyler und Barrett eine Wohnung mit Tylers großer Liebe Beth, die unheilbar an Krebs erkrankt ist und um die sie sich beide aufopferungsvoll kümmern. Sie sind in den sogenannten besten Jahren und können es noch nicht ganz glauben, dass sich ihre Träume niemals erfüllen werden: Tyler, ein genialer Musiker, steht immer noch ohne Band und ohne Erfolg da. Aber er wird, das nimmt er sich vor und dafür sucht er sich heimlich Inspiration beim Kokain, das ultimative Liebeslied für Beth komponieren, ja, er wird es ihr bei der geplanten Hochzeit vorsingen ... Barrett, fast Literaturwissenschaftler, fast Startup-Unternehmer, fast Lord Byron, verkauft Secondhand-Designerklamotten in Beths Laden und trauert seinem letzten Lover nach, der ihn gerade schnöde per SMS abserviert hat. Als Beth sich wider alle Erwartungen zu erholen scheint, glaubt Tyler umso mehr an die Kraft der Liebe, während der Exkatholik Barrett sich fragt, ob das merkwürdige Licht, das er eines Nachts im Central Park amwinterlichen Himmel sah, nicht doch irgendwie eine göttliche Vision gewesen sein könnte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch:
Der New Yorker Stadtteil Bushwick liegt am Ende von Brooklyn. In dieser Gegend sind die Mieten noch einigermaßen bezahlbar, die Häuser alt und die Leute nicht ganz so schick. Hier teilen sich die Brüder Tyler und Barrett eine Wohnung mit Tylers großer Liebe Beth, die unheilbar an Krebs erkrankt ist und um die sich beide kümmern, jeder auf seine Art und ohne viel Aufhebens. Sie sind in den sogenannten besten Jahren und können es noch nicht ganz glauben, dass sich ihre Träume niemals erfüllen werden: Tyler, ein genialer Musiker, steht immer noch ohne Band und ohne Erfolg da. Aber er wird, das nimmt er sich vor und dafür sucht er sich heimlich Inspiration beim Kokain, das ultimative Liebeslied für Beth komponieren, ja, er wird es ihr bei der geplanten Hochzeit vorsingen … Barrett, fast Literaturwissenschaftler, fast Startup-Unternehmer, fast Lord Byron, verkauft Secondhand-Designerklamotten in Beths Laden und trauert seinem letzten Lover nach, der ihn gerade schnöde per SMS abserviert hat. Als Beth sich wider alle Erwartungen zu erholen scheint, glaubt Tyler umso mehr an die Kraft der Liebe, während der Exkatholik Barrett sich fragt, ob das merkwürdige Licht, das er eines Nachts im Central Park am winterlichen Himmel sah, nicht doch irgendwie eine göttliche Vision gewesen sein könnte …
Autor:
Michael Cunningham wurde 1952 in Cincinnati, Ohio, geboren und wuchs in Pasadena, Kalifornien, auf. Er lebt heute in New York City und Provincetown und unterrichtet Creative Writing an der Columbia University. Sein Roman Die Stunden ist vielfach preisgekrönt, u. a. mit dem Pulitzerpreis und dem PEN/Faulkner Award. Die überaus erfolgreiche Verfilmung The Hours mit Meryl Streep, Julianne Moore und Nicole Kidman wurde mit einem Oscar ausgezeichnet. Die Schneekönigin ist sein sechster Roman.
Übersetzerin:
Eva Bonné, geb. 1970 in Gevelsberg, Förderpreis für literarische Übersetzungen der Stadt Hamburg, Stipendium im Ledig House New York, ist die Übersetzerin von u. a. Sara Gran, Scott Hutchins, Adam Ross, Amy Sackville und Sofka Zinovieff.
MICHAEL CUNNINGHAM
Die Schneekönigin
Roman
Aus dem Amerikanischen von Eva Bonné
Luchterhand
Dieses Buch ist für Billy Hough
Leer, groß und kalt war es in der Schneekönigin Sälen. Die Nordlichter flammten so genau, dass man sie zählen konnte, wann sie am höchsten und wann sie am niedrigsten standen. Mitten in diesem leeren unendlichen Schneesaal war ein zugefrorener See, der war in tausend Stücke zersprungen; aber jedes Stück war dem andern so gleich, dass es ein vollkommenes Kunstwerk war. Und mitten auf dem See saß die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war, und dann sagte sie, dass sie im Spiegel des Verstandes säße und dass dieser der einzige und der beste in der Welt sei.
Hans Christian Andersen,Die Schneekönigin
Ein Abend
Ein himmlisches Licht erschien Barrett Meeks über dem Central Park, vier Tage nachdem die Liebe ihm wieder einmal übel mitgespielt hatte. Es war keineswegs sein erster romantischer Fußtritt gewesen, aber der erste, der ihm mittels einer fünfzeiligen SMS versetzt wurde, deren fünfte Zeile aus vernichtend unpersönlichen Wünschen für eine glückliche Zukunft bestand, gefolgt von drei kleingeschriebenen x.
Während der vergangenen vier Tage hatte Barrett sein Bestes getan, um sich durch diese Abfolge von, der Eindruck drängte sich auf, zunehmend lapidaren und lauwarmen Trennungen nicht entmutigen zu lassen. Als er noch unter dreißig war, endeten seine Liebesbeziehungen für gewöhnlich mit Weinkrämpfen und Geschrei, so laut, dass die Hunde der Nachbarschaft mit einstimmten. Einmal hatten er und sein zukünftiger Ex einander mit Fäusten traktiert (Barrett kann immer noch hören, wie der Tisch umkippt, die Pfeffermühle im Halbkreis über den Dielenboden rollt). Ein anderes Mal: eine lautstarke Auseinandersetzung in der Barrow Street, eine zerbrochene Flasche (bis heute assoziiert Barrett mit »verknallen« grüne Glasscherben auf dem Gehweg unter einer Straßenlaterne) und eine Frauenstimme, die aus einer dunklen, tiefer gelegenen Fensteröffnung kam und einfach nur fragte, weder schrill noch streng: »Könnt ihr Jungs denn nicht verstehen, dass hier Leute wohnen? Wir wollen schlafen«, und dabei klang wie eine erschöpfte Mutter.
Als Barrett dann Mitte und noch später Ende dreißig war, nahmen die Trennungen allmählich den Charakter von Geschäftsverhandlungen an. Sie kamen nicht ganz ohne Kummer und Vorwürfe aus, gestalteten sich aber fraglos weniger hysterisch. Sie ähnelten eher Verträgen oder Investitionen, die, unglücklicherweise und trotz vielversprechender Aussichten auf hohe Gewinne, schiefgelaufen waren.
Diese Trennung war jedoch die erste, die via SMS vollzogen wurde und deren Abschiedsgruß ungebeten und unerwartet auf einem Bildschirm erschien, der nicht größer war als ein Stück Hotelseife. Hi Barrett ich glaube du weißt was jetzt kommt. Hey wir haben es immerhin versucht oder?
Barrett hatte jedoch keine Ahnung gehabt, was kommen würde. Er verstand die Nachricht natürlich – die Liebe und die Zukunft, die sie bringen mochte, waren abgesagt. Aber ich glaube du weißt was jetzt kommt?Diesen Satz könnte ein Dermatologe nach dem jährlichen Check-up fallenlassen. Ich vermute, Sie ahnen schon, dass es sich bei dem Schönheitsfleck auf Ihrer Wange, jenem kleinen, schokobraunen Punkt, der verschiedentlich als eines Ihrer reizendsten Merkmale bezeichnet wurde (wer hatte gleich gesagt, Marie Antoinettes aufgemalte Version habe sich an exakt derselben Stelle befunden?), in Wahrheit um Hautkrebs handelt.
Barretts erste Reaktion erfolgte auf gleichem Wege, per SMS. Eine E-Mail hätte altmodisch, ein Anruf verzweifelt gewirkt. So tippte er auf winzigen Tasten: Wow das kommt überraschend wie wäre es wenn wir kurz reden, bin da wo ich immer bin. xxx.
Im Laufe des zweiten Tages hatte Barrett zwei weitere SMS abgeschickt, gefolgt von zwei Sprachnachrichten, und den größten Teil des zweiten Abends war er damit beschäftigt gewesen, keine dritte zu hinterlassen. Bis zum Ende von Tag drei hatte er nicht nur keine wie auch immer geartete Antwort erhalten, sondern auch angefangen einzusehen, dass er keine mehr bekommen würde; dass der stämmige, nachdenkliche Doktorand aus Kanada (Psychologie, an der Columbia), mit dem er sechs Monate lang Tisch, Bett und Privatsphäre geteilt hatte, der Mann, der gesagt hatte: »Ich könnte dich lieben«, nachdem Barrett beim gemeinsamen Bad Frank O’Haras »Ave Maria« rezitiert hatte, der Mann, der die Namen aller Bäume kannte, als sie das Wochenende in den Adirondacks verbrachten, einfach weiterzog; dass Barrett am Bahnsteig zurückgelassen worden war und sich wunderte, wie es dazu kommen konnte, dass er ganz offensichtlich den Zug verpasst hatte.
Ich wünsche dir für die Zukunft Glück und Zufriedenheit. xxx.
Am vierten Abend durchquerte Barrett nach einem Zahnarztbesuch, der ihm einerseits deprimierend banal erschien, andererseits seine seelische Stärke bewies, den Central Park. Bitte sehr, servier mich in fünf nichtssagenden und verletzend unpersönlichen Zeilen ab. (Tut mir leid dass es sich nicht entwickelt hat wie erhofft, aber ich weiß wir haben beide unser Bestes gegeben.) Deinetwegen werde ich meine Zähne nicht vernachlässigen. Ich werde froh sein, froh und dankbar dafür, dass ich nun doch keine Wurzelbehandlung brauche.
Dennoch. Die Vorstellung, dass er sich ohne jede Vorbereitungszeit damit abfinden musste, niemals mehr die reine, unbeschwerte Anmut dieses jungen Mannes erleben zu dürfen, der den gelenkigen, unschuldigen, schwärmerisch porträtierten Athleten eines Thomas Eakins so ähnlich sah; die Vorstellung, dass er nie wieder sehen würde, wie der Junge sich aus seinem Slip schälte, bevor er ins Bett stieg, nie wieder sein überbordendes, unschuldiges Entzücken über kleine Überraschungen erleben würde (ein von Barrett selbst aufgenommenes Leonard-Cohen-Mixtape mit dem Titel Why Don’t You Just Kill Yourself; ein Sieg der New York Rangers), erschien ihm buchstäblich als Unmöglichkeit, als ein Verstoß gegen die Naturgesetze der Liebe. Ebenso der Umstand, dass Barrett voraussichtlich niemals erfahren würde, was so furchtbar schiefgelaufen war. In den letzten Wochen hatten sie gelegentlich gestritten, sich betreten angeschwiegen. Doch Barrett war immer davon ausgegangen, dass sie lediglich in die nächste Phase eintraten; dass ihre Meinungsverschiedenheiten (Meinst du, du könntest versuchen, wenigstens manchmal pünktlich zu sein? Warum machst du mich in Gegenwart meiner Freunde so nieder?) ein Hinweis auf wachsende Vertrautheit waren. Er hätte sich nicht ansatzweise vorgestellt, eines Morgens beim Blick auf sein Handy erkennen zu müssen, dass die Liebesmüh verloren war, und zwar mit ungefähr demselben Maß an Bedauern, wie man es nach dem Verlust einer Sonnenbrille empfinden würde.
Am Abend der Erscheinung – Barrett war soeben vom Fluch der drohenden Wurzelbehandlung befreit worden und hatte gelobt, pflichtbewusster Zahnseide zu benutzen – ging er über die große Wiese in Richtung der illuminierten, gletscherartigen Masse des Metropolitan Museum. Seine Schritte knirschten über den vereisten, silbergrauen Schnee. Barrett nahm die Abkürzung zur Linie 6, von den Ästen der Bäume fielen Tropfen auf ihn herab, er war froh, endlich zu Tyler und Beth nach Hause fahren zu können, froh, erwartet zu werden. Er fühlte sich betäubt, so als hätte man seinem ganzen Sein Novocain gespritzt. Er fragte sich, ob er mit seinen achtunddreißig Jahren im Begriff war, sich von einer Figur tragischer Leidenschaft, vom reinen Tor der Liebe in einen Nullachtfünfzehn-Manager zu verwandeln, der, während er ein Geschäft abschreibt (ja, das Portfolio des Unternehmens hat Verluste gemacht, aber das ist keine Katastrophe), schon an das nächste denkt, mit neuer, wenn auch leicht realistischerer Hoffnung. Er fühlte sich nicht mehr genötigt, zum Gegenangriff überzugehen, im Stundentakt Nachrichten auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen oder vor dem Haus des Ex Wache zu stehen, obwohl er noch vor zehn Jahren genau das getan hätte: Barrett Meeks, Soldat der Liebe. Inzwischen empfand er sich als gealtert und verarmt. Wenn er ein Drama aus Wut und Leidenschaft inszeniert hätte, dann nur, um zu verschleiern, dass er bankrott war, dass er elend war, bitte, Bruder, hast du eine kleine Spende?
Mit hängendem Kopf lief Barrett durch den Park, nicht aus Scham, sondern ermattet, als wäre sein Kopf zu schwer, um aufrecht getragen zu werden. Sein Blick fiel auf die bescheidene, blaugraue Pfütze seines eigenen Schattens, die vom Laternenlicht auf die Schneedecke geworfen wurde. Er sah seinen Schatten über einen Kiefernzapfen gleiten, über angedeutete Runen aus Kiefernnadeln, über die Verpackung eines Oh-Henry!-Schokoriegels (wurden die immer noch hergestellt?), die knisternd vorbeiflatterte wie zerfetztes, vom Wind getragenes Silber.
Die Miniaturlandschaft zu seinen Füßen kam ihm ganz plötzlich unerträglich winterlich und nüchtern vor. Er hob den schweren Kopf und blickte empor.
Da war es. Ein blasses, türkisblaues Licht, transparent, ein Schleierfetzen, sternenhoch, nein, es stand tiefer als die Sterne, aber weit oben; höher als ein Raumschiff schwebte es über den Baumwipfeln. Es breitete sich langsam aus oder vielleicht auch nicht, war im Zentrum verdichtet und lief zu den Rändern hin in Rüschen und Spiralen aus.
Barrett hielt es für ein Nordlicht, das sich zu weit nach Süden verirrt hatte, ein nicht gerade gewöhnlicher Anblick über dem Central Park, aber als er da stand – ein Fußgänger mit Mantel und Schal auf einer laternenbeschienenen Eisfläche, betrübt und enttäuscht, aber ansonsten ziemlich normal – als er zu dem Licht emporblickte, das vermutlich gerade die Nachrichten beherrschte – als er sich fragte, ob er an seinem Standort verharren und die Überraschung für sich behalten oder loslaufen und sich nach einem Zeugen umschauen sollte – da waren noch andere Leute, dunkle Scherenschnitte, dort drüben auf der großen Wiese verteilt …
In dieser Unentschiedenheit, dieser Unbeweglichkeit, fest verankert in seinen Timberlands, ging es ihm auf. Er glaubte, nein, er wusste mit Sicherheit, dass das Licht, zu dem er hinaufsah, auf ihn heruntersah.
Nein. Es sah nicht. Es verstand. Wie ein Wal vielleicht, der den Schwimmer versteht, mit gravitätischer und majestätischer und vollkommen furchtloser Neugier.
Er konnte die Aufmerksamkeit des Lichtes als Kribbeln spüren, das ihn durchlief wie ein schwacher Stromstoß; eine sanfte, angenehme Spannung, die ihn durchdrang, ihn wärmte, ihn möglicherweise sogar ein ganz kleines bisschen zum Leuchten brachte, so dass er um ein oder zwei Nuancen heller war als zuvor; phosphoreszierend, doch auf eine rosa Weise, auf menschliche Weise, ohne jede Ähnlichkeit mit waberndem Sumpfgas, nur eine Ansammlung von schwach schimmerndem Blut-Licht dicht unter der Haut.
Und dann, weder langsam noch schnell, löste das Licht sich auf. Es verblich zu unzusammenhängenden, blassblauen Funken, die irgendwie belebt schienen, wie der verspielte Nachwuchs eines gelassenen, gigantischen Elternteils. Dann erloschen auch sie, und der Himmel sah aus wie vorher, wie immer.
Er blieb eine Weile stehen und beobachtete das Firmament, als wäre es ein Fernsehschirm, der urplötzlich dunkel geworden war und ebenso unerklärlicherweise wieder aufleuchten könnte. Doch der Himmel bot ihm nichts als die ewig gleiche, gepanschte Finsternis (die Lichter von New York ließen die nächtliche Schwärze ergrauen) und die spärlich gesäten Stecknadelköpfe jener Sterne, die stark genug leuchteten, um überhaupt sichtbar zu sein. Schließlich setzte er seinen Heimweg zu Beth und Tyler fort, zu den bescheidenen Annehmlichkeiten der Wohnung in Bushwick.
Was hätte er sonst tun sollen?
November 2004
Im Schlafzimmer von Tyler und Beth schneit es. Wirbelnder Schnee – harte, kleine Eiskugeln, eher Luftgewehrmunition als Flocken, eher grau als weiß im trüben Morgenlicht – legt sich auf die Holzdielen und auf das Fußende des Betts.
Tyler erwacht aus einem Traum, der sich fast augenblicklich auflöst und nur das vage Gefühl einer unverdienten Freude zurücklässt. Als er die Augen öffnet, ist ihm beinahe so, als wären die Schneegespinste, die durchs Zimmer treiben, Teil seines Traums, die Manifestation einer eisigen, göttlichen Gnade. Aber es handelt sich in der Tat um echten Schnee, der durchs Fenster, das er und Beth gestern Abend nicht geschlossen haben, hereinweht.
Beth schläft eingerollt im Halbkreis von Tylers Arm. Sanft macht er sich los und steht auf, um das Fenster zu schließen. Er geht barfuß über den schneebestäubten Boden und tut, was getan werden muss. Es ist befriedigend. Er ist hier der Vernünftige. In Beth hat er endlich jemanden gefunden, der noch unpragmatischer ist als er, auf eine romantische Art. Wenn Beth wach wäre, würde sie ihn höchstwahrscheinlich bitten, das Fenster offen zu lassen. Sie würde Gefallen daran finden, ihr kleines, vollgestelltes Schlafzimmer (überall stapeln sich Bücher, außerdem kann Beth einfach nicht von ihrer Gewohnheit lassen, auf der Straße gefundene Schätze nach Hause zu tragen – die Hulamädchenlampe, die sich, rein theoretisch, reparieren ließe; der verbeulte Lederkoffer; die beiden hohen und staksigen, mädchenhaften Stühle) als überdimensionierte Schneekugel zu sehen.
Tyler schließt das Fenster, mit Nachdruck. Alles in dieser Wohnung ist verzogen. Ließe man mitten im Wohnzimmer eine Murmel fallen, würde sie schnurstracks zur Wohnungstür hinausrollen. Als er den Fensterrahmen hinunterdrückt, schießt eine finale Schneefurie herein, als wollte sie ihre letzte Chance nutzen, um … um was zu tun? … um sich die vernichtende Wärme im Schlafzimmer von Tyler und Beth nicht entgehen zu lassen, diese einmalige Gelegenheit, sich in der Hitze aufzulösen? … Als die Miniaturbö an ihm vorbeifegt, fliegt ihm etwas ins Auge, ein Staubkorn oder vielleicht auch ein verhärteter, mikroskopisch kleiner Eiskristall, spitz wie die denkbar kleinste Glasscherbe. Tyler reibt sich das Auge, scheint nicht heranzukommen an den Splitter, der sich dort festgesetzt hat. Es fühlt sich an wie eine Verwandlung, als hätte der klare Splitter sich an seine Augenhornhaut angehaftet, und so steht er nun mit einem klaren und einem triefenden Auge da und beobachtet, wie die Schneeflocken sich an die Fensterscheibe werfen. Es ist noch nicht einmal sechs Uhr. Draußen ist alles weiß, überall. Die älteren Schneehaufen, die tagtäglich vor das benachbarte Parkhaus geschoben werden – sie haben sich zu grauen Miniaturbergen verdichtet, hier und da mit giftigen Rußflocken besprenkelt –, sehen nun, vorübergehend, alpin aus, wie ein Weihnachtskartenmotiv; allerdings ein Weihnachtskartenmotiv, aus dem man sich die kakaobraune Betonfassade des leeren Lagerhauses (an dem immer noch der Geist des Wortes »Beton« prangt, es ist zwar verblasst, aber noch erkennbar, so als beharre das zu lange vernachlässigte Gebäude darauf, der Welt seinen Namen mitzuteilen) wegdenken muss, genauso die noch schlummernde Straße, über der das Neon-Q des LIQUOR-Schildes flackert und brummt wie ein Notsignal. Doch selbst in dieser unspektakulären Stadtlandschaft – in diesem verwunschenen, halbleeren Viertel, wo das ausgebrannte Gerippe eines alten Buick (seltsam fromm in seiner verrosteten, ausgeweideten und besprayten absoluten Nutzlosigkeit) seit einem Jahr unter Tylers Fenster am Straßenrand steht – entlockt das Licht vor der Morgendämmerung allem eine schauerliche Schönheit, ein Gefühl von schäbiger, aber noch nicht ganz toter Hoffnung. Sogar in Bushwick. Da fällt er, der neue Schnee, echter Schnee, makellos, mit einem Hauch von Segen, als hätte sich irgendeine Firma, die die besseren Wohnviertel mit Stille und Eintracht versorgt, in der Adresse geirrt.
Wenn man an einem bestimmten Ort lebt, in bestimmten Verhältnissen, sollte man unbedingt lernen, das kleine Glück wahrzunehmen.
Und wenn man wie Tyler hier lebt, in dieser behäbig verarmten Gegend mit alternden Aluminiumverkleidungen, mit Lagerhallen und Parkplätzen, allesamt utilitaristisch, allesamt eher auf der billigen Seite, mit kleinen Ladengeschäften, die sich gerade so halten können, mit entmutigten Einwohnern (aus der Dominikanischen Republik, größtenteils; Menschen, die beträchtliche Mühen auf sich genommen haben, um hier zu leben, die große Hoffnungen hatten, gehabt haben müssen, welche Bushwick nicht erfüllen konnte), die pflichtbewusst zu oder von ihren Mindestlohnjobs trotten, als ließe sich die Niederlage nicht mehr abwenden, als müsse man sich glücklich schätzen, überhaupt etwas zu haben. Die Gegend ist nicht einmal mehr besonders gefährlich; selbstverständlich geschieht hier und da ein Überfall, aber inzwischen scheinen selbst die Kriminellen den Antrieb verloren zu haben. An einem Ort wie diesem ist Glück schwer zu fassen. Es ist nicht leicht, an einem Fenster zu stehen und zuzusehen, wie sich der Schnee federleicht auf die überquellenden Mülltonnen (die unberechenbaren Müllwagen scheinen sich nur sporadisch daran zu erinnern, dass es auch hier Müll abzuholen gilt) und das rissige Kopfsteinpflaster legt, ohne an seine bevorstehende Degeneration zu denken, den graubraunen Matsch, die braunen Tümpel und knöcheltiefen Pfützen an jeder Straßenecke, auf denen Zigarettenkippen und kleine Bälle aus Kaugummifolie (Katzensilber) treiben.
Tyler sollte sich wieder ins Bett legen. Wer weiß, vielleicht wacht er nach einem Intermezzo aus Schlaf in einer Welt auf, deren Reinheit fortgeschrittener, resoluter ist, eine Welt, die einen noch dickeren weißen Mantel über ihr Fundament aus Mühsal und Asche gebreitet hat.
Er zögert jedoch, den Fensterplatz in diesem Zustand halbgarer Wehmut aufzugeben. Jetzt zu Bett zu gehen wäre, als sähe er ein subtil anrührendes Theaterstück, das weder glücklich noch tragisch endet, sondern einfach ausläuft, bis keine Schauspieler mehr auf der Bühne stehen; bis das Publikum begreift, dass das Stück vorbei ist, dass es an der Zeit ist, aufzustehen und den Theatersaal zu verlassen.
Tyler hat versprochen, sich zurückzuhalten. Er war sehr erfolgreich während der letzten paar Tage. Aber jetzt, genau jetzt liegt ein metaphysischer Notfall vor. Beth geht es nicht schlechter, aber auch nicht besser. Die Knickerbocker Avenue wartet geduldig das kurze Zwischenspiel versehentlicher Schönheit ab, bevor sie sich wieder in ihrem eigentlichen Zustand zeigen kann, voller Schneematsch und Pfützen.
Also gut. Heute Morgen wird er eine Ausnahme machen. Es wird ihm ein Leichtes sein, in die Spur der Unnachgiebigkeit zurückzufinden. Bloß ein bisschen Antrieb, wo Antrieb gebraucht wird.
Er geht zum Nachttisch, nimmt das Fläschchen heraus und zieht hastig ein paar Lines.
Und da ist es. Da ist der Stich der Lebendigkeit. Tyler ist zurück von seiner nächtlichen Schlafreise, er ist ganz Klarheit und Ziel; er hat seine Zugehörigkeit zur Welt der Menschen erneuert, die nach etwas streben und miteinander in Verbindung stehen, Menschen, die es ernst meinen, die brennen und verlangen, die nichts vergessen, die hellwach und unerschrocken durchs Leben schreiten.
Er kehrt ans Fenster zurück. Falls der vom Wind getragene Eiskristall vorhatte, mit seinem Augapfel zu verschmelzen, so ist die Verwandlung geglückt; mit Hilfe des winzigen Wunderspiegels kann er jetzt noch klarer sehen …
Da ist wieder die Knickerbocker Avenue, und ja, bald wird sie in ihren Dauerzustand der Irgendwoheit zurückversetzt sein, nicht, dass Tyler es vergessen hätte, aber die rußige Zukunft zählt nicht, ganz ähnlich wie der Schmerz, von dem Beth immer behauptet, er werde vom Morphium zwar nicht ausgelöscht, aber beiseitegeschoben, bedeutungslos gemacht, zum Beiprogramm degradiert, verstörend (Sehen Sie den Schlangenjungen! Sehen Sie die bärtige Frau!), aber fern und, natürlich, ein Scherz, nichts als Mastix und Latex.
Tylers eigener, viel kleinerer Schmerz, die Klammheit seiner inneren Abläufe, der vielen Kabel, die in seinem Gehirn zischen und Funken sprühen, ist vom Kokain wie weggeblasen. Vor einem Augenblick noch war er ganz fahrig und voller Sarkasmus, aber nun – schneller Sog harscher Magie – ist er nur noch Scharfsinn und Verve. Er hat sein Kostüm abgeworfen, und der wahre Anzug seines Selbst passt wie angegossen. Tyler ist ein Einmannpublikum, das zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts nackt an einem Fenster steht, während die Hoffnung in seinem Brustkorb klappert. Es scheint denkbar, dass alle Überraschungen (er hatte eigentlich nicht geplant, mit dreiundvierzig ein unbekannter Musiker zu sein, in erotisierter Keuschheit mit seiner sterbenden Freundin und seinem kleineren Bruder zusammenzuleben, der sich, langsam und allmählich, von einem jungen Hexenmeister in einen nicht mehr so jungen, müden Zauberer verwandelt hat, der zum zehntausendsten Mal Tauben aus einem Zylinder zieht) Teil einer rätselhaften Kraft gewesen sind, zu immens, um als solche erfasst zu werden; eine bestimmte Ansammlung vertaner Chancen und verworfener Pläne und Frauen, die immer nur fast die Richtige waren, was ihm seinerzeit alles willkürlich erschien, ihn aber an diesen Punkt geführt hat, an dieses Fenster, in dieses schwierige, aber interessante Leben, zu störrischer Liebe, einem immer noch straffen Bauch (den Drogen sei Dank) und einem Knüppel von Schwanz (seinem), während die Republikaner auf dem absteigenden Ast sind und eine neue Welt, kalt und klar, im Begriff ist, zu entstehen.
Tyler wird einen Lappen holen und den geschmolzenen Schnee von den Dielen wischen. Er wird sich darum kümmern. Er wird Beth und Barrett mit reiner Liebe überschütten. Er wird sie hegen und pflegen, eine zusätzliche Schicht in der Bar übernehmen, den Schnee und alles, was er berührt, als Glück wahrnehmen. Er wird sie aus dieser trostlosen Wohnung holen, sich mit Leidenschaft ins Herz der Welt singen, einen Agenten finden, alles unter einen Hut bekommen, rechtzeitig die Bohnen für das Cassoulet einweichen, Beth pünktlich zur Chemo bringen, weniger koksen und das Dilaudid ganz weglassen, endlich Rot und Schwarz zu Ende lesen. Er wird Beth und Barrett halten, sie trösten, sie daran erinnern, wie wenig Grund zur Sorge besteht, sie ernähren und ihnen genau die Geschichten erzählen, in denen sie mehr von sich selbst entdecken können.
Draußen folgt der Schneefall einer Drehung des Windes, und es ist, als hätte eine gütige Macht, ein riesiger, unsichtbarer Zuschauer verstanden, was Tyler sich wünscht, noch bevor er selbst darauf kommt – eine plötzliche Bewegung, eine Veränderung, die den sanft und stetig sinkenden Schnee aufwirbelt und in flatternde Laken verwandelt, in eine luftige Karte der Windströme; und ja – Tyler, bist du bereit? –, es ist an der Zeit, die Tauben herauszulassen, fünf an der Zahl, auf das Dach des Schnapsladens, es ist an der Zeit, sie fliegen zu lassen und sie dann (schaust du hin?), versilbert vom frühen Tageslicht, gegen die windgetriebenen Schneeflocken zu lenken, sie mühelos nach Westen segeln zu lassen, in die aufgewühlte Luft hinein, die den Schnee zum East River bläst (wo Lastkähne, weiß wie Eisschiffe, durch das kabbelige Wasser pflügen); und ja, genau, einen Moment später ist es an der Zeit, die Straßenbeleuchtung zu löschen und gleichzeitig einen Truck um die Ecke der Rock Street zu schieben, dessen Scheinwerfer noch leuchten und auf dessen flachem Aluminiumdach kleine Warnlichter blinken, granat- und rubinrot, es ist perfekt, es ist phantastisch, vielen Dank.
Barrett läuft mit nacktem Oberkörper durch das Schneegestöber. Seine Brust ist scharlachrot; sein Atem explodiert in Dampfwölkchen. Er hat einige wenige, unruhige Stunden lang geschlafen. Nun dreht er seine morgendliche Runde. Er hat festgestellt, dass er in dieser durchaus gewöhnlichen Tätigkeit Trost findet, er sprintet die Knickerbocker entlang und hinterlässt eine kleine, schnell verdampfende Spur aus Atemstößen, wie eine Lokomotive, die durch ein verschlafenes, schneebedecktes Dorf rumpelt. Wobei sich Bushwick tatsächlich wie ein echtes Dorf anfühlt, das einer strukturellen Dorflogik zu gehorchen scheint (im Gegensatz zu seinem wahren Zustand planlos aneinandergereihter Gebäude mit Baulücken voll Geröll, ohne Zentrum und ohne Randbezirke), aber nur bei Tagesanbruch, nur in dieser eisigen Stille, die bald ein Ende finden wird. Bald werden die Delis und die Geschäfte auf der Flushing öffnen, Autohupen werden blöken, und der Irre – dreckig und orakelhaft, vor Wahnsinn glühend, ein tobender, gedemütigter Heiliger – wird, gewissenhaft wie ein Wachmann, seinen Platz an der Ecke von Knickerbocker und Rock Street einnehmen. Aber im Augenblick, für diesen Augenblick, ist es ruhig. Die Knickerbocker liegt gedämpft und keimend und traumlos da, leer, abgesehen von einigen Autos, die sich vorsichtig vorwärtsschieben und mit ihrem Scheinwerferlicht den fallenden Schnee zerteilen.
Seit Mitternacht kommt es herunter. Der Schnee stürzt und wirbelt, während die Sonne aufgeht und der Himmel anfängt, kaum merklich von einem nächtlichen, schwärzlichen Braun ins leuchtende, samtige Grau des frühen Morgens umzuschlagen, in New Yorks einzigen unschuldigen Himmel.
Gestern Abend ist der Himmel aufgewacht, er hat ein Auge geöffnet und nicht mehr und nicht weniger gesehen als Barrett Meeks, der, auf dem Heimweg und in seinem Mantel im Kosakenstil, auf der vereisten Platte des Central Park stand. Der Himmel hat ihn betrachtet, er hat ihn wahrgenommen und das Auge wieder geschlossen, um sich, Barrett kann es nur imaginieren, wieder den interessanteren, in leuchtenden Galaxien herumwirbelnden Träumen hinzugeben.
Eine Befürchtung: Gestern Abend war nichts, es war nur ein Echo, ein versehentlicher Blick hinter den himmlischen Vorhang, einer jener dummen Zufälle. Barrett ist ebenso wenig »erwählt«, wie ein Zimmermädchen dazu auserkoren wäre, in die Familie einzuheiraten, nur weil sie den ältesten Sohn nackt gesehen hat, auf dem Weg ins Bad, als er dachte, im Flur wäre niemand.
Eine weitere Befürchtung: Gestern Abend war etwas, doch es ist unmöglich zu wissen oder auch nur zu erahnen, was es war. Barrett, ein widerspenstiger, querköpfiger Katholik schon zu Grundschulzeiten (der graugeäderte Marmorjesus am Eingang der Transfiguration School war sexy, er hatte Sixpack und Bizeps und dieses traurige, jungfräuliche Gesicht), kann sich nicht erinnern, nicht einmal aus dem Mund der Nonnen, die an ihm verzweifelten, je von einer dermaßen willkürlich gewährten Vision gehört zu haben, der zudem jeder Kontext fehlte. Visionen sind Antworten. Antworten setzen Fragen voraus.
Nicht, dass Barrett keine Fragen hätte. Wer hat die nicht? Aber dafür braucht er nicht unbedingt die Antwort eines Propheten oder eines Orakels. Selbst wenn sich ihm die Gelegenheit böte, würde er kaum wollen, dass ein barfüßiger Jünger einen schummrig beleuchteten Korridor hinunterläuft und den Seher stört, um zu fragen: Warum stellen sich alle Geliebten von Barrett Meeks als sadistische Deppen heraus? Oder: Welche Tätigkeit wird Barretts Interesse länger fesseln als sechs Monate?
Was also – falls gestern Abend eine Intention dahintersteckte, falls das himmlische Auge eigens für Barrett geblinzelt hat – war verkündet worden? Was genau sollte er nach Ansicht des Lichtes tun?
Als er nach Hause kam, fragte er Tyler, ob er es auch gesehen habe (Beth lag im Bett, in der Umlaufbahn gehalten von der wachsenden Anziehungskraft ihrer Dämmerzone). Als Tyler sagte: »Was soll ich gesehen haben?«, stellte Barrett überrascht fest, dass er zögerte, vom Licht zu erzählen. Natürlich aus offensichtlichen Gründen – wer wollte schon von seinem großen Bruder für verrückt gehalten werden? –, aber zugleich drängte sich Barrett das unbestimmte Gefühl auf, dass hier Verschwiegenheit angebracht war, als sei er stillschweigend instruiert worden, niemandem ein Wort zu verraten. Also dachte er sich spontan etwas aus, Unfall mit Fahrerflucht an der Ecke Thames Street.
Und dann überflog er die Nachrichten.
Nichts. Die Wahlen, natürlich. Und die Neuigkeit, dass Arafat im Sterben lag; dass die Foltergerüchte aus Guantánamo bestätigt wurden; dass eine ungeduldig erwartete Weltraumkapsel mit Sonnenproben zerschellt war, weil der Fallschirm sich nicht geöffnet hatte.
Aber kein Nachrichtensprecher mit kantigem Kinn, der Augenkontakt mit der Kamera suchte und verkündete: Heute Abend hat Gottes Auge auf die Erde niedergeblickt …
Barrett kochte das Abendessen (von Tyler kann man dieser Tage nicht verlangen zu bedenken, dass Menschen regelmäßig essen müssen, und Beth ist zu krank). Er gestattete sich, erneut über seine letzte verlorene Liebe nachzugrübeln. Vielleicht lag es an jenem Telefonat spätabends, bei dem Barrett gleich gespürt hatte, dass er schon viel zu lange über den bescheuerten Kunden redete, der vor dem Kauf eines bestimmten Sakkos unbedingt wissen wollte, ob es unter gewaltfreien Bedingungen genäht worden sei – manchmal kann Barrett ein ganz schöner Langweiler sein, nicht wahr? –, oder vielleicht lag es an dem Abend, als er gleich mit dem ersten Stoß die weiße Kugel vom Tisch befördert und die Lesbe sich zu ihrer Freundin umgedreht hatte, um einen Kommentar zu tuscheln (manchmal kann er auch ganz schön peinlich sein).
Seine mannigfaltigen Missetaten beschäftigten ihn allerdings nicht lange. Er hatte etwas Unmögliches gesehen. Etwas, das offenbar niemand sonst gesehen hatte.
Er kochte das Essen. Er versuchte, die Liste der Gründe, warum er abserviert worden war, zu verlängern.
Und jetzt, am Morgen danach, geht er joggen. Warum auch nicht?
Als er an der Kreuzung von Knickerbocker und Thames über eine zugefrorene Pfütze springt, gehen die Straßenlaternen aus. Nun, da sich ihm ein ganz anderes Licht gezeigt hat, meint er einen wie auch immer gearteten Zusammenhang zwischen dem Sprung und dem Erlöschen zu erkennen, als hätte er, Barrett, mit seinem Sprung die Straßenbeleuchtung abgeschaltet. Als könnte ein einsamer Mann auf seiner morgendlichen Dreimeilenrunde den neuen Tag anstoßen.
Da ist ein Unterschied, der Unterschied zwischen gestern und heute.
Tyler ringt mit dem Impuls, im Schlafzimmer auf das Fensterbrett zu steigen. Er denkt nicht an Selbstmord. Scheiße, nein. Und außerdem, falls er doch an Selbstmord denkt, er befindet sich im ersten Stock. Da bricht er sich höchstens ein Bein, vielleicht – nur vielleicht – schlägt sein Kopf so hart auf dem Asphalt auf, dass es für eine Gehirnerschütterung reicht.
Aber die Geste wäre jämmerlich – die Versagerversion des resigniert trotzigen, letztendlich eleganten Entschlusses, es reicht zu sagen und im Walzerschritt von der Bühne zu tanzen. Er spürt kein Verlangen, mit gespreizten Gliedern auf dem Gehweg zu liegen, ein bisschen verdreht und zerschrammt nach dem Sprung in eine Leere, die keine sechs Meter tief ist.
Er denkt nicht an Selbstmord, er denkt lediglich darüber nach, wie es wäre, sich dem Sturm vollends auszusetzen und die Nadelstiche von Wind und Schnee noch deutlicher zu spüren. Das Problem (eines der Probleme) an dieser Wohnung ist, dass man entweder drinnen sein und zum Fenster hinausschauen oder draußen auf der Straße stehen und zum Fenster hinaufschauen kann. Es wäre ja so schön, so wunderbar, nackt in der Witterung zu stehen; sich ihr ganz auszuliefern.
Weil er keine Wahl hat, begnügt er sich damit, sich so weit wie möglich hinauszulehnen, was kaum mehr bringt als einen frostigen Windschlag ins Gesicht und ein paar Schneeflocken, die sich in seinen Haaren verfangen.
Zurück vom Joggen, betritt Barrett die Wohnung, tritt in Wärme und Geruch ein: in den feucht-holzigen Saunadampf, den die alten Heizkörper ausatmen; den pudrigen Duft von Beths Medikamenten; die Lack- und Farbaromen, die sich hartnäckig zu verfliegen weigern, so als widersetzte sich dieses Drecksloch allen Verbesserungsversuchen; als könnte und wollte der Geist, der dem Gebäude innewohnt, nicht glauben, dass die Zeiten vorbei sind, da die Wände nur aus nacktem, brandfleckigem Putz bestanden und in den Zimmern Frauen in langen Röcken hausten, die am Herd schwitzten, während ihre Fabrikarbeiter-Männer fluchend am Küchentisch saßen. Der kürzlich erzwungene Renovierungsgeruch, eine Mischung aus Wandfarbe und Arztpraxis, schafft es nicht, den tieferen Ur-Dunst von Schinkenfett und Schweiß und Zunder zu überdecken, von Achselhöhle und Whiskey und feuchtem, schwarzem Schimmel.
Die Wärme in der Wohnung überzieht Barretts Haut mit einer kribbelnden Taubheit. Auf der morgendlichen Joggingrunde passt er sich der Kälte an, richtet sich in ihr ein, wie ein Langstreckenschwimmer sich im Wasser einrichten muss, und erst nach seiner Rückkehr merkt er, dass er in Wahrheit halb erfroren ist. Er ist wohl doch kein Komet, sondern menschlich, hoffnungslos menschlich, und als Mensch zieht es ihn hinein – in die Wohnung, das Boot, das Raumschiff –, er könnte nicht bestehen zwischen den vernichtenden Schönheiten, in den eiskalten, luftleeren, stillen Räumen, in der gewundenen, spiralförmigen Schwärze, die er so gern seine wahre Heimat nennen würde.
Ein Licht ist ihm erschienen. Und wieder vergangen, wie eine unangenehme Erinnerung an die Kirchenbesuche seiner Kindheit. Seit seinem fünfzehnten Geburtstag lebt Barrett so unerbittlich weltlich, wie es nur ein Exkatholik kann. Er hat sich selbst entlassen, vor Jahrzehnten, aus Einfalt und Vorurteil, hat sich losgesagt vom Leib Christi, der von UPS in Pappkartons angeliefert wird; von der schwerfälligen, müden Fröhlichkeit der Priester.
Doch er hat ein Licht gesehen. Und das Licht ihn.
Was soll er damit anfangen?
Zunächst einmal steht das Morgenbad an.
Im Flur, auf dem Weg zum Badezimmer, kommt Barrett an der Tür zu Tylers und Beths Schlafzimmer vorbei, die sich in der Nacht gähnend aufgeschoben hat wie alle Türen und Schubladen und Schränke in dieser schrägen Wohnung. Barrett hält inne, sagt nichts. Tyler beugt sich zum Fenster hinaus, nackt, er steht mit dem Rücken zur Tür und lässt sich beschneien.
Barrett war immer schon vom Körper seines Bruders fasziniert. Dafür, dass sie Brüder sind, sehen er und Tyler sich nicht besonders ähnlich. Barrett ist ein großer Kerl, nicht dick (noch nicht), aber bärengleich, mit purpurroten Lippen und Augenrändern; sein Pelz ist rotblond, und er strahlt (hofft er) eine bezaubernde, sinnliche Durchtriebenheit aus; er ist der Prinz, der sich in einen Wolf oder Löwen verwandelt hat, ganz der träge Sanfte mit großen Tatzen und gierigen gelben Augen, der nur darauf wartet, von der Liebe wachgeküsst zu werden. Tyler ist geschmeidig und sehnig, von muskulöser Spannung. Selbst im Ruhezustand sieht er aus wie ein Trapezkünstler kurz vor dem Absprung. Tylers Körper ist mager, aber dekorativ, der Körper eines Akrobaten; aus irgendeinem Grund drängt sich die Vokabel »fesch« auf. Tyler begegnet seinem Körper ohne jeden Respekt. Er agiert mit der Waghalsigkeit eines Zirkusartisten.
Er und Barrett werden selten für Brüder gehalten. Und doch sind sie mittels eines undurchschaubaren genetischen Plans verbunden. Barrett weiß das mit Gewissheit, auch wenn er es nicht erklären könnte. Sie ähneln sich auf Arten, die nur sie verstehen. Sie erkennen einander, wie wilde Tiere sich an Ausscheidungen und Kot erkennen. Sie erscheinen einander nie rätselhaft, auch wenn sie in den Augen aller anderen ein Rätsel bleiben. Nicht, dass sie sich nie streiten oder messen; es ist nur so, dass nichts, was der eine sagt oder tut, den anderen je wirklich verblüffen könnte. Anscheinend sind sie sich, vor langer Zeit und ohne je darüber gesprochen zu haben, einig geworden, ihre Seelenverwandtschaft in Gegenwart anderer zu verheimlichen; sich bei Dinnerpartys zu zanken, um Aufmerksamkeit zu buhlen, einander gedankenlos zu beleidigen und abzulehnen, sich in der Öffentlichkeit wie gewöhnliche Brüder aufzuführen und ihre keusche, brennende Liebe für sich zu behalten wie eine Sekte mit zwei Mitgliedern, die als ganz normale Bürger durchgehen und warten, bis ihr Tag gekommen ist.
Tyler wendet sich vom Fenster ab. Er könnte schwören, einen Blick im Nacken gespürt zu haben, und obwohl da niemand ist, fühlt er eine Präsenz, eine aufgelöste Form, die die Luft im Türrahmen noch nicht ganz vergessen hat.
Und dann das Geräusch von Wasser, das in die Wanne läuft. Barrett ist vom Joggen zurück.
Wie kommt es, dass sich Barretts Rückkehr, von wo auch immer, für Tyler bis heute wie ein Ereignis anfühlt? Die Heimkehr des verlorenen Sohns, ein ums andere Mal. Dabei ist er doch nur Barrett, der kleine Bruder, der dicke kleine Junge, der mit der Brady Bunch-Brotdose unterm Arm an der Haltestelle steht und dem Schulbus nachweint; der heranwachsende Clown, der es irgendwie geschafft hat, jenem Schicksal zu entrinnen, das für die sommersprossigen Pummel ganz automatisch vorgesehen ist; Barrett, der in der Cafeteria der Highschool Hof hielt, der Barde von Harrisburg, Pennsylvania; Barrett, mit dem Tyler sich unzählige Kinderkämpfe um Gehege und Geschwätz lieferte, mit dem er um die wankelmütige und königliche Aufmerksamkeit der Mutter wetteiferte; Barrett, dessen schiere Kreatürlichkeit ihm vertrauter ist als die eines jeden anderen Menschen, auch die von Beth; Barrett, dessen aufnahmefähiger und quirliger Verstand ihn bis nach Yale brachte und der seither damit beschäftigt ist, Tyler, und nur Tyler, die zwingende Logik seiner unterschiedlichen Vorhaben zu erklären: nach dem Abschluss jahrelang im Land herumzufahren (siebenundzwanzig Staatsgrenzen hat er überquert), Jobs anzunehmen (an der Fritteuse, an der Motelrezeption, als Aushilfe auf dem Bau), weil sein Hirn überladen war, seine Hände aber ungeschickt; dann der Strich (weil er in romantischen Vorstellungen schwelgte, zu versessen darauf war, ein zeitgenössischer Byron zu werden, es war höchste Zeit, einen Crashkurs in Sachen Gemeinheit und Garstigkeit der Liebe zu belegen), der Antritt der Doktorandenstelle (