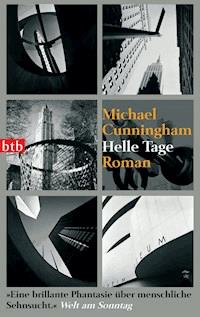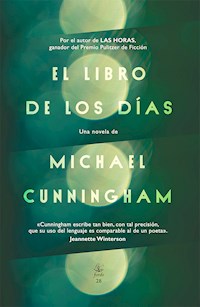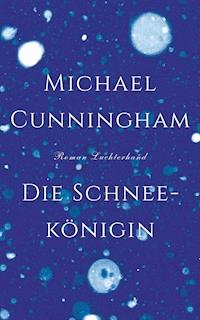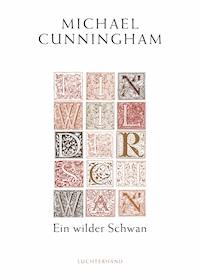8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Tag im Leben dreier Frauen: Clarissa Vaughan spaziert an einem strahlenden Junimorgen durch die Straßen von New York. Es ist das pulsierende New York der späten neunziger Jahre. Clarissa will Blumen für eine Party besorgen, die sie an diesem Abend für ihren aidskranken Freund Richard geben will, der soeben einen bedeutenden Literaturpreis erhalten hat. Sie kennen sich seit Jahrzehnten, für kurze Zeit waren sie auch ein Paar. Richard gab ihr den Spitznamen Mrs. Dalloway, weil sie ihn an die Heldin aus Virginia Woolfs gleichnamigen Roman erinnert.
Laura Brown ist mit einem Kriegsveteranen verheiratet, der rührend um sie bemüht ist, ihr kleiner Sohn liebt sie abgöttisch, sie ist zum zweitenmal schwanger. Doch das Hausfrauenleben in einem Vorort von Los Angeles erdrückt sie. An einem Tag im Jahr 1949 flieht sie vor den alltäglichen Pflichten, mietet sich ein Zimmer in einem Hotel und liest fasziniert "Mrs. Dalloway".
Virginia Woolf ringt im Jahr 1923 um den Anfang ihres neuen Romans, dem sie den Arbeitstitel "The Hours" (Die Stunden) gegeben hat und der einmal "Mrs. Dalloway" heißen wird. Sie hat Kopfschmerzen und hört Stimmen, und sie vermisst die Großstadt, obwohl sie weiß, dass ihr der Rückzug aufs Land nach Richmond gut tut. Fast steigt sie in den Zug nach London, nur fast, denn nun schreibt sie den ersten Satz: "Mrs. Dalloway sagte, sie wolle die Blumen selber kaufen."
In seinem überwältigend schönen und bewegenden Roman schildert Michael Cunningham einen Tag im Leben dieser drei Frauen. Von Virginia Woolfs Leben und Werk inspiriert, schafft er eine ganz eigene Welt, die sich um die Möglichkeiten von Freundschaft und Liebe dreht, um das Auffangen von Scheitern und Lebensüberdruss und um eine Gemeinschaft jenseits von Leben und Tod: der Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Ein Tag im Leben dreier Frauen: Clarissa Vaughan im New York der neunziger Jahre bereitet eine Party für ihren Jugendfreund vor; von ihm hat sie den Spitznamen »Mrs. Dalloway«, nach einer Heldin bei Virgina Woolf. Laura Brown, Hausfrau und Mutter in einem Vorort von Los Angeles im Jahr 1949, entflieht ihrem Alltag und liest »Mrs. Dalloway«. Und schließlich Virginia Woolf in Richmond im Jahr 1923; sie vermisst die Großstadt London, und sie ringt um den ersten Satz ihres Romans »Mrs. Dalloway«. Ein überwältigend schöner und bewegender Roman über Freundschaft und Liebe, über die Suche nach Anerkennung und Lebensglück.
MICHAEL CUNNINGHAM wurde 1952 in Cincinnati, Ohio, geboren und lebt heute in New York City und Provincetown. Sein Roman »Die Stunden« wurde u. a. mit dem Pulitzerpreis und dem PEN/Faulkner Award ausgezeichnet und in 22 Sprachen übersetzt. Die überaus erfolgreiche Verfilmung »The Hours« mit Meryl Streep, Julianne Moore und Nicole Kidman erhielt einen Oscar.
»Ein brillanter Roman über Frauen,die keine Kompromisse wollen.«
Brigitte
Inhaltsverzeichnis
Für Ken Corbett
Wir wollen einen dritten Tiger suchen. Dieser wird, wie die anderen, ein Bild sein aus meinen Träumen, ein System aus Wörtern der Menschen, und nicht der Tiger mit Rückgrat, der jenseits der Mythologien auf der Erde lebt. Ich weiß wohl, doch zwingt mir etwas dies unbegrenzte Abenteuer auf, sinnlos und alt, und so harre ich aus und suche in der Dämmerzeit des Abends den andren Tiger, den, der nicht im Vers ist.
– JORGE LUIS BORGES, Der andere Tiger, 1960
Ich habe keine Zeit, meine Pläne darzulegen. Ich müsste eine Menge über The Hours sagen, & über meine Entdeckung; wie ich hinter meinen Figuren schöne Höhlen ausgrabe; ich glaube, dadurch kommt genau zum Ausdruck, was ich will; Menschlichkeit, Humor, Tiefe. Die Idee ist, dass die Höhlen sich verbinden, & jede im gegenwärtigen Augenblick ans Tageslicht kommt.
– VIRGINIA WOOLF, Tagebücher, 30. August 1923
Prolog
Sie hastet aus dem Haus, wirft einen für die Witterung zu schweren Mantel über. 1941. Wieder hat ein Krieg begonnen. Sie hat eine Nachricht für Leonard hinterlassen und eine weitere für Vanessa. Zielstrebig geht sie in Richtung Fluss, ihres Vorhabens gewiss, doch sogar jetzt lässt sie sich noch beinahe ablenken durch den Anblick der grünen Hügel, der Kirche und ein paar vereinzelter Schafe, leuchtend weiß, mit einem leichten Stich ins Schwefelgelbe, die unter einem dunkelnden Himmel weiden. Sie hält inne, betrachtet die Schafe und den Himmel, geht dann weiter. Hinter ihr murmeln die Stimmen; Bomber dröhnen am Himmel, die sie nicht sehen kann, obgleich sie Ausschau nach ihnen hält. Sie kommt an einem Landarbeiter vorbei (heißt er nicht John?), einem stämmigen Mann mit kleinem Kopf, der eine kartoffelfarbene Weste trägt und den Graben säubert, der durch die Weidenpflanzung führt. Er blickt auf, nickt ihr zu, schaut wieder hinab in das braune Wasser. Welch ein Erfolg für ihn, welch ein Glück, einen Graben durch eine Weidenpflanzung reinigen zu können, denkt sie auf dem Weg zum Fluss. Sie hingegen hat versagt. Eigentlich ist sie gar keine Schriftstellerin; lediglich eine begabte Exzentrikerin. Himmelsfetzen schillern in den Pfützen, die der Regen letzte Nacht hinterlassen hat. Ihre Schuhe sinken ein wenig in den weichen Boden ein. Sie hat versagt, und jetzt sind die Stimmen wieder da, das undeutliche Gemurmel knapp außerhalb ihres Blickfelds, hinter ihr, hier, nein, dreh dich um, und sie sind irgendwo anders. Die Stimmen sind wieder da, und der Kopfschmerz naht so sicher wie der Regen, der Kopfschmerz, der sie, was sie auch ist, zermalmen und ihre Stelle einnehmen wird. Der Kopfschmerz naht, und es scheint (beschwört sie die nun selbst herbei?), dass die Bomber wieder am Himmel auftauchen. Sie erreicht den Uferdamm, steigt darüber und wieder hinab zum Wasser. Flussaufwärts, weit weg, ist ein Angler, er wird sie nicht bemerken, oder? Sie sucht einen Stein. Sie geht rasch, aber systematisch vor, als hielte sie sich an ein Rezept, das man gewissenhaft befolgen muss, wenn es gelingen soll. Sie wählt einen aus, der ungefähr die Größe und die Form eines Schweineschädels hat. Selbst als sie ihn hochhebt und ihn in eine Tasche ihres Mantels zwängt (der Pelz kitzelt sie am Hals), nimmt sie unwillkürlich die kalkige Kälte des Steins und seine Farbe wahr, ein milchiges Braun mit grünen Flecken. Sie steht unmittelbar am Fluss, der ans Ufer schwappt und die kleinen Unebenheiten im Morast mit klarem Wasser füllt, das gänzlich anders beschaffen sein könnte als die gelbbraune, gesprenkelte Masse, die sich, scheinbar fest wie eine Straße, ebenmäßig von einem Ufer zum andern erstreckt. Sie tritt einen Schritt vor. Sie zieht ihre Schuhe nicht aus. Das Wasser ist kalt, aber nicht unerträglich kalt. Sie hält inne, steht bis zu den Knien im Wasser. Sie denkt an Leonard. Sie denkt an seine Hände und seinen Bart, die tiefen Furchen um seinen Mund. Sie denkt an Vanessa, an die Kinder, an Vita und Ethel: so viele. Sie haben alle versagt, nicht wahr? Plötzlich tun sie ihr unendlich leid. Sie stellt sich vor, dass sie umkehrt, den Stein aus der Tasche nimmt, zum Haus zurückgeht. Sie könnte vermutlich rechtzeitig zurück sein, um die Briefe zu vernichten. Sie könnte weiterleben; sie könnte ihnen diese letzte Gefälligkeit erweisen. Knietief im fließenden Wasser stehend, entscheidet sie sich dagegen. Die Stimmen sind da, der Kopfschmerz kommt, und wenn sie sich wieder in die Obhut von Leonard und Vanessa begibt, werden sie sie nicht noch einmal gehen lassen, oder? Sie beschließt, darauf zu bestehen, dass man sie gehen lässt. Unbeholfen watet sie hinaus (der Boden ist schlüpfrig), bis ihr das Wasser zur Taille reicht. Sie wirft einen Blick flussaufwärts zu dem Angler, der eine rote Jacke trägt und sie nicht bemerkt. Auf dem gelben Fluss (eher gelb als braun, wenn man’s genau besieht) spiegelt sich matt der Himmel. Das also ist die letzte Wahrnehmung – ein Angler in einer roten Jacke und der bewölkte Himmel, der sich im trüben Wasser widerspiegelt. Beinahe unfreiwillig (es kommt ihr unfreiwillig vor) tritt oder torkelt sie vorwärts, und der Stein zieht sie hinein. Einen Augenblick lang kommt es ihr dennoch nichtig vor; es kommt ihr vor, als habe sie ein weiteres Mal versagt; nur kühles Wasser, aus dem sie mühelos wieder herausschwimmen kann; doch dann erfasst sie die Strömung und zieht sie mit einer so jähen, geschmeidigen Kraft mit sich, dass es sich anfühlt, als hätte sich ein starker, muskulöser Mann vom Grund erhoben, ihre Beine gepackt und sie an seine Brust gedrückt. Es fühlt sich menschlich an.
Über eine Stunde später kehrt ihr Mann aus dem Garten zurück. »Madame ist ausgegangen«, sagt das Hausmädchen und schüttelt ein fadenscheiniges Kissen auf, aus dem winzige Daunen stöbern. »Sie hat gesagt, sie kommt bald wieder.«
Leonard geht nach oben ins Wohnzimmer, um die Nachrichten zu hören. Er findet einen blauen, an ihn adressierten Umschlag auf dem Tisch. Darin steckt ein Brief.
Liebster,
Ich fühle deutlich, dass ich wieder verrückt werde. Ich glaube, wir ertragen eine so schreckliche Zeit nicht noch einmal.
Und diesmal werde ich nicht wieder gesund werden. Ich höre Stimmen und ich kann mich nicht konzentrieren.
Also tue ich das, was mir in dieser Situation das Beste zu sein scheint. Du hast mir das größtmögliche Glück geschenkt. Du bist mir alles gewesen, was jemand für einen Menschen sein kann. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, bis diese schreckliche Krankheit kam. Ich kann nicht mehr dagegen ankämpfen. Ich weiß, dass ich Dein Leben ruiniere und dass Du ohne mich arbeiten könntest. Und das wirst Du auch, ich weiß es.
Du siehst, nicht einmal das hier kann ich ordentlich schreiben. Ich kann nicht lesen.
Was ich sagen möchte, ist, dass ich alles Glück in meinem Leben Dir verdanke.
Du hast unendliche Geduld mit mir gehabt & bist unglaublich gut zu mir gewesen. Das möchte ich sagen – jeder weiß es. Wenn jemand mich hätte retten können, wärest Du es gewesen. Alles andere hat mich verlassen, außer dem sicheren Wissen um Deine Güte. Ich kann Dein Leben nicht länger ruinieren.
Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, als wir gewesen sind. Virginia
Leonard stürzt aus dem Zimmer, rennt nach unten. »Ich glaube, Mrs. Woolf ist etwas zugestoßen«, sagt er zu dem Hausmädchen. »Ich glaube, sie hat möglicherweise versucht sich umzubringen. Wohin ist sie gegangen? Haben Sie sie gesehen, als sie das Haus verlassen hat?«
Das Mädchen ist verängstigt, fängt an zu weinen. Leonard stürmt hinaus und geht zum Fluss, vorbei an der Kirche und den Schafen, vorbei an der Weidenpflanzung. Am Flussufer stößt er lediglich auf einen Mann in einer roten Jacke, der angelt.
Rasch wird sie von der Strömung davongetragen. Sie scheint zu fliegen, wirkt wie ein Fabelwesen, die Arme ausgestreckt, mit fließendem Haar, dem Pelzmantel, der sich wie ein Schweif hinter ihr bauscht. Schwerfällig treibt sie durch braune, körnige Lichtstrahlen. Ihre Füße (die Schuhe sind nicht mehr da) streifen gelegentlich den Grund, und jedes Mal wirbeln sie eine träge Schlickwolke mit schwarzen Blattrippen auf, die nahezu reglos im Wasser stehen bleibt, nachdem sie vorbei und außer Sicht ist. Grünschwarze Ranken verfangen sich in ihren Haaren und dem Pelzmantel, und eine Zeitlang sind ihre Augen von einem dicken Strang Wasserkraut verdeckt, der sich schließlich löst und davontreibt, sich verwindet, entwirrt und wieder verwindet.
An einem der Pfeiler der Brücke in Southease kommt sie endlich zur Ruhe. Die Strömung zieht und zerrt an ihr, doch sie sitzt am Fuß der wuchtigen, viereckigen Stütze fest, den Rücken dem Fluss zugekehrt und das Gesicht am Stein. Sie rollt sich dort ein, hat einen Arm an die Brust gelegt, und der andere schwebt über ihrer Hüfte. Ein Stück über ihr ist die helle, gekräuselte Wasseroberfläche. Unstet spiegelt sich dort der Himmel, weiß und wolkenverhangen; schwarze Krähen, scharf umrissen wie Scherenschnitte, ziehen vorbei. Personenwagen und Laster rumpeln über die Brücke. Ein kleiner Junge, nicht älter als drei, der mit seiner Mutter die Brücke überquert, bleibt am Geländer stehen, kauert sich hin, schiebt den Stock, den er bei sich hat, zwischen den Querstreben hindurch und lässt ihn ins Wasser fallen. Seine Mutter drängt ihn weiterzugehen, doch er will unbedingt noch bleiben, zusehen, wie der Stock von der Strömung erfasst wird.
Hier sind sie nun, an einem Tag in den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs: der Junge und seine Mutter auf der Brücke, der auf dem Wasser treibende Stock und Virginias Leib am Grund des Flusses, als träumte sie von da oben, von dem Stock, dem Jungen und seiner Mutter, dem Himmel und den Krähen. Ein olivgrüner Laster rollt über die Brücke, beladen mit Soldaten, die dem Jungen zuwinken, der gerade den Stock geworfen hat. Er winkt zurück. Er verlangt, dass seine Mutter ihn hochnimmt, damit er die Soldaten besser sehen kann; damit auch sie mehr von ihm sehen. All das dringt in die Brücke ein, hallt durch Holz und Stein, dringt in Virginias Leib ein. Ihr Gesicht, an den Pfeiler gedrückt, nimmt das alles auf: den Laster und die Soldaten, die Mutter und das Kind.
Mrs. Dalloway
Die Blumen müssen noch besorgt werden. Clarissa gibt sich gereizt (obgleich sie solche Aufgaben liebt), lässt Sally das Badezimmer putzen, verspricht, in einer halben Stunde zurück zu sein, und stürmt hinaus.
New York City. Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts.
Der Junimorgen draußen vor der Tür zum Vestibül ist so schön und klar, dass Clarissa auf der Schwelle innehält wie am Rand eines Schwimmbeckens, als betrachtete sie das türkise Wasser, das an die Kacheln schwappt, das flimmernde Gespinst der Sonnenstrahlen in der blauen Tiefe. Als stünde sie am Rand eines Schwimmbeckens, zögert sie den Sprung hinaus, den jähen Eishauch, den schieren Schock beim Eintauchen. New York mit seinem Lärm und seiner düsteren braunen Hinfälligkeit, seinem bodenlosen Niedergang, bringt immer ein paar Sommermorgen wie diesen zustande; Morgen, die durchdrungen sind von neuem Leben, das sich überall mit einer solchen Entschiedenheit behauptet, dass es fast komisch ist, wie eine Comicfigur, die andauernd schreckliche Prügel einstecken muss und immer wieder unversehrt, ungeschoren davonkommt, bereit zu mehr. Auch in diesem Juni haben die Bäume entlang der West Tenth Street auf dem spärlichen Stück Boden voller Hundedreck und weggeworfener Verpackungen, auf dem sie stehen, wieder makellose kleine Blätter ausgetrieben. Wieder ist in dem Blumenkasten der alten Frau nebenan, in dem wie immer verblichene rote Plastikgeranien in der Erde stecken, ein einzelner Löwenzahn aufgegangen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!