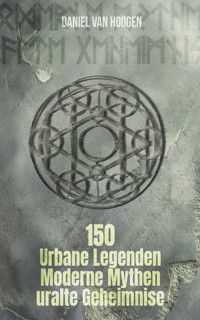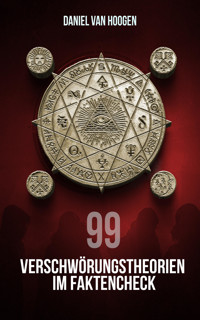6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein humorvoll-schräges Fantasy-Abenteuer voller Sarkasmus, absurder Dialoge und magischem Chaos. Sabine entdeckt an der Ostsee eine Flasche, die eine ungewöhnliche Flaschengeistin freisetzt: Smokey, ein allmächtiges Wesen aus dem Weltall, geboren im Urknall als kosmische Anomalie, deren sarkastische und humorvolle Art sofort Sabines Leben für die nächsten Stunden auf den Kopf stellt. Smokey gewährt Sabine zwei Wünsche, doch sich etwas zu wünschen, ist gar nicht so einfach. Schließlich nimmt Smokey Sabine die Entscheidung ab – sie weiß schließlich viel besser, was Sabine sich wünscht. Nachdem sie beide Wünsche erfüllt hat, die für Sabine allerdings völlig anders ausfielen, als sie es sich vorgestellt hatte, fliegt Smokey völlig unbeeindruckt ins Weltall – schließlich muss sie ja noch ihre ebenfalls allmächtigen Freundinnen im Weltall treffen – man ist zum Basteln verabredet. Doch dann merkt sie, dass sie ihre Notizen mit den galaktischen Koordinaten vergessen hat. Wie soll sie ihre Freundinnen jetzt finden? Also zurück zur Erde, Sabine suchen. Sie müsste die Flasche ja noch haben, und darin befinden sich auch ihre Notizen. Aber wie soll man nur einen einzelnen Menschen in diesem großen Haufen von Menschen finden? Sie trifft auf Jon, der widerwillig in ein chaotisches Abenteuer hineingezogen wird, als er sich zusammen mit Smokey auf die Suche nach Sabine begibt. Dabei erleben sie skurrile Situationen, die von der Umgestaltung eines Cafés in einen psychedelischen Albtraum bis hin zu diversen Manipulationen der Zeit reichen – was natürlich die Zeitpolizei auf den Plan ruft. Diese Geschichte nimmt klassische Fantasyelemente und wirbelt sie ordentlich durcheinander. Wortwörtlich. Smokey, eine eigensinnige Flaschengeistin, ist alles andere als die typische Wunscherfüllerin – sarkastisch, unberechenbar und mit einer Vorliebe für bissige Kommentare. Die Welt um sie herum bleibt bodenständig, während sie mit ihrem losgelösten, schillernden Wesen gegen jegliche Erwartungshaltung rebelliert. Der Erzählstil spielt geschickt mit der Balance zwischen Humor und Tiefgang. Alltagsmomente werden mit magischen Elementen verwoben, ohne dabei in märchenhafte Klischees abzudriften. Die Dialoge sind modern, voller trockener Ironie und pointiertem Witz. Besonders die Dynamik zwischen den Charakteren sorgt für einen unkonventionellen Charme: Ein ruhiger, ironischer Mann trifft auf ein Wesen, das sich nicht an Regeln hält – und auch nicht daran interessiert ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Vorwort
Zum ersten Mal beschäftigte ich mich mit dem Gedanken, drei Wünsche frei zu haben, als ich mit etwa zwölf oder dreizehn die Geschichte von Aladdin las. Nein, nicht die weichgespülte Disney-Version mit Gesangseinlagen und sprechendem Teppich, sondern das Original aus tausendundeiner Nacht: Aladdin und die Wunderlampe. Eigentlich fand ich die Geschichte ziemlich zäh. Viel Gerede, wenig Action, und Aladdin kam mir nicht besonders clever vor – zumindest am Anfang nicht. Aber die Idee, einfach so drei Wünsche zur Verfügung zu haben, ließ mich nicht mehr los. Wenn ich abends im Bett lag und nicht einschlafen konnte, stellte ich mir vor, was ich mir wünschen würde. Anfangs, für ein, zwei Jahre vielleicht, war mein erster Wunsch immer derselbe: dass Patrizia aus meiner Klasse mich genauso gern hat wie ich sie. Später ersetzte ich Patrizia durch Anja. Gemocht hat mich aber irgendwann Nina. Zwar nicht mein Wunsch-Mädchen, aber hey – nehmen wir, wie es kommt.
Beim zweiten Wunsch wurde es komplizierter. Geld war natürlich eine naheliegende Wahl. Eine Million? Klingt gut. Aber warum so bescheiden? Warum nicht zehn Millionen? Oder hundert Millionen? Wieviel Geld reicht eigentlich? Wieviel, damit es mir nicht irgendwann ausgeht und ich mich ärgere, dass ich nicht viel mehr gewünscht hatte? Und was ist mit der Inflation? Nein, viel zu kompliziert. Geld ist eine ziemlich flüchtige Sache. Der perfekte Wunsch musste unkaputtbar, unverlierbar und immer bei mir sein. Aber was? Ich habe es nie herausgefunden. Immerhin war es ein magischer Wunsch – und wenn man schon einen hat, dann sollte er auch hundertprozentig passen.
Ehrlich gesagt machte mir das Grübeln darüber viel mehr Spaß, als mich auf eine endgültige Antwort festzulegen. Es war ein Spiel, ein endloses Gedankenabenteuer, bei dem ich immer neue Möglichkeiten erfand, ohne mich entscheiden zu müssen. Wenn ich nachts im Bett lag, eingehüllt in die Stille des Hauses, nur unterbrochen von den leisen Geräuschen der Nacht, und die tanzenden Schatten des Baumes beobachtete, die das Laternenlicht an meine Wand warf, fühlte sich allein das Nachdenken über Wünsche schon magisch an. Ich grübelte so lange und so gerne über den zweiten Wunsch, dass ich nie zum dritten kam. Übrigens – falls Sie mal nicht einschlafen können, kann ich diese Methode wärmstens empfehlen!
Nun bin ich schon lange erwachsen und mein größter Wunsch hat sich längst erfüllt: Melissa. Als ich sie zum ersten Mal sah, wusste ich sofort: Sie war es. Vergesst Patrizia, Anja und Nina – all die kleinen und großen Sehnsüchte meiner Kindheit und Jugend verblassten neben diesem einen Wunsch. Ich hätte ohne zu zögern all meine drei Wünsche auf einen reduziert, wenn es nur Melissa wäre. Und wissen Sie was? Ich würde es noch heute tun.
Mein Wunsch ging in Erfüllung, ich habe Melissa heiraten dürfen. Nicht nur das, wir bekamen sogar zwei Kinder: Saskia und Mila, unsere beiden fantastischen Töchter – klug, liebenswert und mit genau der richtigen Dosis Wahnsinn, die man als unsere Kinder wohl zwangsläufig haben musste. Mittlerweile sind die beiden erwachsen, haben das Nest verlassen und führen ihr eigenes Leben. Melissa und ich gewöhnen uns langsam daran, dass die Spülmaschine nicht mehr täglich gefüllt wird, dass keine Schuhe mehr im Flur herumfliegen und dass unser Kühlschrank tatsächlich länger als 24 Stunden voll bleibt. Ich habe sogar Zeit, dieses Buch zu schreiben – ein Privileg, das ich zu schätzen weiß, seit niemand mehr „Papa, wo sind meine Socken?“ durchs Haus ruft oder mitten in der Nacht mit einem „Ich brauche ganz dringend ein Referat über den Regenwald bis morgen früh!“ vor meinem Bett steht.
Jetzt sitze ich da, eine Tasse Kaffee in der Hand, und lasse meine Gedanken schweifen. Ich denke über meine zurückliegenden Wünsche nach. Viele haben sich tatsächlich erfüllt.
Aber nicht nur meine…
Erinnerungen
An einem Sonntagmorgen saß Sassi, damals fünf Jahre alt, auf der Couch im Wohnzimmer und schaute ihr Kinderprogramm – völlig versunken, die Beine angewinkelt, die Augen auf den Bildschirm geheftet. Aus einem Impuls heraus schlich ich mich langsam von hinten an, legte die Arme um sie und flüsterte mit verschwörerischer Stimme
„Ein guter, lieber Geist ist gerade im Raum. Und weißt du was? Weil du so ein braves und liebes Mädchen bist, möchte er dir einen Wunsch erfüllen.“
Sassi erstarrte für einen Moment, riss die Augen auf und drehte sich ruckartig zu mir um.
„Wo ist er?“ fragte sie mit ehrfürchtiger Stimme, während ihre Blicke bereits suchend durch den Raum huschten. Ich tat so, als würde ich mich ebenfalls umsehen, ließ meinen Kopf langsam nach links und rechts wandern, als könnte ich ihn irgendwo zwischen den Bücherregalen oder hinter der Stehlampe entdecken. Sassi folgte meinem Blick, ihre Augen wurden noch größer, ihre Lippen leicht geöffnet, voller Spannung, als würde der Geist vielleicht genau jetzt hinter ihr auftauchen.
„Oh … na ja“, sagte ich schließlich und zuckte mit den Schultern. „Er ist unsichtbar. Aber er hat mich gebeten, dir auszurichten, dass du einen Wunsch frei hast. Also? Was möchtest du dir wünschen?“ Keine Sekunde zögerte sie. Keine dramatische Pause, kein langes Nachdenken. Stattdessen rief sie aus voller Überzeugung – als wäre es das einzig Logische auf der Welt:
„Schokopudding!“
Ich konnte nicht anders, als zu lachen. Meine Tochter hatte also die unendliche Möglichkeit, sich alles zu wünschen – Reichtum, Zauberkräfte, einen eigenen Ponyhof – und sie entschied sich für Schokopudding. Was soll ich sagen? Es gab an diesem Tag Schokoladenpudding satt für alle. Ich habe mich sogar dazu hinreißen lassen, Vanillesoße dazu zu machen.
Ich dachte mir, ein bisschen Extra-Magie im Leben meiner Kinder kann nicht schaden. Also gewöhnte ich mir an, die beiden hin und wieder mit einem freien Wunsch zu überraschen – einfach so, aus dem Stegreif. Einzige Regel: Es darf nichts kosten. Oder, na ja, wenn doch, dann bitte nicht viel. Mit geheimnisvoller Stimme verkündete ich dann: „Ihr habt einen Wunsch frei.“ Ihre Augen leuchteten jedes Mal, als hätte ich ihnen gerade die Wunderlampe höchstpersönlich überreicht. Ihre Wünsche waren meist von entwaffnender Einfachheit: länger wach bleiben, noch eine Folge ihrer aktuellen Lieblingsserie, Eis, Pizza, Fischstäbchen, Spielplatz. Alles Dinge, die ich ihnen nur zu gerne erfüllte – allein schon wegen der begeisterten Freudenschreie, die folgten.
Eines Tages, die beiden Kleinen mögen da etwa acht und sechs Jahre alt gewesen sein, lag Melissa mit einer ziemlich fiesen Grippe im Bett, fiebrig, blass, erschöpft – komplett außer Gefecht gesetzt. Während sie sich unter der Decke vergrub, kämpfte ich mich durch einen Tag voller Haushalt, Chaos und zwei Kinder, die in Sorge um ihre Mami waren. Alle drei, Mami, Sassi und Mila, hielten tapfer durch und die Kleinen halfen mir sogar im Haushalt, so gut sie konnten. Als ich sie dann zu Bett brachte und mich für die viele Hilfe bedankte und beide lobte, erschien wieder der unsichtbare Geist. Ich bemerkte ihn und flüsterte Sassi und Mila zu: „Der liebe Geist ist wieder da! Ihr habt einen Wunsch frei.“ Normalerweise folgte darauf eine kurze, aber intensive Denkpause, vielleicht ein Gekicher, ein verschwörerisches Flüstern. Doch diesmal nicht. Diesmal sahen mich die beiden nur an und sagten wie aus einem Mund: „Mami soll gesund werden.“ Mir wurde ganz warm ums Herz. Ich hätte ihnen natürlich erklären können, dass Wünsche in dieser Kategorie nicht unbedingt funktionieren – aber das hätte nur bedeutet, dass ich den Zauber ruiniere. Also schaute ich zu unserem guten Geist herüber, den nur ich sehen konnte, und lauschte eine Sekunde seinen imaginären Worten. „Der liebe Geist sagt, er gibt sich ganz besonders viel Mühe, um euren Wunsch zu erfüllen“ beruhigte ich die beiden, und gab ihnen ein Küsschen auf die Stirn.
Und siehe da: Am nächsten Morgen war Mami tatsächlich auf den Beinen. Noch etwas wackelig, noch etwas blass, aber mit einem Lächeln für ihre Töchter, die sich auf sie stürzten, als wäre sie gerade von einer langen, gefährlichen Expedition heimgekehrt. Von diesem Moment an erzählten sie jedem, dass sie Mami geheilt hatten. „Wir haben sie gesund gewünscht!“, verkündeten sie stolz auf dem Spielplatz, in der Schule, bei Oma und Opa, und sogar dem Kassierer im Supermarkt. Und was hätte ich sagen sollen? Es stimmte ja irgendwie. Vielleicht hatte Mama sich beim Gesundwerden für ihre Töchter besonders viel Mühe gegeben, um deren Wunsch zu erfüllen – aber ein bisschen Magie war da bestimmt auch im Spiel.
Dann geschah etwas Seltsames – und plötzlich begann ich selbst an Magie zu glauben.
Eines Tages waren wir auf dem Jahrmarkt unterwegs, als wir an einer dieser Losbuden vorbeikamen. Sie wissen schon – diese riesigen Wagen, vollgestopft mit Plüschtieren aller Art und jeder Menge Plastikspielzeug, das für Kinder alles bedeutet und für uns Eltern eher… na ja… Ramsch ist. Hauptattraktion waren diesmal riesige, bunte Einhorn-Kuscheltiere. Dutzende, in verschwenderischer Anzahl an die Wand geheftet, glitzernd, plüschig, unwiderstehlich. Meine beiden Kleinen blieben wie angewurzelt stehen, ihre Augen so groß wie die Einhörner selbst. Und dann kam der unausweichliche Satz: „Papa, wir wünschen uns ein Einhorn!“ Ich tat, was jeder vernünftige Elternteil tun würde: Ich lenkte ab. „Schaut mal, da drüben gibt es Karussells!“, „Wollt ihr eine Bratwurst?“, „Oh, Zuckerwatte! In Regenbogenfarben!“ Es funktionierte… also fast. Sie fuhren Karussell, aßen Würstchen, schleckten Zuckerwatte – aber in jeder einzelnen Pause hörte ich das Wort „Einhorn“.
Gegen Ende unseres Jahrmarktbesuchs gab ich mich geschlagen. Ich seufzte tief, gab ihnen ein paar Münzen und sagte: „Hier. Kauft euch ein Los. Aber denkt dran: Wünsche bringen nichts – zum Gewinnen braucht man Glück, nicht Magie.“ Die beiden stürmten zur Losverkäuferin, die mit einem Korb voller bunter Lose vor dem Stand wartete. Sie griffen hinein, zogen je ein Los und hielten es gespannt in die Luft. Die Verkäuferin riss die Lose auf. Schaute kurz darauf. Und dann lächelte sie. Beide hatten ein Einhorn gewonnen.
Ich konnte es nicht fassen. Sie quietschten vor Freude, nahmen ihre riesigen Einhörner entgegen und hopsten glücklich davon. Später habe ich lange darüber nachgedacht. Hatte die Verkäuferin ihnen absichtlich zwei Gewinnlose zugeschanzt? Waren die Chancen einfach hoch, weil es so viele Gewinne in der Losbox gab? War es ein Fehler beim Befüllen der Losbox, sodass nur Gewinnlose drin waren? Ich denke, mit dem Blick der Verkäuferin auf meine beiden Kleinen in Erinnerung, das sie die beiden einfach hat gewinnen lassen. Vielleicht, weil das Gejubel von zwei kleinen Mädchen unzählige weitere Käufer angelockt hat? Ich weiß es nicht. Aber irgendwann hörte ich auf, nach einer Erklärung zu suchen. Es war viel schöner, einfach der unumstößlichen Wahrheit zu folgen – oder besser gesagt, der meiner Töchter: „Unser Wunsch ist in Erfüllung gegangen.“
Heute
Neulich kam die Große zu Besuch. Wir standen draußen auf der Terrasse, die Sonne hing tief am Himmel, und eine angenehme Stille lag zwischen uns. Es war einer dieser seltenen Momente, in denen nichts gesagt werden musste. Ich zog sie sanft in eine Umarmung, so wie früher, als sie noch klein war, und flüsterte ihr mit einem Lächeln zu: „Wenn du einen Wunsch frei hättest – was wäre es?“ Sie schaute zu mir auf, ihre Augen voller Erinnerungen. Und dann sagte sie: „Papa, ich bin wunschlos glücklich.“ Ich nahm sie noch etwas fester in die Arme. Doch dann entwand sie sich meiner Umarmung, trat einen Schritt zurück und sah mich prüfend an. Ein leichtes Grinsen zuckte um ihre Lippen.
„Naja…“ sagte sie, zog die Augenbrauen hoch. „Etwas gibt es schon, was ich mir wünschen würde.“
Ich war gespannt. Bereit, notfalls die Welt auf den Kopf zu stellen, das Universum umzukrempeln oder eine kleine Revolution anzuzetteln, nur um diesen Wunsch zu erfüllen. Sie lehnte sich ein wenig zu mir, als würde sie mir ein großes Geheimnis anvertrauen, und sagte dann feierlich:
„Schokopudding!“
Und bevor ich auch nur reagieren konnte, brach sie in schallendes Lachen aus und fiel mir zurück in die Arme. Ich überlasse es Ihnen, sich auszurechnen, wie viele Taschentücher es mich gekostet hat, um meine Tränen wegzuwischen.
In einer weit entfernten Galaxie
Das Wesen aus Rauch und seine beiden allmächtigen Freunde – das eine aus flüssigem Licht und mystischer Dunkelheit, das andere aus kristallklarem Wasser – hatten sich mal wieder in ihrer liebsten Beschäftigung verloren: dem kosmischen Basteln. Während normale Wesen vielleicht Karten spielten oder Rätsel lösten, fiel ihre Version von Freizeitbeschäftigung ein wenig… größer aus. Galaxien neu anordnen, Sternhaufen umgestalten, schwarze Löcher wie Murmeln durch die Leere schubsen – eben die üblichen Dinge, wenn man allmächtig ist.
An diesem Tag jedoch hatten sie eine besonders originelle Idee: „Lass uns ein neues Sonnensystem entwerfen!“ rief das Wesen aus Wasser begeistert. Das Wesen aus Licht, bekannt für seine ausgefallenen Designs, wollte natürlich, dass die Planeten in einer perfekten spiralförmigen Choreografie umeinander tanzten, während das Wesen aus Wasser darauf bestand, dass sie stattdessen in unregelmäßigen Mustern leuchteten, um die „Schönheit des Chaos“ einzufangen.
Das Wesen aus Rauch hingegen hatte eine ganz andere Vorstellung. „Warum nicht einfach die Milchstraße verknoten und sehen, was passiert?“ schlug es vor, während sein Nebel in einem frechen Türkis wirbelte. Das Universum war schließlich ihr Privatspielplatz – warum also nicht etwas spektakuläres wagen?
Die beiden anderen fanden die Idee… nun ja, sagen wir, unorthodox. „Du kannst doch nicht einfach das halbe Universum verknoten, nur um zu sehen, was passiert!“ meinte das Wesen aus Licht, während das aus Wasser hinzufügte: „Wir haben doch gerade erst die Sternenkonstellationen sortiert! Das wäre ja, als würde man ein Puzzle fertigstellen und dann wieder in die Schachtel werfen!“
Das Wesen aus Rauch, überzeugt von seiner kreativen Vision, ließ sich nicht beirren. „Ach, ihr seid einfach nicht cool genug. Ein bisschen Chaos hat noch keinem Kosmos geschadet!“ Sein Nebel blitzte in einem leuchtenden Violett, als es mit einem kleinen, charmanten Fingerschnips (bildlich gesprochen natürlich – Finger hatte es keine) begann, die Milchstraße spielerisch ein wenig rotieren zu lassen. Was dann folgte, war weniger ein Streit und mehr eine… kreative Meinungsverschiedenheit mit freundschaftlichen Konsequenzen. Die beiden anderen waren sich schnell einig: Das Wesen aus Rauch brauchte mal eine kleine Auszeit, um über gewisse unkonventionelle Methoden nachzudenken. Natürlich nicht als Bestrafung – eher als pädagogische Maßnahme.
„Nur vorübergehend,“ versicherten sie ihr mit einem Augenzwinkern, bevor sie, mit einem Hauch von kosmischem Humor, eine gläserne Flasche erschufen – ein äußerst stilvolles Behältnis, versteht sich – und es hineinschickten. „Betrachte es als… künstlerische Schaffenspause,“ sagte das Wesen aus Wasser mit einem verschmitzten Lächeln. „Und wer weiß? Vielleicht findest du da draußen jemand Interessantes, der dich befreit.“ Allerdings gab es eine kleine, aber nicht unbedeutende Bedingung: Die Flasche war kein gewöhnliches Gefäß, das sich von jeder neugierigen Hand öffnen ließ. Nur ein Wesen von wahrhaft gütigem Herzen – jemand, der selbstlos, warmherzig und ohne Hintergedanken handelte – war in der Lage, den Verschluss zu lösen und das Wesen aus Rauch zu befreien. Erst dann durfte es die Enge seines funkelnden Gefängnisses hinter sich lassen, in die Freiheit entweichen und seinen unverwechselbaren, schillernden Rauch in die Welt hinausströmen lassen. Doch mit der Befreiung kam auch eine Verpflichtung: Es mussten zwei Wünsche erfüllt werden – nicht mehr und nicht weniger. Und wenn diese Aufgabe vollbracht war, wenn die Wünsche gesprochen und in die Wirklichkeit gewebt waren, dann – und erst dann – sollte dem Wesen aus Rauch die Rückkehr zu seinen Freundinnen gestattet sein. Eine Heimkehr in jene Weiten, in denen Sterne tanzten, Galaxien flüsterten und alte Freunde bereits mit einem amüsierten Funkeln in den Augen auf sie warten werden. Das Wesen aus Rauch, das zunächst noch dachte, das Ganze sei ein Scherz, fand sich schneller als erwartet in den Tiefen eines irdischen Ozeans wieder. Sich für Ihre pädagogische Maßnahme extra einen klitzekleinen Planeten in einem völlig unbedeutenden Teil des Universums zu wählen, machte die ganze Sache noch lustiger, wie ihre Freundinnen fanden. Sie hatten das Wesen aus Rauch nicht bestraft, sondern ihr eine neue Perspektive geschenkt. Allerdings… nach ein paar Jahrhunderten in dieser Flasche hatte es genug von Perspektiven.
„Gut, ihr habt gewonnen,“ dachte es oft, während es durch die Meere trieb. „Ich habe über meine Methoden nachgedacht – und ich denke, sie waren fantastisch. Jetzt holt mich hier raus.“
Aber die beiden blieben aus. Offenbar lag es nun tatsächlich an irgendeinem nichtsahnenden Erdenbewohner, diese kosmische Pause zu beenden. Und bis dahin blieb ihr nichts anderes übrig, als geduldig zu warten. Sie trieb über das endlose Blau, gefangen in ihrem gläsernen Kokon, der gerade mal wieder in einem besonders langweiligen Abschnitt des Ozeans herum schaukelte – langweilig genug, um sogar einer Alge das Gähnen beizubringen. Das stetige Hin und Her der Wellen hatte längst den Charme eines kaputten Metronoms angenommen, und der Anblick der immer gleichen, glubschäugigen Standard-Fische ließ ihren Rauch in einem genervten Grauton aufwallen. Ach, guck mal, schon wieder du, dachte sie, als ein Fisch mit dem üblichen Ausdruck existenzieller Verwirrung an ihr vorbeischwamm.
Ab und zu huschten mal Delfine vorbei, die so albern grinsten, als hätten sie gerade den besten Witz des Ozeans gehört. Wahrscheinlich irgendein Delfin-Insider, murmelte sie, während ihr Nebel in einem sarkastischen Violett aufleuchtete. Oder ein Wal zog majestätisch vorbei und blies Wasserfontänen in die Luft, ganz nach dem Motto: Schaut her, ich bin frei und kann blubbern, soviel ich will! Sie rollte mit den Augen – eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich nur aus schimmerndem Rauch bestand und gar keine Augen hat. Und dann diese Schildkröten – langsam, stoisch, als hätten sie alle Zeit der Welt. Natürlich habt ihr die, dachte sie düster. Schaut mich erst mal an – ich bin seit Jahrhunderten in einer Flasche eingepökelt. Ich habe superviel Zeit… plus ein paar extra Äonen!
Ja, seit Jahrhunderten dümpelte sie nun so vor sich hin. Jahrhunderte! Dabei hätte sie viel lieber ein paar Galaxien neu angeordnet. Oh, da ist schon wieder die Milchstraße, grinste sie innerlich, während ihr Rauch einen silbrigen Schimmer annahm. Vielleicht hänge ich sie mal neben Andromeda, nur um zu sehen, wie chic das wäre. Aber nein, stattdessen durfte sie jeden Tag denselben Makrelen-Gesichtern dabei zuschauen, wie sie mit der Anmut von Seifenblasen an ihrer Flasche vorbeiflitzten. Ganz großes Kino hier unten. Der Gedanke daran, wieder mit ihren allmächtigen, omnipotenten Freunden im All abzuhängen und zu basteln, war das Einzige, was sie bei Laune hielt. Sie stellte sich vor, wie sie zusammen schwarze Löcher als Frisbee benutzen würden. Oh, wie sie lachen werden, dachte sie, wenn ich ihnen von meiner „interessanten Wohnsituation“ erzähle. Ihr Rauch flackerte vor lauter Ironie kurz in einem leuchtenden Grün auf.
Was für ein glorreiches Schicksal für ein allmächtiges Wesen, dachte sie trocken, während ihr Blick einem besonders dümmlich dreinblickenden Kugelfisch folgte, der in gemächlicher Unbekümmertheit unter ihrer Flasche vorüberschwamm. Er schien nicht einmal die Höflichkeit zu besitzen, sie mit einem anerkennenden Blubbern zu grüßen – eine Dreistigkeit sondergleichen. Na schön, ein lebloses Glasgefängnis das auf den Wellen der Meere schwamm war nicht gerade der Ort, an dem man Respekt einflößte. Aber ein bisschen Anstand konnte man ja wohl erwarten! Ihre Gedanken wirbelten missmutig in ihrer gläsernen Unterkunft umher, bis ihr Blick auf eine köstliche kleine Szene fiel: Der Kugelfisch, dessen gedankenverlorene Miene bereits Bände sprach, blieb mit seinen Stacheln an einem hartnäckigen Stück Seetang hängen.
Na, wenigstens hast du’s auch nicht leicht da draußen, murmelte sie mit einer sehr kleinen, aber nicht gänzlich zu leugnenden Spur von Gehässigkeit. Ihr Rauch kräuselte sich amüsiert, bildete zwei schwungvolle, rauchige Linien – das ätherische Äquivalent eines Augenrollens.
Vor ein paar Tagen
Auch dieser Tag begann wie jeder andere in ihrer endlosen Odyssee: langweilig, blau und fischlastig. Der Ozean dehnte sich in alle Richtungen aus, ein scheinbar endloser Flickenteppich aus Wellen, Sonnenflecken und schweigendem Leben, das sich nicht um die Existenz eines in Glas gefangenen Wesens scherte.
Doch dann… veränderte sich etwas. Das Meer, sonst eine monotone Kulisse für ihre unfreiwillige Flaschen-Existenz, begann zu brodeln. Erst kaum merklich, ein feines Zittern in der Tiefe, das sich langsam in eine unruhige Bewegung verwandelte. Irgendwo in weiter Ferne donnerte es dumpf, ein Grollen, das sich durch das Wasser fraß wie ein unsichtbares Raubtier. Über ihr zog sich der Himmel zusammen, als hätte jemand die Helligkeit in einem Anflug schlechter Laune gedimmt. Wolken rollten heran, schwere, bedrohliche Gebilde, die den eben noch so friedlichen Ozean in ein düsteres Grau tauchten. Dann kamen die ersten Tropfen – kalt, schwer und mit einer Entschlossenheit, die nichts Gutes verhieß. Sie prasselten auf die Oberfläche des Wassers, ließen kleine, hastige Kreise entstehen, bevor sie im tosenden Meer verschwanden. Einer nach dem anderen landete auch auf ihrer Flasche, dumpfe, hohle Schläge gegen das Glas.
Etwas lag in der Luft. Eine Spannung, die nicht greifbar war, sich aber in ihrem Inneren widerspiegelte. Ihr Rauch kräuselte sich, nahm eine unruhige Bewegung an – und ohne dass sie es bewusst steuerte, verfärbte er sich in ein nervöses Blaugrün. Etwas war im Anmarsch. Zuerst waren es nur kleine Wellen, die gegen ihre Flasche klatschten, als wollten sie ihr einen Streich spielen – neckische kleine Stöße, die sich anfühlten wie das Plätschern ungeduldiger Fingerspitzen. Doch das Vergnügen war nur von kurzer Dauer. Die sanften Bewegungen wurden zu einem gierigen Ziehen, dann zu einem wilden Rütteln. Plötzlich türmten sich gewaltige Wellen auf, rasten ungebändigt über die Oberfläche, peitschten und tosten, als würde eine unsichtbare Kraft das Wasser zum Toben bringen.
Und mittendrin: eine kleine, gläserne Flasche, die nun mehr Spielball als Gefäß war. Ach, fantastisch. Eine gratis Achterbahn, dachte sie mürrisch, während sie herumgeworfen wurde wie ein Kinderspielzeug in einer viel zu übermotivierten Waschmaschine.
Die Strömungen schleuderten sie von einer Seite zur anderen, ließen sie in absurdem Tempo trudeln, aufsteigen, absacken – und dann wieder mit erschreckender Wucht gegen das tosende Wasser knallen. Über ihr zerfetzte ein Blitz den Himmel, riss für den Bruchteil einer Sekunde gleißende Narben in die dunklen Wolken, bevor ein Donnergrollen folgte, so tief und mächtig, dass es durch das Wasser vibrierte. Es klang, als hätte das Universum höchstpersönlich beschlossen, sie mit einem dramatischen Soundtrack zu versorgen. Für einen Moment flackerte ihr Rauch in einem elektrischen Violett auf – ein stiller Kommentar zu dieser absurden Inszenierung. Und während sie weiter durch die aufgewühlten Fluten geschleudert wurde, konnte sie nicht anders, als zu denken: Wenn das Universum wirklich Humor hat, dann ist es definitiv ein sadistischer.
Die Wellen wurden zu wassergewordenen Bergen, gewaltig und unnachgiebig. Jede einzelne schleuderte sie gnadenlos in die Höhe, ließ sie für einen kurzen, fast trägen Moment auf ihrem kalten Rücken verweilen, bevor sie sie mit brutaler Willkür in die tobenden Tiefen hinabstürzte. Alles, was sonst Leben in diesen Ozean brachte, war verschwunden. Delfine? Weg. Fische? In alle Richtungen zerstreut. Selbst die stoischen Schildkröten, die normalerweise mit unerschütterlicher Ruhe durchs Wasser glitten, hatten sich wohlweislich verzogen. Zurück blieb nur sie – allein mit der chaotischen Gewalt des Sturms. Ihre Flasche drehte sich unaufhörlich, wurde von den Strömungen herumgeschleudert, taumelte und überschlug sich in einem Tempo, das selbst die robustesten Seebewohner seekrank gemacht hätte. Das Wasser schlug gegen das Glas, trommelte mit dumpfen, unnachgiebigen Schlägen dagegen, als würde es versuchen, sich einen Weg hinein zu bahnen. Im Inneren tanzte ihr Rauch in unkontrollierbaren Wirbeln. Mal verdichtete er sich zu dunklen, zornigen Schlieren, die gegen das Glas drängten – ein stummer Ausdruck ihrer Genervtheit über dieses nasse Desaster. Dann wieder zuckte er auseinander, flackerte in grellweißen Blitzen auf, während Panik sich in ihr ausbreitete.
Der Boden unter ihr wurde flacher. Der unerbittliche Zug des Wassers, der sie so lange mit sich gerissen hatte, verlor an Kraft. Statt von Strömungen verschluckt zu werden, wurde sie nun mehr geschoben als gezogen, taumelte durch das unruhige Wasser, während das wilde Toben des Sturms langsam hinter ihr verblasste. Ein letzter, besonders aggressiver Schwall riss sie aus dem Wasser, schleuderte die Flasche wie einen Kieselstein durch die Luft. Für einen Moment war da nichts außer Wind und Gischt, dann ein dumpfes Plopp, als sie mit einem wenig eleganten Sturz im nassen Sand landete. Sie rollte. Einmal, zweimal. Wurde von einem schwachen Wellenrest angestupst, als wollte das Meer noch ein letztes Mal mit ihr spielen. Doch schließlich blieb sie liegen.
Stille.
Nach all dem Lärm, dem Dröhnen des Donners, dem Brüllen der Wellen – nichts. Nur das sanfte Zischen des sich zurückziehenden Wassers und der ferne Klang eines erschöpften, abziehenden Sturms. Sie ließ sich einen Moment Zeit. Ihr Rauch sammelte sich träge, wirbelte sich in langsamen, missmutigen Spiralen zusammen, bevor er das ätherische Äquivalent eines Achselzuckens formte (sie hatte schließlich keine Achseln).
Na super.
Ausgespuckt wie Treibholz. Ein kosmisches Wesen, das einst zwischen Sternen tanzte, nun von einem launischen Meer an einen zufälligen Strand gespült – könnte das Universum noch uncharmanter sein? Während sich der Himmel klärte und das Wasser in seinen ruhigen Rhythmus zurückfand, keimte jedoch eine leise, vorsichtige Hoffnung in ihr auf. Vielleicht, nur vielleicht, würde jetzt endlich jemand kommen. Jemand, der sie fand. Und – mit etwas Glück – jemand mit genug Verstand, um zu wissen, wie man eine Flasche mit Korken öffnet.
Heute, an der Ostsee
Die Ostsee scheint noch immer unruhig, als würde sie den vergangenen Sturm nicht so leicht vergessen können. Obwohl die schweren Böen längst abgeklungen sind, kräuseln sich die Wellen weiterhin und rollen in gleichmäßigem Rhythmus ans Ufer, ihre Schaumkronen zerfließen zischend auf dem feuchten Sand. Die Luft trägt noch einen Hauch von Salz, durchzogen von einem fernen, herben Geruch nach Tang und verwittertem Holz.
Während der Sturm tobte, hat das Meer eine wahre Flut an Treibgut an Land geworfen – dunkle Büschel Seegras, das in dichten Knäueln am Ufer liegt, vom Wasser geschliffene Holzstücke, die matt in der Sonne glänzen, und dazwischen immer wieder unwillkommene Spuren der Zivilisation: Plastikflaschen, zerfetzte Tüten, eine verlorene Schuhsohle, halb im Sand versunken. Doch es sind nicht nur leblose Dinge, die das Meer hergegeben hat. Zwischen den angeschwemmten Algenresten blitzen die starren Schuppen einiger toter Fische auf, ihre silbrigen Leiber matt und von Sand überzogen. Krabben liegen verstreut auf dem Strand, ihre Gliedmaßen verdreht, als hätten sie vergeblich versucht, gegen die unbändige Kraft der Wellen anzukämpfen. Die Natur hat ihre eigene Ordnung, doch nach einem Sturm wirkt sie oft rau und erbarmungslos.
Hier, am Brodtner Ufer, einer beeindruckenden Steilküste zwischen den Badeorten Travemünde und Niendorf, fühlt sich Sabine so frei wie an keinem anderen Ort. Besonders im Herbst, wenn die Touristenströme verebbt sind und nur noch vereinzelt Möwen über die See kreischen, ist sie hier oft völlig allein – allein mit dem Rauschen des Meeres, das sie so sehr liebt, und der gewaltigen Steilküste, die wie ein stummer Wächter vom Strand aufragt. In dieser Abgeschiedenheit kann sie ihren Gedanken freien Lauf lassen, während ihre Füße durch den groben Sand und Kiesel wandern. Immer wieder wandert ihr Blick über den feuchten Strand, denn hier gibt es manchmal etwas ganz Besonderes zu finden: Bernstein – das „Gold der Ostsee“. Vor einigen Jahren hatte sie das Glück, ein kleines, honigfarbenes Stück zwischen Algen und Muschelscherben zu entdecken. Es lag unscheinbar im nassen Sand, doch als sie es aufhob und ins Licht drehte, schimmerte es warm und golden. Voller Stolz brachte sie ihren Fund zu einem Mineralienhändler in Lübeck, der ihre Hoffnung bestätigte: Es war echter Bernstein.
Seitdem hat dieses besondere Stück einen Ehrenplatz in ihrem kleinen Setzkasten, in dem sie all ihre wertvollsten Schätze aufbewahrt – Fundstücke, die sie über die Jahre an den Stränden der Ostsee gesammelt hat. Doch keines dieser Stücke kann mit ihrem ersten Bernsteinfund mithalten – einem warmen, sonnengelben Tropfen aus längst vergangener Zeit, eingefangen in den Wellen der Ostsee. In ihrem Setzkasten der gesammelten Schätze liegen nicht nur der Bernstein, sondern auch einige Hühnergötter – kleine, vom Meer geschliffene Steine mit einem natürlichen Loch. Sie sind besondere Glücksbringer, so sagt man, und Sabine kann sich nie zurückhalten, wenn sie einen entdeckt. Die meisten sind grau oder cremefarben, manche mit dunklen Einschlüssen, als wären winzige Geheimnisse in ihnen verborgen. Besonders stolz ist sie auf ihre Donnerkeile, die fossilen Überreste einer längst ausgestorbenen Tintenfischart aus der Kreidezeit. Diese glattgeschliffenen, spitzen Kegel haben Millionen von Jahren unter Sedimenten verborgen gelegen, bis das Meer sie wieder preisgegeben hat. Sabine besitzt drei dieser Relikte der Urzeit – einen tiefschwarzen und zwei in einem warmen Orangeton, die in der Sonne beinahe leuchten. Jeder von ihnen fühlt sich kühl und schwer in der Hand an, als trüge er die Geschichte der vergangenen Epochen in sich.
Doch nicht immer sind es Fossilien oder außergewöhnliche Fundstücke, die ihren Weg in den Setzkasten finden. Manchmal sammelt Sabine einfach nur kleine Steine, die ihr ins Auge springen, weil ihre Form, Farbe oder Maserung sie besonders schön macht. Zwei davon haben einen besonderen Platz in ihrer Sammlung: zwei rote Jaspissteine, auch „Blutstein der Ostsee“ genannt. Ihre Oberfläche ist von einer intensiven, fast glühenden roten Farbe, durchzogen von feinen, weißen Adern, die an filigrane Risse im Glas erinnern. Sie wirken fast lebendig – als hätten sie einst selbst die Kraft des Meeres in sich getragen.
Die hohe Steilküste hat dem Sturm standgehalten – dieses Mal. Keine neuen Erd- oder Gesteinsbrocken sind abgebrochen, kein Teil des steilen Abhangs ist ins Meer gestürzt. Doch die Zeichen vergangener Unwetter sind überall sichtbar. Am Boden liegen entwurzelte Bäume, ihre knorrigen Äste und Wurzeln ragen in den Himmel wie die Finger uralter Riesen. Sabine kennt sie alle – sie sind Überreste früherer Stürme, die irgendwann einmal mit unbändiger Kraft über das Brodtner Ufer hinweggefegt sind. Nun liegen sie hier, vom Wetter gegerbt, vom Salzwasser gebleicht, und werden langsam Teil der Landschaft. Sie steigt über die toten Baumstämme hinweg, ihre Füße tasten sicher über die größeren und kleineren Steine. Nach Herbst- und Winterstürmen steigt die Chance, Bernstein zu finden. Deshalb hält sie den Blick fest auf den Boden gerichtet, konzentriert auf jedes kleine, goldgelb schimmernde Stück, das sich zwischen den bunten Kieseln verstecken könnte.
Bis Niendorf ist es noch eine gute halbe Stunde. Dort wird sie sich eine Pause gönnen – ein heißer Kaffee gegen die kühle Brise, die vom Meer herüberweht. Und vielleicht, nur vielleicht, lässt sie sich von sich selbst zu einem kleinen Stück Kuchen überreden. Nur ein klitzekleines. Es ist kurz nach neun Uhr morgens, und die Welt wirkt noch ruhig und unaufgeregt. Die Touristen sind schon vor Wochen abgereist, die Küste gehört im Herbst und Winter wieder den Einheimischen, den Spaziergängern und um diese frühe Uhrzeit den wenigen Frühaufstehern, die das Meer in der klaren Morgenluft genießen.
Sabine hat noch Zeit – erst mittags beginnt ihre Schicht im Café, in dem sie seit einigen Monaten arbeitet. Nach dem Abschluss ihrer Lehre zur Bankkauffrau in diesem Sommer hat sie sich bewusst eine Pause gegönnt – ein ganzes Sabbatjahr, um ihr Berufsleben nicht überstürzt zu beginnen, sondern in Ruhe durchzuatmen. Ein Jahr für sich, für freie Tage am Meer, für lange Spaziergänge an der Steilküste, für Gedanken, die sich nicht nur um Zahlen und Finanzen drehen. Doch es ist mehr als das. In den vergangenen Monaten hat sich in ihr eine Frage aufgetan, die sie nicht so leicht ignorieren kann: Ist das wirklich der richtige Weg für sie? Vielleicht ist es an der Zeit, sich ganz neu zu orientieren. Vielleicht ist ein Studium die bessere Wahl. Noch ist nichts entschieden – aber genau dafür hat sie sich dieses Jahr genommen: um nachzudenken, Möglichkeiten auszuloten und herauszufinden, was sie wirklich will.
Einige Meter vor sich sieht Sabine etwas am Ufer aufblitzen. Ein heller Reflex, eingefangen von der Sonne, die am wolkenlosen Himmel steht. Ihr erster Gedanke: Glas. Vielleicht eine Scherbe. Doch als sie näherkommt, erkennt sie es – eine Flasche.
Sofort schlägt ihr Herz ein wenig schneller. Die Neugier packt sie, während sie auf das glitzernde Fundstück zugeht. Eine Flaschenpost?
Der Inhalt ist noch ein Rätsel, aber in ihrem Kopf beginnt bereits ein kleiner Sturm der Ideen zu toben. Natürlich wird sie antworten! Vermutlich stammt die Nachricht von Touristen, die einfach einen netten Gruß hinterlassen haben. Wie wäre es, wenn sie als Piratin zurückschreibt? Eine raue, aber freundliche Kapitänin, die Fremde auf hoher See willkommen heißt und ihnen anbietet, als Crewmitglieder an Bord zu kommen! Oder noch besser: Eine Schatzkarte! Sie könnte irgendwo am Strand eine Tupperdose vergraben, mit ein paar Schokomünzen darin – eine kleine Belohnung für wagemutige Abenteurer. Na gut… das wäre vielleicht ein bisschen aufwendig. Aber ein Brief mit Piratensymbolen, vielleicht einem kleinen Totenkopf und einem zerfledderten Rand, das könnte doch drin sein! Sie spürt, wie sich ein breites Grinsen auf ihrem Gesicht ausbreitet. Irgendetwas Witziges fällt ihr bestimmt ein. Vielleicht eine geheimnisvolle Botschaft, die mit „Ahoi, ihr Landratten!“ beginnt?
Sabine streicht mit den Fingerspitzen über das angespülte Seegras, das die Flasche halb verdeckt. Behutsam schiebt sie das wirre Gewirr aus Tang und Sand beiseite und greift nach dem gläsernen Fundstück. Kaum hat sie es in der Hand, hält sie irritiert inne.
Es ist nicht die Sonne, die die Flasche glitzern lässt. Sie leuchtet von selbst.
Ein feines Schimmern pulsiert unter der glatten Oberfläche. Es kommt nicht von außen – sondern von innen. Hinter dem Glas bewegt sich etwas. Zuerst glaubt sie, es sei nur eine Spiegelung, eine optische Täuschung durch das Sonnenlicht und das Wasser, das die Oberfläche benetzt. Doch als sie genauer hinsieht, erkennt sie Rauch. Oder vielleicht Dampf. Dunkelgrau, fast schwarz, aber durchzogen von grünen, glühenden Fäden, die sich zu bewegen scheinen – nicht ziellos, nicht wie Nebelschwaden, die vom Wind getrieben werden, sondern absichtlich, gezielt. Die Linien verdichten sich zu Schlieren, verwirbeln ineinander, lösen sich wieder auf, nur um sich dann in feinen, fast geometrischen Mustern neu zu formieren.
Sabine hält den Atem an. Ihr Herz schlägt schneller. Sie hat in ihrem Leben schon so einige Flaschen gefunden – aber so eine noch nie. Vorsichtig dreht sie die Flasche in der Hand. Das Glas ist dick, eben, mit winzigen Luftbläschen darin – offensichtlich eine alte Weinflasche, die lange unterwegs gewesen sein muss. Doch das, was sich darin befindet, wirkt nicht wie etwas, das die Zeit hätte erschaffen können.
Kaum streichen ihre Finger über den Flaschenkörper, beginnt sich der Rauch zu verändern. Das Dunkelgrau hellt sich auf, fließt langsam in ein sanftes Hellgrau, als würde jemand durch Nebel hindurchtreten. Dann – wie eine zögernde Antwort – tauchen neue Farben auf. Blau, Gelb, Rot. Sie pulsieren schwach, verschwimmen, lösen sich auf, nur um sich erneut zu formen, in immer neuen Konstellationen. Ein leiser Schauer läuft ihr über den Rücken. Sie hat das Gefühl, als würde die Flasche auf sie reagieren. Die Flasche ist warm. Nicht unangenehm, nicht heiß – sondern sanft, fast beruhigend, wie ein Stein, der den ganzen Tag in der Sonne gelegen hat. Viel zu warm für die kühle Morgenluft. Ihre Finger umschließen den Flaschenhals fester. Was hat sie hier gefunden?
Sabine bemerkt kaum, wie sie sich auf einen der riesigen Steine sinken lässt, die hier am Brodtner Ufer verstreut liegen – glattgeschliffen von Wind und Wasser, uralte Zeugen der Zeiten. Ihr ganzer Fokus liegt auf der Flasche in ihren Händen. Sie ist grünlich, fast durchsichtig, und der lange, ungewöhnlich schmale Flaschenhals verleiht ihr etwas Elegantes. Sabine wiegt die Flasche in ihren Händen, lässt sie leicht auf und ab wippen und runzelt die Stirn – deutlich schwerer, als sie es von einem Gefäß erwartet hätte, das nur Rauch enthalten soll.
Vorsichtig dreht sie sie hin und her, kippt sie leicht, beobachtet, wie das Licht über das dicke Glas gleitet. Doch was immer im Inneren dieser Flasche wirbelt, scheint sich davon nicht stören zu lassen. Der Rauch – oder was auch immer es ist – setzt sein hypnotisches Farbspiel unaufhörlich fort. Grüne Fäden schlängeln sich durch das Dunkel, rotgoldene Schlieren blitzen auf, lösen sich in Blau auf, um dann in einen sanften, schimmernden Nebel überzugehen.
Ein Gedanke blitzt in ihr auf. Das wäre die perfekte Deko für ihr Wohnzimmer.
Ein kleines, maßgeschneidertes Wandregal, direkt neben ihrem Setzkasten, vielleicht mit einer indirekten Beleuchtung von hinten, damit das Farbspiel besonders gut zur Geltung kommt. Ein echtes Highlight.
Sabine betrachtet die Flasche nachdenklich, während ihre Finger sanft über den fest sitzenden Korken gleiten. Ihr Blick bleibt an dem wirbelnden Rauch im Inneren hängen. Die Farben tanzen in fließenden Übergängen, als hätten sie ein Eigenleben – ein leuchtendes, schimmerndes Spektakel, das sie gleichzeitig fasziniert und etwa verunsichert.
Was könnte das nur sein?
Ein leiser Zweifel regt sich und ein ungutes Gefühl kriecht ihr den Rücken hinauf. Was, wenn dieser Rauch nicht einfach nur harmloser bunter Nebel ist? Vielleicht ist er giftig, eine seltsame chemische Reaktion? Oder noch schlimmer – könnte er radioaktiv sein? Ihr Herz schlägt einen Tick schneller. Mit einem kurzen Blick über die Schulter, als könne ihr jemand eine Antwort geben, überlegt sie, ob es klug war, diese Flasche überhaupt anzufassen. Doch ihre Neugier ist stärker als die aufkeimende Vorsicht.
„Am besten google ich das mal.“, murmelt sie leise. Nur dass sie nicht googlen kann – zumindest nicht hier. Ihr iPhone liegt, wie immer bei Spaziergängen, sicher zu Hause. Sie hat sich angewöhnt, es nicht mitzunehmen, um die Zeit am Strand wirklich zu genießen – ohne Ablenkung, ohne ständige Nachrichten oder Social-Media-Generve. Und ihr „Notfallhandy“, das im Auto liegt? Daran ist nicht mal Internet.
Ihre Gedanken an Kaffee und Kuchen – zu dem sie sich auch heute absolut nicht erst lange hätte selbst überreden müssen – sind vergessen. Mit einem tiefen Atemzug richtet sie sich auf. Sie wird der Sache auf den Grund gehen. Die Flasche kommt mit. Egal, was sie da gefunden hat – sie wird es herausfinden.
Die Flasche passt allerdings nicht in ihre Jackentasche – viel zu groß, viel zu unhandlich. Sabine zögert kurz, sucht nach einer besseren Lösung und steckt sie schließlich in die Kapuze ihrer Jacke. Behutsam zieht sie die Kapuzenbänder etwas fester, sodass die Flasche sicher an ihrem Nacken ruht, sanft von Stoff umhüllt.
Mit schnellen Schritten macht sie sich auf den Rückweg zum Parkplatz in Travemünde, wo ihr Auto steht. Der Wind hat aufgefrischt, bläst in kräftigen Böen vom Meer heran und schneidet mit seiner salzigen Kälte durch die Luft. Sabine zieht ihre Mütze tiefer in die Stirn, während sie den Schal fester um ihr Gesicht wickelt, sodass nur noch ihre Augen frei bleiben. Die Flasche in ihrer Kapuze schaukelt sanft mit, doch die fest zugezogenen Bänder halten sie sicher an ihrem Platz.
Ihre Schritte hinterlassen flüchtige Spuren im Sand, die der Wind sofort wieder verwischt. Möwen kreischen über ihr. Nach gut dreißig Minuten erreicht sie schließlich die festen Planken der Promenade und wechselt von dort auf den kurzen, asphaltierten Weg zum Parkplatz.
Sie erreicht ihren nagelneuen weißen Ford Focus, der noch genauso makellos glänzt wie an dem Tag, an dem sie ihn abgeholt hat. Erst zwei Monate ist es her, doch jedes Mal, wenn sie ihn sieht, durchströmt sie ein leises Gefühl von Stolz. Ein kleines Zeichen dafür, dass sich all die Mühe und Arbeit gelohnt haben. Sie streicht kurz über den kühlen Lack, bevor sie die Tür aufschließt.
Vorsichtig greift sie hinter ihren Rücken und nimmt die Flasche aus der Kapuze, als wäre sie ein kostbares Geheimnis, das nur für sie bestimmt ist. Sie zieht ihre dicke Winterjacke aus und wickelt die Flasche in sie ein. Sie faltet den dicken Stoff sorgfältig um das Glas, schützt es vor den harten Erschütterungen der Welt da draußen. Sabine fühlt sich in diesem Moment beinahe wie eine Hüterin eines geheimen, wertvollen Schatzes. Ein freudiges Lächeln spielt um ihre Lippen, als sie die Flasche im Fußraum platziert, ihre Neugier wächst und mit ihr die still wachsende Freude an diesem seltsamen, wunderschönen, geheimen Artefakt.
Sehr gut, denkt sie zufrieden. Hier ist sie eingemummelt und absolut sicher.
Sie atmet tief durch, setzt sich hinters Steuer und wirft einen letzten prüfenden Blick zur Seite. Die Flasche liegt sicher unter den weichen Falten der Jacke. Sie dreht den Schlüssel im Zündschloss. Zeit, herauszufinden, was sie da wirklich gefunden hat.
Strahlende Sorgen und leuchtende Rätsel
Nach zwanzig Minuten Fahrt rollt Sabine mit ihrem weißen Ford Focus langsam durch die schmalen Gassen der Lübecker Altstadt. Das vertraute dumpfe Klacken der Reifen auf dem Kopfsteinpflaster hallt leise durch die Straßen. Sie fährt an den alten Backsteinhäusern entlang, die die Gassen säumen, ihre Mauern von der Geschichte der Stadt erzählend.
Als sie schließlich auf ihren Parkplatz zusteuert, ein kleiner, versteckter Platz zwischen den Häusern, atmet sie tief ein. Ihr Blick wandert zur Winterjacke, die im Fußraum der Beifahrerseite liegt – und zu dem, was darin verborgen ist. Ihr Herz schlägt schneller. Noch vor einer Stunde war sie voller Vorfreude gewesen, als sie sich ausgemalt hatte, wie sie auf die geheimnisvolle Flaschenpost antworten würde – mit einer Schatzkarte, einer Einladung auf ein Piratenschiff oder zumindest einem Brief mit ein paar geheimnisvollen Kritzeleien. Doch während der Fahrt hat sich ihre Besorgnis verstärkt.