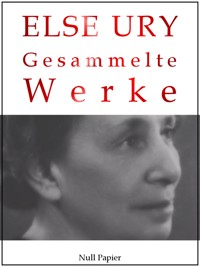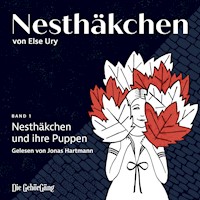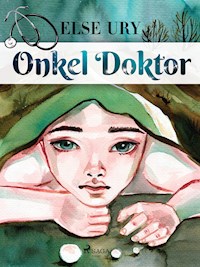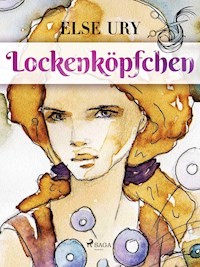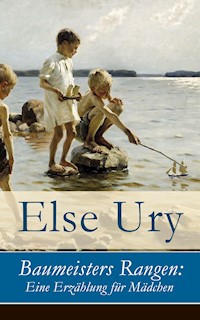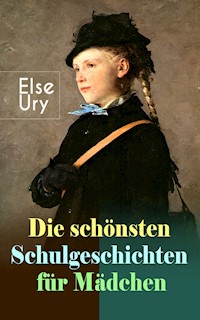
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Die schönsten Schulgeschichten für Mädchen" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Inhalt: Huschelchen Elses erstes Konzert Erikas Weihnachtspuppe Das Komödiantengretl Jungfer Rührmichnichtan Eine kleine Heldin Lieschen Vogelscheuche Das neue Fräulein Das Lieserl von der Alm Fräulein Angstmeier Tante Wischen Die Letzte Lotte Naseweis Eva, das Kriegskind Goldhänschen Die kleine Samariterin Die beste Freundin Fräulein Professor Kornblumentag Die Leseratte Ilses erster Kriegsgeburstag Jungfer Fürwitz Nesthäkchen und ihre Puppen Nesthäkchens erstes Schuljahr Nesthäkchen im Kinderheim Nesthäkchen und der Weltkrieg Nesthäkchens Backfischzeit Nesthäkchen fliegt aus dem Nest Nesthäkchen und ihre Küken Nesthäkchens Jüngste Nesthäkchen und ihre Enkel Nesthäkchen im weißen Haar Professors Zwillinge-Reihe Bubi und Mädi In der Waldschule In Italien Im Sternenhaus Von der Schulbank ins Leben Studierte Mädel von heute Baumeisters Rangen Kommerzienrats Olly Das graue Haus Else Ury (1877-1943) war eine beliebte deutsche Schriftstellerin und Kinderbuchautorin. Urys Schaffen beschränkt sich auf Prosa: Kinder- und Jugendgeschichten und -romane. Die Abenteuer, die Else Ury ihre Helden in ihren Erzählungen erleben lässt, haben häufig eine für den Leser sehr erheiternde Seite.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 5789
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die schönsten Schulgeschichten für Mädchen
Huschelchen
Vater und Mutter, Schwester Edith und sogar der fünfjährige Hansel, alle nannten sie die kleine Irene »Huschelchen« – es war wirklich empörend!
Bittere Tränen hatte Irene schon deswegen vergossen, aber wenn sie weinend mit dem Fuße aufstampfte und rief: »Ich will aber nicht ›Huschelchen‹ heißen – nein – ich will aber nicht!«, dann sagte Mutti ernst: »Du trägst den Namen, den du verdienst, Kind, nimm dich zusammen und sei weniger huschelig, vergiß nicht alles, was man dir aufträgt, dann wird dich kein Mensch mehr so nennen!«
»Unser Huschelchen müßte sich eine Tafel in ihrem Gehirnkasten befestigen, auf der sie alles notiert, wofür ihre neunjährige kleine Persönlichkeit verantwortlich ist«, neckte der Vater.
Ja – wenn es solch eine Gehirntafel gäbe!
Aber leider war eine solche noch nicht erfunden, und so mußte Huschelchen das hübsche Köpfchen mit dem dunkelblonden Gelock selbst anstrengen.
»Ich will dir ein feines Mittel verraten, Huschelchen, wie du nie etwas vergessen kannst,« sagte Schwester Edith geheimnisvoll, als Irene beim Schlafengehen noch schnell in allen Ecken nachschaute, wo denn bloß ihr schön gespitzter Bleistift zur morgigen Zeichenstunde hingekommen sei.
»Was denn? – Bitte, bitte, liebe Edith, sage es mir,« bat die kleinere Schwester begierig, Spielsachen und Bücher in aufgeregtem Suchen durcheinanderwirbelnd.
»Du mußt jedes Ding, das du tun willst, gleich tun, nichts aufschieben, da kannst du es nicht erst vergessen.« Edith war für ihre vierzehn Jahre schon recht verständig.
»Dummes Zeug!« murrte die Kleinere, die nicht allzuviel Respekt vor der großen Schwester besaß. Sie hatte geglaubt, Edith würde ihr irgendeinen Wunderspiegel, durch den man alles sah, oder ein goldenes Zaubersieb, in dem man die unnützen Gedanken von den nützlichen aussieben konnte, verraten – wie es in ihren Märchenbüchern stand. Für Moralpredigten dankte sie – die kostete sie schon von Eltern und Lehrerinnen zur Genüge.
»Na, denn nicht, Fräulein Huschelchen, dann suche dir deinen Bleistift selber, wenn du obendrein noch einen großen Mund hast.« Damit verließ Edith das Zimmer.
In den großen, braunen Kinderaugen begann es feucht zu schimmern. Denn Irene hatte Edith von Herzen lieb. Aber gleich darauf tröstete sich das sorglose Huschelchen.
»Pah – sie wird schon wieder gut werden – wenn ich nur erst meinen Bleistift hätte,« und sie begann nun auch in der bereits gepackten Mappe eine wüste Unordnung zu veranstalten. Dabei kam ihr das Geschichtenbuch, das sie von ihrer Freundin Eva geliehen hatte und morgen wieder abgeben wollte, in die Hand. Die eine Erzählung, die mit dem armen, verwaisten Büblein, hatte ihr besonders gefallen, die mußte sie schnell noch einmal lesen.
Huschelchen dachte nicht mehr an den verlegten Bleistift. Wenn sie irgendwo ein Geschichtenbuch ergatterte, war sie für alles andere nicht mehr zu haben. Sie kauerte beim Schein eines Lichtes an ihrem Arbeitspult und las mit heißen Wangen die schöne Erzählung. Daß Mutti beim Gutenachtkuß gesagt hatte, sie solle unverzüglich zu Bett gehen, damit sie morgen zum Diktat gut ausgeschlafen habe, daran dachte das kleine Mädchen nicht mehr. Auch nicht an Vaters Verbot, niemals abends bei offenem Licht zu lesen, da es den Augen schädlich sei und überdies leicht Feuer entstehen könnte. Dafür war sie ja das Huschelchen.
Seite um Seite schlug sie um, das Papier knisterte, und das Licht flackerte. Die Blätter von Evas Buch bekamen einen gelblichen Schein, bald einen bräunlichen; ein sengender Geruch durchzog das Zimmer – Irene merkte es nicht.
Da – Schritte auf dem Korridor – Anna holte sich die Stiefel zum Putzen – Huschelchen kehrte aus ihrem Geschichtenbuch wieder in die Wirklichkeit zurück. Sie löschte hastig, in dem Gefühl, bei etwas Unerlaubtem ertappt zu werden, das Licht aus und kroch geschwind ins Bett.
Der Kuckuck steckte den Kopf aus dem Fenster der kleinen Schwarzwälder Uhr – ein – zweimal vernahm es Irene noch, aber beim neunten Kuckucksruf schlief sie bereits.
Kurz darauf betrat Edith, die mit der jüngeren Schwester das Zimmer teilte und eine Stunde länger aufbleiben durfte, das Stübchen.
Es war ein heißer Sommerabend, an dem man die Fenster geöffnet ließ; die Linden sandten ihren süßen Blütenhauch in das Zimmer der beiden Mädchen.
Aber was war das? Ein seltsam sengender Geruch schlug Edith entgegen; den vermochte der Lindenduft nicht zu betäuben.
Um Himmels willen – was hatte das Huschelchen da wieder angestellt? Mit bebenden Fingern machte Edith Licht. Sie beleuchtete das ruhig schlummernde Kind, ein befreiender Atemzug hob ihre Brust.
Gottlob – Huschelchen war unversehrt; aber damit gab sich Edith noch nicht zufrieden. Sie hatte oft genug davon gehört, daß ein achtlos hingeworfenes Streichholz auf Teppichen und Decken stundenlang schwelte, bis ein Windzug es zur hellen Flamme entfachte. Sie suchte allenthalben nach der Ursache des brenzligen Geruchs, aber sie fand dieselbe nicht. Doch etwas anderes fand sie – Huschelchens schön gespitzten Bleistift. Aus den Tiefen des Puppenwagens, wo ihn die kleine Schwester zum Schulespielen benutzt und dann vergessen hatte, zog Edith ihn hervor. Schweren Herzens mußte sie sich endlich unverrichtetersache ins Bett legen. Wären die Eltern nicht noch ausgegangen, hätte die bedachte Edith sie sicherlich gerufen, so aber konnte sie nur beten: »Lieber Gott, laß uns morgen früh nicht verbrannt sein!«
Nein, verbrannt waren sie am anderen Morgen nicht, aber so verschlafen, daß Anna dreimal wecken mußte, ehe sich die kleinen Fräulein gähnend zum Aufstehen entschlossen. Das späte Zubettegehen rächte sich.
In aller Eile wurde Toilette gemacht. Eine war der anderen im Wege, sie schubsten sich am Waschtisch, und jede wollte zuerst von Anna frisiert werden. Der neue Tag, den die beiden Schwestern, die sich gut vertrugen, sonst mit Lachen und Scherzen zu begrüßen pflegten, ließ sich höchst unerfreulich an.
»Du hast ja deine Schulsachen noch alle im Zimmer herumliegen, du kommst sicher zu spät,« damit eilte Edith ins Speisezimmer, um noch schnell ihr Frühstück zu verzehren.
Huschelchen schleuderte aufgeregt in die Mappe, was ihr gerade in die Hand kam. Auch Evas Buch war darunter. Ans Frühstücken dachte sie nicht mehr, mit eiligem Adieu wollte sie aus dem Haus hinter Edith her, da begegnete ihr zum Unglück der Vater, der schon von der Praxis kam.
Der Arzt sah sein hastendes Töchterchen mißbilligend an.
»Kakao getrunken, Huschelchen?« fragte er.
Irene war huschelig und unzuverlässig, doch zu lügen vermochte sie nicht.
»Ich habe es vergessen,« gestand sie kleinlaut, »aber jetzt muß ich fort, wir schreiben Diktat.«
»So viel Zeit muß sein, dann stehe ein andermal früher auf.« Das kleine Mädchen wußte: Diesem Tone des Vaters gegenüber gab es keine Widerrede.
Im Stehen goß sie den Kakao hinunter und merkte es nicht einmal, daß ein Teil der braunen Flüssigkeit auf das saubere Waschkleidchen tropfte. Denn die Serviette vorzubinden, hatte Huschelchen natürlich vergessen, auch sich den Mund noch einmal zu waschen: der Kakaoschnurrbart nahm sich lustig in dem rosigen Kindergesicht aus.
Blieben deshalb die Kurgäste, die von der Brunnenpromenade kamen, stehen und sahen dem hübschen Doktortöchterchen nach?
Die Stadt, in der Irenes Vater praktizierte, war ein großer böhmischer Kurort, und die reizenden Kinder des beliebten Badearztes waren allgemein bekannt. Aber Huschelchen vergaß in der Eile, vor Vaters Patienten einen Knicks zu machen, ja selbst den netten Herrn Geheimrat, der ihr neulich die große Tüte mit Pralinés mitgebracht hatte, lief sie fast um, ohne ihn zu grüßen.
Sein »Hallo, kleines Fräulein, so eilig – – –« verklang ungehört.
Gott sei Dank – es gelang ihr noch, vor Fräulein Sturm in die Klasse zu flitzen; um das gefürchtete Nachbleiben wegen Zuspätkommens kam sie noch einmal.
Das Diktatschreiben begann.
Irene war von der Hetzjagd noch so aufgeregt, daß sie ihre Gedanken gar nicht sammeln konnte. Sie schrieb »viele« mit ieh, und der Geist, der in dem alten Schlosse spukte – spuckte bei ihr.
Die gefürchtete Stunde war vorüber. Irene gab ihrer Freundin Eva mit Dank das geliehene Buch zurück. Sie ahnte nicht, wie dasselbe inwendig ausschaute.
»Evchen, du wolltest mir nach Irene das Buch borgen, darf ich es mir gleich nehmen?« Miezi, die Erste der Klasse, ließ Evas schönes Geschichtenbuch in ihre Mappe wandern.
Die nächste Stunde war Französisch.
Die französischen Exerzitien wurden abgegeben.
» Eh bien, vite – vite,« sagte Monsieur nun schon zum dritten Male.
Aber Huschelchen kramte noch immer in ihrer Mappe. Sie wußte es doch ganz genau, sie hatte das französische Heft heute morgen hineingelegt. Und nun fand sie's nicht!
Da – da ist's – nein, o Schrecken, es ist ja das Diktatheft, das denselben blauen Deckel hat; in ihrer Eile hat Huschelchen das Diktat in das französische Heft geschrieben!
Monsieur machte ein unzufriedenes Gesicht, und bei Fräulein Sturm, die Irene nach der Stunde um Auswechselung der Hefte bitten mußte, setzte es einen Sturm der Entrüstung über das unordentliche Mädchen.
»Wie kann man nur solch ein Huschelchen sein!« sagte die Lehrerin zum Schluß ein wenig freundlicher, als sie sah, wie tief der Kleinen die Strafpredigt ging.
»Huschelchen« – da war es wieder, das verhaßte Wort, selbst hier in der Schule verfolgte es Irene.
»Ich will mir aber von nun an bestimmt Mühe geben, nichts mehr zu vergessen,« gelobte sich das kleine Mädchen, »damit der gräßliche Name verschwindet.«
Ja – wenn das Huschelchen nur nicht zu allererst dieses Versprechen vergessen hätte, dann wäre ihr ihre Vornahme am Ende gelungen.
Als sie mittags nach Hause ging, kam unweit der Schule die Frau Mirzenbacher, Muttis Waschfrau, hinter Irene hergeprescht.
»Klein's Fräulein – klein's Fräulein –,« rief sie schon von weitem, »gehen's heim?«
Irene bejahte freundlich.
»Ach, da täten's mir einen großen Gefallen erweisen, wenn's dem Herrn Papa bestellen möchten, ob er nicht gleich amal nach meinem Bub schauen könnt', er liegt nun schon den ganzen Tag mit feuerrotem Köpfle im Bett und schwätzt gar verwunderliches Zeug, da brauch' ich ihn halt net so lang allein zu lassen, den Bub – aber vergessen's ums Himmels willen net.« – Die geängstigte Mutter lief schon wieder zurück zu ihrem fiebernden Kinde.
Was – der Mirzenbacher Franzl krank – das nette Büblein, das seine Mutter stets abends abholen kommt? Die gutherzige Irene hat ihm manchen Bonbon und manch einen rotbackigen Apfel geschenkt – nein, das wird sie sicher nicht vergessen!
Sie öffnete die Gittertür zu dem parkartigen Garten, in dem die Doktorvilla lag.
Nanu – ein galonierter Diener dort zwischen den Büschen? Der imponierte der Kleinen sehr. Er fand sich anscheinend in dem großen Garten nicht zurecht.
»Sie wünschen?« fragte Irene höflich.
»Eine Empfehlung von der Frau Gräfin von Metternich, und der junge Graf haben Schnupfenfieber, der Herr Doktor möchte doch heute noch vorsprechen.« Der Bediente war froh, daß er seine Bestellung so schnell erledigt hatte.
Irene aber stürmte ins Haus, in Vaters Sprechzimmer.
»Vater, ein galonierter Diener war eben da, du sollst schnell zum jungen Grafen Metternich kommen, er hat das Schnupfenfieber,« bestellte sie aufgeregt. Den armen Mirzenbacher Franzl hatte das Huschelchen über den jungen Grafen ganz vergessen.
Den ganzen Tag dachte sie nicht mehr an die ihr aufgetragene Bestellung der armen Waschfrau. Aber sie erkundigte sich angelegentlich beim Vater, ob der junge Graf mit einer Krone im Bett läge.
Andern Tags gab's in der Schule große Aufregung. Die drei Freundinnen Miezi, Eva und Irene kündigten sich die Freundschaft. Miezi hatte das gestern entliehene Buch von Eva wieder mitgebracht, um dieser zu zeigen, daß einige Seiten darin versengt seien, damit die Schuld nicht auf sie fiele.
Eva wandte sich an Irene. Die aber behauptete steif und fest, das Geschichtenbuch in tadellosem Zustande zurückgegeben zu haben.
»Sogar einen Umschlag habe ich mir sogleich gemacht!« rief sie voll Eifer.
Daß sie abends bei Licht noch darin gelesen, daran dachte Fräulein Huschelchen schon längst nicht mehr. Eva weinte, daß ihr schönes Buch verdorben sei, Irene und Miezi stritten sich, wer es getan habe, und als Miezi zum Schluß aufgebracht meinte: »Schau deine Bücher nach und die meinigen, meine sind alle sauber und ordentlich, und du bist selbst mit deinen Schulbüchern huschelig,« da kam's zum Bruch.
Die drei Schulfreundinnen sahen sich nicht mehr an.
Irene, die ein weiches Herz hatte, kränkte sich sehr darüber. Aber die nächste Stunde, Deutsch Gedicht, goß Balsam auf ihre wunde Seele.
Fräulein Sturm brachte ein Gedicht, das sie selbst verfaßt hatte, mit und ließ es von einigen Schülerinnen vortragen. Irene sprach am lautesten und ausdrucksvollsten.
»So magst du das Gedicht morgen sprechen, wenn die Erzherzogin eintrifft, und ihr dabei den Blumenstrauß zum Willkomm überreichen, Irene – wirst du es noch lernen können?«
Na, ob sie es noch lernen konnte! Und wenn es zehnmal länger gewesen wäre!
Daß die Schulkinder in weißen Kleidern, mit Rosenkränzen im Haar, beim Empfang der Fürstin Spalier stehen sollten, war schon längst bestimmt. Aber von einem Gedicht war bisher noch nichts verlautet.
Irene strahlte, daß sie diejenige sein sollte, die zur Erzherzogin sprechen durfte.
»Die Erste mag jedenfalls das Gedicht als eventueller Ersatzmann mit lernen,« meinte Fräulein Sturm noch.
Pah – Irene würde sich schon hüten, daß sie nicht heiser wurde bis morgen, und wenn die Welt aus ihren Fugen ging, sie mußte das Gedicht aufsagen!
An diesem Tage hatte sie für nichts anderes Sinn als für den morgigen Empfang. Wo sie ging und stand, ertappte sie sich dabei, daß sie den tiefen Knicks übte, den sie vor der Erzherzogin zu machen gedachte.
»Huschelchen, vergiß nur den Knicks nicht, oder gar die Ansprache,« neckte sie der Vater.
»Ich würde mich halbtot ängstigen, wenn ich sprechen müßte,« meinte die schüchterne Edith.
»Ich gar nicht,« fiel der kleine Hansel keck ein, und »Ka Spur!« rief auch Irene, ausgelassen im Kreise herumwirbelnd.
Hatte Huschelchen da wohl Zeit, an eine Mutter zu denken, die um das Leben ihres Kindes bangte?
Frau Mirzbacher hatte nicht wieder geschickt. Sie war eine bescheidene Frau und wagte es nicht, den berühmten Arzt, der so vornehme Patienten hatte, noch einmal zu bitten, um ein »Vergelt's Gott!« nach ihrem Franzl zu schauen.
So kam der festliche Tag heran. Im Kurort herrschte bewegtes Leben. Die Badegäste wohnten gleichfalls dem Empfang der Fürstin bei, es war eine stattliche Menge, die sich auf dem bekränzten Bahnhofe eingefunden.
Irene sah wie ein Elfchen aus. Das graziöse Kind im weißen Spitzenkleid, den Rosenkranz in den dunkelblonden Locken und die strahlenden Braunaugen voll Jubel und Seligkeit, erregte allgemein Aufsehen.
»Huschelchen, deinen Strauß vergiß nicht!« rief die Mutter, als das vergeßliche Töchterchen sich ohne denselben zu ihren Schulkameradinnen begeben wollte.
Irene wandte sich zurück, um den herrlichen La-France-Rosenstrauß in die Hand zu nehmen. Da sah sie die Anna atemlos auf den Vater zueilen, der sich gerade zu den übrigen Herren, welche die Kurverwaltung zum Empfang beordert hatte, begeben wollte.
Gleich darauf trat der Vater zu ihnen heran.
»Ich muß leider fort, die Mirzbacher hat geschickt, ihr Bub läge im Sterben; daß die Leute auch immer erst schicken, wenn es Matthäi am letzten ist! Na, mach deine Sache brav, Huschelchen!« Damit eilte der Arzt an das Krankenbett.
Huschelchen aber dachte nicht mehr an die Erzherzogin, die in wenigen Minuten eintreffen mußte, noch an die ehrenvolle Aufgabe der Begrüßung.
»Der Mirzenbacher Franzl liegt im Sterben – durch deine Vergeßlichkeit muß der arme Bub' sterben!« Das war das einzige, was Irene denken konnte. Sie wußte kein Wort mehr von Ihrem Gedicht, ihre zitternden Lippen vermochten nur lautlos die Worte zu bilden: »Lieber Gott, hilf – er darf nicht sterben!«
Es wurde ihr schwarz vor den Augen.
»Irene, Irene – flink – der Zug ist in Sicht!« rief man aufgeregt vom Perron her.
Das kleine Mädchen vermochte sich nicht von der Stelle zu bewegen.
»Ich kann nicht – mir ist nicht gut!« kam es tonlos von ihren Lippen.
Mutti beugte sich erschreckt zu ihr herab, während der Rosenstrauß geschwind Miezi, dem Ersatzmann, in die Hand gegeben wurde.
Wie durch einen Schleier sah Huschelchen, daß Miezi vor der Erzherzogin knickste, ihr Gedicht sprach und den Willkommenstrauß darbot. Jetzt neigte sich die Fürstin lächelnd zu dem kleinen Mädchen und strich ihr dankend über das dunkle Haar. Dann winkte sie einem Begleiter, und dieser überreichte der glückselig errötenden Miezi ein kleines Lederetui mit einem Medaillon an einem Goldkettchen.
Aber kein Gefühl des Bedauerns oder gar des Neides kam in Huschelchens Herz, das war ja alles so gleichgültig – so schrecklich gleichgültig!
Die Freundinnen umstanden mitleidig die blasse Irene, keine dachte mehr an den Streit, der sie entzweit.
»Mutti, der Mirzenbacher Franzl stirbt!« schluchzte die Kleine fassungslos, als sie endlich wieder daheim war.
»Aber Kind – Kind, deshalb darfst du dich doch nicht so aufregen, der Vater hat doch oft schwere Patienten!« begütigte die Mutter liebevoll.
Da kam's stoßweise von Huschelchens Lippen, die schwere Schuld, die sie durch ihre huschlige Vergeßlichkeit auf sich geladen.
Mutti war tief betrübt über ihr Töchterchen. Aber auch sie bat den lieben Gott von Herzen, das Kind nicht so schwer für seinen Fehler zu strafen.
Es wurde Abend. Vater kam noch immer nicht nach Hause. Nur die Operationsinstrumente hatte er sich holen lassen.
Irene war nicht ins Bett zu kriegen. Mit verweinten Augen stand sie am Fenster und schaute nach dem Vater aus.
Endlich, endlich tauchte seine Gestalt zwischen den Jasminbüschen auf.
Huschelchen wagte es nicht, dem Vater entgegenzugehen. Ihre Füße waren ihr so schwer wie Blei.
Da stand der Vater hinter ihr.
Er las die bange Frage mehr in den braunen Kinderaugen, als daß er sie von den zuckenden Lippen seines Töchterchens vernahm.
Es war dem Vater selbst schwer, daß er nichts weiter als ein Achselzucken für die Seelenpein seines Kindes hatte. Die Operation war gelungen, aber ob die erschöpften Kräfte des kleinen Kranken aushalten würden, das ließ sich nicht sagen.
Eine schwere, böse Nacht kam für das leichtsinnige Huschelchen. Kein Auge schloß das kleine Mädchen, und als der Vater in aller Frühe schon zu dem kranken Kinde ging, da fand er bei der Heimkehr sein Töchterchen im langen Nachthemd auf der Treppe kauern; sie hatte es im Bett nicht ausgehalten.
»Der Bub ist gerettet!« Wie die Stimme eines Engels klangen ihr Vaters Worte ins Ohr, ein heißer Tränenstrom löste die Pein der langen Nacht. Und dann beugte sich Huschelchen herab und küßte voll Dankbarkeit Vaters Hand, die wieder gutgemacht hatte, was sein Töchterchen versäumt.
Der Arzt aber wies ernst gen Himmel: »Dem Vater droben danke, Kind, ich war nur sein Werkzeug!«
Von diesem Tage an ist der Name »Huschelchen« aus der Doktorvilla geschwunden – Irene vergißt sobald nichts wieder!
Elses erstes Konzert
»Mutter, wir machen eine Aufführung, alle Schulkinder aus jeder Volksschule sollen mitsingen, im ganzen zweitausend! Und ich darf sogar beim Sologesang mitwirken!« Mit heißen Wangen stürmte die zwölfjährige Else in das kleine Dachstübchen, in dem die Nähmaschine von morgens bis abends rasselte.
Die Mutter hob das versorgte Gesicht von der Arbeit.
»Setz die Kartoffeln ans Feuer, Kind, und schau mal nach den Buben, die raufen sich heute den lieben langen Tag schon wieder drunten auf der Gasse. Ja, wenn die Vaterhand fehlt!« – sie nickte bekümmert vor sich hin.
Else, um deren frischen Mund es noch eben wie Enttäuschung gezuckt hatte, daß die Mutter an der die ganze Schule in Aufregung versetzenden Neuigkeit so wenig Anteil nahm, tat schnell und geschickt nach ihrem Geheiß. Sie wußte als Älteste, was für ein Sorgenpäcklein die Mutter jahrein, jahraus fast klaglos auf ihren zarten Schultern schleppte.
Es war nicht leicht, mit Mäntelnähen vier hungrige Mäulchen sattzumachen. Die Stiefel und Höschen der wilden Buben bedurften auch ständig der ausbessernden Hand. Ordentlich und sauber sollten ihre vier gehen, darauf hielt Frau Reinhardt, wenn sie auch nur eine arme Witwe war.
Da rasselte denn die fleißige Nähmaschine oft schon an dunklen Wintermorgen beim Zitterschein der kleinen Petroleumlampe, wenn die Kinder noch in festem, traumlosem Jugendschlaf lagen. Nur Else, Mutters rechte Hand, erhob sich dann manchmal schlaftrunken von ihrem Lager, schlich sich zum Herd und stellte ein Töpfchen Kaffee in die noch vom Abend gehaltene Kohlenglut, daß die arme Mutter doch einen Schluck Warmes bekam. Und wenn sie dann wieder im molligen Bett lag, dachte sie wohl, während ihre Gedanken schon mit dem eintönigen Geräusch der Nähmaschine ins Land der Träume hinüberirrten: »Ach, wäre ich doch erst groß und könnte auch was verdienen, daß sich mein Mutterchen nicht mehr so arg zu plagen brauchte!«
Wie sie es wohl möglich machen könnte, ebenfalls etwas zum Lebensunterhalt beizusteuern, nahm auch im Wachen Elses Gedanken oft in Anspruch. Denn sie war über ihre Jahre verständig.
Aber was sie der Mutter auch vorschlug, Gebäck-, Milch- oder Zeitungsaustragen, eine Laufmädchen- oder Kindermädelstelle für den Nachmittag, Mutter wollte davon nichts hören.
Nein, ihre Else, ihr hübsches, blondes Mädel, sollte nicht in den Jahren des Wachstums durch zu schwere Arbeit verkümmern. Lieber plagte sie sich selbst noch mehr. Ein Mädel von zwölf Jahren braucht ausreichend Schlaf, den wollte selbstlose Mutterliebe ihrem Kinde nicht verkürzen. Und eine Nachmittagsstelle – sicher würden die Schularbeiten darunter leiden! Sie war doch zu stolz darauf, daß ihre Else durch alle Klassen hindurch die Erste war, das begabte Mädel sollte es mal später im Leben bester haben als ihre Mutter!
So blieb es denn bei Elses Wunsch: »Ach, wäre ich doch erst groß!«
Aber sie versäumte mit Gedanken, die in die Zukunft schweiften, nicht die Gegenwart. Da regte sie vorläufig mal im Hause die fleißigen Hände. Jede Arbeit nahm sie der Mutter geschickt ab. Morgens, ehe sie in die Schule ging, hatte sie schon mehr getan als die meisten anderen Mädchen den ganzen Tag über. Sie bürstete Zeug und Stiefel, sie wusch die Kleinen und kleidete sie an. Und während sie lustig mit dem Besen den Staub aus den Ecken kehrte, lauschte sie auf das Summen des Kaffeewassers, das die kleine Köchin rief. Ja, oft summten ihre frischen Lippen selbst ein Lied mit dem Wasserkessel um die Wette.
Heute war sie ganz besonders zum Singen aufgelegt. Während sie die vielen Stiegen hinabsprang, schmetterte sie mit heller Stimme eins der Lieder, die sie in der Schule zu der bevorstehenden Aufführung einübten. Da ließ manch einer der Hausbewohner lauschend die Arbeit bei den jungen, glockenreinen Tönen sinken und schmunzelte: »Potztausend, Reinhardts Else – ja, so kann's keine!«
Else aber war indessen in den engen, winkligen Hof gesaust, wo die Kinder paarweise um einen Leierkastenmann nach den Klängen »Sancta Lucia« herumtanzten. Ein kleines Mädchen, nicht größer als Else, begleitete das Gedudel des Vaters mit schriller Kinderstimme.
Elses musikalisches Ohr berührten die scharfen Töne geradezu schmerzhaft. Und trotzdem stand sie wie gebannt. Aus den Fenstern ringsum flogen allenthalben in Zeitungspapier gewickelte Geldstücke, die das kleine Leierkastenmädchen mit einem Dankesknicks jedesmal aufhob und in die Büchse warf.
Das war etwas, was sie auch konnte! Ja, viel schöner konnte sie noch singen als das fremde Mädchen. Hatte der Musiklehrer sie nicht heute erst die gesangliche Stütze der ganzen Klasse genannt?
Mindestens zehnmal hatte sich das kleine Mädchen nach den Nickelstücken gebückt, denn es wohnten viele Leute in dem großen Mietshause. Oh, wieviel Geld konnte man verdienen, wenn man von Hof zu Hof herumzog! Es schwindelte Else förmlich bei dieser Aussicht. Dann sollte es ihr Mutterchen mal gut haben! Eine warme Winterjacke wollte sie ihr kaufen und dem Rudi feste Stiefel. Paul und Peter brauchten auch neue Sonntagshosen ... Herrgott, sie sollte die Buben ja suchen, das hatte Else über ihre herrlichen Pläne vollständig vergessen!
Im Hof waren sie nicht, die Rangen, da trieben sie sich sicher auf der Straße umher. Richtig – aus den langen, schwarzen Gasröhren, welche Arbeiter hier aufgestapelt, lugte ein bekanntes rot und blau geringeltes Bein hervor. Das gehörte sicher zu Peter.
Else zog kraftvoll daran, und bald hatte sie den kleinen, vierjährigen Burschen ans Tageslicht befördert. Auch sein Zwillingsbrüder Paul wurde auf ähnliche Weise aus einer zweiten schwarzen Gasröhre hervorgezogen, welche die kleinen Kerle beim Spiel als ihre Höhlen benutzten. Rudi aber, der Abcschütz, war nirgends zu finden. Bis der Schwester scharfes Auge ihn schließlich hoch oben auf einem Laternenpfahl entdeckte, an dem er seine Kletterübungen machte. Die Schulhosen sahen lustig aus. Sie bestanden fast nur noch aus Löchern. Da hatte die arme Mutter wieder für den Wildfang zu sticheln.
Endlich saß das vierblättrige Kleeblatt um den sauber gescheuerten Holztisch im Dachstübchen. Die Kartoffeln dampften und schmeckten den hungrigen Kleinen so gut wie der schönste Braten.
»Mutterchen, ich weiß, wie ich dir helfen kann, Geld zu verdienen,« begann Else und wurde abwechselnd rot und blaß vor Aufregung.
Die Mutter sah lächelnd auf ihr Mädel, das in rührender Weise bemüht war, ihr die Arbeitsbürde zu erleichtern.
»Nun, Kind, was hast du heute wieder ausgeheckt?«
»Ich geh' singen, Mutter, ich kann es besser als das kleine Leierkastenmädchen vorhin. Ich nehme meine Zither mit. Mutterchen, die von Vater, auf der ich fast jedes Lied spielen kann. In allen Häusern sing' ich, und wenn ich dann abends heimkomme, sollst sehen, Mütterchen, wieviel Geld ich verdient habe!« Elses Augen leuchteten.
»Verdient – erbettelt meinst du wohl! Mein Gott, ist es so weit mit uns gekommen, daß mein Kind um Almosen singen muß?!« Die Mutter schlug in jähem Schmerzensausbruch die Hände vor das Gesicht.
Das hatte Else nicht erwartet. Sie hatte wohl, wie schon öfters, Einwände gefürchtet, aber dieser Jammer der Mutter erschreckte sie aufs tiefste. Beide Arme schlang sie, selbst mit den Tränen kämpfend, um die Weinende.
»Mutter – Mutterchen, sei nicht traurig, ich will ja ganz gewiß nicht mehr davon sprechen, wenn es dich kränkt!« bat sie zärtlich, während die Kleinen mit erstaunten Augen auf die große Schwester blickten. War sie unartig gewesen?
Es wurde kein Wort mehr über Elses Absicht gewechselt. Die Mutter ging wieder an ihre Nähmaschine und ihr Töchterchen an den Mittagsaufwasch.
Auch Elses Gedanken kehrten kaum noch zu jenem Luftschloß zurück. Die wanderten jetzt andere Wege.
In der Schule wurde von nichts anderem mehr gesprochen als von dem bevorstehenden Kinderkonzert. Zu wohltätigen Zwecken fand es statt, in erster Linie sollte der Erlös armen Kindern zugute kommen.
Eine Hauptfrage bestand darin: »Was ziehst du an?«
Jedes Kind wollte sich so schön als nur irgend möglich machen, die meisten hatten weiße Sommerkleider.
Else stand vor dem kleinen Garderobenschrank und musterte ihr Sonntagskleidchen. Sie hatte für Winter und Sommer dasselbe. Rot kariert war es, Mutter hatte es vor vier Jahren selbst genäht. Inzwischen war die Else tüchtig in die Höhe geschossen, und auch das Rotkarierte hatte einen breiten schwarzen Streifen als Ansatz erhalten müssen. Das war es aber nicht allein, was schwere Sorgenfalten auf die weiße Kinderstirn rief.
Auch andersfarbige Ärmel hatte es bekommen, da kein Stoff mehr zum Ausbessern gewesen. Und nun hing von jeder Seite ein schwarzer Ärmel wie ein düsterer Tintenklecks hernieder.
Ach, würden die spottlustigen Kameradinnen lachen, wenn sie in dem bunten Stieglitzkleid erschien!
War es nicht besser, sie trat lieber ganz von der Aufführung zurück? Doch was würde Herr Schmidt, der Gesanglehrer, dazu sagen? Und der Chordirigent, der sie heute, wo schon viele Schulen zusammen geübt hatten, ganz nach vorn geholt hatte, weil ihre Stimme besonders schön geklungen?
Nein – nein – sie konnte nicht darauf verzichten, mitzusingen! Der Lehrer hatte gesagt, das sei eine Erinnerung für das ganze Leben. Auch der kaiserliche Hof wurde erwartet, vor dem Kaiser und der Kaiserin sollten sie singen – da mußte sie dabei sein!
Aber in dem alten Kleide? Die Solosängerinnen putzten sich bestimmt alle mit weißen Kleidern. Jeden Tag schlüpfte Else unschlüssig zum Schrank, doch das Kleid wollte nicht schöner werden.
Ihrem Mütterchen sagte Else nichts von ihren Toilettensorgen, die hatte genug anderes, um das sie sich sorgen mußte. Else schämte sich sogar oft, wenn sie dachte, wegen welch nichtiger Dinge sie sich trübe Gedanken machte. Aber in solch kleiner Evastochter, ob sie auch erst zwölf Jahre alt ist, wohnt doch schon ein ganz Teil Eitelkeit. Immer wieder kehrte Elses Denken zu dem Rotkarierten zurück.
Eine Mutter hat scharfe Augen. Selbst wenn sie den ganzen Tag kaum den Blick von ihrer Näharbeit hebt, sie weiß doch, was in dem Herzen ihres Kindes vorgeht.
Frau Reinhardt grübelte und grübelte. Tausendmal mehr als das Kind empfindet ja die Mutter ihre Unzulänglichkeit, wenn sie dem Liebling, wie sie es so gern getan, nicht helfen kann. Soviel die Mutter auch sann und rechnete, es wollte nicht zu einem neuen Kleide langen.
Da kam Else eines Tages aus der Schule, die sonst so rosigen Wangen blaß, die lachenden Augen trüb. Aber sie biß tapfer die Zähne zusammen, die kleine Else, daß nur ihr Mutterchen nichts von ihrem Kummer merken sollte.
Aber als das Töchterchen kaum die Suppe anrührte und ihre helle Stimme, die sonst zur Freude der Mutter all die reizenden Lieder, die sie zur Aufführung gelernt, zu jubilieren pflegte, heute ganz verstummt war, nahm sich Mutter ihr Mädel vor.
Da kam's denn heraus.
Sie hatten heute die erste Stellprobe gehabt. Das Konzert fand im Zirkus statt, da derselbe die größte Menschenmenge faßte. Die Stimmen der Solosänger waren geprüft worden. Und da hatte man Else ganz dicht neben die kaiserliche Loge postiert, da ihre Stimme eine der schönsten gewesen. Der Herr Dirigent aber hatte ihr über das Blondhaar gestrichen und anerkennend gesagt: »Mädel, aus dir wird noch mal was, du hast ja einen wahren Schatz in der Kehle!«
Und darüber war Else traurig? Nein, das hatte sie stolz und glücklich gemacht. Aber gleich darauf war es ihr eingefallen, wie sich wohl das Rotkarierte neben der kaiserlichen Loge ausnehmen würde, ob nicht am Ende die jungen Prinzen und Prinzessinnen ebenfalls über das Stieglitzkleid spotten würden.
»Ach, Mutterchen, hätte ich den Schatz doch lieber in der Hand als in der Kehle, daß ich dafür was kaufen könnte!« sagte sie unter Lachen und Weinen.
»Sei dankbar, Kind, daß dir der liebe Gott eine schöne Stimme zu deiner und deiner Mitmenschen Freude geschenkt hat, die ist mehr wert als ein schönes Kleid,« tröstete die Mutter ihr Kind und sich selbst.
Die Tage vergingen. Eisige Wintertage waren es. Man konnte nicht mehr an neue weiße Kleider denken, man hatte in dem Dachstübchen, wo der Wind durch die schlechtschließenden Fenster pfiff, genug damit zu tun, das Geld zur Feuerung aufzubringen.
Vierzehn Tage waren es noch bis zum Konzert.
Da wachte Else eines Morgens ganz erstaunt auf, nicht von einem Lärm, sondern im Gegenteil von einer ungewohnten Ruhe.
Mutters Nähmaschine stand still. Sie rasselte nicht wie sonst in aller Herrgottsfrühe.
Die Mutter aber warf sich mit fieberheißen Wangen in den Kissen umher. Sie hatte sich bei dem schneidenden Ostwind am Abend zuvor, als sie die Arbeit abliefern ging, eine Lungenentzündung zugezogen.
Böse Tage kehrten in das Dachstübchen ein. Die zwölfjährige Else hatte jetzt ganz allein die Last des armseligen Haushaltes auf ihre jungen Schultern zu nehmen. Ach, und daneben drückte sie eine andere Last noch viel, viel mehr hernieder: Die Sorge um das Leben der Mutter!
Der Armenarzt zuckte die Achsel. Die zarte Frau würde der bösen Krankheit wohl kaum Widerstand entgegenzusetzen haben, er gab wenig Hoffnung.
Kräftige Hühnersuppe sollte die Mutter zur Stärkung bekommen, woher sollte Else das nur bestreiten? Das kleine Pappschächtelchen, das die Barschaft enthielt, war bis auf wenige Pfennige geleert. Drei Abende hatte sie und die Brüder schon mit einer Wassersuppe fürlieb nehmen müssen.
Aber ihr Mutterchen mußte die notwendige Pflege haben, das durfte nicht sterben – und wenn sie betteln gehen mußte!
Betteln, nein, das war nicht nötig, wenn auch Mutter es damals in ihrem Scherz so genannt hatte. Sie konnte singen – hatte sie nicht einen Schatz in der Kehle?
Ja, sie wollte mit ihrer Zither in den Höfen herumziehen und das Geld für Mutters Pflege und für die armen, hungernden und frierenden Brüderchen ersingen.
Es war die letzte Hilfe!
Sie tat kein Unrecht – nein – sie tat es ja, damit ihr Mutterchen nicht sterben mußte!
So schlang Else eines Tages, nachdem sie das letzte Stück Holz in den Ofen geschoben und ihrer Mutter, wie um Verzeihung bittend, über die geschlossenen Augen gestrichen, ein Tuch um Kopf und Schultern und griff nach Vaters Zither.
Leise stahl sie sich aus dem Hause.
Eisig pfiff der Wind. Scharf wie Nadelspitzen jagte er die Schneeflocken in das Kindergesicht. Aber mutig schritt sie vorwärts.
Dort das schöne, große Haus, sollte sie da hineingehen? Sicher wohnten hier reiche Leute, die nicht mit dem klingenden Beifall kargten.
Else stand und zögerte.
Nein, sie traute sich nicht, das Haus schaute doch gar zu vornehm drein. Lieber versuchte sie es in dem bescheideneren nebenan.
Zwischen dem Müllkasten und der Regentonne nahm Else in dem engen Hof Aufstellung. Mit klammen Fingern wickelte sie Vaters Zither aus, hauchte in die Hände und begann leise die ersten Akkorde. Noch leiser und scheuer setzte darauf ihre Stimme ein. Sie schämte sich unsäglich.
Kein Fenster öffnete sich. Kein Geldstück klirrte auf die Steine des Hofes. Der eisige Sturm übertönte mit wildem Hohnlachen die schüchterne Kinderstimme.
Sie mußte lauter singen, sie mußte – es war ja für ihr Mutterchen!
Das erste Fenster ward aufgetan. Ein Schuster hielt in seinem Hämmern inne, nickte mit dem Kopfe nach den Klängen des Liedes und warf der kleinen Sängerin ein Geldstück zu. Jetzt folgten andere. Hier und dort öffneten sich Fenster und Herzen. Das arme Kind da unten, das in Sturm und Kälte so schön sang, erregte Mitleid.
Ein – zwei – drei – vier – fünf Sechser. – Else knickste glückstrahlend. Dann zog sie ein wenig dreister in das vornehme Haus nebenan.
Hei – wie auf einen Schlag öffneten sich die Küchenfenster in allen Stockwerken, als Elses helle Stimme einsetzte. Lachend und sich in den Hüften wiegend, schauten dralle und rotbäckige Küchenfeen, die Anna, die Mine, die Guste und Rike, Kochlöffel oder Besen im Arm, auf sie hernieder. Aber ehe sie sich noch dazu entschließen konnten, der Kleinen den üblichen »Sechser« zuzuwerfen, kam der Pförtner und jagte die verängstigte Else mit einem barschen »Hier wird nichts gegeben!« vom Hof.
Tränen schossen in die Blauaugen. Else biß sich auf die Lippen, daß es ihr weh tat, um nur nicht laut aufzuweinen. Die kalten Worte des Mannes ließen die Kinderseele mehr frieren als Sturm und Winterkälte.
Es dauerte lange, bis sie sich aufs neue in ein Haus hineinwagte. Hier ging es ihr besser. Es wurde eine reiche Einnahme. Jeder halbwegs nur musikalische Mensch ward auf die selten schöne Kinderstimme aufmerksam.
Hin und wieder sagte wohl auch einer: »Schade, daß so was auf den Höfen verkommen muß!«
Eine gutherzige Waschfrau reichte dem kleinen, verfrorenen Ding, das so »rührselig« sang, einen Topf heißen Kaffee aus dem dampfenden Waschkeller hinaus. Oh, das tat gut, das warme Wort und der warme Trank!
Am schlimmsten waren die Höfe, auf denen es eine Hundehütte gab. Else hatte, trotzdem sie schon zwölf Jahre alt war, immer noch eine geheime Angst vor großen Kötern. Daß die Hofhunde den fremden kleinen Eindringling nicht gerade freundlich begrüßten, war ja selbstverständlich. Sie knurrten, sie blafften, rissen an der Kette, oder wenn sie, was das Allerschlimmste war, frei herumliefen, wartete Elfe ihr Willkommen gar nicht ab. Statt zu singen, nahm sie schreiend Reißaus. Musikalische Hunde waren auch nicht gerade angenehm. Die heulten und jaulten mit der kleinen Sängerin im Duett, daß es nicht anzuhören war.
Als es dunkel wurde, hatte sie doch so viel zusammenbekommen, daß sie das Huhn für die kranke Mutter kaufen konnte. Ja, zu Brot, Milch und Kohlen langte es sogar noch.
Else war selig. Sie hatte nicht mehr das Empfinden, gebettelt zu haben, das ihr doch ab und zu bei unfreundlichen Worten auf den Höfen gekommen, nein, es war das erste selbstverdiente Geld!
Nun mußte ja ihr Mutterchen wieder genesen!
Eine hilfreiche Nachbarsfrau erbot sich, die Suppe für die Kranke zu kochen, und als die Mutter die ersten Tropfen der kräftigen Brühe schluckte, war keiner so stolz wie Else.
Die Suppe allein mochte ja nicht schuld daran sein, möglich, daß der liebe Gott, der Vater der Witwen und Waisen, Elses Kindesliebe belohnen wollte – ihr Mutterchen wurde gesund!
Langsam, sehr langsam ging es freilich mit der Genesung. Das Schulkinderkonzert nahte, und noch immer hatte sie das Bewußtsein nicht völlig erlangt.
Else hatte den Lehrer gebeten, sie nicht mitsingen zu lassen, da ihre Mutter krank sei. Aber der wollte durchaus nichts davon hören. Else Reinhardt war die beste Gesangschülerin, mit der wollte Herr Schmidt Ehre einlegen. Als er nun hörte, daß es besser ginge mit der Mutter, war überhaupt keine Rede mehr vom Fehlen.
Noch mehrere Male hatte Else während der Krankheitstage Zuflucht zu Vaters Zither nehmen müssen, wenn kein Brot mehr im Hause war, wenn es galt, die notwendige Pflege für die Mutter zu beschaffen. Die Ernährerin der Familie lag danieder, da mußte Else wieder von Hof zu Hof ziehen, um wenigstens den Hunger, den bitteren Gast, aus dem Dachstübchen zu bannen.
Heute hatte die Else einen schweren Kampf mit sich selbst zu kämpfen. Morgen war das Konzert, sie hatte soeben das rotkarierte Stieglitzkleid einer letzten Musterung unterworfen. Das Ergebnis war niederschmetternd. Sie mußte in den letzten Wochen noch tüchtig gewachsen sein, denn das Kleid reichte trotz der schwarzen Verlängerung ihr noch nicht bis zu den Knien. So sehr Else auch daran zog und zerrte, länger wurde es nicht.
Da kam ihr plötzlich ein Gedanke. Wenn sie um Brot auf den Höfen gesungen hatte, konnte sie es nicht ebensogut für ein neues Kleid tun?
Dann würden sie die Kameradinnen morgen nicht auslachen, dann konnte sie, ohne sich zu schämen, ihren Platz neben der kaiserlichen Loge einnehmen.
Schon griff sie nach Vaters Zither.
Die gab einen leisen, traurigen Ton von sich. Wie Mutters Jammerlaut damals klang es, als Else ihr zum ersten Male von ihrer Absicht gesprochen. Das Kind bedeckte die Augen mit beiden Händen.
Nein – nein – wegen eines neuen Kleides durfte sie nicht tun, was der Mutter Schmerz bereiten mußte. Wenn sie auch um des täglichen Brotes willen den schweren Schritt unternommen hatte, aus Eitelkeitsgründen durfte sie es nicht.
So kam der Konzertsonntag heran, und Else schlüpfte in das Rotkarierte. Nachdem sie die kleinen Brüder versorgt, trat sie noch einmal ans Bett der Mutter. Die hatte zum ersten Male die Augen voll geöffnet und schaute ihr Kind klaren Blickes an. Heute ganz fieberfrei. Elses Herz jubelte. Sie dachte nicht mehr an das ausgewachsene Stieglitzkleid, glückselig drückte sie einen Abschiedskuß auf die kühle Stirn der Mutter.
Die Schüler und Schülerinnen versammelten sich im Zirkus. Wie der Kinderkreuzzug ins gelobte Land schaute es auf der Straße aus. Scharen von Kindern, immer mehr, immer neue, Knaben und Mädchen, große und kleine – Kinder, wohin man auch blickte.
Im Zirkus wimmelte es von blonden und dunklen Kinderköpfen. Das war ein Flüstern, ein Wispern, Kichern und Lachen, bis jedes von den zweitausend Schulkindern seinen Platz eingenommen hatte. Die Lehrerinnen, die jeder Abteilung beigegeben waren, hatten alle Mühe, die aufgeregten jungen Sänger im Zaume zu halten.
Hier zog ein Bruder die gerade vor ihm sitzende Schwester übermütig am Zopf, daß sie losschrie, dort probten zwei Jünglinge trotz der Enge im Boxen ihre kraftvollen Muskeln. Drüben pufften sich zwei um einen Platz, hier weinte ein kleines Mädel, das den ihrigen durchaus nicht finden konnte.
Im allgemeinen ging es bei den Mädchen leiser und gesitteter zu als bei den Jungen. Die Mädel hatten genug damit zu tun, die eingeschmuggelten Bonbons zu vertilgen, und vor allem gegenseitig ihre Kleider zu bewundern. Wer nur einigermaßen dazu imstande war, hatte ein weißes angelegt.
»Habt ihr schon Else Reinhardt gesehen, sitzt die Erste und hat nicht mal ein weißes Kleid an – «
»Wie unser Flickenkasten sieht sie aus!« lachte eine andere.
»Ja, und zum Ballett scheint sie gehen zu wollen, so kurz ist ihr Rock,« flüsterte es wieder.
Else saß wie auf Kohlen. All die spöttischen Bemerkungen der übermütigen Schulkameradinnen fing ihr Ohr gequält auf, wenn sie auch noch so leise geflüstert waren. Aber sie wollte sich ihre frohe Stimmung nicht nehmen lassen. Ihr Mütterchen war wieder gesund, sie hatte heute das erste bewußte Wort zu ihrem Kinde gesprochen, da mochten die anderen sagen, was sie wollten.
Der Zirkus füllte sich. Lange vorher schon waren sämtliche Billette ausverkauft. Trotz des gewaltigen Rundbaues konnte bald kein Apfel mehr zur Erde fallen. Allenthalben sah man Kinder ihrem Vater, der Mutter oder einem Onkel mit dem Taschentuch zuwinken.
Else hatte niemand hier, dem sie zunicken konnte. Aber sie ließ sich dadurch nicht traurig machen, nein, sie hatte ja heute allen Grund, dem lieben Gott dankbar zu sein.
Da geht es plötzlich wie ein elektrischer Schlag durch die vieltausendköpfige Menge. Auf einen Ruck haben sich all die Schulkinder von ihren Plätzen erhoben.
Der kaiserliche Hof ist erschienen.
Ganz vorn an der Brüstung der golden glänzenden Loge sitzt der Kaiser. Neben ihm die Kaiserin mit grauem Federhut. Dahinter Kronprinz und Kronprinzessin, die junge Prinzessin im weißen Spitzenkleid und einige Prinzen. Im Hintergrunde das Gefolge.
Elses Herz pocht bis in den Hals hinein. Keine zehn Schritte von ihr entfernt der Kaiser und die Kaiserin. Auch in ihren kühnsten Träumen hatte Else niemals gehofft, sie so nahe zu sehen.
Aber jetzt war keine Zeit zum Staunen. Der Dirigent hatte mit dem Taktstock auf das Pult geklopft, das Zeichen zum Beginn.
Wie eine einzige Stimme setzten Tausende von klaren Kinderstimmen überwältigend ein: »Der Herr ist mein Hirt.«
Da feuchtete sich manches Auge bei dem herzinnigen Sang der jungen Kehlen, beim Anblick der reinen Kindergesichter.
Elses Stimme jubelte heute. Als ob sie all das große Glück, daß es ihrem Mutterchen besser ging, in Tönen herausjauchzen wollte.
Das erste Lied war verklungen.
Endloses Beifallklatschen.
Das aber war es nicht allein, was Elses Herz höher schwellen ließ. Deutlich, ganz deutlich hatte sie gehört, wie der Kaiser ein vernehmliches »Bravo!« gerufen. Und was das merkwürdigste war, es schien ihr, als ob er sie ganz besonders dabei angesehen.
Das zweite Lied, der Kaisergruß: »Heil unserm deutschen Kaiser! Heil Kaiser Wilhelm, dir!« Wie die Wangen der jugendlichen Sänger in vaterländischer Begeisterung glühen, wie die glänzenden Kinderaugen glücklich stolz zur Kaiserloge hinübergehen!
Der Kaiser winkt den kleinen Patrioten lächelnd seinen Dank zu.
Der Knabenchor schmettert jetzt »Lützows wilde, verwegene Jagd«, und darauf der Chor der Mädchen ein neckisches Maienlied.
Die Blicke der kaiserlichen Familie sind nach rechts gerichtet, man flüstert leise miteinander, aller Augen haften auf der Stelle, wo ein blondzöpfiges Mädel selbstvergessen wie eine Lerche in den Lüften jauchzt und jubiliert.
Aber plötzlich wurde Else aufmerksam.
Blutübergossen nahm sie ihren Platz wieder ein. Kein Zweifel, ihr galten die Blicke der hohen Herrschaften! Nein, nicht ihr, sicher ihrem häßlichen, rotkarierten Kleide, vielleicht waren sie darüber böse, daß sie sich nicht feiner gemacht hatte.
Zum Glück war der Knabenchor jetzt wieder dran. Else konnte sich von dem beschämenden Gefühl, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen zu haben, noch ein wenig erholen.
Aber als die Mädel dann wieder ihr übermütiges Kinderlied »Der Bauer hat ein Taubenhaus« zu singen begannen, da dachte die Else nicht mehr an ihr Rotkariertes. Sie sang, als ob sie daheim im Dachstübchen ihre Stimme erschallen ließ.
Pause.
Der Kaiser ließ den Chordirigenten zu sich rufen, um ihm seine Anerkennung auszusprechen.
Einige Minuten später trat der Dirigent mit heißem Kopf vor die nichtsahnend einen geschenkten Bonbon lutschende Else.
»Ihre Majestät die Kaiserin wünscht dich zu sprechen. Du bist in die kaiserliche Loge befohlen!« flüsterte er erregt.
Else wäre fast vor Schreck an ihrem Bonbon gestickt. Mit zitternden Händen beförderte sie ihn unauffällig in ihr Taschentuch und folgte dem Herrn, an allen Gliedern bebend.
Jetzt kam's – jetzt würde die Kaiserin ihre Mißbilligung über das wenig festliche Kleid aussprechen.
Ihr schwindelte, als sie die mit roten Teppichen belegte Kaiserloge betrat, es ward ihr schwarz vor den Augen. Kaum unterschied sie blitzende Uniformen, kaum vermochte sie ihren tiefen Knicks zu machen.
Da traf eine freundliche Stimme ihr Ohr.
»Wie heißt du, liebes Kind?«
Else nannte mit niedergeschlagenen Augen ihren Namen.
»Du hast ja eine ganz wunderbare Stimme, kleine Else, die wollen wir uns und unserm Volke erhalten. Wo wohnst du?« In herzgewinnender Freundlichkeit sprach die hohe Frau zu der verschüchterten Kleinen.
Ein Begleiter notierte die genannte Adresse.
Dann sagte auch der Kaiser lächelnd, sie würde sicherlich einmal eine große Sängerin werden, und – sie war entlassen.
Wie Else wieder auf ihren Platz gekommen, das wußte sie nicht. Die Blicke des Publikums, der Lehrerinnen und Kinder, alle suchten sie das kleine, ärmlich gekleidete Mädchen, das Majestät so ausgezeichnet.
Wieder schwindelte es ihr, aber diesmal vor seligem Glück. Trotz des ausgewachsenen, rotkarierten Stieglitzkleides hatten Kaiser und Kaiserin mit ihr gesprochen, sie gelobt – ach, sie hätte die ganze Welt umarmen mögen.
Es wurde ihr schwer, den nicht endenwollenden Applaus am Schluß des Konzertes abzuwarten. Sie lief wie gejagt durch die Straßen, sie flog die Treppen zum Dachstübchen empor, um nur ja keine Minute Zeit zu verlieren. Ihr Mutterchen mußte sich mit ihr freuen.
Gottlob! Klaren Blickes grüßte die Mutter ihr Kind, und mit deutlicher, wenn auch noch etwas matter Stimme fragte sie: »Na, war's schön, Else?«
Ach, die Else fand kein Ende, zu erzählen, wie schön, wie herrlich es gewesen.
Freude soll die beste Medizin sein, das bewahrheitete sich auch an Frau Reinhardt. In glücklichem Mutterstolz blickte sie auf ihr blondes Mädel.
Am nächsten Tage erschien ein Herr vom kaiserlichen Hof, um Erkundigungen über die Familie einzuziehen.
Er mußte wohl die bittere Armut und Krankheit, die in dem Dachstübchen herrschte, recht anschaulich geschildert haben, denn schon in wenigen Tagen sprachen Damen vom Komitee des Schulkinderkonzertes vor und steuerten tatkräftig der ersten Not.
Else hatte nicht mehr nötig, in Sturm und Schnee mit Vaters Zither auf den Höfen zu singen. Als sie der Mutter gestand, wie sie das Geld zur Pflege und zum Lebensunterhalt erworben, vergoß diese wieder Tränen. Aber das waren Freudentränen über die Kindesliebe ihrer Else.
Ihre Majestät die Kaiserin setzte der kleinen Sängerin bis zum Abschluß ihrer musikalischen Studien eine jährliche Summe aus, die so reichlich war, daß alle Sorgen ein Ende hatten.
Frau Reinhardt durfte dieses Geld ohne Skrupel annehmen, galt es doch, ihre Else zu einer tüchtigen Künstlerin auszubilden.
Heute ist Else Reinhardt eine der beliebtesten und gefeiertsten Opernsängerinnen. Ihr Gesang begeistert Tausende, die Herzen des Publikums fliegen ihr zu, sobald sie die Bühne betritt.
In das kaiserliche Schloß wird die berühmte Künstlerin jetzt oft geladen, viele Auszeichnungen werden ihr dargebracht. Keine aber hat sie je wieder so glücklich gemacht wie die, welche dem kleinen Mädel im ausgewachsenen, rotkarierten Kleide bei ihrem ersten Konzert zuteil geworden.
Erikas Weihnachtspuppe
»Hurra, Weihnachtszensuren!«
Damit stürmten Eberhards drei in das trauliche warme Eßzimmer. Die Pelzmütze saß schief auf den Blondköpfen, kleine Schneeteiche tauten in der Wärme von den derben Lederstiefeln, aber was schadete das? Die Wangen der drei glühten, und die Augen blitzten und strahlten. Morgen war ja Weihnachten.
In glückseligem Stolz blickte die am Nähtisch sitzende Mutter auf ihr blühendes Kleeblatt.
»Na, hoffentlich sind es auch echte, rechte Weihnachtszensuren, an denen Vater und ich unsere Freude haben werden,« meinte sie lächelnd. »Aber eure Füße hättet ihr euch trotz aller Aufregung draußen auf der Strohmatte abtreten können, Kinder, nun muß Auguste erst wieder hinterherwischen.«
»Nicht schelten, Mütterchen!« Zwei Arme schlangen sich von rückwärts um den Nacken der Mutter, und eine Stimme, der man den inneren Jubel anhörte, verkündete: »Ich bin Erste gekommen!«
»Der Tausend!« Mutter lächelte erfreut der zwölfjährigen Hilde zu und durchflog das ihr strahlend dargereichte Zeugnis. »Das lasse ich mir gefallen, mein Mädel, da muß der Weihnachtsmann morgen wohl noch etwas Extraschönes bringen, was?«
»Vernickelte Schlittschuhe, Mütterchen, und die weiße Sportmütze ja nicht vergessen!« Ein schneller Blick flog von der blondzöpfigen kleinen Eitelkeit zum Spiegel hinüber, wie letztere ihr wohl stehen mochte.
»Nun du, Fritz – auch Erster gekommen, hm?« Mutter wandte sich dem hoffnungsvollen Quartaner zu.
»Ach wo, Mutter,« Fritz war beinahe beleidigt, »lauter ›sehr gut‹ wie bei den Mädchenzensuren,« es klang ungeheuer verächtlich, »das gibt es doch bei uns Jungs gar nicht, und Erster – – –«
»Das gibt es doch bei uns Jungs gar nicht,« neckend waren die Schwestern eingefallen, und jetzt umtanzten sie den Jungen lachend.
»Gibt es auch nicht.« behauptete Fritz mit der Beharrlichkeit des künftigen Mannes. »Erster – pah – Primus heißt es bei uns im Gymnasium.«
»Schön, also Primus, der hättest du doch werden können, mein Zunge, aber ich lese hier ja ›Fünfter unter 40 Schülern‹?« neckte jetzt auch die Mutter.
»Herr Doktor Richter hat gesagt, er wäre recht zufrieden mit meiner Zensur,« meinte Fritz nun doch ein bißchen kleinlaut.
»Na, denn muß ich's wohl auch sein,« beruhigte die Mutter ihren Jungen.
»Ja, und Primus zu sein, ist überhaupt langweilig, da kann man ja gar nicht mehr raufkommen, nur immer runter!« Fritz gewann jedem Ding im Leben die beste Seite ab.
Erika, das Nesthäkchen, wurde ungeduldig. Sie hatte noch nicht viel Zensuren nach Haus gebracht, da sie erst das zweite Jahr in die Schule ging.
»Nun komme ich dran, ich bin Dritte, Muttchen – etsch, Fritz, zwei Plätze über dir!« frohlockte die Kleine.
Bruder Fritz reckte seine kräftigen Arme bereits zum Boxen. Er machte nicht viel Federlesen, wenn man seine Jungsehre angriff.
Aber Mutters ernstes Wort ließ ihn innehalten.
»Erika, was lese ich denn hier! Aufmerksamkeit: Zuletzt nicht immer zur Zufriedenheit. Ja, was soll denn das heißen, Kind?«
Die siebenjährige Erika schob die Unterlippe vor. Das war das sicherste Zeichen für eine baldige Tränenüberschwemmung.
»Ich – ich – morgen ist doch Weihnachten, Muttchen – –«
»Jawohl, da haben alle Kinder die Verpflichtung, sich ganz besonders zusammenzunehmen, in der Schule sowohl als auch zu Hause, sonst bringt ihnen Knecht Ruprecht eine Rute statt der Weihnachtsgaben, das weißt du doch, Erika!« Mutter nickte ernsthaft mit dem Kopf.
Die Tränenflut aus Erikas Blauaugen ergoß sich.
»An den – an Knecht Ruprecht habe ich ja gerade immer denken müssen, ob er auch ganz bestimmt meinen Brief bekommen hat,« schluchzte sie, »deshalb habe ich bloß manchmal nicht aufgepaßt.«
»Einen Brief! Du hast Knecht Ruprecht einen Brief geschrieben?« lachte Schwester Hilde.
»Ist die noch dämlich!« Fritz sagte es so recht von der Höhe seines stolzen Quartanertums herab, das nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt.
»Pst!« Mutter legte den Finger auf den Mund, »das ist unser Geheimnis, was, Erika? Na, dann wollen wir es diesmal mit der Aufmerksamkeit nicht so genau nehmen, sonst ist die Zensur ja gut.«
»Glaubst du, daß mir Knecht Ruprecht trotzdem meinen größten Wunsch erfüllen wird, Muttchen?« Nesthäkchen fragte es immer noch ein wenig ängstlich.
»Deinen größten Wunsch?« Mutter mußte sich erst besinnen. »Ach so, ja, ich denke doch, daß er es ganz sicher tun wird.« Sie lächelte unmerklich.
»Was hast du dir denn gewünscht?« Selbst Quartaner können manchmal neugierig sein.
»Weißt du denn überhaupt, wo er wohnt?« Auch Hilde hätte das Geheimnis des Schwesterchens gern herausbekommen.
»Jawohl! Wolkenland. Milchstraße, Stern vierzehn.« kam die Adresse prompt aus der Kleinen Mund.
Hellauf lachten die beiden Großen.
»Laßt mir meine Erika in Ruhe und zieht euch endlich aus, sonst kommt Weihnachten heran, und ihr steht noch hier,« mahnte die Mutter.
Ja, wenn Weihnachten nur so schnell herangekommen wäre! Nie schleicht die Zeit langsamer als einen Tag vor dem heiligen Abend, wenn sehnsüchtige Kinderherzen die Stunden beflügeln möchten. Aber endlich bricht der wichtigste Tag im Jahre doch an. Überall ist man im Wege, überall findet man verschlossene Türen, und zum mindesten festverschnürte Pakete und Schachteln. Jedes Gesicht ist ein großes Geheimnis.
Im Eberhardschen Hause roch es herrlich nach Weihnachtsbaum und frischgebackener Stolle. Hilde stichelte mit feuerroten Backen, sie legte die letzte Hand an Mutters Kreuzstichdecke. Fritz hatte seine Schnitzeleien zu Weihnachten in der Schule im Handfertigkeitsunterricht fabriziert, er hatte heute nichts mehr zu tun. Höchstens hier und da durch ein Schlüsselloch zu lugen, wenn es gar zu geheimnisvoll im Nebenzimmer knisterte.
Um so mehr aber hatte die Jüngste unseres Kleeblattes zu schaffen. Nicht etwa an den Weihnachtsarbeiten; Mutters Waschlappen und Vaters Uhrständer waren längst fertig. Nein, Erika hielt in ihrem Puppenwinkel Großreinemachen. Denn – ja, das war eben das Geheimnis.
Eine große Lockenpuppe, eine lebendige, die richtig sprechen und laufen konnte, hatte sie sich bei Knecht Ruprecht zu Weihnachten bestellt. Und wenn er ihren Brief bekommen hatte – sie hatte ihn der Sicherheit halber der Mutter übergeben, und diese hatte versprochen, ihn gut zu besorgen –, und wenn er nicht gar zu böse über ihre zuletzt nicht immer zufriedenstellende Aufmerksamkeit in der Schule war, dann würde heute abend die lebendige Puppe hier ihren Einzug halten. Das Schlimme war nur, daß die Puppe, wenn sie sprechen konnte, ganz sicher sagen würde: »Pfui, Erika, was ist das hier für eine greuliche Unordnung in deinem Puppenwinkel.« Und wenn sie laufen konnte, würde sie am Ende wieder davonlaufen, weil ihr die neue Puppenmutter zu liederlich war. Darum mußte Erika noch ganz schnell Ordnung schaffen.
Draußen kam leise und still der Heiligabend über die festlich weiße Wintererde geschritten. Auf weichen, silbrigen Schneesohlen kam er, Hand in Hand mit der Dämmerung. Er blickte durch die Eisblumen am Fenster in jedes Haus, in jedes Hüttlein und lächelte seinen Friedensgruß hinein.
Eberhards drei sahen ihn nicht kommen, trotzdem sie am Fenster hockten und Gucklöcher in die zugefrorenen Scheiben hauchten. Die hatten viel zu viel von den bevorstehenden Herrlichkeiten zu schwatzen, um die leisen, mahnenden Schritte des Heiligabends zu vernehmen. Wenigstens die beiden Großen. Klein-Erika spähte herzklopfender Aufregung durch ihr Guckloch, ob denn der Wolkenschlitten Knecht Ruprechts noch immer nicht kommen wollte.
»Was hast du dir denn bloß gewünscht?« Immer wieder versuchten die beiden Großen hinter das Geheimnis der kleinen Schwester zu kommen. Aber die machte nur ein vielsagendes Gesicht und schwieg. Au – Hilde und Fritz, die würden einmal die Augen ausreißen, wenn die lebendige Puppe ihr nachher entgegengelaufen kam.
Horch – Glockengeläut. »Knecht Ruprechts Schlitten!« rief Erika.
»Quatsch! Vaters Klingel!« ließ sich der unhöfliche Fritz vernehmen.
Und dann standen alle drei geblendet. Strahlender Glanz flimmerte in die Dunkelheit hinein, die Pforten zur Kinderseligkeit taten sich auf.
Aber nur einen Augenblick blieben die Eberhardschen Sprößlinge in dem Bann der plötzlich über sie hereinbrechenden Lichtfülle des Tannenbaumes. Dann eilten sie in das Weihnachtszimmer, sie überpurzelten sich fast.
Die Kleinste war trotz ihrer kürzesten Beinchen die erste drin. Einen Blick die lange Weihnachtstafel herab – hurra – da war sie, die große Lockenpuppe, Knecht Ruprecht hatte ihren Brief erhalten.
Ein Weilchen mußten die Kinder noch ihre Ungeduld und Erwartung zügeln. Vorläufig saß der Vater erst am Klavier, und die feierlichen Klänge des Weihnachtsliedes durchzogen das Zimmer. Aus jugendlich hellen Kehlen erschallte es: »Stille Nacht, heilige Nacht,« und wenn auch mancher Blick inzwischen zu der reich besetzten Weihnachtstafel hinüberirrte, das nimmt der liebe Herrgott an diesem Abend keinem Kinderauge übel.
Mutter hatte Mitleid mit ihren erwartungsvollen dreien. »Ich denke, wir bescheren zuerst, und hören uns dann noch her die Weihnachtsgedichte an, vorher habt ihr doch keine Ruhe und Andacht dazu,« meinte sie lächelnd.
Lauter Jubel war der Dank für diese Worte. Ein jedes eilte zu seinem Gabentisch, den es mit bewunderungswürdigem Scharfsinn gleich herausgefunden hatte. Hilde hatte bereits die weiße Sportmütze auf den blonden Schopf gedrückt und schnallte sich jetzt die blanken Nickelschlittschuhe an die Füße. Fritz schwenkte in der einen Hand den »Robinson«, in der anderen den Laubfrosch, der zu seinem Aquarium gehörte.
Und Erika? Die stand steif und stumm vor ihrem Platze, während große Tränen der Enttäuschung über ihre Bäckchen kullerten. Die neue große Lockenpuppe kam ihr nicht entgegengesprungen, wie sie es gehofft, steif und stumm, ganz wie ihre kleine Puppenmama, blieb sie auf ihrem Platz.
Hilde und Fritz hingen dankbar am Halse des Vaters und der Mutter, Nesthäkchen rührte sich nicht von der Stelle.
»Nun, Erika,« die Mutter trat zu der stillen Kleinen, »freust du dich denn gar nicht über deine schönen Weihnachtsgeschenke? Sieh doch, eine Kochmaschine, auf der man richtig mit Spiritus kochen kann, das neue Puppenservice, hier das schöne Märchenbuch, und dann die große Lockenpuppe – nun hat Knecht Ruprecht doch deinen Wunsch erfüllt, was?«
»Nein – gar nicht –,« es kam höchst weinerlich heraus, »die olle Puppe kann ja nicht sprechen und nicht laufen, ich wollte eine richtige lebendige Puppe haben, die hier mag ich nicht.«
»Aber Erika, schämst du dich denn gar nicht, so undankbar zu sein, und noch dazu am lieben Weihnachtsfest? Hast du denn dein neues Kind überhaupt schon liebgehabt?« Die Mutter ergriff die große Lockenpuppe, legte sie der Kleinen in den Arm und drückte sie ein wenig auf den Bauch.
»Mama! Papa!« sagte sie da ganz deutlich.
Das war eigentlich fein. Aber Erika war doch noch zu sehr enttäuscht, um schon eine reine Freude daran zu haben.
»Einen Papa, den gibt es gar nicht bei mir, und eine Mutter drückt ihr Kind überhaupt nicht auf den Bauch,« sagte sie noch immer ungnädig.
»Ei, Erika, wenn du die Puppe nicht magst, so werden wir sie einem armen Kinde schenken, das freut sich sicher damit,« mischte sich jetzt der Vater ziemlich ernsthaft hinein.
Erika hatte inzwischen aber gesehen, wie schön die neue Puppe war. Sie hatte Schlafaugen, Wimpern aus richtigen Haaren und winzige Zähnchen. Ein allerliebstes weißes Spitzenkleid trug sie mit einer mattrosa Seidenschärpe. Und das Stickereihütchen mit dem Tausendschönchen war einfach süß. Als Erika die Puppe so in ihren Armen hielt, da fühlte sie doch schon Liebe zu ihrem neuen Kinde.
»Ich möchte sie doch gern behalten, wenn sie auch nicht laufen und sprechen kann,« meinte sie und gab ihr einen Kuß als Willkomm. Den nächsten Kuß aber erhielten Vater und Mutter zum Dank für die schönen Geschenke.
»Vielleicht lernt sie noch laufen und sprechen,« neckte der Vater.
»Oder Knecht Ruprecht hat sich geirrt und die lebendige Puppe irgendwo anders abgegeben, am Ende tauscht er sie noch um,« scherzte auch die Mutter.
»Eine lebendige Puppe – ha, ha, ha! – ist die Erika noch dämlich!« Bruder Fritz lachte das Schwesterchen weidlich aus.
Wenn es nicht Heiligabend gewesen wäre, hätte es ganz sicher eine Schlacht gegeben, aber der Weihnachtsabend lächelt selbst in die rauflustigsten Kinderherzen seinen Frieden hinein.
Man hatte auch heute wirklich anderes zu tun. Hilde probierte so lange den Holländerbogen auf ihren neuen Schlittschuhen, bis sie auf der Nase lag und Mutter wegen der blessierten Nase und des blessierten Teppichs Einspruch erhob. Fritz, die Leseratte, hatte sich beide Zeigefinger in die Ohren gestopft und ein großes Stück Marzipan in den Mund; so las er in seinen neuen Büchern. Erika aber überlegte. Es war eine sehr schwierige Überlegung, nämlich die, wie ihr neues Kind heißen sollte. Kein Name schien ihr schön genug.
Nun waren auch die Weihnachtsgedichte hergesagt, die Handarbeiten für die Eltern überreicht und die Christbaumlichte heruntergebrannt.
Voll Hausfrauenstolz trug Erika ihr neues Kind in den schön aufgeräumten Puppenwinkel. Und dann lag sie müde von aller Aufregung in ihrem Bette. Aber sie konnte trotzdem nicht schlafen. Der Name ihrer Puppe machte ihr große Sorge und Kopfzerbrechen. Als sie endlich einschlief, hieß das neue Kind »Maria«, und als sie am andern Morgen aufwachte, war eine »Magdalena« daraus geworden.
Und dabei blieb's.
Am ersten Feiertag ward Puppe Magdalenchen getauft. Zu Ehren der Taufe wurden die neue Kochmaschine und das neue Service eingeweiht. Mutter half auch, denn allein war ihr die Spiritusmaschine doch ein wenig zu gefährlich. Die große Hilde verschmähte es durchaus nicht, mitzuspielen – sie machte unter Mutters Aufsicht Eierkuchen, während Erika Apfelsuppe und Nußpudding fabrizierte. Sogar der Herr Quartaner geruhte, sich zu beteiligen, freilich nur am Vertilgen des leckeren Taufessens. Es war ein wunderschöner Feiertag, und herrliche Ferientage folgten.
Mit klingendem Frost nahm das alte Jahr seinen Abschied. Jeden Tag wurden die neuen Schlittschuhe auf den mit eisfunkelnder Kristalldecke überzogenen Wiesen angeschnallt. Von Tag zu Tag fiel Hilde bei ihren Holländerbogen weniger auf die Nase, und von Tag zu Tag wuchs Erika ihr neues Kind Magdalenchen mehr ans Herz. Es ging ihr damit, wie es auch mancher Mutter geht, man hat sein Kind trotz aller Schwächen lieb.