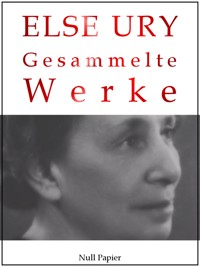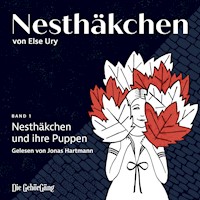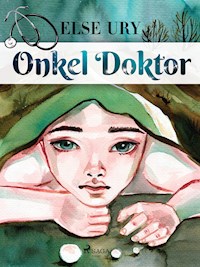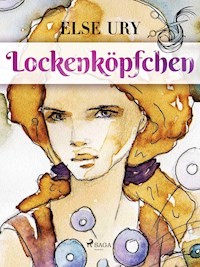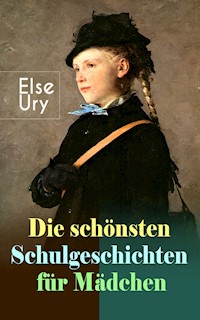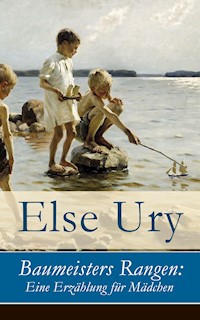Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Lillis Weg ist der Fortsetzungsroman zu Lilli Liliput. Einige Jahre sind seit dem ersten Band vergangen, der erste Weltkrieg ist vorbei und Lilli und ihre Schulfreundin Ilse haben eine Ausbildung im Lettehaus, der Berufsfachschule für Frauen in Berlin, beendet. Viel lieber wollte Lilli aber aufs Gymnasium gehen und studieren. Erfahre mehr über Lillis Vernunftentscheidungen und das Schicksal Lillis und vieler anderer Frauen dieser Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Else Ury
Lillis Weg
Saga
Lillis Weg
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1925, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726883756
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Erstes Kapitel
Abgang vom Lettehaus
Durch den großen Hörsaal des Berliner Lettehauses erklang die Abschiedsrede der Vorsteherin. Einige hundert junge Damen zwischen siebzehn und zwanzig Jahren, blonde und brünette, kindlich schlanke und schon voller entwickelte, hielten die Köpfe lauschend dem Rednerpult zugewandt.
»So vereinige ich Sie denn heute zum letztenmal in diesem Hause, meine lieben Schülerinnen.« Die Sprecherin erhob ihre klangvolle Stimme. »Ich darf wohl der Genugtuung Ausdruck geben, daß wir nicht umsonst miteinander gearbeitet und gestrebt haben, sondern daß jede von Ihnen wohlausgerüstet mit dem heutigen Tage ins Leben und in den erwählten Beruf tritt. Sei es auf hauswirtschaftlichem Gebiete, sei es kaufmännisch, kunstgewerblich oder fachwissenschaftlich, Sie werden bemüht sein, auf den Grundsteinen, die unser Letteverein für Ihr Lebenswerk gelegt hat, weiterzubauen und unserer Anstalt stets Ehre zu machen. Nie war die Zeit geeigneter, Kräfte zu entfalten und Können zu beweisen als augenblicklich. Unser Vaterland braucht die Arbeit der Frau. Es ist mir gelungen, Ihnen allen Stellungen nachzuweisen, die Sie, wie ich hoffe, mit ernstem Pflichtbewußtsein antreten werden und durch die Sie volle Befriedigung finden mögen. Das sind meine warmen Wünsche für Sie am heutigen Entlassungstage. Zeigen Sie sich der großen Aufgabe würdig, deutscher Frauenarbeit vollste Anerkennung erringen zu helfen. Leben Sie wohl, meine lieben Schülerinnen – Gott mit Ihnen!«
Die Vorsteherin trat von dem Rednerpult herab und streckte in liebenswürdiger Weise den sich um sie scharenden jungen Damen beide Hände zum Abschied entgegen: »Leben Sie wohl – lassen Sie es sich gut gehen! Viel Glück zu dem photographischen Atelier, das Sie eröffnen wollen, Fräulein Engelhardt –. Die hauswirtschaftliche Tätigkeit auf der Domäne wird Ihnen gut tun, Fräulein Blaßschnabel –. Hat Sie der Professor am physiologischen Institut für Mikroskopie angestellt, ja? Das freut mich. – Den Saldo nicht vergessen vorzutragen, Fräulein Lehmann; Ihr Bankchef wird nicht so nachsichtig sein wie Ihre langmütige Vorsteherin hier –« scherzhaft drohte sie einem jungen Mädchen. »Ach, die beiden Intima – Fräulein Gerhard, ich denke, Sie werden im Röntgenlaboratorium eine nutzbringende Tätigkeit finden, und Sie, Fräulein Steffen, sind von morgen an würdige städtische Beamtin! Nur die Gedanken fest am Bändel halten, daß sie Ihnen nicht in unbekannte Weiten entwischen, dann werden Sie überall Ihren Platz ausfüllen, wo immer das Schicksal Ihnen denselben auch anweist! Leben Sie wohl und viel Glück!« Für jede der abgehenden Letteschülerinnen hatte die beliebte Vorsteherin noch ein aufmunterndes Wort, einen warmen Händedruck.
Die beiden zuletzt Angeredeten, von der Vorsteherin als »Intima« Bezeichneten, traten auch als letzte Arm in Arm aus dem großen Hauseingang des Lettehauses auf den Viktoria-Luise-Platz hinaus.
»Weißt du noch, Ilse, mit welchen Gefühlen wir hier zum erstenmal hineingingen?« Die Kleinere wandte den goldblonden Kopf, auf den das dunkle Mützchen unternehmungslustig gestülpt war, nachdenklich nach dem stattlichen Bau zurück. »Ziemlich märtyrerhaft kam ich mir vor, daß ich die kaufmännische Laufbahn einschlug, anstatt aufs Gymnasium zu gehen und zu studieren. Und ganz im geheimen dachte ich wohl, das bleibt dir ja noch, wenn Vater nur erst wieder gesund ist. Und nun? In meinem armen Kopf ist das ganze schwere Geschütz: Schreibmaschine, Stenographie und doppelte Buchführung angriffsbereit aufgefahren gegen alle dummen, überflüssigen Gedanken, die nicht in das Hirn einer ›würdigen städtischen Beamtin‹ gehören.«
Die schelmischen Braunaugen lachten zu den trübseligen Worten der jungen Sprecherin in seltsamem Gegensatz.
»Ja, Lilli, ich hab's damals auch nicht gedacht, daß mein Vater, wenn ich den Röntgenkursus erst beendigt habe, noch immer im Petersburger Gefangenlager interniert sein würde. Zuerst hatte ich nach dem Friedensschluß mit Rußland von Woche zu Woche gehofft, daß man ihn als harmlose Zivilperson doch endlich freilassen müßte. Aber allmählich erlahmt einem die Hoffnung – wenigstens wenn es nicht gerade gilt, meiner Mutter gut zuzusprechen.«
Ilse Gerhard, ein schlankes, braunhaariges Mädchen mit feingeschnittenem, blassem Gesicht, seufzte leise.
»Hast recht, mein Ilsenkind, ich bin eine ganz undankbare Kreatur, der es noch viel zu gut geht. Als ob nicht jeder jetzt in der schweren Zeit seine Wünsche dem eisernen Muß der Notwendigkeit unterzuordnen hätte. Wenn der kaufmännische Kram nur nicht so ledern und mopsig wäre! Die dicken Kassabücher und Folianten, die kommen mir vor wie boshafte Unholde, die mich einschläfern und dann meinen falschen Ausrechnungen Schande bringen. Die stenographischen Hieroglyphen sind sicher leichtbeschwingte Zaubervögel, deren rasend schnellem Flug ich armes Menschenkind nicht folgen kann. Und nun erst die Schreibmaschine! Die beherbergt ein ganzes Reich von kleinen Klopfgeistern, die dem Menschen gehorchen müssen, nach seinem Willen auf und nieder springen, und die ihn doch nur zu oft foppen und narren. Unter seinen Fingern verwandeln sie sich heimtückisch in einen falschen Buchstaben. Da wird, ehe man sich's versieht, aus Rosen Hosen, und statt Liebe setzt's Hiebe. Und während man wütend zum Radiergummi greift, hört man ganz deutlich, wie die Schelme schadenfroh knistern und kichern zwischen den Klöpfeln.« Lilli Steffens rosiges Gesichtchen lachte nicht weniger schelmisch.
Die beinahe um einen Kopf größere Freundin mußte in das helle, herzenswarme Lachen mit einstimmen. So war es schon von kleinauf gewesen. Lillis hellklingendes Lachen wirkte auch auf den mürrischsten Griesgram ansteckend. Und das war die Ilse Gerhard durchaus nicht mit ihren neunzehn Jahren. Im Gegenteil, sie lachte nur zu gern und war glücklich, wenn sie mit Lilli recht von Herzen vergnügt sein konnte.
Nun standen beide an der Haltestelle und warteten auf die elektrische Bahn, die sie täglich zum Wannseebahnhof zu benutzen pflegten. Aber natürlich kamen zunächst alle anderen Linien, nur nicht die gewünschte.
»Lilli, eigentlich paßt du zur würdigen städtischen Beamtin wie die Lerche zum Droschkenpferd. Dichterin hättest Du mit deiner Phantasie werden sollen, Schriftstellerin! Haben wir dich in unseren Backfischkränzchen vor Jahren nicht schon ›Märchenkobold‹ genannt? Du hast deinen eigentlichen Beruf verfehlt.«
»Das fürchte ich selbst, Ilse.« Das lustige, rosige Mädchengesicht wurde ernst. »Eigentlich habe ich ja nie etwas anderes gedacht und ersehnt, als Schriftstellerin zu werden. Als ich aus der Schule kam und mich für irgend einen Beruf entscheiden sollte, da sagte ich ohne Überlegung: ›Schriftstellerin will ich werden!‹ Aber Muttchen hat mich ausgelacht: ›Ein Talent läßt sich nicht erlernen. Und ich weiß nicht, ob das deinige ausreicht, um darauf deine Zukunft zu begründen,‹ meinte sie. Und dann setzte sie mir noch liebevoll auseinander, daß ich kein vermögendes Mädchen sei, das abwarten kann, ob sich sein Talent vielleicht nach Jahren Bahn bricht und Anerkennung findet. Ich müßte daran denken, sobald als möglich auf eigenen Füßen zu stehen. Das habe ich natürlich eingesehen, weiß ich doch, wie Muttchen sich quält, um ihre ewig hungrigen Drei jetzt während der schweren Zeit satt zu machen. Ja, wenn Vater gesund wäre! Aber seitdem er damals den Lungenschuß bekommen hat und seine Tätigkeit als Oberlehrer fürs erste nicht ausüben darf, müssen wir Jungen einspringen. Da müssen alle unvernünftigen Wünsche schweigen.« Kein Zug von Enttäuschung zeigte sich in dem offenen Mädchengesicht. Nur zuversichtliche Genugtuung, der Mutter die Sorge ums tägliche Brot bald erleichtern zu können.
»Werdet ihr euren Vater nicht mal im Sanatorium besuchen? Der Schwarzwald ist gar nicht so weit. Ach, wenn ich den meinen doch in erreichbarer Nähe hätte! Wie wollte ich zu ihm eilen.«
»Mein Herz, du kannst dir in deinem Wohlleben gar keine Vorstellung davon machen, wie wir jetzt jeden Pfennig dreimal umdrehen müssen, ehe wir ihn ausgeben. Muttchen spart, soviel sie nur kann, um die Reise zu Vater zu ermöglichen. Aber dann kommt plötzlich eine unvorhergesehene Ausgabe – Stiefelsohlen oder derartiges – und heidi – sind die Spargroschen wieder dahin. Ludwig hat vom Stundengeben auch schon ein erkleckliches Sümmchen zusammen, und wenn ich mein erstes Gehalt als städtische Beamtin dazufüge, dann hoffe ich, daß Muttchen endlich ihrem Herzen folgen und auf ein paar Tage zu Vater fahren kann.«
Ilse antwortete nicht gleich. Sie war in einem reichen Haushalt groß geworden und konnte sich nicht so schnell darein finden, daß für eine so wichtige Sache kein Geld vorhanden sein sollte. Eigentlich waren Steffens doch wirklich zu bedauern. Und doch, was für einen zufriedenen, heiteren Eindruck machte Lilli und ebenso ihre ganze, liebe Familie. Auch jetzt blickten ihre braunen Augen hell und zuversichtlich. »Es geht Vater viel besser,« berichtete sie glücklich. »Die Temperaturerhöhungen sind seltener geworden. Ja, neulich hat er zum erstenmal wieder eine wissenschaftliche Arbeit vorgenommen. Es wird schon noch alles gut werden!«
Als endlich der Wagen der elektrischen Bahn herankam, war er schon überfüllt. Weder bei der Wagenführerin vorn noch bei der Schaffnerin auf der hinteren Plattform wollte sich ein Plätzchen für die beiden Freundinnen finden. Es entwickelte sich sogar ein lebhafter Wortwechsel zwischen einem beleibten Herrn, der sich noch durchaus hineinquetschen wollte, und der Schaffnerin, die ihn vergebens daran zu verhindern suchte, wobei letztere den kürzeren zog.
»Die Ärmsten sind auch nicht zu beneiden,« meinte Lilli, empört über die Rücksichtslosigkeit des Fahrgastes. »Nicht nur, daß sie in Wind und Wetter anstatt ihrer noch nicht heimgekehrten Männer bis in die Nacht hinein ungewohnten Dienst tun müssen, während ihre Gedanken gewiß oftmals bei den Kindern daheim sind, leistet das Publikum ihren Anordnungen häufig nicht Folge, weil man sie nicht für voll ansieht. Gerade ihnen sollte man ihr schweres Amt doch erleichtern.«
»Ja, unser Fräulein Doktor hat recht, jede von uns muß dazu beitragen, der Frauenarbeit allgemeine Anerkennung zu erringen,« stimmte Ilse ihr bei. »Aber was machen wir nun, Lilli? Die Bahn ist weg.«
»So geht's auf Schusters Rappen hinterdrein,« sagte Lilli, »trotzdem es eigentlich leichtsinnig ist, seine Stiefelsohlen so sehr abzunützen. Es ist ja schönes Wetter.«
»Schönes Wetter nennst du das? Na, ich danke! Es fängt doch schon wieder an zu regnen und sogar zu schneien,« stellte Ilse fest.
»Ja, wirklich,« verwunderte sich Lilli. »Eben hat doch noch die Sonne geschienen. Der April scheint sich um einen Tag geirrt zu haben, wir schreiben doch heute erst den einunddreißigsten März.«
»Den Wannseezug erreichen wir nicht mehr, wir müssen den Potsdamer Zug nehmen. Ach! das letzte Mal, daß wir heute zusammen fahren, Lilli!« Ilses graue Augen blickten zärtlich in das liebreizende Gesicht der Freundin.
»Ja, leider waren die Erbauer der Berliner städtischen Sparkasse, welche die Ehre hat, mich von morgen an zu ihren Beamten zu zählen, und das Röntgenlaboratorium in Charlottenburg, das du beglücken wirst, nicht einsichtsvoll genug, die beiden Gebäude in unmittelbarer Nähe zu errichten. Über fünf Jahre sind wir nun täglich zusammen von Schlachtensee nach Berlin hereingefahren und mittags wieder zurück. Das wird uns fehlen, Ilse, aber – das Opfer müssen wir schon bringen; es gibt heutzutage größere.«
»Das weiß der liebe Himmel,« dabei dachte die schlanke Braunhaarige sehnsüchtig an den Vater in russischer Gefangenschaft.
Die feinfühlende Lilli war ihren Gedanken gefolgt.
»Habt ihr mal wieder Nachricht über Schweden gehabt – nein? Auch nicht von Sonja Pietrowicz? Es ist doch ein großes Glück, Ilse, daß gerade unsere ehemalige Pensionärin Sonja, mit der wir so befreundet waren, und ihre Mutter in derselben Stadt wohnten, in der dein Vater gefangengenommen wurde. Frau Doktor Pietrowicz hat ihm doch manche Annehmlichkeit und Bevorzugung dort verschaffen können, wenn auch ihre Bürgschaft nicht genügte, um ihn in Freiheit zu setzen.«
»Ohne die Bürgschaft der in Petersburg einflußreichen Ärztin wäre Papa sicherlich in ein Gefangenlager der gefürchteten russischen Sumpfniederungen gewandert. Wenn sie ihn nicht sogar auf den bloßen Spionageverdacht hin erschossen hätten.«
»Also, siehst du, Ilse, wieviel Grund du noch hast, dankbar zu sein.« Lilli drückte zärtlich den Arm der starr vor sich Hinblickenden. »Eigentlich bist du sogar besser daran als ich. Wenigstens weißt du deinen Vater gesund in dem Gefangenlager. Und nun wird er sicherlich auch bald zurückkehren. Paß auf, Ilschen, eines schönen Tages ist er da.«
»Du verstehst es, Lillichen, auch an dem Schlechtesten noch etwas Gutes herauszufinden. Wenn ich dich nicht die Zeit über gehabt hätte! Du wirst dich auch sicher in deinem neuen Beruf wohl fühlen und trotz aller Trockenheit ihm die angenehmste Seite abgewinnen,« meinte Ilse. »Während mir eigentlich ein bißchen bange ist, wenn ich an morgen und die neuen Pflichten, die mich im Röntgenlaboratorium erwarten, denke.«
»Bange – ne, nicht die Spur! Die Vorgesetzten und die Kolleginnen werden schon nett sein und sich freuen, in uns beiden eine so tüchtige Kraft zu finden – haben ja auch allen Grund dazu!« Lilli machte dabei ein so drolliges Gesicht, daß Ilses Heiterkeit wieder erwachte.
»Wenn du bei mir wärst, Lilli, würde ich viel zuversichtlicher meinen neuen Wirkungskreis antreten. Schade, daß du dich nicht auch mit dem Röntgen-X befaßt hast. Die Tätigkeit würde dir eigentlich viel besser liegen als kaufmännische Buchführung. Es ist doch immerhin etwas Wissenschaftliches.«
»Und an das fürstliche Einkommen, das ich als städtische Beamtin beziehen werde, denkst du gar nicht? Ja, nicht einmal an die Pension, die ich Glückliche später mal in grauen Locken zugebilligt bekomme? Ach, Ilse, habe ich lachen müssen, als Muttchen mir ganz im Ernst riet, die Stelle bei der Stadt einer anderen bequemer gelegenen vorzuziehen, weil ich dadurch pensionsberechtigt werde. Als ob man sich mit neunzehn Jahren schon darum kümmerte, was mal sein wird, wenn man erst neunzig ist!« Lilli lachte wie ein Kobold.
Mit der lebhaften Unterhaltung hatte die Gangart der beiden jungen Damen nicht Schritt gehalten, sondern sich im Gegensatz dazu erheblich verlangsamt. Jetzt warf Lilli einen erschreckten Blick auf ihr ledernes Uhrenarmband.
»Du, Ilse, wenn wir uns nicht sehr heranhalten, ist der Potsdamer Zug auch über alle Berge. Das Zuspätkommen um einen Zug kann ich wohl vor Muttchen verantworten, da es ja heute doch das letzte Mal ist! Aber für zwei Züge wird sie kein Verständnis haben, fürchte ich.« Trotz ihrer Jungendamenwürde setzte sich Lilli in Trab und jagte der Freundin voran, die regennasse, zum Wannseebahnhof führende Straße hinauf.
Manch erstaunter und bewundernder Blick folgte der leichtfüßig wie ein Elfchen Dahinfliegenden. Lilli gab jedoch darauf nicht acht. Sie bemerkte nicht einmal, daß ihre Freundin Ilse trotz ihrer längeren Beine kaum hinterher kam.
Nein, wie selbstsüchtig von ihr, daß sie sich nicht mehr nach Haus beeilt hatte! Sie nahm der Mutter, die gerade genug in Anspruch genommen war, gern noch die letzten Handreichungen bei der Fertigstellung des Essens ab. Margot, das jüngere Schwesterchen, mußte zur Klavierstunde, und Ludwig, ihr Zwillingsbruder, hatte täglich von drei Uhr ab Nachhilfeunterricht zu erteilen. Immer schneller lief die junge Dame, während sich auch die Gedanken in ihrem Kopf jagten.
Gerade als Lilli im Schnelläufertempo den Bahnsteig erreichte, pfiff der Potsdamer Zug zum Abgehen.
»Halt – halt!« schrie die Atemlose dem berußten Lokomotivführer zu, der eben seine Maschine in Bewegung setzen wollte.
Und das Wunder geschah – die Bahn, an peinlichste Pünktlichkeit gewöhnt, säumte noch eine Viertelminute auf den Zuruf eines zierlichen kleinen Persönchens. Drin war sie!
»Ilse – Ilse –« Vergeblich drehte sie den zerzausten Blondkopf nach allen Seiten aus dem Fenster. Jetzt erst bemerkte Lilli, daß die Freundin nicht Schritt gehalten und zurückgeblieben war. Was nun? Sollte sie wieder herausspringen? Nein, der Zug bewegte sich schon. Gerade noch Ilses blauen Hut sah Lilli über der Treppe auftauchen, dann entführte sie das fauchende Ungeheuer der ihr mit verdutzten Augen nachschauenden Freundin. Zum erstenmal in all den Jahren fuhren die beiden getrennt heim – heute, da es das letzte Mal war.
Zweites Kapitel
Lillis Zuhause
Lilli war über diese Tücke des Schicksals mit Recht aufgebracht. Was hatte man noch alles besprechen und überlegen wollen. Ilse Gerhard wohnte in dem Berliner Villenvorort Wannsee, während Lilli Steffen in dem etwa eine halbe Stunde davon entfernten Schlachtensee daheim war. Nicht einmal eine Verabredung hatten sie für die nächsten Tage getroffen. Wußte Ilse doch noch nicht, wie ihre Arbeitstunden im Röntgenlaboratorium liegen würden.
Aber lange hielt »schlecht Wetter« auf Lillis Stimmungsbarometer niemals an. Noch ehe draußen die ersten schüchternen Sonnenstrahlen sich durch das noch kahle, regenbetropfte Gezweig stahlen, blickten Lillis Braunaugen schon wieder froh und strahlend in die Welt.
Wenn man neunzehn Jahr alt ist und vor einem neuen, unbekannten Land steht, in das man den Fuß setzen will, dann schaut einem alles hoffnungsgrün und sonnenhell entgegen. Ja, selbst die geschmähten dicken Folianten mit Lederrücken vermochten keinen Schatten auf Lillis freudige Zuversicht zu werfen.
Wie sie in der Schule und später im Lettehause stets eine der Besten gewesen, so würde sie sich auch in dem neuen Wirkungskreis hineinfinden und zur Zufriedenheit die ihr aufgetragenen Pflichten erledigen. Nur ihre Gedanken, die leichtbeschwingten, mußte sie energisch bewachen, daß ihr keiner auf phantastischen Ausflügen entschlüpfte. Die Vorsteherin des Lettehauses hatte recht. Derartige Ausreißer hatten nichts mit dem nüchternen Soll und Haben zu tun.
Ja, wenn sie wenigstens ihr Abiturientenexamen hätte machen und studieren können, wie sie es gern gewollt, nachdem es mit der Schriftstellerei nun einmal nichts werden sollte. Das Studium hätte sicherlich ihre Gedanken vollständig gefesselt.
Und dennoch – Lilli lächelte still vor sich hin – sie bereute es nicht, daß sie darauf verzichtet hatte. Mutter selbst hatte ihr zugeredet, das Mädchengymnasium zu besuchen. »Bist ja Kapitalistin, Mädel,« hatte sie scherzend gemeint. »Eine bessere Verwendung deiner tausend Mark gibt's nicht, als daß du dafür etwas Tüchtiges lernst und deine Zukunft darauf aufbaust.«
In der Tat, seit einigen Jahren besaß Lilli die riesige Summe von tausend Mark, ja, sie hatte sich dieselbe in höchst eigener Person verdient. An einem Märchenpreisausschreiben hatte sie sich als Backfisch zu beteiligen gewagt und – o Glück! – den ersten Preis davongetragen. Das war ja auch der Grund, daß sie durchaus Schriftstellerin werden wollte. Sie ahnte noch nicht, daß nicht nur Rosen an diesem Wege wuchsen, sondern auch Dornengestrüpp Hoffnung und Zuversicht gar oft wund ritzen. Aber die erfahrungsreife Mutter kannte das Leben besser. Sie wollte ihr Kind vor Enttäuschungen, die nicht ausbleiben würden, bewahren und hatte Lilli den Rat gegeben, das Geld zum Studium zu verwenden.
»Und Ludwig« – Lilli wußte es noch wie heute – »was wird aus Ludwig, Muttchen?« so hatte sie gefragt.
»Ja, Herzchen,« zögernd war Mutters Antwort gekommen. »Wenn unser Vater noch länger fern von uns weilen muß, wird Ludwig von der Unterprima abgehen und irgendwo als Kaufmannslehrling eintreten müssen. Wir leben in bescheidenen Verhältnissen, das weißt du. Den Notgroschen, den Vater in unermüdlicher Arbeit zurückgelegt hat, dürfen wir trotz der schweren Zeiten nicht angreifen. Es können noch schwerere kommen. Möglich ist es ja, daß man unserem Ludwig als fleißigen Schüler ein Stipendium zum Studium bewilligt, daß er mit Unterrichtstunden das Fehlende hinzuverdienen könnte. Aber denke mal, Lilli – du bist doch meine Große, Verständige – wie lange das währen würde, bis ihr beide dann auf eigenen Füßen ständet. Meinst du nicht auch, daß es richtiger ist, wenn wenigstens eins von euch uns die schweren Zeiten ein wenig erleichtern hilft?«
»Ja, Muttchen, du hast recht, wir können nicht alle beide studieren. Aber Ludwig, der bereits in der Prima ist und so darauf brennt, Ingenieur zu werden, darf nicht verzichten. Von meinen tausend Mark soll er studieren, wir sind Zwillinge, da gehört einem das Geld so gut wie dem anderen. Nur erfahren darf er's nicht, nein, Muttchen, das versprichst du mir? Dann nimmt er's nicht von mir an; du kennst ihn doch.« Nicht einen Augenblick hatte Lilli überlegt. Und die Mutter hatte ihr opferfreudiges Mädchen zärtlich ans Herz geschlossen.
Lilli aber hatte im Lettehaus kaufmännische Buchführung gelernt, glücklich und befriedigt in dem Gedanken, dem geliebten Zwillingsbruder das Studium ermöglichen zu helfen.
Während Lillis Gedanken so rückwärts flogen, eilte der Eisenbahnzug unablässig vorwärts. Schon war der Schlachtenseer Bahnhof erreicht.
Der Weg bis zur Kirschallee, in der Steffens wohnten, war nicht weit. Wie früher als Schulmädel sprang die junge Dame ihn hinunter, um die Zeitversäumnis möglichst wieder gutzumachen. Und wie dereinst, als sie ein Schulmädel gewesen, baumelten ihr im kühnen Schwunge die prachtvollen Blondzöpfe über den Rücken. Der Frühlingssturm, der sich draußen im Freien noch mehr austoben konnte als zwischen den hohen Häusern Berlins, sah nicht ein, warum man solch eine goldene Pracht unter der dunklen Pelzmütze verstecken sollte. Tüchtig zauste er seine junge Freundin, mit der er früher manch liebes Mal um die Wette gejagt war.
Es war ein schönes, trauliches Heim, dem Lilli zueilte. Mitten zwischen Gärten stand das weiße Häuschen, das die Familie des Oberlehrers Doktor Steffen bewohnte. Ein bescheidenes Häuslein war es nur, aus Erdgeschoß und einem Giebelstockwerk bestehend. Aber seinen Bewohnern dünkte es der schönste Besitz, den je ein Glücklicher sein genannt. Ein eigen Haus und Heim – darin lag wohl der größte Zauber, den das anspruchslose Häuschen sowohl auf die Eltern als auch auf die Kinder ausübte. Von seinen sauer verdienten Spargroschen hatte der Vater es erstanden, damals als Grund und Boden draußen noch wohlfeil zu haben waren. Stolz hatte er dann sein junges Weib zur Rosenzeit heimgeführt, und Frau Mieze kam sich wie eine Königin in ihrem neuen Reich vor. Glücklicher und zufriedener konnte jedenfalls auch keine Königin sein, als es Frau Doktor Steffen all die Jahre hindurch trotz Werktagsarbeit und nicht ausbleibender Sorgen hier gewesen. Für den Oberlehrer bildete der Garten mit seiner Rosenkultur und dem selbstgezogenen Edelobst die schönste Erholung nach anstrengender Berufsarbeit. In solcher harmonisch zufriedenen Atmosphäre waren die drei Kinder aufgewachsen, und der Abglanz des häuslichen Glücks schaute ihnen aus den jungen Augen, offenbarte sich in der warmen, herzfrohen Art der Drei, trotz ihrer Verschiedenheit.
Noch stand der Garten kahl, das Rosenrondell hinter dem weißen, von Ludwig eigenhändig angestrichenen Staketzaun hatte noch die papierenen Schlafmützen gegen den Winterfrost über die Ohren gestülpt. Auch der kleine, steinerne Gnom war noch nicht in seine Sommerwohnung, ins Vorgärtchen, übergesiedelt, sondern schnarchte noch hinten im Borkenhäuschen frühlingswärmeren Tagen entgegen. Aber die Linden, Akazien und Rotdorn hatten sich bereits mit ihrem Perlengeschmeide geschmückt. Winzige, kleine Perlchen, die allerersten Vorboten des kommenden Lenzschmuckes, hatten sich seit gestern, noch kaum sichtbar, hervorgewagt. Lillis Blick erspähte sie doch. Liebevoll glitt er an den Zweigen entlang. Und »der Flieder schlägt ja schon die Augen auf!« mit diesem Jubelruf betrat sie das weiße Häuschen.
Dort saß man noch in dem mit einfacher Gemütlichkeit ausgestatteten Parterrezimmer um den Mittagstisch.
»Du meinst wohl, der Flieder setzt Augen an, Lilli!« verbesserte der junge Student seine poetische Zwillingsschwester mit nüchterner Sachlichkeit.
»Lillichen, ich habe null Fehler im französischen Extemporale, zu dem du mit mir gelernt hast,« schrie ihr das Nesthäkchen Margot freudestrahlend entgegen.
Schnauzel, der bejahrte Teckel, ließ seinen Futternapf, den er jetzt bei der knappen Zeit einer mehrfachen Reinigung zu unterziehen pflegte, im Stich und gab durch ein kurzes, wohlwollendes Bellen seiner Freude Ausdruck, daß die Familie bis auf den Vater nun wieder vollzählig war.
Nur die Mutter sprach nicht. Umso sprechender aber gingen ihre klaren braunen Augen zu dem mit gelöstem Haar und schiefgerutschtem Hut erscheinenden Fräulein Tochter.
»Guten Tag, Muttchen, Tag, Kinder –« Lilli fiel es jetzt erst ein, daß sie über die ersten Frühlingsgrüße selbst den Gruß vergessen hatte. »Sei nicht böse, Muttchen, daß ich zu spät komme, die Elektrische war überfüllt und – –«
»Und du mußtest noch ausgiebigen Abschied von Ilse Gerhard nehmen, nicht wahr?« unterbrach sie die Mutter halb im Scherz, halb ernsthaft.
»Nun, gar keinen Abschied konnten wir voneinander nehmen, solche Bosheit! Nicht einmal zusammen nach Hause gefahren sind wir heute zum letzten Mal,« verteidigte sich Lilli eifrig.
»I der Tausend, und da ist der Zug überhaupt abgelassen worden?« zog der lange Zwillingsbruder das bei weitem kleinere Schwesterchen auf. Er kam bereits aus der Küche und stellte, die Serviette wie ein Kellner unter dem Arm, den dampfenden Teller Kohlrüben auf den Platz der Schwester.
»Gnädiges Fräulein, das Mittagsmahl ist angerichtet,« meldete er untertänigst.
»Danke, mein guter Junge, ich hätte mich ja auch allein bedienen können. Aber jetzt muß ich mich erst ganz schnell menschlich machen, ehe ich mich zu Tisch setze. Von unserem Lettehausabgang erzähle ich euch nachher.« Damit sprang Lilli die Treppe zu ihrem Zimmer empor.
Ein Mansardenstübchen war es, hell und freundlich. Schneeweiße Mullgardinen an den Fenstern, zwischen den Scheiben blühende Hyazinthen in Gläsern, die eine immer farbenfreudiger als die andere. Lilli hatte des Vaters glückliche Hand in der Blumenpflege geerbt. Auch auf dem Fensterbrett, dem kleinen, von Ludwig selbstgezimmerten Nähtischchen und der Blumenkrippe grünte und blühte es. Den »Wintergarten« nannten die Geschwister Lillis Stübchen, und so ganz unrecht hatten sie nicht mit ihrer scherzhaften Benennung. Die rankenden Schlinggewächse und Blumen gaben dem Zimmerchen selbst zur Winterszeit ein lenzfrohes Gepräge, und der in seinem Bauer in dem grünen Reich jubilierende »Goldschopf« vervollständigte diesen Eindruck.
Sonst gab's nicht viel Sehenswertes in dem kleinen Raum. Außer dem Bett, dem Waschtisch und Schrank noch Lillis »Schreibtisch«, der einst ganz andere Funktionen zu erfüllen gehabt hatte. Ein sogenannter »stummer Diener« war es. Ein altmodisches, zusammenklappbares Anrichtetischchen, das Großmama als junge Frau zu ihrer Einrichtung bekommen. Da das von Natur schon ziemlich wackelige Möbelstück im Laufe der Zeit noch wackeliger geworden, hatte die Großmama es außer Betrieb setzen und in die Rumpelkammer schaffen wollen. Aber Lilli, ihr erklärter Liebling, hatte dagegen Einspruch erhoben und sie gebeten, ihr doch den »stummen Diener« als Schreibtisch zu überlassen. Es gibt wohl wenige Großmütter, die ihren Enkeln einen Wunsch, wenn er nicht gerade allzu unvernünftig ist, abzuschlagen vermögen. Und Lilli konnte so leicht überhaupt keiner etwas versagen, wenn sie einen mit ihren lieben braunen Augen bittend ansah. So war der eigenartige Schreibtisch in das Mansardenstübchen gewandert. Ach, eigentlich hatte Lilli damals gehofft, ihrer lebhaften Phantasie daran freien Lauf lassen zu können, an jenem Schreibtisch eine berühmte Schriftstellerin zu werden. Ja, Bruder Ludwig, der sein poetisches Zwillingsschwesterchen trotz seiner abgöttischen Liebe gern ein wenig neckte, hatte sie heimlich »geknipst«. »Lilli Steffen an ihrem stummen Diener« stand unter dem Bildchen, das sie einige Tage darauf unter ihrer Serviette fand. »Für die ›Illustrierte‹ oder für die ›Woche‹, Lilli, wenn du erst eine berühmte Schriftstellerin bist; man kann nie früh genug dafür Sorge tragen,« neckte Ludwig. Und dann hatten sie alle beide von Herzen darüber gelacht. Lilli aber hatte schließlich doch ziemlich ernsthaft gemeint: »Wenn ich meinem stummen Diener erst die Sprache verleihe, wirst du mich nicht mehr anulken, Lulu. Laß nur, wer zuletzt lacht, lacht am besten!« Das Bildchen war statt in die Illustrierte in das Sanatorium zum Vater gewandert. Der stumme Diener aber hatte eine andere Sprache gelernt, als seine junge Herrin damals gemeint. Ein Stenographielehrbuch, Leitfaden für englische und französische Korrespondenz, kaufmännische Buchführung und Handelswissenschaft lagen jetzt auf dem Schreibtisch.
Etwas aber war der jungen Bewohnerin noch geblieben, wohin sich die trockene kaufmännische Gelehrsamkeit nicht wagte – ihr »Märchensofa«. Das große, alte, ziemlich mitgenommene Ledersofa, das noch eine Generation weiter zurückdenken konnte als der Schreibtisch. Auf ihm hatte das Zwillingspärchen Lilli und Lulu seine ersten Kletterversuche unternommen. Später hatte Lilli dann mit offenen Augen die merkwürdigsten Märchen in den Tiefen des alten Sofas geträumt und sie abends in der Schummerstunde ihrem Lulu dort erzählt. Jetzt war das Märchensofa zur Oase geworden in der trockenen Wüste einförmiger Buchführung. Das Eiland, auf das sie sich rettete, wenn die Flut von stenographischen Sigeln sie zu verschlingen drohte.
Augenblicklich hatte Lilli weder für ihren stummen Diener noch für ihr Märchensofa Interesse. Erschreckt blickte sie in den kleinen Spiegel, der ihr den zerzausten Blondkopf zeigte. Nein, wie schaute sie aus. Geschwind das Haar überbürstet, die Flechten frisch aufgesteckt und die Hände gewaschen. So – nun war ihre »Dinertoilette« beendet.
Mit gesundem Jugendappetit ging es dann an die Vertilgung des aufgetürmten Tellers Kohlrüben. Als Beilage dazu gab Lilli den Bericht von der Abschiedsfeier im Lettehaus zum besten. Margot mußte zu ihrem Leidwesen zur Klavierstunde, aber die gute Schwester vertröstete sie mit einer erneuten Auflage am Abend.
»So wäre dieser Abschnitt also auch beendet, mein Mädel,« meinte die Mutter gedankenvoll. »Nun bist du flügge und wagst den ersten selbständigen Flug in ein neues Leben hinein.«
»Flügge – unser Liliputchen? Nein, Mutter, das ›Kleine‹ müssen wir nach wie vor unter unsere Flügel nehmen, sonst findet es sich in dieser realen Welt nicht zurecht,« unterbrach sie der langaufgeschossene Bruder mit väterlicher Miene.
»Oho, mein Junge – Respekt – du siehst eine städtische Beamtin vor dir,« Lilli reckte ihre schlanke, junge Gestalt bis zur Schulter des Zwillingsbruders. »Beamtenbeleidigung wird schwer geahndet, das weißt du doch.«
»Kinder, hört mit euren Dummheiten auf,« unterbrach die Mutter, selbst belustigt, die Übermütigen. »Es gibt Wichtigeres zu überlegen, nämlich, wie wir dich künftig ausreichend ernähren werden, Lilli. Die Arbeitszeit von acht bis fünf Uhr in der Sparkasse liegt ja recht günstig. Da hast du den ganzen Abend noch für dich und uns frei. Nur die anderthalbstündige Tischzeit ist schwierig. Unmöglich, daß du den weiten Weg vom Zentrum Berlins bis hier herauskommen kannst. Ich werde dir dein Mittagessen bis zum Abend aufheben.«
»Lilli wird froh sein, wenn sie uns und unsere Kohlrübenplage mal für 'ne Weile los ist,« meinte Ludwig mit einem schiefen Blick auf den Teller der Schwester. »Na, Liliputchen, wirst du dich nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurücksehnen?«
»Vielleicht doch, Ludwig. Es ist doch immerhin was Warmes, und wir müssen zufrieden sein, daß wir wenigstens noch Kohl und Rüben zu erschwingbaren Preisen bekommen,« entgegnete Lilli ernsthaft.
»Mancher Arme würde gewiß recht gern solch sorgfältig gekochtes Gericht essen,« bedeutete auch die Mutter dem etwas wählerischen Herrn Sohn.
»Lilli, könntest du denn nicht über Mittag zur Großmama gehen? Die wohnt doch ziemlich in der Nähe der Sparkasse und nimmt dich gern auf,« lenkte Ludwig von dem ihm unbehaglich werdenden Gespräch schnell ab.
»Ich habe selbst daran zuallererst gedacht. Aber ich mag Großmama bei der heutigen Teuerung nicht auch noch zur Last fallen. Ihr wißt doch, wie schwer es ihr wird, sich mit all den Lebensmittelkarten abzufinden, so daß sie stets meint, ihr armer, alter Kopf hielte das gar nicht mehr aus. Sie lebt in einer ewigen Angst, sie könne ihr Mädchen nicht satt machen. Ein Glück, daß Onkel Martin und Tante Gretchen jetzt endlich Wohnung gefunden haben, und ihr Haushalt wieder verkleinert ist. Nein, Großmama mag ich keinesfalls eine neue Sorge aufbürden. Ich nehme mir ordentlich Stullen mit – und basta. Dabei werde ich schon nicht verhungern.« Mit diesen Worten trug Lilli ihren geleerten Teller in die Küche.
»Ordentlich Stullen – wie sollen wir da mit unserer Brotration auskommen? Und womit schmieren? Das Kind kann doch von morgens bis abends nicht von Marmelade leben?« wendete die Mutter seufzend mit gefurchter Stirne ein.
»Gib mir zwei Stullen weniger mit zur Technischen Hochschule, Mutter; ich bekomme doch Mittagbrot,« rief Ludwig ohne Besinnen. Er war doch ein Prachtjunge, wenn er auch keine Kohlrüben mochte!
»Jedenfalls koche ich dir morgens eine Suppe, mein Mädel, die du dir in einer Flasche mitnimmst, damit du den ganzen Tag über nicht nur auf Brot angewiesen bist,« entschied die Mutter, als Lilli mit ihrer Nachspeise wieder das Zimmer betrat.
»Eine Thermosflasche solltest du haben, Lilli, da bleibt die Suppe kochend heiß,« riet der praktische Bruder.
»Ja, wenn ich erst das viele Geld am nächsten Ersten einheimsen werde, wird sie angeschafft, bis dahin gibt's kalte Suppe.« Lachend stellte Lilli das Geschirr zusammen.
Die Tafel wurde aufgehoben. Frau Doktor Steffen mußte zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Nationalen Frauendienst; Ludwig zu seinen Schülern.
Lilli aber streifte ihre Ärmel auf, band die große Küchenschürze über und machte sich eifrig an das Aufwaschen des Geschirrs. Denn das Dienstmädchen hatte Frau Doktor Steffen entlassen, der Verbrauch mußte in jeder Weise eingeschränkt werden. Zu den gröbsten Hausarbeiten kam morgens eine Frau aus der Nachbarschaft.
Lilli schreckte vor keiner Tätigkeit zurück. Schon als winziges Dingelchen, als sie kaum mit der Nasenspitze an den Tisch reichte, hatte sie der tatkräftigen Mutter zu helfen versucht. Auch heute tummelte sie sich, so daß die Rosen auf ihren Wangen sich noch vertieften. Und während draußen der Regen, mit großen Eiskörnern untermischt, gegen das Fenster prasselte, schmetterte sie durch das stille Haus: »O wie wunderschön ist die Frühlingszeit – die Frühlingszeit.«
Drittes Kapitel
Städtische Beamtin
Ein grauer Morgen. Grau und schwer hingen die Wolken bis auf die Dächer der hohen Mietshäuser herab. Ein schleierfeiner Sprühregen ging hernieder. Man sah ihn nicht, man fühlte ihn nur zusammenfröstelnd. Alt-Berlin, das altersgraue, mit seinen schmalen verwitterten Häusern, tauchte im Osten der stolzen, neumodischen Geschäftspaläste schemenhaft auf.
Die Menschen, die zu dieser frühen Morgenstunde Straßen und Bahnen füllten, bemerkten nichts davon. Jeder hastete aus dem ungemütlichen Nebelgeriesel möglichst schnell ins Trockene, pünktlich an die Berufsarbeit zu kommen. Gähnend saßen sie in der elektrischen Bahn, studierten die neuesten Nachrichten oder starrten, noch mit offenen Augen schlafend, durch die wasserbeperlten Scheiben. Tägliche Gewohnheit, welche die meisten den Weg viermal am Tage zurücklegen ließ, hatte sie gegen ihre Umgebung abgestumpft.
Nur zwei hellbraune, junge Augen hielten voll lebhaftem Interesse Umschau. Da war die Spree mit ihren schwarzgrauen Wassern, dort standen uralte, baufällige Häuser an der Friedrichsgracht. Drüben Alt-Kölln, die Wiege der heutigen Riesenstadt. Nun wurde das graue Schloß, in seinen Umrissen kaum erkennbar, zwischen grauen Nebelfetzen sichtbar, und »Molkenmarcht« rief die Schaffnerin mit scharfer Stimme.
Erschreckt fuhr die Besitzerin der hellbraunen Augen zusammen und verließ schleunigst den Wagen. Beinahe wäre sie über ihr Ziel hinausgefahren. Einen Blick zu der heute kaum entzifferbaren Rathausuhr – noch fünf Minuten bis acht, dem festgesetzten Beginn ihrer neuen beruflichen Tätigkeit.
Lilli Steffen schlenderte langsam dem Mühlendamm zu, an dem die städtische Sparkasse gelegen war. Ein recht häßlicher Morgen, der ein neues Leben einleiten sollte. Alles so grau, farb- und freudlos, als wage die Hoffnungssonne sich nie wieder aus dem dunklen Gewölk hervor.
»Ach was, bange machen gilt nicht,« sagte Lilli mit der von der Mutter ererbten Entschlossenheit zu sich selbst, gab sich einen Ruck und betrat das weitgestreckte, aus gelblichen Backsteinen gefügte Gebäude der städtischen Sparkasse.
Trotz der frühen Stunde war es hier schon belebt. Fremde Menschen eilten eifrig an Lilli vorüber, Türen öffneten sich und schlossen sich. Beherzt schritt das junge Mädchen auf den Pförtner zu, der unberührt von dem Treiben um ihn her in seine Volkszeitung vertieft war.
Sie pochte an die kleine Glasscheibe, hinter der er thronte. Ärgerlich über die Störung, blickte der Gestrenge auf.
»Wollen Sie Geld einzahlen, dann linkerhand – steht groß und breit dran ...«
»Nein, ich – – –« begann Lilli.
»Also abheben – rechterhand – steht auch dran,« damit warf er sein Fensterchen wieder zu.
Verdutzt stand Lilli Steffen da. Sie wußte nicht, ob sie lachen oder sich ärgern sollte. Aber da ihre heitere Veranlagung meist den Ausschlag zu geben pflegte, vertieften sich die Grübchen in ihren Wangen, lustige Kobolde kicherten aus ihren Augen.
Wie würden sich die Geschwister daheim belustigen, wenn sie ihnen heute abend eine Schilderung von ihrem Eintritt in das neue Leben gab.
Dann wagte sie es noch einmal gegen das Fensterchen zu pochen.
»Was wollen Sie denn noch?« knurrte es von drinnen.
»Ich bin vom ersten April ab hier als städtische Beamtin eingestellt und möchte wissen, wo ich mich zu melden habe,« sagte Lilli großartig und reckte ihre zierliche Gestalt zu ehrfurchtgebietender Höhe.
»Warum sagen Se denn das nich jleich – Zimmer sechsunddreißig,« ihre Eröffnung schien dem Pförtner keinen rechten Eindruck gemacht zu haben.
Wo war nun Zimmer sechsunddreißig? Lilli fragte diesen, fragte jenen, meist einen, der ebensowenig Bescheid wußte wie sie selbst. Nachdem sie eine Treppe hinauf und eine hinunter gestiegen war, einen Gang rechts, einen links und einen geradeaus durchirrt hatte, stand sie endlich vor der gesuchten Türnummer.
Sie klopfte höflich. Aber da kein »Herein« sich hören ließ, wagte sie es, wenn auch zaghaft, die Tür zu öffnen.
Ihr Eintritt wurde gar nicht bemerkt. Einige ältere Herren saßen an ihren Schreibpulten und sahen nicht auf. Vor dem Holzgitter, das den Raum teilte, standen mehrere Frauen, blaß und ärmlich.
»Guten Morgen,« sagte Lilli mit ihrer hellen Stimme.
Federgekritzel war die einzige Antwort. Vergeblich wartete sie, daß man sie nach ihrem Begehr frage. Minute um Minute verstrich. Die von Haus aus an peinliche Pünktlichkeit gewöhnte Lilli beunruhigte es, daß sie ohne ihre Schuld ihr neues Amt zu spät antreten mußte. Sie faßte sich ein Herz.
»Verzeihung, ich bin von der städtischen Sparkasse zum ersten April engagiert worden. Bin ich hier an richtiger Stelle?« Es war nicht gut möglich, diese helltönende Mädchenstimme, die laut durch den stillen Raum klang, zu überhören. Dennoch schienen die Schreibenden nicht übel Lust dazu zu haben. Jeder meinte, der andere würde wohl antworten, während die bescheiden wartenden Frauen die junge Dame mit unverhohlener Verwunderung wegen ihrer Dreistigkeit anstarrten.
»Hm« – meinte schließlich einer. Dann fuhr er im Schreiben fort, wohl in der Annahme, sich nun genügend geäußert zu haben.
Der Zweite räusperte sich umständlich zu einer längeren Rede. Bevor er aber noch dazu kam, hatte der älteste von ihnen seine Brille, die er merkwürdigerweise beim Schreiben auf die Stirn geschoben, vor die Augen geführt und musterte die errötende Lilli kopfschüttelnd.
»Sie wollen als Kassenbotin hier eintreten?« fragte er zweifelnd.
»Als wa-as?« Lilli sah den Fragenden belustigt an und plötzlich lachte sie hell heraus. Mißbilligend hoben die beiden anderen Herren den Kopf ob solch einer ungehörigen Heiterkeit in diesen ernsthaften Büroräumen. Mißbilligend schienen selbst die nüchtern getünchten Wände, ja, die wenigen Möbel dreinzublicken.
»Ich bin vom Lettehaus empfohlen und für Korrespondenz, Stenographie und Schreibmaschine angestellt worden.« Das junge Mädchen bemühte sich vergeblich, seiner hier nicht hergehörenden Lustigkeit Herr zu werden.
Da begann es auch hinter den Brillengläsern zu zucken. Unzählige kleine Fältchen gruben sich in die pergamentfarbene Haut des älteren Herrn, und die Lippen ließen ein heiseres »Hä – hä – hä – hä – hä –« hören. Lillis silbernes Lachen bewährte sich selbst hier in diesem ernsten Arbeitsraum – es wirkte ansteckend.
»Na, denn gehen Sie mal nach Zimmer vier, gleich im Erdgeschoß, hier werden nur Kassenboten eingestellt,« meinte der Herr darauf schmunzelnd.
Lilli dankte und eilte zurück. Erschreckt stellte sie fest, daß die Uhr bereits viertel neun zeigte.
Zimmer vier war ein großer, weiter Raum. Längs der Fensterwand standen Doppelpulte, eins neben dem anderen wie Soldaten aufmarschiert. Vorwiegend Damen saßen eifrig schreibend daran.
Eine hölzerne Schranke trennte sie von dem Gesamtraum. Es war sehr voll in diesem Saal. Das Publikum stand in Reihen vor dem Holzgitter.
Lilli überflog mit einem Blick dies alles. Beherzt schritt sie dann an den Wartenden vorüber zu dem abgegrenzten Raum.
»Hinten anstellen!« erschallte es hier und da empört aus den Reihen hinter ihr her.
»Jawoll, das möcht' woll jeder, zuletzt kommen und zuerst dran sein!« rief eine Frau hämisch.
»Ich will ja nur etwas fragen,« wandte Lilli bescheiden ein.
»Das wollen wir alle bloß – hier jeht's nach de Reihe,« die große, vierschrötige Frau schien nicht übel Lust zu haben, das zierliche, junge Ding handgreiflich zurückzuschieben.
»Ruhe!« rief es vom ersten Pult in den Wortwechsel hinein, »wer soll denn bei dem Lärm rechnen?«
»Ja, aber vordrängen is nich,« beharrte die Schimpfende. »Da könnt ja 'n jeder kommen.«
Aufseufzend ließ die Dame am ersten Pult ihre Bücher im Stich, um für Ordnung zu sorgen. »Sie müssen sich der Reihe nach anstellen,« bedeutete sie Lilli kurz.
»Aber ich bin ja angestellt – – –«
»Is nich wahr,« schrie die Frau dazwischen, »sie is jleich vorjelaufen – – –«
»Ich bin von der Sparkasse hier als Buchhalterin angestellt.« Lilli war das Weinen trotz allen Humors jetzt doch näher als das Lachen.
»So-o?« Ein langer, prüfender Blick. »Na, dann melden Sie sich hier im Privatkontor!« Die hölzerne Schranke öffnete sich, und Lilli konnte aufatmend den geheiligten Boden ihrer künftigen Tätigkeit betreten. Hinter ihr her klang noch immer das Schelten der aufgebrachten Frau.
In dem Privatkontor brannten die Lampen hinter grünen Schirmen. Mehrere Schreibmaschinen rasselten. Ein Herr hob bei Lillis Eintritt die sanft vom Lichtschein bestrahlte Glatze von den Schriftstücken.
»Sie wünschen?« fragte er kurz.
»Mein Name ist Lilli Steffen; ich bin durch das Lettehaus zum ersten April von der Sparkasse für Korrespondenz, Stenographie und Schreibmaschine angestellt worden,« zum wievielten Male wiederholte sie nun schon ihr Sprüchlein.
»Halbe Stunde zu spät – unpünktliche Beamtinnen können wir hier nicht gebrauchen. Lassen Sie sich von Fräulein Schwertfeger Platz und Arbeit anweisen.« Die Schreibmaschinen, die einen Augenblick verschnauft hatten, während neugierige Mädchenaugen Lillis Äußeres überflogen, ratterten aufs neue. Die Glatze tauchte wieder in den Lichtkreis zurück.
Es wäre vergeblich gewesen, sich zu entschuldigen und das Zeitversäumnis klarzustellen. Man sah und hörte sie nicht mehr. Lilli verließ das Privatkontor. Aber auch ihr froher Mut, mit dem sie bisher noch an jede neue Aufgabe herangegangen war, wollte sie verlassen. Doch da war es ihr, als ob sie ihres Zwillingsbruders frische Stimme vernähme: »Liliputchen, wie heißt das elfte Gebot?«
»Laß dich nicht verblüffen,« unhörbar sagte es das junge Mädchen vor sich hin und mußte wieder lächeln. Und plötzlich meldete sich auch wieder ihre fröhliche Zuversicht.
Sie hielt unter den an den Pulten schreibenden Damen Umschau. Welche sah so aus, als ob sie Fräulein Schwertfeger hieß? Junge und ältere Gesichter, kokette Löckchen und ernsthafte Scheitel.
Lilli trat zu dem Pult der ersten Buchhalterin, die vorhin so energisch »Ruhe!« gerufen. »Ich soll mich bei Fräulein Schwertfeger melden und bitten, daß sie mir meinen Platz und meine Arbeit anweist.«
»Schön – bin ich selbst. Fräulein Liedtke, räumen Sie Ihren Platz hier und setzen Sie sich an das freie Pult dort hinten. Ich muß die Neue unter meinen Augen haben.«
Lilli errötete ein wenig beschämt. Sie war gewöhnt, in der Schule sowohl als im Lettehaus, stets zu den Besten zu gehören. Und nun sollte sie ihre neue Laufbahn hier unter Oberaufsicht beginnen. »Ich will schon zeigen, daß ich etwas leisten kann,« dachte sie zuversichtlich und nahm den von ihrer Vorgängerin freigemachten Platz ein.
Da thronte nun die neue städtische Beamtin vor ihrem Pult und blickte von ihrer Höhe stolz auf das Publikum herab, das ihr vorhin den Durchgang verweigert hatte.
»Hier sind die Bücher, die Sie führen sollen. Sie haben die bargeldlosen Zahlungen und Überweisungen unter sich. Diese Posten sind zusammenzurechnen – die Briefe zu kopieren. In einer halben Stunde müssen Sie zum Stenogramm bei Herrn Mählich sein.« Die Unterweisungen wurden in nicht unfreundlichem Ton gegeben, aber so geschäftsmäßig kurz, daß Lillis an Herzlichkeit gewöhntes Gemüt zu frieren begann. Ein paar begrüßende, aufmunternde Worte hätte die Dame ihr doch wohl zum Empfang gönnen können.
Bevor Lilli sich an das Zusammenrechnen der Zahlenregister machte, mußte sie ihre Vorgesetzte erst ein wenig eingehender studieren. Fräulein Schwertfeger war klein und gedrungen. Das Gesicht frisch und energisch, das dunkle Haar straff aus der Stirn gestrichen. Auf der kurzen Knubbelnase gab sich ein Kneifer alle Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Das war Fräulein Schwertfeger.
»Ziemlich streng, aber die Nase gibt ihr einen gutmütigen Ausdruck,« zu diesem Schluß kam Lillis neunzehnjährige Menschenkenntnis. »Ich will schon mit ihr auskommen.«
Zunächst war es freilich notwendig, daß sie sich mal erst an die Erledigung der ihr aufgetragenen Pflichten machte.
Lilli rechnete, daß ihr der Kopf zu rauchen begann. Rechnen war stets ihre schwächste Seite gewesen. Den trockenen Zahlen hatte sie niemals besondere Sympathien entgegengebracht. Und wäre sie nicht solche fleißige Schülerin gewesen, wäre vor allem der gute Bruder nicht hin und wieder hilfreich eingesprungen, dann hätte sie wohl öfters einmal dabei Schiffbruch gelitten.
Hier war aber leider kein Bruder Ludwig, der nachrechnen konnte, ob es stimmte, dafür war aber hier etwas anderes: lauter Betrieb.
Daheim in Lillis Mansardenstübchen hatte allenfalls Goldschopf dazwischen zu flöten gewagt, wenn sie über der Arbeit saß. Mäuschenstill war es dort gewesen. Ebenso wie in der Schulklasse und in den Arbeitsälen des Lettehauses. Hier dagegen schlugen die Türen unaufhörlich auf und zu und ließen immer wieder neue Menschen ein. Bei der Abfertigung ging es durchaus nicht leise her. Und Lilli besaß noch nicht die Fähigkeit der meisten Bankbeamten, sich hinter einer selbsterrichteten unsichtbaren Mauer vor den Eindrücken der Außenwelt zu verschanzen.
6 347 542 und 87 974 – Lilli kaute am Federhalter und rechnete emsig.
»Ach, liebes Fräulein, können Sie mir denn das Geld nicht ohne Erbschaftsschein aushändigen? Wovon soll ich denn sonst heute die Miete bezahlen? Mein Mann ist doch leider gestorben, hier ist die polizeiliche Bescheinigung, weiter bedarf es doch nichts,« erklang es da mitten in Lillis Rechnereien hinein. So traurig schien die Stimme, so müde – war es da ein Wunder, daß die Teilnahme der neuen Buchhalterin geweckt wurde, daß sie ihre Zahlen vergaß, und die braunen Augen mitleidig auf die Sprechende richtete? Es war eine noch junge, abgehärmte Frau. Ein Kind trug sie auf dem Arm, eines hing ihr am Rock.
Sicher würde das Fräulein, das die Abfertigung des Publikums unter sich hatte, ein Einsehen mit der Not der Ärmsten haben.
»Ohne Erbschaftsschein darf ich Ihnen nichts aus dem auf den Namen Ihres Mannes lautenden Sparkassenbuch aushändigen.«
Lilli war empört. Sie hatte noch zu wenig kaufmännisches Verständnis, um die Notwendigkeit eines derartigen Dokumentes einzusehen. Ihr weiches Herz empfand alle Not und Bedrängnis mit der Armen. Ihr phantastisches Köpfchen hatte bereits deren ganze Lebensgeschichte zusammengedichtet.
»Fragen Sie doch noch mal, Fräulein, vielleicht wird doch 'ne Ausnahme gemacht,« bat die Witwe.
Das Fräulein trat an das Pult des Fräulein Schwertfeger. Lillis gepreßte Seele atmete aus. Fräulein Schwertfeger würde sicher mitleidiger sein.
Aber »ohne den Erbschaftsschein darf nichts ausgeliefert werden,« so geschäftsmäßig und gleichgültig klang es wie irgend eine andere beliebige Anordnung.
»Sie ist doch nicht gutmütig, trotz der Knubbelnase.« Lilli warf ihrer Vorgesetzten einen mißbilligenden Blick zu.
Aber auch Fräulein Schwertfeger warf einen mißbilligenden Blick auf die ganz von der Verhandlung in Anspruch genommene neue Buchhalterin.
»Fräulein Steffen, lassen Sie sich in Ihren Abrechnungen nicht stören – das Publikum darf für Sie nicht vorhanden sein.« Ernst und mahnend klang es.
Lilli steckte das Näschen eiligst wieder in die großen Kassabücher, um gleichzeitig die peinliche Röte zu verbergen, die ihr bis an das Goldhaar stieg. Eine Rüge, gleich am ersten Tage! Lillis Ehrgeiz litt schwer darunter. Soviel Mühe sie sich auch gab, ihre Gedanken nur auf das Zahlengewirr zu richten, sie flatterten ihr davon. Hinter der blassen Frau eilten sie her, was mochte sie in ihrer Not jetzt beginnen! ...
Ach, wenn sie doch reich wäre, wie gern hätte sie geholfen. Ob man ihr wohl im voraus ihr Gehalt auszahlte? Aber gleich am ersten Tage konnte sie damit unmöglich kommen und – –
»Eine Dame zum Stenogramm,« erklang es aus dem Privatkontor.
»Fräulein Steffen, sind Sie so weit?«
»Ich – ich habe noch einige Spalten durchzurechnen,« stotterte die Angeredete erschreckt.
»So gehen Sie, Fräulein Habicht.« Die feinfühlige Lilli hörte den unausgesprochenen Vorwurf aus Fräulein Schwertfegers Worten heraus. Mit aller Gewalt zwang sie eine fürwitzige Träne, die ihr den Blick trüben wollte, zurück.
»Tue deine Pflicht, dann brauchst du dich nicht ansäuseln zu lassen,« schalt sie sich selber und versuchte Augen und Ohren vor allen neuen Eindrücken zu verschließen.
Das ging auch eine Weile ganz gut. Da – ein süßes Kinderstimmchen, hell wie Vogelgezwitscher. Das ließ sich nicht aussperren.
»Ich darf ganz allein mein Geburtstagsgeld in mein Sparkassenbuch einzahlen, nicht, Muttchen? Und wenn Weihnachten ist, kaufe ich dafür schöne Geschenke für Mutti, Vater und Anna,« schwatzte es zutraulich.