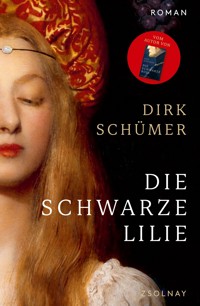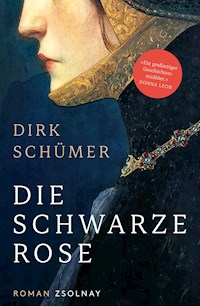
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
„Man kann kaum etwas Vergnüglicheres, Erbaulicheres tun, als in diesem Sommer die Schwarze Rose zu lesen.“ Nils Minkmar, Süddeutsche Zeitung
Als Ketzer denunziert, muss sich im Jahr 1328 der berühmte deutsche Prediger Eckhart von Hochheim am Hof des Papstes in Avignon der Inquisition stellen.
In Begleitung seines Novizen Wittekind wird Meister Eckhart Zeuge eines blutigen Raubüberfalls. Als Wittekind selbst angegriffen wird, ahnen die beiden, dass sie in einen Finanzbetrug von europäischem Ausmaß hineingezogen werden. Im Schatten des Papstpalasts ist auch der geheimnisvolle Franziskaner William von Baskerville den Tätern auf der Spur.
Dort, wo Umberto Ecos „Der Name der Rose“ aufhört, setzt Dirk Schümers packender historischer Roman an. Wir erleben eine finstere Metropole der Religion, in der nur ein Credo gilt: Gold.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 978
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Als Ketzer denunziert, muss sich im Jahr 1328 der berühmte deutsche Prediger Eckhart von Hochheim am Hof des Papstes in Avignon der Inquisition stellen.In Begleitung seines Novizen Wittekind wird Meister Eckhart Zeuge eines blutigen Raubüberfalls. Als Wittekind selbst angegriffen wird, ahnen die beiden, dass sie in einen Finanzbetrug von europäischem Ausmaß hineingezogen werden. Im Schatten des Papstpalasts ist auch der geheimnisvolle Franziskaner William von Baskerville den Tätern auf der Spur.Dort, wo Umberto Ecos »Der Name der Rose« aufhört, setzt Dirk Schümers packender historischer Roman an. Wir erleben eine finstere Metropole der Religion, in der nur ein Credo gilt: Gold.
Dirk Schümer
DIE SCHWARZE ROSE
Roman
Paul Zsolnay Verlag
Le Moyen-Âge, c’est le Noir.
Jacques Le Goff
Fra Dolcino da Novara, verbrannt 1307 in Vercelli
Marguerite Porete, verbrannt 1310 in Paris
Jacques de Molay, verbrannt 1314 in Paris
Bernard Délicieux, zu Tode gefoltert 1320 in Carcassonne
Guilhèm Belibaste, verbrannt 1321 in Vilaroja
Ubertin von Casale, ermordet 1328 in München
Eckhart von Hochheim, verschollen 1328 in Avignon
Ihrem Angedenken und allen Opfern der heiligen Inquisition ist dieses Buch gewidmet.
Kapitel 1
Avignon, 20. Mai 1328
Welches Tier?, fragte ich.
Der Meister blickte zu den zerlumpten Menschen am Flussufer. Tief gebeugt zogen die Mutter und zwei Söhne an Seilen einen Lastkahn die Rhone aufwärts, während der Vater mit einem langen Stock das Boot vom Ufer weghielt. Im Gegenwind des Mistrals beförderten sie das Boot, das bis über die Reling mit Brennholz beladen war, in Richtung Hafen. Ihre Gesichter grau, den Blick auf die Füße gerichtet, dieweil ein kleines Mädchen von vielleicht drei Jahren barfuß nebenher hüpfte. Die Frau war schwanger und kam nur schwer vorwärts. Eine Familie von Treidlern, wie sie hier ständig vorbeizogen, Schritt für Schritt für Schritt.
Der Meister, nachdenklich in die Ferne blickend, hatte die Leute gar nicht bemerkt.
Welches Tier?, fragte er zurück. Du weißt doch, dass ich dein Spiel nicht mag. Esel vielleicht?
Das sind keine Esel, sagte ich. Esel sind stur und klug und widerspenstig. Die machen nur, was sie wollen. Diese Leute da unten merken gar nicht mehr, was sie tun. Schau nur, wie krumm die Kinder in den Seilen hängen. Die werden ein Leben lang nicht aufrecht gehen. Ameisen sind das, die dem Papst das Brennholz für seine Küchen liefern.
Das Boot war am Flusshafen angekommen. Da würden die Treidler das Holz abliefern, ein paar Münzen dafür bekommen und sich nach einer Nacht im Boot wieder die Rhone hinuntertreiben lassen. Morgen ging dann das Schleppen von neuem los, mit Holz, mit Kohlen, mit Sand, mit Weinfässern, mit Gemüse. Avignon konnte alles gebrauchen.
Ich sagte: Viele tausend Ameisen liefern, was die Stadt braucht. Avignon ist der Ameisenhaufen, und der Papst da oben in seinem Haus auf dem Felsen, das ist der Ameisenkönig. Er befiehlt, und aus dem ganzen Abendland kommen Waren und Speisen, Gold und Silber oder eben Brennholz. Und Menschen, immer mehr Menschen.
Ich wandte mich um und erblickte die Stadt mit ihren Vorburgen. Überall wurde gebaut. Zimmerleute hämmerten an Gerüsten, Maurer zogen Steine an Kränen hoch. Selbst hier unten am schlammigen Flussufer konnte man Hütten mit Schilfdächern finden, die es tags zuvor noch nicht gegeben hatte und die die nächste Flut kaum überstehen würden. Es wurde geklopft und gemeißelt und gesägt. Avignon war viel geschäftiger als meine ruhige Stadt in Westfalen, es war hier sogar noch lauter als in Köln. Ich hatte mich an die nie abreißende Unruhe gewöhnt, genau wie an den Mistral, der jeden dritten Tag von Norden den Fluss herunter blies und die Menschen wild machte. Vor ein paar Jahren, so erzählten die Eingesessenen, war Avignon noch eine unbedeutende Bischofsstadt gewesen. Dann kam der Papst und machte seine Residenz zum quirligsten Ameisenhaufen der Christenheit. Auch wir waren hier, weil der Papst es befohlen hatte.
Ich wies auf die Brücke. Aus der Ferne waren Karren, Reiter und Fußgänger auszumachen, die sich auf der schmalen Spur über den Bögen stauten. Sie alle wollten aus dem Königreich Frankreich herüber in die Stadt des Papstes. Der Ameisenkönig hatte immer Hunger, er musste gefüttert werden.
Wenn wir, schlug ich vor, auf den Kahn der Treidler steigen und uns die Rhone abwärts treiben lassen, dann sind wir in spätestens zwei Tagen am Meer. Von dort aus können wir überallhin segeln, dann sind wir frei. Meister, wollen wir? Du weißt doch genau wie ich, dass es hier immer gefährlicher wird. Wir haben keinen Freund in Avignon, nicht einmal im Konvent der Brüder, da am allerwenigsten. In Köln warst du der größte Prediger, die Menschen kamen von weit her, um dich zu hören. Hier hat dir die Inquisition den Mund verboten, sie haben dich wochenlang im Kloster eingesperrt. Wir werden immer noch überwacht. Wir hätten nie nach Avignon kommen dürfen. Meister, ich habe Angst.
Er schaute mich an. Er war in den letzten Wochen dünner geworden, seine rundliche Gestalt hatte sich gebeugt, und sein Kinderblick wirkte traurig. Immer und überall trug er seine Verteidigungsschrift mit sich herum und las, was er den Inquisitoren auf ihre Anklagen entgegnen wollte. Auch jetzt am Ufer der Rhone hatte er im Pergament geblättert und sich auf seiner Schreibtafel Notizen gemacht. Er war einmal ein mutiger Denker gewesen. Jetzt war er nur noch ein alter Mann, der auf sein Urteil wartete.
Wir fahren nirgendwohin, sagte er mit leiser Stimme.
Ich bin kein Ketzer, und du weißt das. Der Papst weiß das, seine Inquisitoren wissen das auch. Im Winter haben sie uns noch im Brüderkloster eingesperrt, da bekam auch ich ein bisschen Angst. Aber, Wittekind, jetzt ist Frühling, und wir sitzen in der Sonne am Fluss. Wir dürfen uns sogar in der Stadt frei bewegen. Das ist ein gutes Zeichen und beweist, dass dieser lächerliche Prozess bald abgeschlossen ist. Dann können wir zurück nach Köln. Das ist das Einzige, was ich in diesem irdischen Leben noch will, nach Hause.
Der Meister blickte über die Rhone nach Norden, wo in der Ferne unsere Heimat lag, und seufzte:
Auf keinen Fall werde ich fliehen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen und will auch nicht nach Süden ans Meer. Wohin sollen wir denn gehen? Nach Italien zum Kaiser? Wollen wir uns in Genua unter dem Schiffsvolk im Hafen verstecken? Oder als zwei Bettelmönche ins Heilige Land pilgern mit ein paar Groschen im Beutel? Nein! Der Herr Papst wird mich freilassen, er hat gerade ganz andere Sorgen als einen alten Dominikaner aus Deutschland. Meine Gedanken versteht der Papst sowieso nicht, er ist kein Theologe, sondern ein Jurist. Aber wenn ich ihm das Nötige erklärt und auf mein Recht hingewiesen habe, dann lässt er uns ziehen. Es kann nicht mehr lange dauern.
Die Familie mit ihrem Brennholz war inzwischen am Flusshafen angekommen. Es war ein ungemütlicher Tag wie so viele andere auch, mit Wolken und Wind und einem Frühjahr, das sich zwischen Dürre und Flut nicht entscheiden konnte. Ein Tag Hitze, ein Tag Regen, heute Nacht vielleicht Sturm. Wenn ich die Augen zukniff, konnte ich in der Ferne die beiden Treidlerjungen erkennen, die gerade das Holz abluden, während das zerlumpte Mädchen weiter um sie herumsprang. Die Mutter hockte mit dickem Bauch daneben, und der Vater handelte sicher gerade um ein paar Sous, besorgte den Seinen dann einen Kanten Brot. Die Ameisen hatten nicht das Recht, sich auszuruhen.
Ich weiß bis heute nicht, warum der Meister mein Spiel nicht mochte. Wenn man sich die Tiere vorstellt, denen die Menschen gleichen, dann sieht man, wie sie wirklich sind. Jeder Mensch hat sein Tier. Mein Meister mit seinem runden Gesicht, seinen großen Augen, seiner Stirnglatze und seinem kleinen Buckel war für mich eine weise alte Eule, der es aber immer schwerer fiel, Mäuse zu fangen. Inzwischen konnte sie nicht einmal mehr fliegen. Aber das sagte ich ihm nicht.
Lass uns zurückgehen zur Stadt, sagte der Meister. Er zog seinen Mantel über die Schultern und seine Kapuze über den Kopf. Es kommt wieder dieser ungute Wind auf. Mir wird kalt, ich will beten.
Kapitel 2
Wir stiegen die Böschung hinauf und gingen ein Stück die Rhone entlang. Die Subburgi, die hier verstreut lagen, gaben ein wunderliches Bild. Hier eine Kardinalsresidenz mit hohen Steinmauern und bewachtem Tor. Dort ein paar Fachwerkstraßen, die von einem Holzzaun umgeben waren. Dann in den Wiesen am Stadtrand viele mit Schilf gedeckte Hütten. Wir gingen an den Mauern unseres Konvents vorbei, denn der Meister hatte nicht vor, sich am späten Nachmittag bereits unter die Kontrolle des Priors zu begeben. Aber ich fürchtete, dass uns auch draußen stets ein paar Mitbrüder im Blick behielten. Der Meister war ein angeklagter Häretiker unter der Gewalt der Inquisition. Und die Dominikaner, unsere Mitbrüder, waren verantwortlich dafür, dass er vor seinem Prozess nicht davonlief.
Hinter dem Kloster, dem größten und reichsten von ganz Avignon, lag das nicht minder prächtige Anwesen des päpstlichen Kämmerers Gasbard de Laval. Eine Festung mit zwei Türmen, Stallungen und Wohngebäuden für die Schreiber und Boten. Das ist der Mann, hatte mir Bruder Ramon, der Gärtner, gleich nach unserer Ankunft im November gesagt, der dem Papst das Geld beschafft. Gasbard de Laval kam wie fast alle wichtigen Leute am Hof von Joan aus dem Quercy. Kaum jemand hier in der Stadt hatte gewusst, wo das liegt, ja dass es so etwas wie das Quercy überhaupt im französischen Königreich gab. Heute kannte jeder die Stadt Cahors, aus der Papst Joan stammte. Hunderte Kleriker, Händler, Bankiers, Söldner aus dem Quercy waren dem Ruf ihres Patrons nach Avignon gefolgt. Sie hielten zusammen, und sie waren bei den Provenzalen verhasst für ihre Geldgier.
Die Kleriker aus Cahors scheißen Geld, sagte Bruder Ramon, und sogar ihre Scheiße horten sie. Darauf wachsen Bäume, an denen neues Gold hängt. Damit stopfen sie sich voll und tragen das Gold in ihre Heimat. Die Menschen von Avignon bleiben arm, und das Quercy wird immer reicher.
Die Nachbarschaft zum päpstlichen Kämmerer hatte unserem Konvent nicht geschadet. Die Straßen wurden regelmäßig mit Rhonekieseln geplättet, von Dreck gesäubert und waren sogar abends noch sicher. Gasbard de Laval war gut organisiert. Sogar in der Sänfte, in der er sich jeden Tag zum Papstpalast hinübertragen ließ, so hieß es, las er auf seinem Schoß noch in Rechnungsbüchern. Ich hatte ihn in den mehr als fünf Monaten unserer Anwesenheit noch nie zu Gesicht bekommen.
Daneben, am äußersten Stadtrand, stand die kleine Mirakelkapelle, die Gasbard gestiftet hatte. Hier hatte vor einigen Jahren ein Scheiterhaufen gebrannt. Doch der Verurteilte — er soll es mit der eigenen Mutter getrieben haben — wurde von der Muttergottes durch einen Regenguss gerettet. Ein Wunder. Seither pilgerten viele Leute aus Avignon hierher, um zur Madonna zu beten. Gasbard de Laval hatte ein Herz für Sünder. Und er hatte einen vollen Geldbeutel. Er finanzierte gleich neben seinem Anwesen den Konvent der Repenties mit einer eigenen Kapelle. Vierzig bekehrte Huren mussten hier in strenger Klausur den ganzen Tag beten und büßen für ihr sündiges Leben.
Was sollen das für Huren sein?, fragte Ramon, als er mir den Orden erklärte. Natürlich sind es alte, hässliche, die auf der Straße keinen Sou mehr verdienen. Da bekehrt es sich leichter. Aber sie haben ein hartes Leben, knien stundenlang auf Holzbänken, murmeln ihre Litaneien und geißeln einander mit Lederriemen. Eine Aufseherin hat es mir erzählt. Für solche Frömmigkeit haben die reichen Herren aus dem Papstpalast gerne Almosen übrig. Vierzig Huren — was für ein Witz! Tausende von Huren gibt es in Avignon, für jeden Kleriker mehr als eine.
Ramon, bei dem ich in diesem langen Winter bei der Gartenarbeit die provenzalische Sprache erlernt hatte, war zugänglicher als die strengen Dominikanerprediger, die auf seinesgleichen als Laienbruder und Gärtner nur verächtlich herabsahen, während sie sein Gemüse aus dem Frühbeet und seinen Salat verzehrten. Mit ausländischen Ketzern wie uns redete außer den Arbeitern sowieso niemand.
Anders als meine ummauerte westfälische Stadt war Avignon von keinem Wall umgeben. Den morschen Ring um die innere Stadt hatte man vor zwei Jahren erst geschleift. Seither mussten sich die Menschen in ihren Häusern und Nachbarschaften, mussten sich auch die Mönche in ihren Klöstern und die Leute in den freistehenden Subburgi verbarrikadieren. Hier draußen waren nachts Ketten über die Gassen gespannt, aber nur die reichen Kardinäle konnten sich Mauerwerk und Wächter leisten. Der Papst lockte die Menschen zu sich nach Avignon. Aber er schützte sie nicht.
Der Meister und ich waren am Rand der Bebauung angekommen. Hier lagen die großen Fischteiche des Papstes. Kinder mit langen Stangen liefen herum, um Reiher und Kormorane zu verscheuchen. In der Fastenzeit hatte ich von meinem Fenster im Konvent beobachten können, wie Karpfen und Hechte für die Tafel des Papstes herausgefischt und in Kübeln zum Palast getragen wurden. Die Bestände hatten sich gelichtet. Nun streuten die Aufseher mehrmals täglich Schafmist ins Wasser und mästeten die Fische für den Winter.
Unser Ziel lag im Wiesengrund des Flussufers. Die windschiefe Kapelle hatte einst Pilgern in Richtung Santiago zu einem letzten Gebet gedient, bevor die Reicheren auf Booten die Rhone hinunterfuhren — oder die Ärmeren zu Fuß ihren Weg nach Spanien fortsetzten. Nun gab es eine bequemer gelegene Jakobskapelle in der Stadt, hier draußen wurden keine Messen mehr gelesen. Die Kapelle mit ihrem bröckelnden Putz und ihren zerbrochenen Fenstern fiel in Vergessenheit. Gerade darum kam der Meister gerne hierher. Er liebte die Einsamkeit, wenn sie auch in Avignon noch schwerer zu finden war als eine reuige Hure.
An der Weggabelung neben den Schuppen der Teichwärter hockte ein blinder Bettler und leierte monoton seine Botschaft herunter: Ich habe das Ende der Welt gesehen. Ich sehne mich nach Trost. Tut Buße! Ich habe das Ende der Welt gesehen.
Wir näherten uns. Der Mann stank. Wohl bei einem Brand hatte er sich das Gesicht versengt, die Haut war mit lauter Narben wie aus brüchigen Rotziegeln wieder zusammengewachsen, aber die Augenhöhlen starrten leer. Was wollte der Bettler hier, wo kaum jemand vorbeikam? Hatte er sich verlaufen? Konnte er überhaupt laufen?
Ich habe das Ende der Welt gesehen, leierte der Mann.
Der Meister beugte sich hinunter und reichte ihm ein Stück Brot aus demselben Beutel, in dem er auch seine Verteidigungsschrift mit sich trug. Schneller, als wir schauen konnten, hatte der Blinde das Brot verschlungen. Danach segnete ihn der Meister und wollte ihm die Hand auf den Kopf legen. Aber der Bettler zuckte zurück, stieß den Meister weg und brüllte: Der Teufel hat diese Welt erschaffen. Hütet euch vor der Welt! Tut Buße!
Ein verlorenes Gotteskind, sagte der Meister und schüttelte den Kopf. Vor dem Holzportal fragte er mich, ob ich mit ihm beten wolle: Es ist sehr lange her, seit ich dich zuletzt beten sah, Wittekind.
Was willst du?, fragte ich. Schließlich bin ich Schüler eines Ketzers.
Der Meister schaute mich traurig an. Gott ist überall, und er ist immer bei dir. Das solltest du wissen.
Dann muss ich ihn nicht in der Kapelle suchen.
Mit einem Mal schien wieder die Sonne. Hier in der Provence hatte sie Ende Mai so viel Kraft wie daheim in Deutschland im Hochsommer. Ich streckte meine Glieder aus, in denen ich noch die Kälte des Klosters spürte. Schwalben jagten knapp über dem Wasser nach Mücken; auf der Rhone trieben zwei Boote mit Reisenden, die lauthals Lieder sangen. Wäre nicht das Geschrei des Bettlers gewesen, man hätte für einen Augenblick an eine Welt voller Frieden und Geborgenheit glauben können.
Plötzlich wurde hinter mir das Portal aufgerissen. Wittekind, komm her, schnell!
Ich sprang auf und lief in die Kapelle. Es schien alles verwaist. Der Meister wies stumm zur linken Wand, wo ein Haufen Gerümpel herumlag, eine alte Kirchenbank, Stühle, Bretter. Von irgendwo kam ein Wimmern.
Dann sah ich es. Ein rotes Rinnsal floss im Halbdunkel aus den Trümmern. Ein Bein schaute hervor. Ich zerrte die Bretter weg und fand einen Mann auf dem Boden. Der Mund war geknebelt, und aus Wunden an Armen und Beinen blutete er. Ich löste ihm den Knebel, aber der Mann war ohnmächtig. Arme und Beine sahen fürchterlich aus. Offenbar hatte man ihm mit einem Knüppel Knie und Ellbogen, Schienbeine und Knöchel zertrümmert. Überall schauten zersplitterte Knochen hervor. Ich zog das Bündel Mensch zur Wand, es konnte jedoch nicht aufrecht sitzen und sackte sofort in sich zusammen. Der Mann war ein Kleriker, wie seine Tonsur verriet. Der Kopf schien unverletzt.
Heilige Mutter der Schmerzen, rief der Meister, fiel auf die Knie und faltete die Hände. Ich habe ihn erst bemerkt, als ich sein Wimmern hörte. Dann das Blut.
Hast du niemanden gesehen? Ist jemand vor dir in der Kapelle gewesen?, fragte ich und zeigte auf die Seitentür.
Ich habe nichts gesehen und gehört. Herrgott, Wittekind, wer hat dem Mann das angetan?
Was weiß ich?, sagte ich. Wir müssen sofort Hilfe holen. Bleib du hier und pass auf den Mann auf. Ich laufe zum Kloster. Es wird bald jemand kommen.
Ich rannte zu den Hütten der Teichwärter und schrie, sie sollten sofort zur Kapelle kommen. Dort liege ein Verwundeter. Unterwegs fragte ich mich, ob es eine gute Idee gewesen war, den Meister bei dem Verletzten allein zurückzulassen. Doch umkehren konnte ich jetzt nicht mehr.
Im Konvent rief ich möglichst viele Mönche an der Pforte zusammen. Jemand sagte Bruder Deodat Bescheid, der sich ums Hospital und die Krankenstube kümmerte. Ich organisierte noch eine Trage. Dann eilten wir gemeinsam los. Bei den Teichen fiel mir auf, dass der blinde Bettler verschwunden war.
Kapitel 3
In der Krankenstube ließ Bruder Deodat den Verwundeten auf den langen Holztisch legen, auf dem er seine Operationen durchführte. Deodat scheuchte außer seinem Assistenten alle Schaulustigen aus der Stube. Nur uns behielt er da, um uns über den Hergang zu befragen:
Wie lange lag der Patient in der Kapelle auf dem Boden?
Wir wissen es nicht, antwortete der Meister. Mindestens eine halbe Stunde, vielleicht länger.
Konnte er etwas sagen?
Nein, meinte ich, er war erst geknebelt, dann bewusstlos.
Diese Strauchdiebe werden immer dreister, urteilte Deodat und schüttelte den Kopf. Seit unser Herr, der Papst, aus welchen Gründen auch immer, die Juden wieder in der Stadt zugelassen hat, häufen sich die Überfälle. Man erzählt, dass die jüdischen Lumpensammler ihre Opfer ausspionieren, mit Versprechungen an den Stadtrand locken und dann hinterrücks niederschlagen. Frauen vergewaltigen sie, unschuldige kleine Kinder bringen sie um, trinken ihr Blut. Jeder weiß das.
Deodat war ein hochherziger Mönch mit hoher Stirn, kurzen grauen Haaren und kühlen blauen Augen. Sein lippenloser Mund war zusammengezogen wie ein Geldbeutel. Eine Eidechse? Ein Iltis? Ich war mir noch nicht sicher.
Als Arzt wirkte Deodat nicht besonders fürsorglich. Ich hatte ihn noch niemals lächeln sehen. Offenbar teilte er die Menschen ein in Patienten und Sünder. Die Ersten waren die Kranken, Letztere die Gesunden. Und ihm, Bruder Deodat, fiel die unangenehme Aufgabe zu, seine Patienten wieder zu Sündern zu machen.
Ramon hatte mir erzählt, dass Deodat eigentlich Professor der Medizin in Montpellier werden wollte. Doch als er kurz davorstand, berufen zu werden, hatte ihn der Orden vor fünf Jahren zur Heiligsprechung des Thomas von Aquino nach Avignon abgeordnet, weil der Konvent für die Ehrengäste einen kompetenten Mediziner benötigte. Die feierliche Heiligsprechung des klügsten aller Dominikaner durch Papst Joan anno 1323 war das größte Ereignis in der Geschichte des Ordens. Bis heute war täglich die Rede von den glanzvollen Zeremonien, den Feierlichkeiten, den Gästen aus aller Welt. Wunderdinge, so wusste noch der letzte Laienbruder, hatten sich in diesen Mauern ereignet; Feinde hatten sich versöhnt, Lahme konnten plötzlich wieder laufen. Und unser Prior Gaucelin fühlte sich seither fast so wichtig wie der Papst persönlich und fast so heilig wie der Doctor Angelicus, dem unser fetter Vorsteher, wenn schon nicht im Intellekt, so doch an Bauchumfang nahekam. Gaucelins Tier war der Elefant, der in den undurchdringlichen Wäldern Afrikas sein Leben fristet. Weshalb der Prior auch meistens in seiner Wohnung verblieb und zwischen den Mahlzeiten in der Privatkapelle für das Wohl seines Konvents und das seines Leibes betete.
Seit seiner Abberufung aus Montpellier tröstete Bruder Deodat sich über das Leben fern der Universität, indem er regelmäßig Kardinäle und andere hohe Kurienmänner Avignons in ihren Residenzen besuchte und ihren Urin beschaute. Ramon machte seine Witze darüber, dass die Pisse eines Kardinals sicher nach Weihwasser oder sogar nach Burgunderwein schmecke und im Dunkeln leuchte wie ein Heiligenschein. Es waren auch Dominikaner unter den Patienten, Juristen aus Montpellier, Theologen, die dem Papst dabei halfen, die Rechtgläubigkeit zu verteidigen. Diese Kirchenfürsten suchten, wie mir Ramon erzählte, gegen ihre Gicht und ihre Fettleibigkeit zuweilen auch den Rat jüdischer Ärzte, obwohl der Papst das streng verboten hatte. Doch ab einem bestimmten Rang scherte sich hier in Avignon niemand um päpstliche Verbote, der Papst am allerwenigsten. Die Konkurrenz zu den jüdischen Ärzten, die in der Heilkunst Iberiens und Arabiens bewandert sein sollten, war die schlimmste Kränkung für Bruder Deodat.
Wenn sich dieser Doktor überhaupt dieses Bewusstlosen annahm und die Schürze mit seinem Blut befleckte, dann um anatomische Studien an den zertrümmerten Knochen zu betreiben. So auch jetzt.
Der Kranke stöhnte plötzlich auf. Er sah totenbleich aus, sein Kopf fiel zur Seite.
Wird er es überleben?, fragte ich.
Bruder Deodat blickte über mich hinweg zum Meister, der mit gefalteten Händen in der Ecke stand und immer nur fassungslos den Kopf schüttelte. Ich war Novize und keiner Antwort würdig.
Nur ein Ignorant, sagte der Arzt verächtlich, kann übersehen, dass bei diesem Patienten keine lebenswichtigen Organe verletzt wurden. Galenus, obgleich ein Ungläubiger, doch ein beachtlicher Kenner der Medizin, schreibt, dass die göttliche Vorsehung alles Leben in Kopf und Leib versammelt hat, damit die Extremitäten als die Diener des Leibes ihm zuarbeiten und den Kopf entlasten. Dieser Mann hat, wie ich konstatieren kann, ein Problem mit seiner Dienerschaft.
Er wird also überleben?, fragte der Meister an meiner statt.
Natürlich wird er überleben, dozierte Deodat gewichtig. Wenn er den Schock bis jetzt verkraftet hat, ist er stark genug. Ob er freilich je wieder wird laufen können, das weiß nur Gott allein. Dafür braucht es ein Wunder. Man kann aber auch ohne Wunder Gottes durchs Leben kriechen. Dein Gehilfe — Deodat zeigte mit einem Skalpell auf mich — scheint mir, wenn er schon nicht besonders klug ist, wenigstens einigermaßen stark. Er wird mir jetzt helfen, diesen Mann aufzurichten. Wir müssen ihm etwas einflößen, das ihm die Schmerzen beim Richten der Knochen erträglich macht.
Mit dem Kinn wies mir Deodat den Platz am Kopfende. Ich fasste den bewusstlosen Kranken unter den Schultern. Deodat hielt ihm ein Fläschchen mit einer Substanz unter die Nase und schlug ihm auf die Wangen.
Wir müssen den Patienten erst wach machen, damit er schlafen kann. Per aspera ad astra. Verstehst du etwas von Dialektik?, fragte er mich.
Er muss erst wach sein, um das Mittel für die Betäubung trinken zu können?, fragte ich.
Du hast es erfasst, sagte Deodat.
Er schien, einmal am Werk, besserer Laune zu sein. Da trat sein Assistent, ein junger verschlossener Mönch, mit einer Schale voll trüber Flüssigkeit herein. Er hielt sie so feierlich vor sich wie einen Kelch mit Messwein.
Der Malträtierte kam mit schmerzverzerrtem Gesicht zu sich. Er war höchstens vierzig Jahre alt, unrasiert und hatte viele geplatzte Adern unter seiner Gesichtshaut. Die verschwitzten Haare hingen wirr herab. Sogar seine Augen waren von Adern gerötet. Ob das alles von der Tortur kam? Der erloschene Blick, den dieser Mann kurz auf mich richtete, ging mir durch Mark und Bein. Das war kein Lebendiger, der unter der Hand des Arztes auf Genesung hoffte. Dieser Mann war bereits tot. Welche Wunder Deodat mit seinem Körper auch verrichten mochte, sein Geist hatte alle Hoffnung aufgegeben. Der Mann stöhnte laut auf, als ihm der Arzt noch einmal auf die Wangen schlug. Dann blickte er ruhig im Raum umher, senkte ganz langsam den Blick auf seine zerschundenen Beine. Er kicherte mit hoher Stimme und verzog den Mund.
Ein Gruß vom Bären.
Was für ein Bär, dachte ich? Bären gab es im Gebirge, aber sicher nicht in Avignon. Wen meinte er?
Bruder Deodat hielt dem Kranken die Schale an den Mund, und der trank mit gierigen Schlucken das Gebräu aus. Sofort verdrehten sich seine Augen, der Kopf fiel zur Seite.
Warum habt ihr ihn nicht gefragt, wer er ist? Und wer ihm das angetan hat?, fragte ich den Arzt.
Diesmal hielt Deodat mich einer Antwort für würdig: Jeder Dummkopf sieht doch wohl, dass jetzt nicht die Zeit ist für ein Verhör. Wenn der Mann geschient und verbunden ist, dann hat er noch genug Zeit, den Sergenten des Papstes zu antworten. Und nicht dir.
War das Mohn im Schlaftrunk?, fragte der Meister.
Allerdings, meinte Deodat, eine große Dosis Mohn. Genau richtig, um traumlos wegzudämmern. Ihr kennt euch aus? Man hat mir erzählt, dass ihr bei euren Predigten in Deutschland zu viel über die Göttlichkeit der menschlichen Seele spekuliert habt, dass ihr die Unendlichkeit der Welt postuliert und Gottes freien Willen bestreitet. Schlimm genug. Dass ein Ketzer sich mit Medizin auskennt, ist selten. Oder habt ihr den Mohn für andere Zwecke verwendet? Magie?
Der Meister schaute wie immer in solchen Momente arglos drein. Ich weiß nicht, ob er sich diese Haltung anerzogen hatte oder ob er wirklich keinerlei Wut empfand und die Worte des Widersachers an ihm abperlten wie Wasser am Gefieder einer Ente. Jedenfalls bewunderte ich seinen Gleichmut, den ich auch schon bei den Verhören vor den Inquisitoren des Bischofs von Köln erlebt hatte. Gelassenheit, das war der Kern seiner Lehre, die er auch mir vermitteln wollte, Gelassenheit der Seele in Gott.
Mein Meister sagte:
Ich habe in meinem Leben genug Zeit an Universitäten verbracht, um neben vielem Unsinn das eine oder andere Nützliche aufzuschnappen. Vielleicht sogar aus der Heilkunde, in der ihr ein sehr viel größerer Meister seid, Bruder Deodat. Ihr kennt euch hervorragend aus mit Mitteln der Linderung und Betäubung, wie ich weiß. Damit habt ihr auch mich im Winter gesund gemacht, und ihr werdet sicher ebenso diesen armen Christenmenschen heilen — was Gott gefälliger ist als alle Spekulation über die Seele und die Unendlichkeit des Universums. Gott hat uns als Helfer unserer leidenden Mitmenschen erschaffen. Und wir müssen dem Schöpfer danken, dass es Menschen gibt wie euch, Bruder Deodat.
Der Arzt schüttelte irritiert den Kopf, weil er vergeblich nach einem hämischen Unterton in der Rede des Meisters gesucht hatte. Dann befahl Deodat: Ihr und euer Gehilfe müsst jetzt gehen, der Patient braucht Ruhe und wird nicht vor morgen früh erwachen. Wir nehmen uns seiner Wunden an. Ihr solltet in der Kirche für seine Genesung beten. Wie ihr vielleicht wisst, steht in der dritten Seitenkapelle rechts der Altar der heiligen Cosmas und Damian, der Schutzpatrone der Ärzte und Apotheker. Um euch auf die Sprünge zu helfen: Es sind die letzten Heiligen im Hochgebet Communicantes, beileibe nicht die unwichtigsten. Möge ihr Segen auf meiner Arbeit ruhen.
Während wir die Krankenstube verließen, sagte der Meister ohne die geringste Aufwallung von Unmut:
Lieber Wittekind, ich bin schon seit vielen Jahren überzeugt, dass die größte Kunstfertigkeit, die Gott den Menschen geschenkt hat, nicht die Theologie ist. Womit wir frommen Philosophen uns ein Leben lang befassen, das sind Spekulationen für gutes Wetter. Aber es herrscht im Leben nicht immer Sonnenschein. Erst wenn wir mit dem Leiden konfrontiert sind, bemerken wir: Die größte aller Künste ist die Medizin.
Leider, antwortete ich, wird sie von Ärzten ausgeübt.
Kapitel 4
Wie kann ein so guter Arzt nur ein so schlechter Mensch sein? Ich begreife es nicht!
Wir saßen im Garten des Konvents zwischen zwei Beeten.
Das ist ganz einfach, sagte Ramon, das ist Gottes Wille.
Wieso ist das Gottes Wille, dass es so hochmütige Menschen gibt wie Deodat?
Ramon sagte: Mein lieber Albarino — so hatte er meinen Namen für sich übersetzt —, du bist ein Novize aus dem kalten Deutschland, und darum musst du bei uns in der Provence noch viel lernen. Hör auf deinen Freund Ramon. Es ist ganz einfach. Wem Gott eine große Tugend schenkt, so wie er Deodat die Heilkunst vermacht hat, dem kann er nicht auch noch die Güte vermachen. Arzt zu sein ist schon viel. Damit ihm der Hochmut nicht zu Kopf steigt, hat Gott ihm die Niedertracht in die Seele gesenkt. Mal hoch, mal niedrig, am Ende kommt das Mittelmaß in die Welt, so war es immer. Sonst wäre hier schon das Paradies, und das wäre viel zu früh. Außerdem, mit einem freundlichen Bruder Deodat wäre unsere Krankenstube immer überfüllt, weil jeder Bruder bei jedem Wehwehchen zum Arzt gelaufen käme. So bleiben wir ihm lieber fern und heilen unsere kleinen Erkältungen, Verstauchungen, Bienenstiche mit einem heißen Wein, einem Honigumschlag oder reiben uns mit Salz ein. Das geht auch, und alles hat seine Ordnung. Gott hat es so gewollt.
Ich staunte immer wieder über Ramons theologische Findigkeit.
Du willst also sagen, dass Klugheit und Güte nicht zusammenpassen?
Genau!
Und wenn jemand klug und gütig zugleich ist, wie etwa mein Meister?
Ramon kratzte sich am Ohr: Dann ist er ein Heiliger. Und wenn so einer auftaucht, dann ist das gleich verdächtig, weil jeder Heilige auch ein Ketzer sein kann. Sieh doch, was seine Güte deinem Meister eingebracht hat. Er steht vor dem Gericht der Inquisition. Vielleicht wird er nächste Woche auf einem Holzhaufen vor dem Papstpalast festgebunden und lebendig verbrannt.
Du teilst dir die Menschen streng ein, staunte ich. Der Papst ist also in deinen Augen was? Heilig oder niederträchtig?
Dem Papst Joan, wusste Ramon, hat der Herrgott die größte Klugheit aller Menschen auf der ganzen Erde gegeben, wie das zu diesem hohen Amt dazugehört. Damit treibt der Papst jetzt aus dem ganzen Abendland Geld ein, vom Kupfergroschen bis zum goldenen Florin. Und er wird immer reicher und reicher, und alles wandert in seine Keller so wie bei mir die Rüben und das Kraut und die Bohnen. Der Papst Joan wurde wahrlich von Gott reich beschenkt.
Auch mit Güte?, wollte ich wissen.
Nun, meinte Ramon verschlagen, was zu viel ist, ist eben zu viel. Da wäre der Papst ja vollendeter als Jesus Christus. Und das kann Gott nicht zulassen. Maß halten, immer Maß halten, das sind die Worte meines seligen Vaters aus Lansac. Gott ist gerecht.
Und der arme Teufel, fragte ich, der da jetzt mit zerschmetterten Armen und Beinen in unserer Krankenstube liegt? Womit hat er das verdient?
Wie du schon sagst, meinte Ramon ungerührt, der arme Teufel war entweder ein schlimmer Sünder, dann musste es so kommen. Oder er wurde von Gott beschenkt mit einer großen Gabe, einer gewaltigen Liebe oder einem Sack Gold, oder er konnte mit Zaubersprüchen Regen machen oder kranke Rinder durch Handauflegen heilen. Irgend sowas. Das ist ihm dann natürlich zu Kopf gestiegen — und bumms. Da hat ihm unser Heiland gezeigt, dass es auch ganz anders geht. Heute rot, morgen tot, wie wir in Lansac immer sagen.
Ramon stammte aus dem Dorf Lansac. Ich wusste genau, wo das liegt. Jeder im Kloster wusste, wo Lansac liegt. Zehn Meilen südlich von Avignon die Rhone hinab, wenn du nach Tarascon kommst, hältst du dich an der Kirche rechter Hand. Und nach einer guten halben Stunde Fußmarsch bist du da. Frag nach dem Hof von Raoul.
Hundertmal hatte er mir das schon beschrieben. In Lansac war Ramon vor etwa dreißig Jahren als Bauernsohn zur Welt gekommen. In Lansac hatte er Schweine gehütet, Nüsse von den Bäumen geschlagen, im Bach Stichlinge gefangen und den Kuhstall seines Vaters ausgemistet. Wenn Ramon von seinem Dorf erzählte, wirkte Lansac prächtiger als Paris mit der Sorbonne, der Kathedrale Notre-Dame und den bunten Glasfenstern der Sainte-Chapelle. Lansac war für ihn, was für einen Mauren Mekka war und für einen Christen Rom. Wobei — Rom war nun, da der Papst in Avignon wohnte, auch nicht mehr das, was es einst gewesen war. Für Ramon jedenfalls war Rom bei weitem nicht so prachtvoll wie Lansac mit seinen Schweinen, Obstgärten und Weinbergen.
Und die Mädchen von Lansac, schwärmte Ramon spätestens nach dem dritten Glas Wein, die sind rund und rotbackig. Und wenn du sie anfasst, hast du richtig was in der Hand. Die machen einen Hundertjährigen im Nu wieder lebendig, wenn du weißt, was ich meine. Und er machte eine Geste mit dem Unterarm.
Ramon, wandte ich ein, was weißt du denn von den Mädchen? Du bist ein Dominikaner, auch als Laienbruder hast du ewige Keuschheit geschworen.
Da schmunzelte er: Komm du mir erstmal nach Lansac, da wirst du schon sehen, was so ein Schwur wert ist.
Ich hatte im Winter begonnen, im Kloster bei der Gartenarbeit zu helfen. Bibliothek und Skriptorium waren für uns anfangs verboten, der Meister lag krank im Bett. Ich brauchte Bewegung. Ramon hatte meinen Eifer honoriert und mir abends etwas Speck oder Wurst zugesteckt. Er hauste in einem selbstgebauten Verschlag am äußersten Ende der Klostermauer und kam kaum je zu den Chorgebeten — unter dem Vorwand, dass er schließlich auf die Hühnereier für den Abt aufpassen musste. Oder der Honig war zu rühren oder der Wein umzufüllen oder die faulen Körner aus dem Getreide zu sieben. Wir beschnitten mit seinen Arbeitern die Obstbäume, brachten Mist auf die Beete aus, säten das Frühgemüse. So konnte ich trotz des Ausgehverbotes meinen Vorsatz wahrmachen, so schnell wie möglich Provenzalisch zu lernen.
Einmal hatte ich Ramon gefragt, warum er ins Kloster gegangen war.
Ich bin nicht gegangen, ich musste, antwortete er mit dem gewohnten Gleichmut. Was willst du machen? Meine Eltern hatten acht Kinder, fünf Mädchen. Und sie hatten das Pech, dass alle durchgekommen sind. Keines verreckte, das war Gottes Wille. Woher die Mitgift nehmen? Woher den Grund und Boden für eine zweite, dritte Bauernschaft? Die Mädchen mussten alle ins Kloster zu den Klarissen, da haben wir wenigstens die Aussteuern gespart. Mein ältester Bruder, Raoul, bekam den Hof; den hat er noch. Der Zweitälteste, Guilhem, zog nach Marseille, um Matrose zu werden. Gott weiß, ob er jetzt auf dem Meeresgrund von Fischen gefressen wird oder ob er bei den ungläubigen Mauren als Sklave schuftet. Dann hat mein Vater mich bei den Dominikanern abgegeben. Das sind Prediger, hat er gesagt, und du hast ein großes Maul. Da bist du genau richtig. Dabei habe ich in meinem ganzen Leben noch keine Predigt gehalten.
Die Dominikaner von Avignon wussten nicht, was für einen Prediger sie in ihren Reihen hatten. An diesem Abend streute Ramon wie immer Körner für die Vögel in seinem Garten aus und lockte sie an.
Das sind die Seelen, um die ich mich sorge, sagte er. Wenn sie morgens singen, dann ist das die Musik des Paradieses für mich. Dieses Jahr wohnt sogar eine Nachtigall in den Hecken. Ihr Priesterbrüder hört in euren engen Zellen nichts von der Musik der Vögel.
Mir hatte Ramon im März eine Pritsche in seinem Schuppen aufgestellt, damit ich von der Nachtigall, den Singdrosseln, den Amseln, den Zaunkönigen und den Rotkehlchen auch etwas abbekam.
Das Konzert ist nicht umsonst, lobte sich Ramon. Ich füttere sie täglich und rede ihnen gut zu, meinen Piepern. Woanders singen sie längst nicht so schön.
Dein Ramon predigt also den Vöglein, kommentierte der Meister lächelnd, als ich ihm davon erzählte. Da gibt es berühmte Vorgänger. Vielleicht hat sich unser Gärtner ja im Gelübde vertan. Die Franziskaner hätten sicher Verwendung für ihn.
Aber Ramon wollte nirgendwo anders hin. Er war bei jedem Wetter in seinem Garten, sonnengebräunt sogar im Winter, stämmig und mit einem eckigen Schädel, kurzer Stirn und braunen Augen. Er war der Ochse, der den Wagen dieses Klosters zog — jedenfalls solange er genug Essen bekam.
An diesem Abend hatte Ramon mir eine Schale Erdbeeren verwahrt. Mit etwas Honig schmeckten sie köstlicher als der flaue Pamp, der den Mönchen im Refektorium vorgesetzt wurde. Ramon und ich hatten vorher ein paar Spiegeleier mit schwarzen Trüffeln gegessen, denn meinem Freund unterstand ein ganzer Hühnerstall. Dazu gab es noch ein Taubenhaus voller Eier. Unweit standen seine Bienenstöcke, im Schatten war ein Butterfass, denn auch zu den Laienbrüdern in den Viehställen unterhielt Ramon beste Beziehungen, genau wie zu den Bauern auf den Klostergütern draußen vor der Stadt und sogar zu den Brüdern anderer Konvente im Gebirge, die ihm je nach Saison Steinpilze brachten und Trüffeln oder die Eier von Schwänen, Wildtauben und Krähen. Ich hatte so eine Wirtschaft noch nie erlebt. Mangel war unbekannt. In den Gärten und draußen auf den Ländereien herrschte ein reger Tauschhandel mit Lebensmitteln. Solange Prior Gaucelin täglich mit fettem Braten und Honigspeisen versorgt war, redete Ramon niemand in sein Regiment hinein. Die Dozenten der Universität Avignon und der päpstlichen Theologieschule — die meisten waren Dominikaner — verstanden ohnehin nichts vom Landbau, ebenso wenig wie die Schreiber und Illuminatoren im Skriptorium. Der Papst wollte ein stilles, gehorsames, reiches Kloster der Predigerbrüder in seiner Stadt, keine theologischen Diskussionen. Hinter unseren Mauern herrschte Ruhe. Und Ramon hatte zwischen seinen Beeten, Getreidesäcken, Weinfässern und Obstdarren den besten Posten in diesem Kloster ergattert, das war wohl Gottes Wille.
Und wenn, räsonnierte Ramon, es der Teufel persönlich war, der den armen Mann zerschlagen hat? So eine morsche Kapelle, wo keine Messe mehr gelesen wird und die Dämonen durch die Ritzen kriechen, die hat der Herr Teufel besonders gerne. Kaum gehst du rein und vergisst, das Kreuz zu schlagen, schon sitzt der Gottseibeiuns auf dir und bricht dir alle Knochen. Und was hat der Mann gesagt? Ein Gruß vom Bären? In den Bergen oben feiern sie den Karneval, sie rennen gegen Winterende mit Bärenmasken durch die Dörfer und erschrecken die Leute. Vielleicht hat der Herr Teufel sich ja so eine Maske geschnappt und ist mit seinen Gehilfen zu uns nach Avignon gekommen.
Ramon schlug schnell ein Kreuz, aber er sah nicht so aus, als wäre er verängstigt. Er griff seinen Weinsack und nahm einen Schluck. Er wusste, dass man den Teufel so am sichersten vertreibt.
Eines ist klar, sagte Ramon, Deodat hat den Kranken jetzt in seinen Klauen und gibt ihn nicht mehr heraus. Den siehst du nicht wieder, von dem erfährst du nichts. Wenn du wirklich wissen willst, was in der Kapelle passiert ist, musst du hingehen und selber nachschauen. Aber vergiss nicht, dich zu bekreuzigen.
Ich hatte Ramon von meinen Befürchtungen erzählt. Was war, wenn der Überfall gar nicht dem Kranken gegolten hatte, sondern dem Meister? Seit Köln hatte ich auf dem langen Weg immer den Verdacht, dass uns jemand folgen könnte. Magister Paul, der den Meister gemeinsam mit mir nach Avignon begleitete, war die Reise zum Verhängnis geworden. Fett wie er war, machte der Bücherwurm auf einem Hügel irgendwo im Jura schlapp, sackte zusammen und kam kaum wieder auf die Beine. Bald danach gab er in einer Herberge bei Bisanz den Geist auf, und wir mussten ihn begraben. Sein Herz sei stehengeblieben, hatte der Meister gemeint. Zu viel Anstrengung und Regen auf der Wanderung für einen Mönch, der nur das Studium gewohnt ist. Meister Nikolaus von Straßburg, unser Generalvikar in Teutonia, hatte mich eigens ausgesucht für die Reise, weil ich jung war und stark und von früher anderes kannte als nur die Lektüre und den Chorgesang. Ich war kein Theologe, ich war kein Prediger, ich war noch nicht einmal ein richtiger Mönch.
Ich weiß von den anderen Brüdern, hatte Meister Nikolaus gesagt, dass du jeden Tag deinen Körper in Übung hältst. Man sieht dich frühmorgens im Garten, wenn du eigentlich zum Chorgebet müsstest. Aber du stemmst lieber Steine, springst und beugst deine Knie. Ich weiß, du bist weit gereist, bevor der Meister dich in Westfalen zu seinem Schüler gemacht hat. Und es heißt, dass du im Norden nicht immer gottesfürchtige Dinge getan hast. Ich will das gar nicht so genau wissen. Unser Meister ist der gelehrteste aller Dominikaner. Aber hier im Rheinland besucht er seit Jahren nur die Klöster mit frommen Nonnen und Beginen und erklärt den Frauen, wie sie sich Gott nähern können. Die Welt da draußen kennt er nicht mehr. Und wir haben niemanden, der auf ihn aufpasst. Darum sehe ich es gerne, wenn du ihn mit Magister Paul auf die gefährliche Reise nach Avignon begleitest. Du hast gesehen, was für Verräter unter unseren Mitbrüdern ihn angeklagt haben. Hermann de Summo und Wilhelm von Nidecke sind Leute, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Ich weiß bis heute nicht, wer diese Verbrecher in unseren Orden aufgenommen hat. Sie sind eine Schande für die Jünger des heiligen Dominikus. Bischof Heinrich von Virneburg ist zuzutrauen, dass er die Verräter deckt. Der Bischof hält die Lehren des Meisters für verkapptes Beginentum. Er ist es, der den Meister weghaben will, vergiss das nie. Dein Lehrer hat viele Feinde.
Generalvikar Nikolaus schaute düsteren Sinnes in den Garten hinaus und fuhr dann fort:
Dass unsere Widersacher ein Verfahren vor der päpstlichen Inquisition gegen den Meister gewinnen, ist mehr als unsicher. Er hat nichts Unrechtes gelehrt, ich habe das als Prüfer für den Orden bereits so entschieden. Die Bischöflichen haben mir jetzt das Verfahren aus den Händen gerissen. Der Papst soll entscheiden. Vielleicht aber will unser Bischof den Meister auch nur auf eine lange Reise schicken, eine Reise ohne Wiederkehr. Verstehst du?
Ich verstand.
Sei auf der Hut, hatte Nikolaus mir noch eingeschärft: Und du kannst ruhig dein Messer mitnehmen.
Woher wisst ihr, dass ich ein Messer habe?, fragte ich.
Nikolaus von Straßburg blickte wieder aus dem Fenster und meinte: Köln ist zwar eine große Stadt, aber was hier im Konvent vorgeht, zumal in direkter Nachbarschaft des Meisters, das weiß ich als Generalvikar genau. Wir müssen auf der Hut sein. Zwar ist es einem Mönch streng verboten, eine Waffe bei sich zu tragen. Aber immerhin müsst ihr unterwegs Brot und Schinken schneiden. Auch Wölfe und wilde Hunde überfallen oft arme Wanderer im Wald. Hab dein Messer also immer in Reichweite. Mir ist es lieber, fügte er hinzu, wenn dein Messer unserem Meister dienlich ist, als dass ihm ein Messer des Bischofs von Köln Schaden zufügt. Geh mit Gott!
Meister Nikolaus hatte mich umarmt und mir den Friedenskuss gegeben, was er noch niemals zuvor getan hatte. Seine Worte zum Abschied gingen mir nicht aus dem Sinn, seit wir heute den Verletzten in der Kapelle gefunden hatten. Niemand außer meinem Meister besuchte diese Ruine, um zu beten, das war für die Mitbrüder in Avignon kein Geheimnis. Ich hatte ihn allein hineingehen lassen, als vielleicht der Täter noch in der Nähe war. Möglicherweise hatte der Anschlag dem Leben meines Meisters gegolten, und der arme Mann hinter den Brettern war nur zufällig zum Opfer geworden, weil er sich aus irgendeinem Grund gerade in der Kapelle befunden hatte.
Nun fiel mir der blinde Bettler ein, der an der Weggabelung gesessen und uns vor der bösen Welt gewarnt hatte. Ob er etwas mitbekommen hatte? Doch was konnte ein Blinder schon sehen?
Ich musste noch einmal zur Jakobskapelle, um mir Gewissheit zu verschaffen. Vielleicht hatte der Verwundete ja irgendetwas bei sich getragen, was meinen Verdacht zerstreute. Strolche und Diebe verabreden sich an solch abgelegenen Orten, um ihre Beute zu teilen. Vielleicht war noch etwas davon übrig. Niemand von uns hatte in der Aufregung heute Nachmittag danach gesucht. Irgendwelche Spuren musste es geben, auch wenn das Opfer nicht sprechen konnte.
Wir haben noch mehr als eine Stunde Helligkeit, sagte ich zu Ramon. Ich gehe zur Kapelle, um den Teufel zu verscheuchen. Kommst du mit?
Ich? Nein! Ich muss hier auf meine Hühner aufpassen, auf die hat Satan immer ein Auge geworfen. Wir haben hier neuerdings Wiesel, die sind fast so schnell wie der Teufel selbst. Und außerdem — ich schaue lieber mal beim Kellermeister nach, ob ich einen Krug alten Wein gegen Erdbeeren tauschen kann. Wenn du wiederkommst, kannst du mir bei einem guten Tropfen aus Gigondas erzählen, was du gefunden hast. Das Zeug in den Fässern, die gestern angekommen sind, ist zwar nicht so fein wie mein Hauswein aus Lansac. Aber nicht zu verachten, gar nicht zu verachten.
Ich machte mich auf den Weg. Als ich Ramon verließ, fragte er: Willst du dein Messer mitnehmen?
Ich hatte es bei seinen Gartengeräten im hintersten Winkel des Schuppens verstaut, denn die Zelle, die ich mit dem Meister teilte, erschien mir nicht sicher. Ich überlegte kurz.
Nein, das Messer lassen wir, wo es ist. Der Meister ist in seiner Zelle und betet. Oder er schläft schon. Wozu sollte ich eine Waffe brauchen? Ich bin gleich wieder da.
Das jedoch war nicht Gottes Wille.
Kapitel 5
Die Abendsonne beleuchtete vom anderen Ufer her die Rhone, die Jakobskapelle wirkte im rötlichen Schein noch einsamer als am Nachmittag. Selbst die Aufseher an den Fischteichen waren nicht mehr zu sehen. Jedermann hier draußen sah zu, dass er vor der Dunkelheit noch rechtzeitig in die Stadt gelangte. Es war nicht allzu sicher hier. Trotzdem liebte ich die Einsamkeit der Dämmerstunde und hatte in den letzten Wochen öfter hier gesessen und nachgedacht. Ob wir wohl bald aus Avignon herauskommen würden? Und ob für mich die Reise dann nach Süden ging, zu den Häfen des Mittelmeers — Marseille, Nizza, Genua, Barcelona, Mallorca? Oder nach Osten über den Mont Ventoux in die immer noch schneebedeckten Alpen, wo es Wölfe gab und über den Wolken scharfsichtige Adler, die kein Bann der Inquisition je erreichte? Oder doch weiter nach Norden in die graue Heimat, in die mich wenig genug zog, wohin der Meister aber unbedingt zurückkehren wollte?
Ich war — anders als Ramon — erst spät und aus freien Stücken Mönch geworden, damit ich lernen und reisen konnte. Nur die Kirche bot einem Habenichts wie mir die Möglichkeit, Latein zu sprechen und zu studieren. Meine Hoffnungen waren bisher vom Schicksal erfüllt worden. Ich hatte Glück gehabt, dass ich dabei einen Gelehrten wie den Meister kennenlernen durfte. Selbst als er vor einigen Jahren eine Zeitlang in unserem Kloster Wohnung nahm, um sich mit seinem Freund Schendler ausführlich über den Kirchenbau in unserer Stadt auszutauschen, hatte nichts darauf hingedeutet, dass ich bald mit ihm nach Avignon reisen sollte.
Ich weiß heute noch nicht, warum er im Skriptorium mit mir ins Gespräch kam, als ich Pergamente fürs Beschreiben glättete und danach selber in unserer nicht gerade großen Sammlung Lektüre aussuchte. Er nahm den Folianten in die Hand, den ich gerade las, und tadelte, dass ich nur Willem van Rubroecks Bericht über seine Reise zum Großkhan ausgesucht hatte. Der Meister hatte mit scharfer Intuition gespürt, dass ich am liebsten mit dem Finger über Landkarten reiste und kaum je Scholastik studierte — und schon gar keine Pflichtwerke wie die Sentenzenkommentare des Petrus Lombardus.
Ich will über das hinaus, was wir schon kennen, hatte ich ihm erklärt, und das geht nur, wenn wir uns auf den Weg machen. Wir müssen jeden Tag aufbrechen, nicht im Kreuzgang im Viereck schreiten. Wenn ich bloß nachbete, was andere für mich vorgekaut haben, dann kann ich auch gleich Priester werden und auf dem Dorf die Litaneien stammeln.
Der Meister hörte sich das ruhig an. Er fand richtig, dass ich vor allem Sprachen lernen wollte, denn ich war anders als die anderen Novizen als Kind auf keiner Lateinschule gewesen.
Schon Roger Bacon, meinte er, hat gefordert, dass wir möglichst viele Sprachen erlernen müssen, um nicht auf die Verfälschungen der Übersetzer angewiesen zu sein.
Fortan redete der Meister nur noch auf Latein mit mir. Bei seinem nächsten Besuch lobte er meine Fortschritte und fragte, ob ich ihn auf eine Visitationsreise ins Rheinland begleiten wollte.
Warum ich, Meister?
Ich will dich einladen, deine eigenen Grenzen zu überschreiten. Es ist deutlich, dass du hier im Konvent nichts lernen kannst. Morgen früh gehen wir los.
So brach ich mit ihm auf. Seit über drei Jahren waren wir nun schon zusammen unterwegs, immer wieder den Rhein hinauf bis Straßburg und Basel. Vor allem in den Frauengemeinschaften predigte der Meister, weil er fand, dass die Nonnen und Beginen besondere Unterweisung brauchten, weil sie weder an Universitäten noch in unserem Studium generale zugelassen waren. Ansonsten wohnten wir im Kölner Dominikanerkonvent, wo ich neue Bücher über Reisen und neue Landkarten studieren und im berühmten Generalstudium sogar Französisch lernen konnte. Der Meister fragte nicht, was ich vor meiner Zeit als Novize gemacht hatte.
Du bist ein ruheloser Geist, sagte er, du bist durch dich selbst gefährdet. Darum musst du lernen, dass Gott dich hier und jetzt braucht. In jedem Augenblick deiner Existenz. Es gibt keinen fernen Ort, nach dem du dich sehnen musst. Es gibt nur den innersten Funken deiner Seele. Nach innen musst du reisen, nicht zum Großkhan in die Mongolei.
Doch ich wollte nicht nach innen, da war ich schon oft genug gewesen. Zudem war ich mit dem Meister fast andauernd unterwegs. Ich kann nicht sagen, dass mir unsere Wanderungen zu den vielen unbekannten Städten und Landschaften weniger Freude gemacht hätten als die Stunden beim Chorgebet oder bei der Meditation — ganz im Gegenteil. Ob der Meister das bemerkt hatte? Er behielt mich stets in seiner Nähe, ließ mich mit Fragen nach meiner Priesterweihe und dem Studium der Theologie in Ruhe. Und ich ging gerne jeden Weg mit ihm.
Nun führte dieser Weg mich zur Jakobskapelle, in der sich mein Meister am liebsten in seine Gedanken versenkte. Wir müssen, wiederholte er immer wieder, alles hinter uns lassen: Besitz, Hochmut, Wissen, gute Werke. Bis wir schließlich erfahren, dass wir ein Nichts sind. Dann kann Gott in unsere leere Seele einziehen und sein Nichts in unserem Nichts spiegeln. Das ist alles, was wir zur Seligkeit brauchen.
Das waren komplizierte Gedanken, und ich weiß nicht, ob ich sie je richtig begriffen habe. Aber vielleicht war dieses Nichts in meinen Gedanken genau das, was mich jetzt retten sollte.
Ich ging in die Kapelle, sie war leer. Bei schlechtem Licht schaute ich im Gerümpel nach, unter dem wir den Verwundeten gefunden hatten. Ich kniete nieder und strich mit den Händen über den gestampften Lehmboden, stieß aber nur auf allerhand Abfall: Laub, Asche, eine Schnur mit bunten Holzperlen, ein paar zerbrochene Muscheln, wahrscheinlich Kinderspielzeug oder Überbleibsel von Pilgern, die einst ihr Abzeichen hier verloren hatten. Ich steckte die Fundstücke in meinen Beutel, um sie draußen bei besserem Licht zu betrachten. Dann entdeckte ich noch ein paar zerrissene Zettel. Ich raffte auch sie zusammen. Plötzlich öffnete sich quietschend die Seitentür, und das Abendlicht warf den Schatten einer Menschengestalt in den Kirchenraum. Herein kam ein massiger Mann in dunklem Umhang, auf dem Kopf eine schwarze Chaperonne, deren Zipfel ihm schräg über die Schulter hing. In einer Hand hatte er einen mit Leder umwickelten Knüppel. Da wusste ich: Das konnte nur der Bär sein, von dem der Verwundete in der Krankenstube geredet hatte. Ein hungriger Bär, der überraschend behände auf mich zukam.
Hat er euch etwas verraten?, rief er. Rede! Du wirst schon plaudern, ob du willst oder nicht.
Ich hatte genau vor Augen, wie man nach einer Plauderei mit diesem Mann aussah. So schnell ich konnte, sprang ich auf und rannte die paar Schritte zum Hauptportal. Doch das war genau das, was mein Gegner vorausgesehen hatte. Ich zerrte und drückte am Holztor, er musste es von außen verrammelt haben. Schnell war der Riese direkt hinter mir, riss mich bei der Schulter herum, holte mit seinem Knüppel aus und schlug zu. Ich konnte gerade noch den Arm hochreißen, um meinen Kopf zu schützen. Der Schlag tat höllisch weh.
Du wirst schon reden, du Pfaffe!, schrie er.
Aus seinen Augen blitzte mich ein mörderischer Furor an, wie ich ihn noch nie bei einem Menschen gesehen hatte: heiß, wild und freudig, weil er mir nun nach Belieben Schmerz und Leid zufügen konnte. Ich hatte nicht erst beim Meister gelernt, wie wichtig die Leere des Verstandes ist, wenn Überlegung dir nicht mehr helfen kann. Ob die Leere zu Gott führt, wie der Meister sagte, kann ich nicht sagen. Aber mich führte sie zum Leben. Ich hatte im Wald des Nordens meinen Freund Niklas beobachtet, wenn er gelenkig wie ein Zobel im Zweikampf jede Bewegung seines Gegners vorausahnte, blitzschnell auswich und die Kraft des Angreifers mit harten Bewegungen gegen ihn selber richtete. Niklas konnte mit bloßen Händen jedem Angreifer das Messer wegschlagen und ihn dann mit der Faust kaltstellen. Niklas konnte sogar einen Bären besiegen.
Du darfst nicht denken!, hatte er mir eingeschärft. Du musst zur Bewegung werden. Wenn du denkst, ist es schon zu spät. War es bereits zu spät?
In der Ausweichbewegung gegen den Schlag duckte ich mich nach unten weg, riss trotz des stechenden Schmerzes das Knie hoch und rammte es dem Riesen mit aller Macht zwischen die Beine. Gleichzeitig nutzte ich den Moment der Überraschung, um mich loszureißen. Doch als ich weglief, stürzte sich der Mann von hinten auf meinen linken Fuß und klammerte sich liegend daran. Das hätte er nicht tun sollen, denn nun war die Überlegenheit seiner Größe dahin. Ich drehte mich wie eine Eidechse zur Seite, rammte ihm den rechten Fuß fest ins Gesicht, rollte mich rückwärts, sprang auf und rannte zur Seitentür. Im Umdrehen nahm ich wahr, wie dem Riesen Blut aus der Nase rann. Er heulte auf und stürzte mir nach, aber ich war schon draußen.
Vor der Kapelle war ich mir sicher, dass mich der Mann nicht mehr einholen konnte, dafür war er zu massig. Ich rannte Richtung Stadt, an den Fischteichen vorbei, doch als ich mich umsah, musste ich mich wundern. Trotz seiner Körperfülle war der Angreifer, den Knüppel in der Hand, mir dicht auf den Fersen. Was hatte Niklas mir eingeprägt? Bären sind viel schneller, als man glaubt. Ich rannte weiter, kam an die Kapelle der Repenties, lief um einige Bäume und die Residenz des Gasbard de Laval herum. Endlich war ich unter Leuten.
Ruhig!, dachte ich. Nie direkt zu deinem Ziel rennen, wenn du verfolgt wirst!
Zwar atemlos, aber doch wieder bei Verstand, hatte ich plötzlich die Stimme von Niklas im Ohr. Lauf einen Bogen! Sichere dich nach hinten ab!
Das machte ich dann auch, lief beim Fluss an unseren Konventsmauern vorbei, ging schnellen Schritts, aber möglichst unauffällig durch die immer noch belebten Gassen der Nachbarschaft, um wieder zu Atem zu kommen. Dann erst näherte ich mich von der entgegengesetzten Seite der Pforte des Dominikanerkonvents.
Ich hatte einen Plan, ich hatte nachgedacht, das war der Fehler. Kurz vor dem Portal sah ich, wie der dicke Bär aus einer Mauernische hervorsprang und mich mühelos vor dem Eingang erreicht und niedergeschlagen hätte.
Einen Bogen geht man im Wald, wenn man von einem Jäger verfolgt wird und man ihn von der eigenen Spur weglocken möchte. Doch hier war kein Wald. In der Stadt konnte ich meinen Angreifer so nicht ablenken, denn ich trug den Habit der Dominikaner. Sobald der Angreifer mich aus den Augen verlor, musste er einfach zur Klosterpforte gehen, um mich abzufangen. Ich Trottel hatte mit meinem Umweg nur Zeit verschwendet.
Ich drehte mich um und rannte wieder los. Von unserem Konvent aus war die Stadtmitte nicht weit. Nun war ich plötzlich froh, dass es keinen festen Mauerring gab, denn ich konnte mir den Weg aussuchen und brauchte durch kein bewachtes Tor. Ich hielt mich links in Richtung von Saint-Agricol. Die Kirche war eine große Baustelle, und ich hoffte, dass ich mich dort zwischen Sandhaufen und Ziegeln, Gerüsten und Brettern verstecken konnte, während die Dunkelheit kam. Aber dann erschien mir gerade das zu unsicher. Besser in Bewegung bleiben. Anfangs erblickte ich den massigen Mann noch hinter mir im Getümmel der Leute, die unweit vom Brückentor zu den Gasthöfen, Tavernen und Garküchen strömten. Ich hatte den Vorteil, zwischen der Menge durchzuschlüpfen wie ein Fisch. Mein breitschultriger Verfolger teilte die Menschenfluten mit den Armen, aber das gelang ihm nicht so einfach. Ich hörte die Weggestoßenen fluchen und schreien, er geriet immer wieder ins Stolpern. Es war klar, dass er nicht so schnell vorwärtskam wie ich.
Beim Brückentor eilte ich bergauf zum Felsen des Papstes, bog vor dem Palasttor rechts ab ins italienische Viertel. Hier standen die Steinhäuser der ausländischen Banken, die das Geld der Kirche tauschten. Ich hatte mich in den Wochen zuvor zuweilen hier herumgetrieben, um ein paar Brocken der Sprache aufzuschnappen. Die Italiener aus Florenz, Pistoia und Genua hatten ihre eigenen Garküchen, sie ließen ihre Filialen von italienischen Wächtern mit italienischen Hunden bewachen. Drinnen — so erzählte man — befanden sich Steintruhen voller Münzen und vor allem mit Papieren, auf denen ihre Guthaben verzeichnet standen. Zuweilen gingen solche Geldleute in Grüppchen zum Papstpalast, in prächtigen pelzbesetzten Umhängen mit riesigen Ärmeln und hohen Hüten oder bunten Chaperonnes aus Samt. Ich war staunend hinterhergegangen, denn selbst in Köln oder Straßburg hatte ich solch aufwändige Mode noch nie gesehen. Es hieß, dass die eitlen Fremdlinge sogar ihre Frauen aus den Heimatstädten holten, und dass sie niemandem in Avignon über den Weg trauten, am wenigsten dem Papst, von dem sie lebten. Die italienischen Bankiers waren wegen ihrer Arroganz und ihres Reichtums verhasst. Dennoch träumte ich von ihrem Land.
Die Plaça del Cambio, das Herz des Italienerviertels, war an diesem Abend wie ausgestorben. Vielleicht war heute der Namenstag eines Florentiner Stadtheiligen, und die Italiener feierten in ihrer Bruderschaft beim Augustinerkloster. Jedenfalls hatte man die Wechselbänke schon hochgeklappt, und es war außer ein paar Straßenhunden kaum jemand unterwegs.
Da schoss mein Verfolger mit wütendem Grunzen aus einer kleinen Gasse direkt auf mich zu. Ich konnte gerade noch zur Seite springen und rannte wieder los. Aber schon nach ein paar Dutzend Schritten hatte ich die Richtung verloren, wurde unsicher und kehrte unschlüssig auf den Fersen um. Wohin? So gut wie draußen bei unserem Konvent kannte ich mich hier nicht aus. Der Riese kam bedrohlich näher, und ich lief in eine Gasse, die, wie ich zu spät bemerkte, keinen Ausgang hatte. Keine fünfzig Schritte vor mir war eine Wand, im Dämmer klappten gerade die letzten Fensterläden zu. Hohe Mauern rechts und links. Ich saß in der Falle, und hinter mir hörte ich das Lachen meines Verfolgers:
Du kleiner Pfaffe, jetzt bist du dran!
Der Riese sicherte sich noch einmal ab und ging ein paar Schritte zurück, wohl um mit seinem Knüppel irgendeinen Passanten zu verscheuchen, der auf unsere wilde Jagd aufmerksam geworden war. Er wollte keine Zeugen. Ich drängte mich außer Atem an einen Efeubusch. Da hörte ich über mir eine Stimme:
Gib mir die Hand, schnell!
Das Blattwerk tat sich auf, ich konnte einen Arm fassen, der mich zu einer Fensterlaibung hochzog. Ich rutschte ab und hörte schon das Stampfen des Bären.
Da unten ist eine Stufe, stoß dich ab!, hörte ich.
Ich fasste Tritt im dichten Gebüsch. Die Hand umklammerte meinen Unterarm und zog mich durch die Blätter hoch zum Fenster. Ich rutschte kopfüber hinein. Mein Verfolger schrie und rüttelte am Gebüsch, aber er kam zu spät. Wer auch immer mich heraufgehievt hatte, schlug hinter mir die Läden zu, legte einen Riegel vor und sagte: Willkommen in der Carriera!
Kapitel 6
Ich befand mich in einem dämmrigen Kämmerchen, in dem man kaum aufrecht stehen konnte. Der Mann, der mich hereingezogen hatte, schob mich zu einem Fenster an der Gegenseite und blickte mir forschend ins Gesicht.
Du hast mich gerettet, schnaufte ich atemlos.
Sieht ganz so aus, meinte der Mann. Gegen den Wüterich da unten hättest du nicht überlebt. Ich habe ihn in den letzten Tagen schon öfter hier um die Carriera herumstreichen sehen. Der Mann hat einen dicken Knüppel und Hände wie ein Schlachter. Aber um ein Tier zu zerlegen, braucht der kein Messer; er zerreißt es mit bloßen Händen. Was hat er gegen dich? Hast du eine Hure nicht bezahlt, die für ihn arbeitet? Ein theologischer Disput wird es nicht gewesen sein.
Ich weiß es nicht, stieß ich hervor. Er hat mich gejagt, weil ich heute Nachmittag in der alten Jakobskapelle unten an der Rhone einen Mann gefunden habe, dem er alle Knochen gebrochen hat. Der Riese hat mir aufgelauert, als ich später noch einmal wiederkam und irgendwelche Papiere vom Boden aufgeklaubt habe. Von da an hatte er es auf mich abgesehen. Er sucht irgendetwas, das ich nicht kenne. Er hat mich geschlagen, und ich bin ihm quer durch die Stadt davongelaufen. Ich kann nur noch einmal sagen: danke von ganzem Herzen.
Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mir ein Dominikaner für etwas dankt. Normalerweise sind es Flüche und Verwünschungen, die wir Juden von euch zu hören kriegen. Oder die Drohung, uns alle umzubringen, wenn wir uns nicht taufen lassen. Ein Dominikaner in der Carriera! Was für ein Irrsinn! Es war offenbar schon zu dunkel, um deine Kutte zu erkennen.
Ich habe nichts gegen Juden, stammelte ich, ich trage nur den Habit des Ordens, doch ich will niemandem etwas Böses, ich meine, ich habe nichts damit zu tun, dass die Dominikaner …
Du bist kein Inquisitor, willst du sagen? Das sehe ich selbst, dafür bist du noch zu klein. Aber du willst gewiss einer werden. Ich denke, es ist besser, wenn du so schnell wie möglich wieder verschwindest.
Und er zeigte auf den Fensterladen, durch den ich hereingeklettert war: Am besten, ich werfe dich da raus.
Das geht nicht!, rief ich. Da draußen bin ich verloren.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: