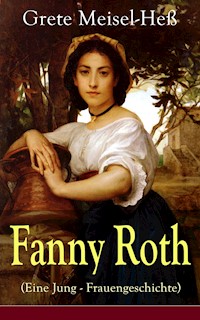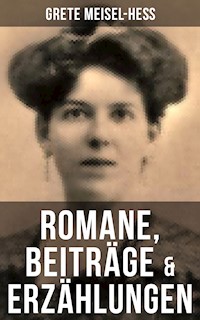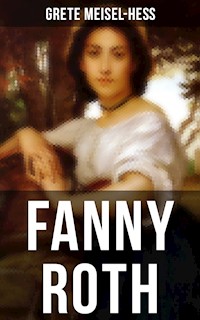1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In ihrem Werk 'Die sexuelle Krise' beschreibt Grete Meisel-Heß die aufkommende sexuelle Revolution und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Durch ihren nüchternen und dennoch einfühlsamen Schreibstil analysiert sie die Veränderungen in der sexuellen Moral und beleuchtet die Befreiung von traditionellen Normen. Mit einem Fokus auf die psychoanalytische Perspektive bietet Meisel-Heß einen tiefgründigen Einblick in das komplexe Thema der menschlichen Sexualität. Ihr Werk steht in engem Zusammenhang mit den soziokulturellen Entwicklungen des frühen 20. Jahrhunderts und wirft wichtige Fragen zur Selbstbestimmung und Freiheit auf. Grete Meisel-Heß, eine prominente österreichische Schriftstellerin und Feministin, wurde durch ihre kritischen Analysen zu Geschlechterfragen und Sexualität bekannt. Als Teil der Avantgarde des Wiener Kaffeehausmilieus war sie eine Stimme des aufstrebenden Feminismus und trug maßgeblich zur Diskussion über Autonomie und Gleichberechtigung bei. Ihr Werk 'Die sexuelle Krise' ist ein herausforderndes und inspirierendes Buch, das die Leser dazu anregt, ihr eigenes Verständnis von Sexualität und Gesellschaft zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die sexuelle Krise
Books
Inhaltsverzeichnis
Vorrede
Diese Arbeit befaßt sich mit einem Thema, über welches dermalen mehr geredet und geschrieben wird, als vielleicht über jedes andere. Wenn aber so viel geredet wird von einer Sache, so ist das immer ein Zeichen großer Not durch sie. So wie der menschliche Körper nur dann gesund ist, wenn man seine einzelnen Teile nicht spürt, so der gesellschaftliche Organismus, wenn sich seine einzelnen Probleme nicht allzusehr aus dem Gesamtgefüge herausheben. Und wenn Hunderte von Stimmen über einer einzigen Frage laut werden, so ist das keinesfalls eine Modeströmung, sondern Not, die nach Ausdruck ringt.
Wenn ich trotz der vielfachen Behandlung der »Frage« den Mut finde, sie zum Stoff einer selbständigen Untersuchung zu machen, so möge diese Kühnheit ihre Rechtfertigung darin finden, daß ich mich dem Problem in einer Art zu nähern suche, in der es bis dahin nicht angegangen zu werden pflegte. Ich fand in all den Werken zur »sexuellen Frage«, die wir heute kennen und lesen, ein Überwiegen entweder des medizinischen oder des anthropologisch-ethnisch-historischen Stoffes, oder die Behandlung der Frage von einer besonderen Seite. Mein Versuch aber soll sich weder mit der Aufzählung der verschiedenen Perversitäten, Anomalien und Krankheiten und der therapeutischen Methoden zu deren Bekämpfung, noch mit der Darstellung des Sexualverkehrs bei den verschiedenen Völkerstämmen befassen (es sei denn dort, wo es zum Vergleiche nötig ist), noch mit einem einzelnen Faktor der »Frage«, sondern mit dem Gesamtproblem und unserer Stellung dazu, mit unserer Not, unserem praktischen Erleben, unserem Dilemma, unserer Krise. Sozialpsychologisch soll diese Krise und in allen ihren Verästelungen, die, aus dem tief verwurzelten Stamm unseres sozialen Gefüges kommend, ins Leben jedes einzelnen Individuums hineinreichen, hier betrachtet werden.
In der zentralsten Region unseres Kulturlebens, dort, wo alle Wege und Ströme des ganzen Riesennetzes zusammenlaufen, sind wir krank. Und alle die vernünftigen und schönen Einrichtungen und Einteilungen, die innerhalb dieses Kulturnetzes getroffen sind, erfüllen nur unvollständig ihre Zwecke, denn alle gesellschaftliche Bewegung nimmt ihren Weg durch diese zentralste Zone, alle Lebenssäfte des ganzen Riesenkörpers strömen von da her – und ist's da nicht »geheuer«, so nützen alle »Errungenschaften« zum Wohlsein derer, für die sie ja schließlich errungen werden, wenig.
Es soll hier voraussetzungslos untersucht werden, warum alle jene Vorgänge, die ihrer Natur nach lebenerhaltend, lebenfördernd und hinaufzüchtend sind, heute nicht selten zu Mächten der Vernichtung, der Hemmung und der Rückbildung werden. Soziale Neugestaltungen, die, durchaus organisch, als Wehr gegen jene Mächte mehr und mehr in der Zeit erstehen – und die Richtung, in die sie die Strömung der »Krise« voraussichtlich lenken werden, zu erkennen, sie aus den schon vorhandenen Anzeichen und Ansätzen zu deuten, wird hier der Versuch gemacht.
Voraussetzungslos – das will heißen: ohne irgendeiner Tendenz zuliebe irgendwelche Zugeständnisse bei der Schilderung der darzustellenden Erscheinungen zu machen. Wer in diesem Buche tönende Verherrlichungen der heute geübten »Verbesserungsversuche«, die der hilflose einzelne in der sexuellen Zwangslage unternimmt, zu finden erwartet, wird enttäuscht sein. Hier soll untersucht werden, was sich begibt, so kritisch und gewissenhaft, als es mir mein Studium und mein Miterleben dieser Krise, in der wir stehen, ermöglichten. Die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, sind zutiefst erlitten worden, aber dieses Erleiden hat mich die Gestalt der Sachlage um so deutlicher erkennen gelehrt. Das vielfältige Material theoretischer Studien ließ mich dann den soziologischen und psychologischen Gesetzen dieser an dem Schicksal der einzelnen in Erscheinung tretenden Krise näher kommen. Alte und neue Forderungen des Sexualgewissens der Gesellschaft, die Formen, in denen diese Forderungen deutlich werden, sowie die Phänomene des Geschlechtslebens selbst sollen hier betrachtet werden. Die Stellungnahme erfolgt pro und contra, immer bemüht, dem »Dinge«, wie es sich in seiner in zahllosen Nuancen erschillernden Wesenheit präsentiert, gemäß zu bleiben. Freilich mit dem Versuch, zu einem Urteil über diese Wesenheit selbst – soweit sie erkennbar – zu gelangen und ohne den Folgerungen, die sich aus der Betrachtung der Sachlage ergeben, auszuweichen. Daß diese verschiedenen Folgerungen sich immer wieder einem gemeinsamen Mittelpunkt zudrängten, überraschte mich selbst. Fast ungewollt erhob sich mir aus dem zerlegten Material etwas wie ein neuer Bau, eine Tatsache, die mir neu bestätigt, was ich triebhaft schon lange geahnt: daß die Dinge das Gesetz ihrer Gestalt in sich tragen und daß ihre morphologische Wesenheit unabweislich zutage tritt, sowie sie in gründlicher und restlos ehrlicher Art in ihre Elemente zerlegt werden.
Der Stoff dieser Untersuchung zerlegte sich mir in drei Hauptabschnitte, deren jeder ein Buch ergibt. Das erste dieser Bücher liegt hier vor. Die Zustände, die sich aus der gegenwärtigen Sexualordnung der Kulturwelt ergeben, sind sein Stoff. Das zweite Buch wird die Reformvorschläge, die zur Entwirrung der sexuellen Krise in unserer Zeit entstanden sind, der Untersuchung und der Kritik zu unterziehen haben. Das dritte Buch bringt den Versuch des Systems einer neuen Sexualordnung, der der Zukunft, die sich, bei Entwirrung der Krise, aus den schon vorhandenen Ansätzen ergeben dürfte.
Da das Material zu dem Gesamtwerk bereits vorhanden ist – es wurde in 2 1/2jähriger, ausschließlich auf diese Arbeit verwandter Tätigkeit zur Stelle geschafft – kann ich die Aufeinanderfolge der Bücher in verhältnismäßig kurzer Zeit in Aussicht stellen.
Daß mein Versuch, dem gewaltigen Problem sowohl seiner universal-sozialen als seiner individual-psychologischen Natur nach gerecht zu werden, ein unvollkommener bleiben muß, ist mir gewiß. Es soll mir genügen, wenn er zu besserer Einsicht, zu stärkerer Tat vorbereitet.
Berlin, Dezember 1908.
G. M.-H.
I. Kapitel
Die Sexualordnung unserer Kulturwelt
»Gib mir, wo ich stehe.«
(Archimedes)
1. Kritik der Ehe in ihrer heutigen Gestalt
Ursachen der zunehmenden Zahl der Zölibatäre – Verkehrung des Werbekampfes.
Zu jeder Zeit gab es irgend etwas, das als »Ordnung« galt. Und wären mit dieser Ordnung alle zufrieden gewesen, so hätten wir uns kaum aus dem Protoplasmaschleim der Tiefsee heraufentwickelt zu dem, was wir sind. Eine bestehende Ordnung für unfehlbar halten, sie aus dem Bereich der Kritik gerückt wissen wollen, hieße gegen jeden Entwicklungsgedanken Front machen. – Das Sexualleben der Kulturwelt basiert auf der Ehe, und die Ehe ist eine »Ordnung«, die des Sinnes durchaus nicht entbehrt. Es fragt sich nur, was diese Ordnung kostet. Solange innerhalb dieser Sexualordnung Mütter auf dem Abort verbluten, wo sie geheim entbinden, Kinder in den Kanälen und bei der Engelmacherin verenden, Frauen zu Dirnen werden, weil ihnen keine andere Existenzmöglichkeit offen bleibt, Syphilitiker, Säufer, Tuberkulöse und Geisteskranke ohne Zeugniszwang verheiratet werden, unerwünschte Kinder zur Welt kommen, für die keine Brotstellen da sind, – sieche, in Verderbnis gezeugte, zum Lebenskampf von Geburt aus unausgerüstete Kinder, die als erwachsene Menschen nur aufhaltend und beschwerend auf den gesellschaftlichen Apparat wirken und ihr eigenes Ich als ekle Last dahinschleppen – solange durch diese Sexualordnung Millionen gesunder Menschen von der Fortpflanzung ausgeschlossen sind, während gleichzeitig, jeder Rassenauslese zum Hohn, jene Elemente am reichlichsten und schnellsten zur Fortpflanzung gelangen, die die »Tüchtigsten« sind – die Ellbogenkräftigsten, Skrupellosesten, der Zeugung gegenüber Unbedenklichsten, wenigst Heroischen – solange ferner Millionen nicht nur an der Fortpflanzung, sondern an naturgemäßem geschlechtlichen Leben überhaupt verhindert sind, teils durch vollkommene Entraffung der Möglichkeiten der Geschlechtsbefriedigung, teils durch Verengung und Erschwerung dieser Möglichkeiten – weitere Millionen nur in der Prostitution dazu gelangen, geschlechtlich zu leben, – solange alle diese Erscheinungen, die sich als die unabtrennbaren Korrelate unserer auf der Ehe ruhenden Sexualordnung erweisen, vorhanden sind, müssen wir diese Ordnung zumindest für höchst reformbedürftig halten.
Nicht selten hört man Ausdrücke der Verwunderung darüber, daß gerade die Frauen es sind, welche gegen die Ehe – als alleiniges Institut des gesellschaftlich legalisierten Geschlechtslebens – Front machen. Und man sagt: die Ehe ist doch für die Frauen da, zum Schutze für sie, nicht für den Mann. Wieso stellen also gerade sie, die Frauen, das Hauptkontingent derer, welche gegen die Ehe (als einziges Monopol des anerkannten, geordneten Geschlechtslebens) auftreten? Und die Antwort, die sich diese Frager selbst geben, lautet: »Die Frauenrechtlerinnen kämpfen gegen die Ehe, weil die Trauben ihnen zu sauer sind.« Stimmt. Jawohl, allermeistens ist die richtige Ehe, wie sie ohne allzu bittere Kompromisse geschlossen werden kann, eine saure Traube. Eine Institution aber, die für Millionen tüchtiger, gesunder, liebestauglicher und zur Elternschaft fähiger Menschen eine saure Traube ist, hat nicht den Anspruch, als alleinige Form des gesellschaftlich erlaubten Geschlechtslebens anerkannt zu werden. In Deutschland allein haben wir ein Plus von einer Million Frauen. Außerdem heiraten überhaupt nur 60% der Männer. Sechs Millionen Junggesellen soll es nach der letzten Zählung in Deutschland geben. Auf diese sechs Millionen Junggesellen kommen acht Millionen »Junggesellinnen«, das sind vierzehn Millionen Ausgeschlossener. Nur durch Übertretung des monogamen Prinzips kommen diese vierzehn Millionen überhaupt zu zeitweiliger Geschlechtsbetätigung, ohne diese Übertretung wären sie, bei gesundem Leibe, zum Leben von Kastraten verurteilt. Nach der Volkszählung von 1900 waren in Deutschland unverheiratete Frauen: im Alter von 18 bis 40 Jahren 44%, im Alter von 18 bis 25 Jahren – also im blühendsten Lebensalter, in dem der Glückshunger der Frau am stärksten ist – 78%! Die Differenz zwischen den beiden Zahlen zeigt zwar, daß 34% dieser Frauen zwischen 25 und 40 Jahren schlecht und recht noch zur Ehe gelangen; meist aber mehr schlecht als recht und unter Kompromissen, die ihnen der Versorgungszwang abnötigt und die den eigentlichen Sinn der Ehe – als »Garten« der Höherpflanzung der Generation und der eigenen Vollendung des Individuums – mehr und mehr Abbruch tun, so daß die außerhalb dieses »Gartens« Stehenden die darin Eingeschlossenen immer weniger zu beneiden Ursache haben. Die Zahl der Zölibatäre wächst denn auch in erschreckendem Maß unter den Frauen sowohl als unter den Männern. Die Ursachen hierfür möchte ich in vier Gruppen teilen: 1. wirtschaftliche, 2. individual-psychologische, 3. rassenbiologische, 4. legislativ-soziale.
Die von der Kulturwelt anerkannte monogame Ehe ruht – noch immer – auf dem Erwerb des Mannes. Des Mannes als Gatten sowohl als des Mannes als Vater, der die Tochter dotiert und ihr damit zur Ehe verhilft. Der Erwerbskampf des Mannes aber wird von Tag zu Tag schwieriger, die Bewertung der Arbeit steigt zwar, gleichzeitig aber, und in höherem Grade, werden die Werte aller Gegenstände der Lebenshaltung von denen, die die Produktionsmittel in Händen haben, höher und höher getrieben. Gleichzeitig wachsen, bei verfeinerter Lebenstechnik, die Bedürfnisse, ihre Befriedigung wird dem einzelnen, auf seine Arbeit Angewiesenen schon für seine Person allein immer schwieriger, immer weniger ist er in der Lage, mehrere Personen davon zu erhalten (zumindest so zu erhalten, daß ihm seine Existenz, im Verein mit ihnen, menschenwürdig erscheinen sollte), immer unmöglicher wird es ihm, auch noch Vermögen für die Töchter wegzulegen, da er ja auch mit der Versorgung seiner selbst für seine alten Tage zumeist auf eigene Ersparnisse angewiesen ist. Frauenarbeit – Miterwerb der Frau – sollte da helfend eingreifen. Dieses Mittel muß aber ein mangelhaftes, durchaus unzuverlässiges bleiben, solange erstens: für den Ausfall am Erwerb des Weibes durch seine Geschlechts- und Fortpflanzungsfunktionen nicht ein Ersatz in vollem Wert dieses Erwerbes geschaffen ist, sei es versicherungstechnisch, sei es durch direkte Initiative der Gesellschaft, die die mit der Fortpflanzung und Aufzucht der Generation beschäftigte Frau in ihren Beamtenstatus einreiht. (Unter welchen Möglichkeiten dies geschehen kann und welche Ansätze zu dieser Gestaltung der Sachlage in der Zeit bereits vorhanden sind, soll an anderer Stelle eingehend erörtert werden.) Diese Geschlechts- und Fortpflanzungsfunktionen nicht zu berücksichtigen, von der Frau, trotz dieser, vollwertigen, regulären Außenerwerb zu erwarten, wie es die Frauenbewegung in ihren Anfängen (wohlgemerkt: nur in diesen) unternahm, hieße von der Frau nicht die gleiche Leistung wie vom Mann, sondern die doppelte, unter Umständen zehnfache verlangen, – und die Menschheit, durch Zermalmung der Mutterkraft, in eine Sackgasse hineintreiben, aus der sie nur schwer lädiert und in ihrer Vervollkommnung um Jahrtausende zurückgeworfen, herausfinden könnte. Die zweite Voraussetzung, unter welcher Frauenarbeit als Mittel erleichterter Eheschließung in Frage kommen könnte, wäre die, daß der Frau – immer solange sie nicht mit Fortpflanzungsarbeit beschäftigt ist – wirklich und mit derselben Selbstverständlichkeit wie dem Mann jede Berufsarbeit, die sie zu leisten vermag, freisteht, daß deren Bewertung die gleiche ist, wie die der vom Manne geleisteten Arbeit – nicht wie heute, wo Frauenarbeit ein Taschengeld für Haustöchter einbringt oder durch Prostitution ergänzt werden muß, um den Unterhalt der Frau zu decken und in der Hand des Unternehmers ein willkommenes Mittel zur Lohndrückerei der Männerarbeit wurde. Drittens müßte endlich, wenn Frauenerwerb die Eheschließung erleichtern sollte, diese als Mittel zur Eheschließung anerkannt werden, d.h. die Frau nicht Amt und Einkommen verlieren, gerade weil sie heiratet, wie heute die Lehrerin, die Staatsbeamtin, in vielen Fällen auch die Privatangestellte. Aus der Zwickmühle: Stelle und Einkommen und Zölibat oder Ehe und Stellenverlust kommen die, die mit dem Verdienst der Frau als Mittel zur Eheschließung rechnen, zumeist nicht heraus. Verdammt aber die Berufsarbeit die Frau zum Zölibat, so muß sie geradezu als antiselektorisches, die Rassenauslese verfälschendes Moment betrachtet werden.
Die Erhaltung der Familie ruht also nach wie vor auf dem Mann, und die Schwierigkeit dieser Erhaltung ist die erste und wichtigste in der Gruppe der Ehehemmnisse, die das Anwachsen der Zahl der Zölibatäre zur Folge haben.
Eine Folgeerscheinung dieser Konstellation, die durch die Aufsaugung der Güter durch den Kapitalismus verursacht ist, ist der enorme »Marktwert« des Mannes, des heiratsfähigen und heiratswilligen Mannes. Damit sind wir in gröbste Unnatur, tief unter den arterhaltenden Zustand, der selbst die wilden Völkerstämme vor Degeneration bewahrt, herabgesunken. Jede Möglichkeit der Auslese der Besten, der Fortentwicklung einer Rasse steht und fällt mit der Wahlfreiheit des Weibes (und des Mannes natürlich). Wenn die Frau in der Lage ist, sich erobern und schwängern zu lassen – vom Stärksten, Tüchtigsten – dann ist die »Auslese« am Werk. Wenn sie aber einerseits noch bezahlen muß (mit ihrer Mitgift) dafür, daß sich überhaupt jemand bereit findet, sie (unter den einzig erlaubten Umständen) zu schwängern, andererseits sich dem Kaufkräftigsten, das ist in unserer »Zone« gewöhnlich ein schon abgetakelter, biologisch durchaus nicht hoch in Anschlag zu bringender Herr, ergeben muß – dann ist ein Prozeß der Herabzüchtung im Gange, der nur durch das heroisch-leichtsinnige Herausspringen der Unbotmäßigen aus dieser »Ordnung« einigermaßen aufgehalten wird.
Bei den Naturvölkern bildet samt und sonders das Mehrbegehrtwerden der Frau die Basis der sexuellen Werbekampfes Auslese. Ein Maori-Sprichwort heißt: »Ein Mann kann noch so schön sein, er wird nicht begehrt; eine Frau mag noch so gewöhnlich sein, so wird der Mann doch begierig nach ihr verlangen.« So ist's bei den Maori, wohlgemerkt! Bei uns ist das strikte Gegenteil der Fall. Frauen von Schönheit und Anmut und allen möglichen Gaben des Geistes und Herzens haben es schwer, »einen Mann zu bekommen«. Der erbärmlichste Wicht aber kann Hunderte von Frauen zur Ehe haben, wie die Fälle der Heiratsschwindler am deutlichsten beweisen. Wo wäre eine Frau, und sei es die reizvollste oder die beste, mit der Hunderte von Männern bereitwillig zum Standesamt gingen, notabene unter Auslieferung ihrer gesamten Ersparnisse? »Bei den Kreuzungen zwischen ungleichen Menschenrassen gehört der Vater fast immer der höheren Rasse an,« berichtet Westermarck. Innerhalb unserer weißen Rasse ist aber, umgekehrt, bei der Paarung zwischen minder- und höherwertigen Typen die entgegengesetzte Tendenz an der Tagesordnung: der degenerierteste Mann an der Seite der schönen, gutentwickelten Frau ist keine Seltenheit, und »ein Mann braucht nicht schön zu sein« ist gerade bei uns zulande eine geläufige, höchst bezeichnende Redensart. Nein, er braucht nicht schön zu sein. Er braucht sie nur zu heiraten, dann kann er ihrer so viele haben, wie weiland Don Giovan.
Mit dieser Konstellation, einer Folge unseres Wirtschaftssystems, sind jene natürlichen Voraussetzungen, von deren Erfüllung das Entstehen immer vollkommenerer menschlicher Wesen abhängt, verrückt, verdreht, auf den Kopf gestellt. Der »Kampf um das Weib«, dieses scheinbar unumstößliche Naturgesetz, das seine tiefwurzelnden Ursachen darin hat, daß das beweglichere, freiere (weil von der Fortpflanzung unbeschwerte) Geschlecht, der Mann, das durch die Begattung gefährdete und beschwerte Geschlecht, das Weib, selbstverständlich umwerben muß, damit es sich der Begattung ausliefere – dieses Fundamentalgesetz auf den Kopf zu stellen, hat unsere kulturelle »Entwicklung« fertiggebracht, indem sie das Weib dahin gelangen ließ, daß es sich sein Begattetwerden noch erkämpfen, erlisten, erkaufen muß, um überhaupt dazu zu gelangen. Indem die Fortpflanzungsmöglichkeit auf eine Institution gestellt wurde, die mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Mannes steht und fällt, wurde die Fortpflanzung selbst Sache des sozialen Kalkuls bei Mann und Weib und hörte auf, eine Erscheinungsform der Zuchtwahl zu sein.
Die individual-psychologischen Ursachen der zunehmenden Ehelosigkeit ergeben sich vor allem aus der zunehmenden Differenziertheit auch der seelischen Bedürfnisse, den wachsenden Anforderungen, die in jeder Hinsicht an das zu wählende sexuelle Komplement gestellt werden. Ein Zustand, der so teuer bezahlt wird – mit der vollen Einsetzung der Arbeitskraft von seiten des Mannes, häufig auch des Weibes – dessen Auflösung immer schwieriger wird, der von hundert Faktoren abhängt, die da alle »stimmen« sollen, damit er überhaupt erreicht wird – der jede weitere sexuelle Wahlmöglichkeit so gut wie abschneidet, hat zur Voraussetzung, daß außer der Übereinstimmung der sozialen Verhältnisse der beiden Kontrahenten auch die individuell-persönlichen Neigungen, Gewohnheiten, Anschauungen der beiden Ehepartner zusammen stimmen. Die Ursache, warum diese Forderung heute stärker ist als ehemals, dürfte wohl in dem Umstand zu suchen sein, daß das Individualbewußtsein, das Klassenbewußtsein oder gar das Nationalbewußtsein des einzelnen mehr und mehr überwächst. Früher vertrat das Individuum in stärkerem Maße als heute den Typus seines Volkes, seiner Rasse, seiner Sprachgemeinschaft, seines Berufes, seiner Zunft und Klasse. Alle diese Gegensätze lösen sich mehr und mehr im kosmopolitischen Individualismus. Innerhalb einer weiten Gemeinschaft konnte der eheliche Partner leichter gefunden werden, weil er hauptsächlich nur die Merkmale eben dieser Gemeinschaft aufzuweisen hatte. Heute aber sollen hundert individuelle Anlagen eines Menschen ihre befriedigende Komplementierung durch einen andern finden, außerdem sollen auch noch die sozialen Bedingungen der Ehemöglichkeit erfüllt sein – was Wunder, daß diese selbst immer problematischer wird. Die Parallelerscheinung dieses Vorgangs ist aber auch die, daß der Geschlechtsimpuls als solcher um so schwächer wird, je schärfer die Analyse ist. Es gibt tausend Mittel, besonders für den Mann, ihn »abzuleiten«, zu »beruhigen«, er kann ihn durch Benützung der Prostitution und des »Verhältnisses« so weit befriedigen, daß er um seinetwillen keine »Dummheiten« macht. Perversionen aller Art, die in allen Kreisen geübt werden, tun das Ihre, die Macht des Sexualtriebes, demzufolge der Mensch begehrend ein geliebtes Wesen an sich reißt und sich ihm verbindet, zu zermürben, ja die stärkere Hinneigung zu einem Wesen anderen Geschlechtes wird meistens von vornherein mißtrauisch als »Gefahr« betrachtet, unter das Seziermesser der Analyse genommen, bis sie glücklich »überwunden« ist. Mit der Brechung und Schwächung der sexuellen Impulse wird zwar so mancher »Sieg der Vernunft« errungen, dem deutlichen Willen der Natur, nach Entstehung bestimmter Kreuzungsprodukte, um dessentwillen sie sich dieses »Triebes«, den man so vernünftig zu besiegen versteht, bedient, aber ein Schnippchen geschlagen.
Die rassenbiologischen Hindernisse stellen nur eine Erweiterung der individuellen dar. Warum ist denn der oder die »Richtige« so schwer zu finden? Vor allem, weil er zur richtigen Zeit, in den richtigen passenden »Verhältnissen« gefunden werden muß. Auf der Welt ist er vielleicht, aber er spaziert vielleicht gerade auf dem Mars, während man sich selbst auf dem irdischen Planeten abmüht. Er würde aber öfter und schneller »gefunden« werden, wenn die Zahl jener Menschen, die durch ihre Persönlichkeit eine andere befriedigen, beglücken können, eine größere wäre. Wenn man dann in diesem Fall – neben den »Richtigen« griffe, wäre er eben auch »richtig«. Was die Gestalten der Einheiten »Rasse«, »Individuum«, »Menschheit« voneinander unterscheidet, ist ja nur ihre Dimension. Quantitativ, nicht qualitativ sind diese Einheiten verschieden. Daß die Rassen degenerieren, heißt, daß zahllose Individuen in ihrer körperlichen und seelischen Beschaffenheit herabgemindert werden und weniger und weniger imstande sind, ihre Glückssehnsucht aneinander zu befriedigen. Daß sich dieser Zustand der herabgeminderten persönlichen Beschaffenheit aber unentwegt vererbt, hat seinen Grund in der Entraffung der Bedingungen einer unverfälschten Auslese, unter deren Zeichen die Kulturmenschheit steht.
Hier schließt sich der circulus vitiosus – wir stehen am Ausgangspunkt unserer Betrachtung.
Gezeugt und geboren – zumindest unter den von der Gesellschaft sanktionierten Bedingungen – wird nur innerhalb einer Institution (der legitimen Ehe), deren Bestand von dem Vorhandensein hunderter sozialer Faktoren abhängt. Die sexuelle Auslese hat da an letzter Stelle Anspruch auf Beachtung. Die Kinder, die durch wirkliche Auslese entstehen könnten – durch die von keinerlei wirtschaftlich-sozialen Bedenken abhängige Verbindung zweier Menschen, die sich aneinander hingeben, weil sie einander gefallen, dürfen nicht geboren werden, werden der Gattung rundweg unterschlagen. Und wenn sie geboren werden, werden sie hineingestoßen in soziale Verhältnisse, unter denen sie verderben müssen. (Daß die »Unehelichen«, deren erschreckende Morbiditätsziffern man als »Beweise« für die schlechten biologischen Resultate der freien Verhältnisse ausspielt, in hohem Prozentsatz zugrunde gehen, ist doch nicht ein »Naturgesetz«, sondern ein Resultat sozialer Mißstände und im Gegenteil die schlimmste Anklage gegen die bestehende »Ordnung«, nicht aber ein Beweis ihrer Notwendigkeit.) Geboren werden die Kinder von Vätern, die im scharfen Lebenskampf ihre besten Energien bereits verbraucht haben, am Seuchenherd der Prostitution ihre biologischen Kräfte verwirtschaftet haben, ehe sie dazu kommen, zu heiraten – die Kinder von Müttern, die von den Gemahlen meist infiziert sind, keine Wahlfreiheit haben, sich dem, den sie lieben, hinzugeben, eventuelle Degenerationsmerkmale mit einer soliden Mitgift zudecken können und gewöhnlich einen passablen geistigen Durchschnitt repräsentieren (denn die Selbständigeren begeben sich nicht leicht der Wahlfreiheit und gelangen daher schwerer zu Ehe und Fortpflanzung). Ferner die Kinder des abgearbeiteten, durch Trunk und Unterernährung geschwächten Proletariates.
Nicht geboren werden die Kinder schöner, junger, starker Menschen, die nichts zueinander führt als ihr Begehren nach einander, ihre Freude aneinander, die deutliche Stimme ihrer ungebrochenen Sexualimpulse. Die dürfen nicht zur Welt.
An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Auch der Wert der monogamen Ehe, als allein anerkannten Instituts der Fortpflanzung, als einziger Basis der Generation, kennzeichnet sich an ihren »Früchten«. Jeder Mann müßte am Anblick jedes Weibes, das im Alter zu ihm paßt, und umgekehrt, jedes Weib an jedem Mann Freude finden, und die Möglichkeit, den richtigen Partner zur dauernden Sexualgemeinschaft unter dieser Riesenzahl begehrenswerter Menschen einer Altersstufe herauszufinden, wäre unter natürlichen Bedingungen ebenso groß, als sie heute gering ist. Statt dessen erfahren wir, daß den meisten vor den meisten schaudert, besonders die Besseren stehen in grausamer Isolierung. Das ist der rassenbiologische Grund der zunehmenden Ehelosigkeit.
Die legislativ-sozialen Ursachen der zunehmenden Ehelosigkeit liegen in der mausefallenähnlichen Architektur des Eherechtes. Kaum sind die Angelockten drinnen, schwupps fällt die Klappe zu. Die Eheschließung ohne Spezialkontrakte von ungezählten Paragraphen ist nahezu eine Lebensgefahr. Sie liefert zwei Menschen, insbesondere die Frau, bis zur lebensgefährlichsten Bedrohung an Leib und Leben und Eigentum an ihren Partner aus. Vermögen, Gesundheit, Kinder, Freiheit – alles das ist einer anderen Person ausgeliefert auf Gnad und Ungnad, und die Befreiung kostet oft übermenschliche Kraftanstrengungen. Die Erschwerung der Scheidung ist mit ein Grund der verminderten Eheschließung. Denn man überlegt es sich, in diese Mausefalle hineinzuspazieren.
Die Abschließung eines Privatkontraktes müßte ebenso obligatorisch werden, als beiderseitige Gesundheitsatteste. Heute ist der eine Partner »beleidigt«, wenn der andere einen Ehekontrakt verlangt. Auch können die hunderterlei Gefährdungen von jedem einzelnen nicht selbst durch entsprechende Paragraphen vorgesehen werden, müßten vielmehr in einem für alle Fälle ausgearbeiteten Schema vorliegen und je nach Bedarf in Anwendung kommen.
2. Das Wesen der ehelichen Gemeinschaft
Das Programm der »Umstürzler«.
Von einem »Götzendienst der äußern Formen und Institutionen, denen die lebendigen Menschen wie einem nimmersatten Moloch geopfert werden«, spricht Meyer-Benfey1. Dennoch ist dieser Trieb nach Errichtung von Formen und Institutionen, die freifließend dahinrasende elementare Mächte auffangen, bergen und verwerten sollen, seinem Wesen nach arterhaltend. Formen, Institutionen – Ordnungen mit einem Wort – sind notwendig, sie müssen nur eben erneuert werden, wenn sie alt und schadhaft geworden sind. Daß gerade die Mächte des Geschlechtslebens einer über ihnen stehenden »Ordnung« bedürfen, die sie »bezähmt, bewacht«, scheint unzweifelhaft. Auch die doppelte Moral, die die gegenwärtige »Ordnung« für Mann und Weib errichtete, war eine Vorkehrung zum Schutze des Weibes und der Generation. Aber eine Schutzvorkehrung, die nur durch Belügung der Natur bestehen kann, verbildet die, die sie handhaben, mehr als sie ihnen nützt. Daß das Weib des Schutzes gegen den Mann im erotischen Verhältnis mit ihm bedarf, haben die Geschlechtstragödien aller Zeiten erwiesen. Nur wird eben die Zukunft verläßlichere Schutzmaßregeln für das Weib und seine kostbare Fracht, das Kind, errichten müssen, als die bisherigen es waren, die darin gipfelten, daß das Weib sich ein geschlechtliches Leben zu versagen hatte, sofern nicht der Mann, dem sie sich hingeben sollte, für alle Zeiten gebunden zur Strecke gebracht war. Diese Tendenz, den Mann zu binden, hatte ihre innerste Begründung dort, wo der Brennpunkt des Kampfes der Geschlechter zu suchen ist: in der Verschiedenheit des Geschlechtsempfindens von Mann und Weib. Ist die »Treulosigkeit« – der polygame Trieb des Mannes – im Gegensatz zum Anhänglichkeitsbedürfnis des Weibes Natur – hat diese Verschiedenheit ihren unveränderbaren Grund in dem von Natur gegebenen Geschlechtsempfinden der beiden – oder ist sie etwa soziale Konstellation, die auf Zahlenfrage, Marktkurs, Angebot und Nachfrage des einen Geschlechts nach dem andern beruht? Erst die wirtschaftliche und moralische Gleichstellung beider Geschlechter kann das erweisen. Ist das Anhänglichkeitsbedürfnis des Weibes im Gegensatz zu dem der Fessel zumeist widerstrebenden, vielfach zugreifenden Geschlechtstrieb des Mannes soziale Konstellation, so ist es jedenfalls schon beinahe zur zweiten Natur geworden dadurch, daß es dem Weib zu schlecht erging, wenn es, ausgeliefert mitsamt dem Kind und vogelfrei ohne den besonderen Schutz eines Mannes – in mehrere Hände geriet. Das Anhänglichkeitsbedürfnis des Weibes würde dann zu den im Kampf ums Dasein gezüchteten Evolutionserscheinungen gehören. Ist diese Verschiedenheit aber Natur – urbestimmtes, unveränderliches Merkmal einer Gattung – ja, dann wird es immer schlimmer stehen um das Weib als um den Mann, »das schwere Dulden ist sein hartes Los« dann unter allen Umständen. Denn der Freiere ist immer der Höhere. Erst die Zeit der gesicherten Mutter wird diesem Problem auf den Grund kommen können.
Daß das Furcht- und Wunderbare der Geschlechtsvorgänge eines Geheges bedarf, hat die Menschheit von ihren Uranfängen an triebhaft empfunden. Westermarck versucht in seiner »Geschichte der Ehe« den Nachweis zu erbringen, daß die eheliche Gemeinschaft selbst bei den niedrigsten Völkerstämmen immer bestanden habe. Er definiert die Ehe als »eine mehr oder minder dauernde Verbindung zwischen Männchen und Weibchen, über die Fortpflanzungstätigkeit hinaus bis nach der Geburt des Sprößlings anhaltend«. Es liegt aber keinerlei Begründung vor, die Annahme, daß nicht vielfach die Herde für das einzelne Elternpaar die Aufgabe der Durchfütterung der Jungen übernommen haben sollte, abzuweisen, zumal die Vaterschaft doch nur bei der (späten) Einehe festzustellen war. Es werden eben mehrere Männchen mit mehreren Weibchen dauernd zusammengeblieben sein, nicht nur um der Jungen willen, sondern zwecks Erleichterung wirtschaftlicher Funktionen und um des Kampfes gegen den Feind willen – aus welchen beiden Instinkten die Tendenz, sich in Gruppen zusammenzuschließen, sich genügend erklärt. Herodot berichtet – ganz im Gegensatz zu Westermarck – von einem nordafrikanischen Stamm: »Sie leben nach der Art des Viehes und kennen kein häusliches Zusammenwohnen mit den Frauen.« Höchst charakteristischerweise ist es immer das häusliche Zusammenwohnen, welches im Bewußtsein aller Völker das Wesen der Ehe ausmacht. Nicht die Geburt von Kindern ist bindend und macht die Geschlechtsgemeinschaft dauernd – erst das dauernde, offiziell erklärte gemeinsame Hausen entrückt Mann und Weib dem gefährlichen Einfluß einer unberechenbaren Naturmacht – der erotischen Liebe – die, nach dem Ausspruch eines modernen Dichters2 »heute gut ist und morgen beißt«, sichert die also Zusammengeschlossenen gegen diese Macht, die, molochartig, immer frische Speisung verlangt, um sich gnädig zu erweisen und stellt die Beziehung auf soziale Hilfeleistung der Sexualgenossen anstatt auf immer neue erotische Inspiration. Und dieses Motiv ist vielleicht das allerentscheidendste für die Unersetzlichkeit der ehelichen Gemeinschaft gegenüber allen anderen Formen des Sexualverkehrs. Nicht diese Gemeinschaft, nicht das eheliche Prinzip ist es, welches die »modernen Umstürzler« bekämpfen, sondern nur die Form, welche dieses Prinzip innerhalb der heutigen Wirtschaftsordnung angenommen hat, die zwangsmäßige Einschirrung, der die Individuen um seinetwillen unterworfen werden und die Abhängigkeit der Fortpflanzungsmöglichkeit und damit der Auslese von dieser einen Form der Geschlechtsgemeinschaft. Diese Form, diese Einmündung des erotischen Lebens des Individuums in eine dauernde sexual-soziale Verbindung mit einem Wesen des andern Geschlechtes, ist, unserer Auffassung nach, diejenige, nach welcher das Individuum, Mann und Weib, ewig streben wird und soll. Aber gerade dieses »Ziel« kann, seinem innersten Sinn gemäß, nur nach Durchschreitung vielfältiger Lebensphasen erreicht werden. Dieser Wechsel auf Ewigkeit soll nicht erpreßt werden müssen. Heute werden die Menschen in eine Sackgasse gejagt, indem einerseits jede andere Sexualbeziehung als die offiziös eheliche gebrandmarkt wird, andererseits alles getan wird, die Ehe zu erschweren, indem sie mit Lasten und Schwierigkeiten verknüpft wird, die die Individuen immer schwerer bewältigen können. Eine Erleichterung des Daseinskampfes ist die Ehe ihrer Natur nach. Heute ist sie eine Sklavenfessel, eine Kette beim sozialen Kampf geworden – sofern sie nicht als Spekulationsmittel benützt wird oder besondere Glückszufälle vorliegen. Die freiwillige Auslese der einander anziehenden Individuen ist die Voraussetzung arterhaltender ehelicher Gemeinschaft. Diese Voraussetzung wird durch die heutige Sexualordnung mit Füßen getreten. Und der Kampf der »Umstürzler« richtet sich nicht gegen das eheliche Prinzip, sondern gegen seine Verstümmelung innerhalb dieser Sexualordnung. Was diese »Umstürzler« erstreben, ist die volle Freiheit für alle rassefördernden Formen des erotischen Lebens und insbesondere für das Werk der Fortpflanzung, soweit diese der reinen Zuchtwahl entspringt. Trotz dieser Freiheit wird das Individuum die endgültige Dauergemeinschaft mit dem bestpassenden Genossen immer suchen, und nur durch diese Freiheit kann es diesen Genossen erkennen und finden. Der heutige Ehezwang verdammt das Individuum, das ihm widerstrebt, zum Zölibat oder zum wilden Geschlechtsleben, das im Gegensatz zum freien hinter dem Rücken der offiziellen Gesellschaft sein wüstes Dasein führt. Sowohl die Zwangsehe als das unfreiwillige Zölibat fortpflanzungstauglicher Individuen als auch das heimliche, jeder Art von Ordnung entrückte »wilde Verhältnis« vergiften die besten Kraftquellen der Menschheit. Daß ohne die offizielle, gesellschaftlich anerkannte Freiheit der erotischen Beziehungen die heimliche Freiheit, die sich einzelne notgedrungen nehmen, wenig gute Resultate für die Rasse sowohl wie für das Glück dieser einzelnen zeitigt, ist gewiß und soll hier nicht nur nicht verschleiert, sondern genau dargetan werden.
1 »Die neue Ethik und ihre Gegner.« Die neue Generation, 4. Jahrg., Nr. 5.
2 Geijerstam.
II. Kapitel
Die Ehe und die Formen und Folgen ihrer Umgehung innerhalb der gegenwärtigen Sexualordnung
»Es ist besser zu heiraten, als zu brennen.«
(Apostel Paulus)
1. Das legitime Moment der Ehe
Analyse des Begriffkomplexes »Ehe« – Die inneren Gefahren des illegitimen erotischen Verhältnisses – »Liebesverdrossenheit«.
Unter dem legitimen Moment der Ehe verstehen wir die unlösbare oder schwerlösbare Verkettung eines Paares durch Gesetze, Sitte und wirtschaftliche Gemeinschaft. Das Prinzip, welches der legitimen Ehe zugrunde liegt, wonach erst das Nest komplett eingerichtet sein muß zur Aufziehung der Jungen und der Vater zur Stelle ist zu ihrer lebenslänglichen Beschützung, andernfalls an Fortpflanzung nicht geschritten, also nicht geheiratet werden soll, dieses Prinzip, welches der legitimen Ehe zugrunde liegt und die Ursache ist aller Schwierigkeiten ihres Zustandekommens, wäre ein ausgezeichnetes, wenn nicht, wie die Erfahrung zeigt, oft, ja meist, wertvolle biologische Elemente dadurch von der Fortpflanzung ausgeschlossen wären. Die Zuchtwahl, wie sie heute spielt, bringt vorwiegend die wirtschaftlich Tüchtigen, welche mit den biologisch und geistig Edlen durchaus nicht identisch sein müssen, einerseits, und den gegen seinen Willen sich übermäßig vermehrenden Proletarier andererseits zur Fortpflanzung. Wir brauchen nur um uns zu sehen, um den Wert dieser »Auslese«, wie sie sich durch die heutige Eheform ergibt, veranschaulicht zu finden. Kaum ein Individuum unter hundert, das der Idee »Mensch« entspräche, das nicht irgendeinen dunklen unberechenbaren Punkt in sich trüge, aus dem alle antisoziale Wucherung krebsartig herauswüchse und das Gemeinschaftsprinzip erschweren würde. Wenn wir in einer Tramway, in einer Versammlung, in einem Konzertsaal oder auf der Straße sind und die Anwesenden ansehen, so faßt uns Verzweiflung über diese Fülle von Häßlichkeit und Stumpfheit, die aus diesen Erscheinungen spricht. Am deutlichsten tritt das in einer Tramway oder in einer Bahn vor Augen, wo man nicht selten staunt, daß unter den zwanzig Personen, die man sich auf ihre Beschaffenheit ansieht, keine ist, die nicht die Merkmale beeinträchtigter oder verbildeter Entwicklung an sich trüge, – keine, die nicht antipathisch wirken müßte durch ihre bloße Existenz. Die tiefste und fruchtbarste Freude aber kann dem Menschen nur wieder durch den Menschen kommen. Diese Möglichkeit wird – bis auf ein Minimum, das ein gnädiger Zufall übrig läßt – durch fortgesetzte Übervermehrung der Minderen, durch fortgesetzte schlechte Zeugung, durch fortgesetzte Verringerung der Möglichkeiten freier Auslese in beschleunigtem Tempo reduziert.
Das Gehege, das die Institution der legitimen Ehe darstellt, bietet seinem Prinzipe nach so viel des Verlockenden, enthält so zahlreiche günstige Momente, daß wir die Abhängigkeit dieses Prinzips von hunderterlei wirtschaftlich-sozialen Faktoren, die seine Erfüllung erschweren, beklagen müssen. Neben der Beschützung der Jungen und teilweise auch der Frau, die durch die dauernde Verbindung des Mannes mit ihr und den Kindern wenn nicht gewährleistet, so doch angebahnt ist und die einzige Form von Mutter- und Kinderschutz bildet, die die Gesellschaft bis heute kennt, – neben diesem Schutz, den lediglich die legitime Ehe heute für Mutter und Kinder bietet und der sie daher unentbehrlich macht, solange nicht eine höhere, festere, verläßlichere Schutzinstanz zur Beschirmung der Generation gefunden ist, – bietet die Ehe innerhalb der heutigen sozialen Konstellation auch die verläßlichste Form zur Herstellung eines Zustandes, der dem Individuum selbst zugute kommt, weil er die Voraussetzung gesunder Entwicklung bedeutet. Dieser Zustand, der heute unter allen Formen des Geschlechtslebens am stärksten durch die Ehe garantiert ist, ist der der »sexualen Versorgung«. Der Ausdruck stammt von Professor Freud. Christian von Ehrenfels, Professor der Philosophie in Prag, auf dessen Vorschläge einer Sexualreform wir später ausführlich eingehen werden, definiert diesen Zustand als »die Zusicherung eines regelmäßigen mühelosen ...... allen Kraftaufwandes des Suchens und Wechselns enthobenen Sinnengenusses, ausgehend von einer sympathischen und befreundeten Persönlichkeit«. Und er schüttet das volle Maß seiner Verachtung über die Anhänger dieses Zustandes aus. Dieser Zustand hat den nicht zu unterschätzenden Vorteil, daß er die Kräfte des Individuums für dessen soziale Leistungen spart, ohne es der Entbehrung genereller Notwendigkeiten auszusetzen. Muß das Individuum – Mann oder Weib – den notwendigen »Sinnengenuß« oder besser gesagt die Auslösung geschlechtlicher Spannung jedesmal neu »erobern« oder gar suchen – so verbraucht es ein starkes Maß seiner Energien auf diese Leistung – die seinem sozialen Werk entzogen werden. Entsagt es dieser Auslösung ganz, so sündigt es gegen die Gesetze seines Stoffes, und die unausgelösten Spannungen erdrücken seine Schaffenskraft.
Außerhalb der Ehe gelangen die Menschen – heute – nur schwer zu normalem geschlechtlichen Leben, nur unter sozialer, hygienischer und psychischer Gefährdung und unter oft peinlichen Begleitumständen; außerdem trägt dieser Verkehr das Merkzeichen des Episodischen, Unregelmäßigen an sich und ist von tausend Stimmungen und Milieuschwierigkeiten bedroht. Das geregelteste und relativ gefahrloseste sexuelle Leben bietet heute noch die Ehe. – Der europäische Mann lebt, außerhalb der Ehe – zwischen zeitweiligen Exzessen einerseits und im Zustand der erotischen Unlust andererseits. »Liebesverdrossenheit« hat Oskar H. Schmitz diesen Zustand genannt. An die Arbeitskraft des Mannes der Kulturwelt werden hohe Ansprüche gestellt, er hat Sorgen, Probleme, Aufgaben und Befürchtungen aller Art, dazu Zeitmangel. Außerhalb der Ehe, die seinem Verkehr mit dem Weibe ein günstiges Milieu bietet, hat er kaum zu irgendeiner anderen Form des sexuellen Lebens Zeit, Muße und Hinneigung als zu der des ungeregeltesten »Besuches«. Für die ärgste Bedrängnis der Sinne hat er den Notausgang der Prostitution. Schon das »Verhältnis« mit dem kleinen, mit seinem Gemüte beteiligten Bürgermädchen wird ihm bald unbequem und die ebenbürtige Geliebte – das Weib, das sich ihm in freier Selbstbehauptung hingibt – fürchtet der moderne Mann geradezu als eine Gefahr. So sonderbar diese Behauptung klingt – so wahr ist sie. Viel eher bringt er es noch mit der »Maitresse« zu einem Dauerverhältnis als mit der Geliebten. Denn die Tatsache, daß er materielle Opfer bringen muß, daß er in eine bestimmte Frau Kapital »investiert« hat, macht sie ihm wertvoll und läßt dem modernen Mann – suggestibel wie er in hohem Grade ist – diese Beziehung als etwas, das man sich zu erhalten suchen muß, erscheinen.
Wenn wir aber auch von dem gemeinen Mannestyp absehen und den höheren ins Auge fassen, so beobachten wir an ihm das Phänomen, daß er die Liebe, d.h. die Sexualbeziehung zum Weibe, die vorwiegend auf tiefe erotische Erlebnisse und dabei nicht auf soziale Gemeinschaft, soziale gegenseitige Förderung, wie sie heute nur die Legitimität bietet – gestellt ist, als eine Gefahr fürchtet, der er entflieht, sobald er sich dazu stark genug fühlt – auch wenn er mit aller Leidenschaftlichkeit dieses Erlebnis suchte. Völlige Enthaltung vom Weibe wäre aber unsozial und unhygienisch, auch bedarf er der Nachkommenschaft und des häuslichen Milieus. Infolgedessen wünscht er die Ehe – eine Gemeinschaft, die ihn erotisch nicht absorbiert, ihm aber den notwendigen Lebenskontakt mit dem Weibe bietet. Aus diesem Punkt ist vielleicht zu verstehen, warum der Mann die »Geliebte«, wenn auch echtes Gefühl ihn mit ihr verband, nach kurzer Zeit meist verläßt. Warum die Geliebte der Gattin gegenüber fast immer auf einem verlorenen Posten steht. Warum der Mann – mehr noch als die Frau – das Heim und die soziale Gemeinschaft mit dem Weibe braucht, um seine Spannkraft nicht gefährdet zu glauben. Darum diese den Männern fast unbewußte Angst vor dem Liebesverhältnis, das sie selbst suchten und knüpften. Darum vielleicht die brutale Abwehr, die Verstoßung der Geliebten. Ein Liebesverhältnis muß heute entweder in Ehe übergehen oder – untergehen. Denn der ganze, der starke Mann, der, der die Liebe ohne Gefahr in seinen Lebenskomplex mit aufnehmen und festhalten kann, ist nicht von heute.
Die Unwilligkeit und Unfähigkeit des heutigen Mannes zur Liebe ist die Tragödie der heutigen Frau, gegen die es nur ein Mittel gibt: ebenfalls in der sozialen Tat (und in der Mutterschaft) Ziele zu finden und die Lebensspannkraft nicht nur von dem Erlebnis mit dem Mann zu nähren.
In früheren Zeiten, besonders in denen des Rittertums, war die Gunst der Frau der Mühe Preis. Die Devise »ich dien« des Ritters galt – nächst Gott – dem Weibe. Dem heutigen überhetzten Geschlecht wird Minnedienst zu Minnefron. Von dem hohen Ideal der Ritterlichkeit war der Mann nie ferner als heute. Darum bedurfte auch die Liebe niemals so sehr des »Geheges« – der von äußeren Mächten abgesteckten Grenzen – als gerade heute. Das soll an dieser Stelle, an der der Jammer dieser Notwendigkeit ins volle Licht gerückt wird, durchaus nicht verschwiegen oder durch Idealisierung der Menschennatur überkleidet werden. Im Gegenteil: voraussetzungslos wollen wir untersuchen, warum dieses Gehege, das wir als der Auslese und Höherentwicklung feindlich, ja als antiselektorisch wirksam erkannten, heute notwendig ist – und unter welchen Bedingungen es überflüssig oder doch in seiner Wirksamkeit verbessert werden könnte.
2. Das soziale Moment der Ehe
Seine Unerläßlichkeit – Das Ideal der sexuell-sozialen Dauergemeinschaft eines Paares – ein ewiges – Dessen Unterschied von der heutigen Dauerehe.
Daß die Aussichten auf Ehe immer geringer, die Hingabe der Frauen immer bedingungsloser, der Wechsel der Beziehungen immer häufiger wird, ist nicht zu übersehen. Einer neuen Ordnung geht logischerweise viel Unordnung voran, und in diesem Stadium halten wir jetzt. »Wie heiratet und verheiratet man«, fragt die alte Fürstin Tscherbatzky in Tolstojs »Anna Karenina« verzweifelt, da es weder mit der französischen noch mit der englischen Methode mehr klappen will. – Im Volk ist der Besitz eines Weibes noch eine Kostbarkeit, um die nicht selten mit Messern gekämpft wird. Das Überangebot an Weiblichkeit ist nur in den »gebildeten« Klassen zu finden. Der sich anbietenden Weiblichkeit gilt das gesellschaftliche Treiben der oberen Stände. Mit allen Mitteln wirbt da die Frau um den Mann. Das Natürliche aber ist, daß der Mann um das Weib wirbt, kämpft, ringt, wütet. Warum das natürlich ist? Erstlich weil, wie schon erwähnt, die Frau der durch die geschlechtliche Vereinigung gefährdete Teil ist, dann weil der Mann das von Natur aggressive Prinzip darstellt. Durch den Bau seines Körpers ist er gezwungen, ein Ziel seiner Begierde zu finden. In ihrer natürlichen Wesenheit aufs gewalttätigste verbildet, in ihren Funktionen zu der befremdlichsten Verkehrung gedrängt – so stehen einander heute die Geschlechter gegenüber. Das legitime Moment der Ehe, von unzähligen äußeren Konstellationen abhängig, mußte dem natürlichen Werbekampf des Mannes um das Weib den Boden abgraben, ihn in sein Gegenteil verkehren. – Dieses Moment der ehelichen Gemeinschaft – das legitime – wird durch eine den Bedürfnissen der Menschennatur besser angepaßte Wirtschafts- und Sexualordnung vielleicht aufzuheben, zu ersetzen, in seiner Wesenheit zu verändern sein. Das Prinzip der Ehe – der Dauergemeinschaft eines Paares – schließt aber neben dem legitimen noch ein anderes Moment in sich, das in seinem Werte unersetzlich erscheint und in jede andere Neugestaltung einer Dauergemeinschaftsform der Geschlechter hinübergerettet werden muß, soll die Menschheit nicht eines wichtigen Haltes verlustig gehen. Dieses Moment ist es, das im letzten Sinne das eheliche Prinzip – über alle Krisen seiner legitimen Erscheinungsform – darstellt, es ist das unentbehrliche Merkmal, ohne die das »Ding« nicht gedacht werden kann, ein hoher Kulturfaktor, der – vom Ansturm, der dem legitimen Prinzip gilt, gefährdet – gerettet und erhalten werden muß. Dieses Moment ist das der offiziellen sozialen Gemeinschaft, die ein Paar eingeht, die wiederum zwei Funktionen erfüllt: einerseits das betreffende Paar nach außen zu schützen – indem durch den unbehindert offiziellen Zusammenschluß die Kräfte der beiden sich mehr als verdoppeln (zwei Energien verbündet, leisten mehr als zwei einzelne, annähernd soviel als drei) – andererseits ihnen Schutz nach innen zu gewähren, gegen die Gefährdung, die einer dem anderen – unverbunden – bedeutet, eine Kunstwehr zu schaffen gegen jene Elementarmacht, »die heute gut ist und morgen beißt«.
Das charakteristische Merkmal der »Ehe« ist, wie wir auch aus der Geschichte der Naturvölker erfahren haben, nicht die Beiwohnung, auch nicht die Schwangerschaft der Frau, sondern der Umstand, daß die Frau das Haus des Mannes teilt und sie sich offiziell als Genossen erklären. Die wirtschaftlich-soziale Gemeinschaft ist ein unerläßliches Attribut der Ehe, alles andere bleibt immer nur ein »Verhältnis«. Nicht nur zusammen »verkehren«, sei es auch dauernd und sei es auch intim, sondern zusammen hausen und wirtschaften und streben, macht – vorausgesetzt natürlich die innere Verbundenheit – die volle Intimität aus. Diese Gemeinschaft erreichbar zu machen, innerhalb einer anderen Sexualordnung, als der heutigen, die in tiefe Unnatur geraten ist und der echten Auslese feindlich entgegensteht – wird die Aufgabe der Zukunft sein. Diese volle häusliche Dauergemeinschaft eines Paares wird in der freiesten Form der Ehe und bei gegenseitiger wirtschaftlicher Unabhängigkeit erreicht werden müssen. Sie wird sich von der heutigen Dauergemeinschaft dadurch unterscheiden, daß ihr keinerlei Zwang anhaftet, daß sie ein Produkt der reinen Auslese und daß sie vor allem nicht die erste, letzte, ausschließliche und alleinige Form des (erlaubten) erotischen Lebens des Individuums und der Fortpflanzung darstellt, daß sie nicht die einzige Karte ist, auf die in blindem, tollkühnem und erzwungenem Hasard das Schicksal einer Gruppe von Menschen gesetzt wird – daß sie nicht die Form ist, in die halbentwickelte Menschen für »ewig« eingeschlossen werden, sondern eine Endphase, in die das geläuterte, in seinem Triebleben beruhigte, zu einer höheren und freieren Bewußtseinsstufe gelangte Individuum – Mann und Weib – eintritt, wenn es den richtigen Schicksalsgenossen ohne jedes Kompromiß, das seine eigene Entwicklung und die der Art schädigen könnte, und im Zustand seelischer und wirtschaftlicher Freiheit gefunden hat. Den Weg zu diesem Ziel werden wir in einem noch entfernten Abschnitt dieses Buches darzustellen haben. Für jetzt gilt es, den Zustand, den wir als »Ehe« begreifen, zu analysieren und darzutun, welche Elemente dieses Komplexes ihm wesentlich sind und welche andere vorübergehenden Zeitkonstellationen entspringen, die bei der Entwirrung der Krise, in die wir mit unserer gegenwärtig gültigen Sexualordnung geraten sind, entfernt werden, von selbst zerstieben, zerfallen, weggeweht werden müssen beim Anhauch des freigewordenen Lebensbewußtseins der Persönlichkeiten – und welche andere Elemente dieses Komplexes bleibend, weil wesenhaft, der Gattung unentbehrlich und darum, wenn auch in veränderter äußerer Gestaltung – ewig sind.
Das soziale Element der Ehe halten wir für ein ewiges Bedürfnis der Menschheit. Der deutliche und öffentliche Zusammenschluß aller Faktoren, auf denen die Existenz zweier Menschen ruht, ist zu ihrer vollen Befriedigung aneinander notwendig. Das tief Unbefriedigende einer Sexualbeziehung, die nicht auch auf Verknüpfung der beiderseitigen Lebenssituation beruht, ist nicht zu leugnen. Auch ist dieser Zusammenschluß aller Verhältnisse, und so eng als möglich, notwendig, da damit ein Widerstandszentrum gegen äußere Mächte, die zwei Menschen auseinanderreißen wollen, geschaffen ist. Es nutzt im Kampf gegen diese Mächte wenig, die Herzen zu verknüpfen, wenn nicht auch die tausend Bande der gemeinsamen sozialen Situation das Paar eng umschlingen. Auch kann das Individuum im Kampf gegen eine Welt von Widersachern fast noch eher des Geliebten entbehren als des Genossen. Den Dauergenossen zu finden, wird daher immer das instinktive Streben des Individuums bleiben und der durch äußere Zwangsverhältnisse erzwungene Wechsel des Weggenossen als arge Bitternis empfunden werden, zumindest von solchen, die ein erotisches Erlebnis als ein Stück ihres Schicksals empfinden. In jeder Phase seines Lebens eine neue Gemeinsamkeit, eine neue Sexualkameradschaft suchen zu müssen, wird ebenso schwer empfunden werden, als das Gegenteil, das erzwungene Verharren in einer ihrem innersten Wesen nach überwundenen Geschlechtsgemeinschaft. – Die offen eingestandene sexual-soziale Beziehung eines Paares ist schon deswegen nötig, weil ohne diese Offizialität ihre Beziehung der guten Genien der gemeinsamen Freunde, der gemeinsamen Erlebnisse in der Außenwelt entbehrt. Eine Beziehung, die auf ein heimliches tête-à-tête beschränkt bleibt, trägt schon Krankheitskeime in sich. Daran – an dieser erzwungenen Heimlichkeit – scheitert heute so oft das »freie« Verhältnis, darum ist ein solches Verhältnis heute tausendmal unfreier als die gebundenste Ehe. Die Akkreditierung der Gesellschaft auch solchen Verhältnissen gegenüber, die in der Entwicklung jugendlicher Menschen nur eine vorübergehende Phase bedeuten können, wird eines der ersten Gebote einer Sexualordnung sein, die der sexuellen Lüge und Heuchelei, in deren Zeichen die heutige Gesellschaft steht, zu Leibe gehen will. Die Forderung nach dem »provisorischen« Weib und dem »provisorischen« Mann – die einander für die zwingendsten Ansprüche der ersten Jugendjahre genügen, aber nur während dieser und nicht mehr später – das ist etwas, womit zu rechnen die Gesellschaft wird lernen müssen. Heute wird die Tatsache dieser Forderung, die sich aus der Kreuzung natürlicher und kultureller Bedürfnisse ergibt, zurückgeschoben, gewaltsam »ignoriert«, und die sich aus ihr ergebenden Konsequenzen werden in die dunkelsten Winkel gedrückt, verleugnet, verfemt. Was die »zehn Jahre der Folter« – vom Alter der vollen Pubertätsreife bis zu dem der heiratsfähigen »Gesellschaftsstütze« – für den Mann bedeuten, hat uns Strindberg gesagt. Was sie für die Frau bedeuten – wird vielleicht noch zu sagen sein.
Leichte Lösbarbeit, aber immerhin offizielle Knüpfung des Bandes scheint die Form, welche den seelischen Ansprüchen unserer und der nächsten Generationen am besten entsprechen dürfte. Mit der Anerkennung dieser Leichtlöslichkeit muß aber das Verständnis der Gesellschaft für wiederholte Eheschließungen einer Person Hand in Hand gehen. Nichts ist natürlicher, als daß im Lauf eines Lebens die richtige Verbindung sich erst nach wiederholten »Versuchen«, wenn überhaupt, ergibt. Die Moralheuchelei, welche sich z.B. über den »dritten Mann« einer Frau entrüstet, gehört zu den widerlichsten konventionellen Lügen. Hat doch fast jeder Mann eine lange Reihe von Frauen in seinem curriculum vitae zu verzeichnen. Wie soll auch, bei der unberechenbaren Charakterzusammensetzung der meisten Menschen und in Anbetracht der Tatsache, daß man die deutliche Kenntnis eines Menschen erst während des Zusammenlebens mit ihm – jedenfalls erst nach der physischen Vereinigung – erwirbt, des weiteren, daß man auch zur Kenntnis des eigenen Charakters und seiner Nötigungen erst nach und nach gelangt – wie soll da die richtige Gemeinschaft so leichthin auf den ersten Griff zu finden sein?
Die Freiheit, ein Band zu lösen, wenn es unerträglich geworden scheint, müßte nicht nur durch das Gesetz, sondern auch durch die moralische Wertung der Gesellschaft gewährleistet sein.
3. Das Suggestionsmoment der Ehe
Kritik der freien Liebesverhältnisse von heute – Die Gefahr der vogelfreien Sexualgemeinschaften – Die Gefahr der »probelosen« Ehe – Die historische Probeehe – Das Konkubinat.
Jene Form des Zusammenlebens der Geschlechter, welche heute durch die Ehe repräsentiert wird, bewahrt das Individuum vor vernichtender Einsamkeit, verhilft ihm zu einem geregelten Geschlechtsleben, zu erleichterter Elternschaft und zur sozialen Zugehörigkeit zu einem anderen Menschen, resp. zu einer ganzen Gruppe. Diese Form des legitim-sozialen Zusammenlebens hat aber noch einen anderen Vorzug, der im Hinblick auf die Suggestibilität des menschlichen Gemütes nicht zu unterschätzen ist: daß die legitime Ehe das Gefühl des »Verheiratetseins« mit sich bringt, ist ihr schönster Vorzug, wenn er auch gerade am allerhäufigsten mißbraucht wird.
Die Liebesgemeinschaft als Experiment hat ein gefährliches Element in sich. Das ist die Voraussetzung, auf der sie beruht, selbst. Nicht wirtschaftliche und soziale, nicht moralische Gründe sprechen so sehr für eine offizielle Eheschließung als dieses Moment, dessen Gefährlichkeit nicht zu übersehen ist, eben diese Suggestibilität des menschlichen Gemütes. Die Gewißheit, daß die Gemeinschaft jeden Augenblick aufhören kann zu bestehen, daß sie Gefühlskrisen gänzlich ausgeliefert ist, gibt ein unbehagliches, unsicheres Gefühl von vornherein. Sie widerstreitet übrigens vollständig der Idee der Liebe, welche seit den Zeiten des Urmenschen danach verlangt, den wirklich geliebten Menschen sich zu verbinden. »Verbindung«, dieser Ausdruck der intimsten Gemeinschaft, enthält ja schon in seinem Stamm den Begriff »binden«. Diese Suggestion der Unverbundenheit entzieht den Liebenden den Boden der Sicherheit, der Unbefangenheit. Die fortgesetzte »Werbung« beider Teile um einander, welche ernste moderne Reformatoren, gewiß aus tief sittlichen Motiven heraus, verlangen, birgt aber wieder die Gefahr in sich, daß sie gerade das entgegengesetzte Resultat zeitigt, indem allzuviel Bemühung des einen Teils um den anderen, diesen – besonders den Mann – nicht selten erkalten läßt. – Auch ist diese beständige erotisch-seelische Emotion wenig geeignet, die Menschen in jene ruhige, starke, nüchterne und freie Stimmung zu bringen, die zu ihrem sozialen Schaffen notwendig ist. Gerade heute, wo für die »freie Liebe« so viele Lanzen – und von edlen Händen – gebrochen werden, können wir nicht umhin, die inneren Gefahren eines solchen Verhältnisses – zumindest unter der heutigen sozialen Konstellation und in Anbetracht des vorhandenen Menschenmaterials – zu beleuchten, wenn wir auch weit entfernt sind, die Momente, die gerade heute zur Knüpfung solcher Bündnisse führen, in ihrer zwingenden Gewalt zu unterschätzen und, natürlich noch weiter entfernt, von der sozialen Massenlüge der Verurteilung solcher Verhältnisse.
Diese innere Gefahr indessen besteht und nimmt in der »Praxis« des freien Verhältnisses größere Dimensionen an, als man meinen sollte.
Im freien Verhältnis erwarten die Leute eine fortwährende »Anregung« voneinander, eine Voraussetzung, die bei der Ehe wegfällt und durch soziale Gemeinsamkeiten ersetzt wird. Das freie Verhältnis nimmt das Individuum über Gebühr in Anspruch und bietet dabei weniger persönlichen Kontakt mit dem Partner als die eheliche Gemeinschaft. In der Ehe fallen, durch die gesicherte Gemeinsamkeit des Milieus, viele Gründe zu Reibereien und Gereiztheiten fort – natürlich ist hier von solchen Paaren die Rede, die gerne zusammen sind. Ein Verhältnis, das abhängig ist von Stimmungen und Milieuschwierigkeiten, entbehrt des Friedens. Insbesondere diese letzteren sind die ärgsten Feinde der unverbunden Liebenden. Außerdem birgt die äußere Form des Liebesverhältnisses, das nicht auf sozial anerkanntes gemeinsames Hausen gegründet ist, die Besuchsform, eine schwierige »technische« Aufgabe. (Das wesentliche Merkmal der ehelichen Gemeinschaft ist, wie wir erfahren haben, die gemeinsame Häuslichkeit, daher auch das Konkubinat ehelichen Charakter trägt, sobald es der offiziellen Anerkennung nicht entbehrt.) Die Besuchsform ist, insbesondere in Anbetracht der Arbeitsüberbürdung der Männer und neuerdings auch teilweise der Frauen, wie gesagt, geradezu eine »technische« Schwierigkeit. Wann und wo und wie sollen die Leute einander sehen und wie sollen sie die knappen Stunden ausfüllen, um die beste Befriedigung in ihnen zu finden! Wenn die Frau die »besuchte« ist, verbraucht sie nicht selten zuviel ihrer geistigen Energie, ihrer seelischen Spannkraft in Erwartung dieses Besuches, insbesondere da ja im Getriebe des modernen Lebens mit Verhinderungen gerechnet werden muß, die zerstörend auf das nervöse Gewebe, das sich im Zustande der Erwartung befindet, wirken müssen. Für den Mann wieder ist die Regelmäßigkeit dieser Besuche oftmals mehr, als ihm seine Zeiteinteilung erlaubt. Dazu kommen – unter den heutigen Verhältnissen – die Erschwerungen, die das Aufrechthalten der Heimlichkeit des Verhältnisses verursacht. So entstehen bald Mißhelligkeiten, vor allem aber ist gewöhnlich, durch die Technik des Wartens, Verabredens, Treffens, Verfehlens, ein peinlicher Kraftverbrauch zu verzeichnen. Das »Warten« auf irgend jemandes Besuche, das bei den Frauen nicht selten zu qualvollem »Harren« wird, ist der Tod der inneren Freiheit.
Die Frau in solchem Verhältnis hat gewöhnlich auch noch einen anderen Feind. Das ist die asketische Stimme im modernen Mann, die gerade unter der Suggestion, daß es sich um ein »Liebesverhältnis« handle, am schnellsten laut wird. In der Ehe steht das suggestible Tier kat exochén, der Mann, unter dem Eindruck, durch den Verkehr mit dem Weibe und der Familie auch seine Pflicht zu erfüllen. Das beruhigt ihn. Beim »Liebesverhältnis« beängstigt ihn bald die Suggestion der »Lust«. Besucht er seine Freundin regelmäßig, so erscheint er sich bald als eine Art Tannhäuser in Duodezausgabe. Und es ist kein behaglicher Gedanke für eine Frau, für jemanden den »Sündenpfuhl« zu repräsentieren. Die Ehefrau genießt, wenn sie geliebt wird, alle Freuden der Liebe, ohne daß die gemeinsame Kemenate als der Hörselberg erschiene, den man fliehen müsse, um seine Mannheit zu retten.
Die Geliebte kostet Zeit. Diesen Vorwurf hat die Ehefrau nicht zu ertragen und »hat« den Mann doch, d.h. lebt mit ihm, sieht und spricht ihn, ohne daß er zu diesem Zweck seine Zeit zu »Besuchen« verwendet. Die asketische Stimme des Mannes rechnet die Zeit nach, die diese Besuche ihm kosten, die besuchte Frau wieder hat die Aufgabe, diese seine kostbare Zeit »anregend« auszufüllen. Die Ehefrau hingegen hat nicht nötig, während sie mit ihrem Manne ist, immer anregend zu sein. Bleierne Stunden sind im Leben unausweichlich. Wenn sie sich bei den Besuchen der Liebenden einstellen, genügen sie, das Verhältnis zur Auflösung zu bringen. – In der Ehe ist man füreinander jederzeit erreichbar, ohne umständliche mise en scène, man verbringt nicht lange kostspielige Stunden mit Konversation und erotischem Geplänkel und ist dabei doch in engstem Kontakt, schöpft Kraft durch die gegenseitige Nähe und die Möglichkeit, sich jederzeit aussprechen zu können. Auch die Gefährdungen psycho-physischer Art, die die erzwungene Trennung Liebender um die grauende Morgenstunde mit sich bringt, der »Lendemain«, an dem das Tagwerk nur mit einem Bruchteil von Kraft vollbracht werden kann – all dies gehört mit zu dem Komplex von Schädlichkeiten, die die Hausgemeinschaft Liebender notwendig erscheinen lassen. Und dabei hängt das »freie Verhältnis« – darüber können wir uns nicht täuschen – in der Luft, lebt von einem Tage zum anderen, abhängig von jeder Stimmung, jeder Störung, äußeren und inneren Feinden – Dämonen – ausgeliefert. Das wissen die Beteiligten. Und einer von beiden – manchmal beide abwechselnd – »zittert« um den Bestand des Glückes. Die psychologisch bedenkliche Folge dieses Umstandes ist die, daß die auf diese Art vereinigten Menschen eigentlich niemals ganz unbefangen miteinander werden. Ein ewiges Berechnen und Erwägen aller möglichen Konstellationen, eine gefährliche Beobachtung der eigenen Haltung und der des anderen sind die Begleiterscheinungen dieser Form des Liebeslebens. Das kostbarste Erleben, das Menschen gemeinsam haben können, wird geschmälert: die Hinwendung zum Objekt. Das gefährliche persönliche Moment läßt die innere Freiheit, die zu dieser Hinwendung nötig ist, nicht aufkommen. Erst das Bewußtsein des »Geheges«, das den Bestand des Verhältnisses gegen jene »Dämonen« schützt, gibt Frieden.