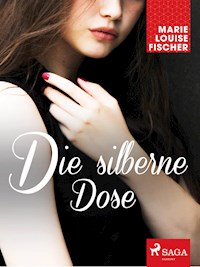
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Monte van Millendonk wird durch einen anonymen Brief aufgefordert, an der Silvesterfeier bei Cleo teilzunehmen. Das allein weckt schon ihr Interesse, aber es soll dort zudem eine Sensation geben. An der Party nimmt auch der Schauspieler Robby teil. Gegen Mitternacht geschieht es dann, Robby stirbt. Vorher hatte er eine Tablette aus Cleos silberner Dose genommen. Der Zusammenhang ist unschwer herzustellen, diese Pille muss vergiftet gewesen sein. Mit Hilfe eines Hausarztes kann der Mord zwar noch einmal vertuscht werden, doch Monte van Millendonk will sich damit nicht zufrieden geben. Ihre Neugier ist geweckt und sie ist fest entschlossen, das Geheimnis der silbernen Dose zu entschleiern.Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei der Prag-Film. Da sie die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945 interniert und musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951 ihren ersten großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu einer überaus erfolgreichen Unterhaltungs- und Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien am Chiemsee.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie Louise Fischer
Die silberne Dose
Roman
SAGA Egmont
Die silberne Dose
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof A/S
Copyright © 2017 by Erbengemeinschaft Fischer-Kernmayr, (www.marielouisefischer.de)
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1945 by Goldmann Verlag, Germany
All rights reserved
ISBN: 9788711718629
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
1
Wenn ich mir jetzt, da alles vorüber ist, überlege, wie es dazu kam, daß ich in die Kette jener merkwürdigen und gefährlichen Ereignisse hineingezogen wurde, die Silvester ihren Anfang nahm, so komme ich zu dem Schluß, daß nicht der anonyme Brief die eigentliche Ursache war.
Den Brief hatte ich ja schon am Vormittag bekommen, und ich hatte ihm durchaus keine besondere Beachtung geschenkt. Natürlich war ich etwas erstaunt, vielleicht auch ein wenig verärgert, aber das war auch alles. Seitdem ich mich im Sommer allzu intensiv mit dem Fall Sybill Herbst befaßt hatte, brauchte ich für den Spott meiner lieben Freunde wahrhaftig nicht mehr zu sorgen. Ich war überzeugt, daß dieser anonyme Brief nichts weiter als ein schlechter Scherz war; ich hätte ihn wahrscheinlich ins Feuer geworfen und vergessen, wenn ich für den Silvesterabend nicht mit Florian Maria Reinberger verabredet gewesen wäre, schon seit Tagen, und wenn er nicht …
Es mag gegen vier Uhr gewesen sein am Nachmittag des 31. Dezember; es dämmerte bereits.
Ich hatte gerade den alten Nagellack von meinen Nägeln entfernt, als ich wieder einmal aufsah, und da bemerkte ich, wie eine große Gestalt aus dem Torweg kam und sich auf der freigeschaufelten Bahn dem Hinterhaus näherte. Noch bevor ich das Gesicht erkennen konnte, wußte ich, daß es Florian war. Geschmeidig und elastisch wie ein Raubtier auf Beutegang überquerte er den Hof. Er hatte die Hände in den Taschen seines Überziehers vergraben, den Kragen hochgestellt und sah nicht zu meinem Fenster auf.
Einem ersten Impuls folgend, wollte ich aufspringen und zur Tür laufen, aber dann bremste ich mich noch rechtzeitig.
Erst als es klingelte, sehr fordernd dreimal hintereinander, stand ich auf, ging in den kalten, düsteren Flur hinaus, machte Licht und öffnete die Wohnungstür.
»Hallo, Florian!«, sagte ich. »Kommen Sie herein!«
Er nahm meine Hand und hielt sie fest zwischen seinen warmen, kräftigen Fingern. »Net bös sein, Muckerl … Mein Taxi wartet!«
Ich begriff nichts und blickte in seine feuchten braunen Tieraugen; er ließ meine Hand nicht los.
»Sein S’ net bös, Engelein«, wiederholte er.
»Aber … was ist denn los?« wollte ich wissen.
»‘s wird nix mit uns heut’ abend«, erklärte er, »net bös sein! An Verleger aus Wien …«
»Ach so!« Ich entzog ihm meine Hand.
»Wir holen’s nach, Muckerl … an andermal! Ganz gewiß!«
»Kann ich … Kann ich nicht mitkommen?« schlug ich vor.
»Naa, das geht net, leider! Da muß ich ganz alleinig …«
»Na schön«, sagte ich, »dann viel Spaß!«
»Net traurig sein, Engelein!«
»Wieso denn?! Ich könnte schreien vor Freude!«
Da standen wir uns nun zwischen Tür und Angel gegenüber, stumm, und sahen uns an. Mich fror.
»Vergebung«, murmelte Florian.
»Ihr Taxi wartet, Herr Reinberger!«
Er lüftete kurz den Hut, seinen breitrandigen Steirerhut, lächelte mit weißen Zähnen, drehte sich um und ging. Das Herz zog sich mir zusammen. Beinahe wäre ich ihm nachgelaufen, um nur nicht im Bösen mit ihm auseinanderzugehen, aber dann warf ich die Wohnungstür ins Schloß und ging in mein Zimmer zurück.
Draußen hatte es wieder angefangen zu schneien, ich setzte mich in den Erker und zündete mir eine Zigarette an. Florian war schon im Torweg verschwunden. Ich rauchte, starrte in das Schneetreiben und dachte über mein verfehltes Leben nach. Man darf sich eben nie auf etwas freuen, dachte ich, nie. Ich war traurig, wütend, maßlos enttäuscht.
Es dauerte eine Zeit, mindestens drei Zigarettenlängen, ehe ich mich wieder gefaßt hatte.
Was sollte ich jetzt mit dem Silvesterabend anfangen? Alle Verabredungen und Einladungen hatte ich abgesagt, und törichterweise hatte ich dabei noch geheimnisvoll durchblicken lassen, daß ich für den letzten Abend im Jahr etwas Besseres vorhatte. Ich seufzte tief, stand auf und knipste die Stehlampe an. Dabei fiel mein Blick auf den anonymen Brief, der am Morgen im Kasten gelegen hatte.
Der Absender hatte vollständige Worte und einzelne Buchstaben aus einer gewöhnlichen Tageszeitung ausgeschnitten und aneinandergefügt. Ich las den Text wieder und wieder:
wenn sie SilvesterfeiEr Bei cleo Sintesius besuchen werden sie als AmateurdeTektivin etwas sehr interessantes erleben
Cleo Sintesius – ich kannte sie nur flüchtig, sie war eine junge Schauspielerin, die sehr im Kommen war. Sie hatte auf mich einen tiefen Eindruck gemacht, es war unzweifelhaft etwas ganz Besonderes an ihr: sie war so zart und licht, so sehr sensibel, ein überaus liebenswertes Mädchen. Es konnte mich schon reizen, den Silvesterabend bei ihr zu verbringen, wenn ich auch überzeugt war, dort nichts Geheimnisvolles oder gar Kriminelles zu erleben. Aber leider kannte ich Cleo nicht gut genug, um mich selber bei ihr einzuladen.
Ich überlegte, wer wohl noch auf dieser Silvesterfeier sein würde. Helm Ritter natürlich, das war sicher. Helm Ritter war Cleos Partner in dem neuen Stück, ›Schneekönigin‹ von Jan Guntram, das Anfang Januar uraufgeführt werden sollte. Aber an Helm Ritter konnte ich mich noch weniger wenden, er war ein verschlossener und eigenartiger Mensch, aus dem man schwer klug werden konnte. Ich erinnerte mich gut, daß ich einmal bei einer Drehbuchbesprechung unvermittelt eine Frage an ihn gerichtet hatte, worauf er mich mit seinen eisblauen Augen gemustert hatte, daß ich mir wie ein lästiges und unangenehmes Insekt vorgekommen war. Nein, mit Helm Ritter war es auch nichts.
Aber Robby! Ja, Robby würde mir sicher helfen. Er war der Freund von Helm Ritter, und wo Helm Ritter war, da würde auch Robby sein.
Ich nahm das Telefonbuch vor, suchte Robbys Nummer heraus, wählte und wartete ein bißchen aufgeregt. Hoffentlich war es nicht Helm Ritter, der an den Apparat kam; die beiden wohnten ja zusammen. Aber es meldete sich niemand, weder Ritter noch Robby.
Wo konnte Robby stecken? Im Theater? Das war ziemlich unwahrscheinlich. Auf der Redaktion? Auch unwahrscheinlich genug, aber immerhin, man konnte es versuchen.
»Monte van Millendonk«, sagte ich, als sich eine weibliche Stimme meldete, »könnte ich Mr. Benett sprechen …? Ja, Mr. Robert S. Benett!«
Absichtlich wählte ich die Bezeichnung ›Mister‹, denn ich wußte, daß Robby, der noch nie in Amerika gewesen war, dennoch oder vielleicht gerade deshalb, auf seine amerikanische Staatsangehörigkeit großen Wert legte.
»Einen Augenblick, bitte!« Es klickte im Apparat, und die Setzerei meldete sich.
»Ich möchte Mr. Robert S. Benett sprechen«, wiederholte ich mein Anliegen.
»Einen Augenblick!«
Dann, nach einer kleinen Weile, meldete sich wahrhaftig Robby.
»Robby …!« freute ich mich. »Fein, daß ich dich aufgegabelt habe!«
»Wo brennt’s denn, Mädchen?« fragte er, leichten Spott in seiner hellen Stimme.
»Nirgends! Das ist es ja eben! Es ist nur … Man hat mich versetzt heute abend!«
»Welcher Jammer!«
»Und ich dachte«, fuhr ich fort, »ich wollte dich bitten, ob du nicht heute abend …«
»Geht nicht, Mädchen. Tut mir wirklich leid.«
»Ach …«
»Ich bin eingeladen … bei Cleo Sintesius.«
»Schade«, meinte ich, »da kann man natürlich nichts machen.«
»Tut mir leid«, wiederholte er.
»Dann entschuldige bitte, Robby. Viel Spaß für heute abend!«
»Halt!« rief er. »Nicht einhängen, hörst du? Ich habe eine Idee … Komm doch einfach mit!«
»Zu Cleo Sintesius …«
»Warum denn nicht?«
»Ich kenne sie doch kaum.«
»Macht fast gar nichts. Paß auf, ich hole dich ab … So um neun herum.«
2
Robby kam früher, als ich ihn erwartet hatte, schon kurz nach acht Uhr, und ich war noch nicht ganz mit meiner Toilette fertig.
»Bitte komm doch einen Augenblick herein«, bat ich, als ich ihm die Tür öffnete.
Er gab mir seine schmale Hand, deren zartes Gelenk, das aus dem Ärmel seines schweren braunen Ledermantels hervorlugte, unwahrscheinlich zerbrechlich und rührend wirkte.
»Es ist wirklich nett von dir, Robby«, erklärte ich, während ich neben ihm her ins Wohnzimmer ging, »daß du dich um mich armes Mauerblümchen kümmerst!«
Er grinste. »Ein Mauerblümchen habe ich mir eigentlich anders vorgestellt.«
»Wie denn?«
»Nicht so rothaarig.«
»Das ist nur äußerlich«, behauptete ich.
Er setzte sich auf einen meiner wackeligen Stühle und zündete sich eine Zigarette an, indes ich mir vor dem Kleiderschrankspiegel das Haar bürstete.
»Wer kommt denn alles heute abend?« erkundigte ich mich.
»Na, die üblichen Figuren.«
»Leider habe ich keine Ahnung, wer bei Cleo Sintesius die üblichen Figuren sind.«
»Na, Helm.«
»Ja.«
»Ftatateta natürlich.«
«Tatateta?«
»F-tatateta!«
»Wer ist denn das?«
»Was, du kennst Ftatateta nicht?«
»Warte mal«, überlegte ich, »Augenblick! Natürlich! Ist das nicht die Amme der Cleopatra bei Bernard Shaw?«
»Sehr gut, Mädchen«, lobte er, »es geht doch nichts über eine fundierte Halbbildung!«
»Aber wer ist das wirklich?« wollte ich wissen und beschäftigte mich mit meinen Wimpern.
»Cleos häßliche Freundin.«
»Wie das klingt!«
»Na, es gibt bei Freundinnen eben immer eine hübsche und eine häßliche.«
»Ich weiß schon. Um die die Herren dann losen!«
»So ähnlich«, stimmte er zu.
»Aber was macht sie sonst? Es ist doch kein Beruf, Cleos häßliche Freundin zu sein.«
»Sie macht Gedichte, ziemlich lausige Gedichte … Und ansonsten ist sie Lehrerin, Studienassessorin oder wie sich das nennt!«
»Aha! Also eine ganz vernünftige Person!«
»Wie man’s nimmt! Jedenfalls ist der Spitzname Ftatateta ganz passend für sie.«
»Und weiter?« forschte ich. »Wer ist sonst noch dort?«
»Jan Guntram mit seiner Lisa. Wenn er ihr dabeizusein erlaubt, heißt das.«
»Versteh’ ich nicht«, erklärte ich und puderte mir die Nase.
»Na, er tyrannisiert sie doch nach Strich und Faden – das weiß schließlich jedes Kind.«
»Ich nicht«, erklärte ich. »Aber weiter – Lisa und Jan Guntram kenne ich.«
»Cleos Bruder, Dr. Sintesius.«
»Arzt …?«
»Zahnarzt.«
»Fein!« Ich zog mir die Lippen nach. »Dann sind ja heute abend mindestens zwei vernünftige Leute dabei. Leute mit vernünftigen Berufen, meine ich … Das findet man selten.«
»Na, wenn du einen Fettwanst und eine Eskimöse als vernünftige Leute bezeichnen willst …«
Ich warf einen Blick in den Spiegel und war mit dem Ergebnis meiner Bemühungen zufrieden. Ich trat zu Robby an den Tisch. Er bot mir eine Zigarette an.
»Danke.« Ich ließ mir von ihm Feuer geben. »Weißt du, Robby, du hast eine reizende Art, die Menschen zu klassifizieren.«
»Findest du?«
»Ja«, sagte ich und ließ mich auf dem Sofa nieder. »Sind das alle? Ich meine, kommt sonst noch jemand heute abend?«
»Ja, mein süßes Schwesterchen Marjorie wird wahrscheinlich auch erscheinen!«
»Du hast eine Schwester? Robby, das habe ich ja gar nicht gewußt!«
»Ich versuche es auch möglichst zu vertuschen!«
»Wieso? Führt sie einen ausschweifenden Lebenswandel?«
»Nein, sie macht Übersetzungen, ziemlich schlechte Übersetzungen … Englisch und Chinesisch!«
»Chinesisch? Donnerwetter, woher kann sie denn Chinesisch?!«
»Du weißt doch, wir sind in China aufgewachsen. Mein Vater war damals als Diplomat, als Vertreter der Vereinigten Staaten, in Hongkong!«
»Sei mir nicht böse, Robby, es fällt mir immer wieder schwer, mir vorzustellen, daß du wahr und wahrhaftig Amerikaner bist!«
»Ich entstamme einer der ältesten amerikanischen Familien«, erklärte er stolz, »meine Vorfahren sind mit der ›Mayflower‹ in die Staaten gekommen!«
»Toll!« bewunderte ich ihn. »Und deine Mutter?«
»War Deutsche – ostpreußischer Adel.«
»Oh, Robby, welch edles Blut rollt in deinen Adern!« rief ich. »Ich bin tief beeindruckt!«
»Das will ich hoffen.«
»Ich glaube, nun bin ich bestens informiert«, meinte ich, »sei bedankt, Robby!«
»Also dann!« Er öffnete die Tür zum Flur. »Hinein ins Vergnügen!«
3
»Hoffentlich findest du deine Kiste nachher wieder«, sagte ich, als Robby zu mir an die Haustür trat und den Schnee von seinem Mantel schüttelte. – Wenn ich geahnt hätte, wie dieser Abend enden sollte!
»Keine Bange, Mädchen«, beruhigte er mich und drückte auf die Klingel.
Kurz darauf wurde die Haustür aufgedrückt, und wir stiegen die Treppe hinauf.
Ein Mädchen in einem kasakartigen Gewand erwartete uns schon in der Wohnungstür; ich wußte, daß es Ftatateta war, noch ehe Robby uns bekannt gemacht hatte. Sie reichte mir die Hand mit einem fast schmerzhaften Druck, und ich sah in ein dunkles, beherrschtes Gesicht mit breiten Backenknochen und einer breiten, niedrigen Stirn. Sie lächelte nicht bei der Begrüßung, aber sie machte auf mich einen äußerst sympathischen und zuverlässigen Eindruck.
»Es sind schon alle drinnen«, erklärte Ftatateta, als wir in der kleinen Diele standen, »zieht euch aus und kommt rein – du weißt ja hier Bescheid, Robby!«
Sie verschwand durch einen leuchtend blauen Vorhang, hinter dem man Gelächter, Gläserklirren und Stimmengewirr hörte.
Einen Augenblick blieb ich auf der Schwelle stehen, um mich in dem großen Raum zurechtzufinden. Es war eines der behaglichsten Zimmer, die ich je gesehen hatte, schon allein durch seine gut proportionierte Form und durch die beiden sehr breiten Fenster, vor die dieselben leuchtend blauen Vorhänge gezogen waren wie vor die beiden Türöffnungen, von denen die eine wohl ins Schlafzimmer führte. Die Einrichtung war mit sicherem Geschmack aus echten alten Stilmöbeln und hochmodernen Stücken zusammengestellt, der mächtige rote Schafwollteppich gab dem Zimmer Behaglichkeit. Das Schönste aber war der breite Backsteinkamin, in dem ein prächtiges Feuer loderte.
Der Raum war voller Menschen, die zwanglos umherstanden, es sich in Sesseln oder auf Polstern auf dem Boden bequem gemacht hatten. Vor dem Kaminfeuer stand ein großer Mann, der sich jetzt, als wir eintraten und die Unterhaltung unwillkürlich für einen Augenblick verstummte, umdrehte und zu uns hinsah. Es war Florian.
Es gab mir einen kleinen Ruck, aber dann faßte ich mich wieder und ging, begleitet von Robby, auf die Gastgeberin zu, die uns entgegenschwebte. Cleo wirkte mit ihrem schimmernden Haar, der weißen Haut und den hellen Augen noch zarter und durchsichtiger, als ich sie in Erinnerung gehabt hatte.
»Robby«, rief sie mit klingender Stimme, »Robby, was für eine reizende Idee von dir, Monte mitzubringen! Guten Abend, Monte … Ich darf Sie doch so nennen? Es ist wundervoll, daß Sie heute abend gekommen sind!«
Sie reichte mir die Hand und lächelte mich an. Das Erstaunliche war, daß nichts an ihrem Benehmen aufgesetzt oder affektiert wirkte.
»Ich bin glücklich, daß Sie mich nicht hinauswerfen«, sagte ich.
Sie lachte, und – so abgeschmackt der Vergleich klingen mag – ihr Lachen tönte wie das Läuten von Silberglöckchen. »Ich finde es so nett, daß wir uns endlich einmal näher kennenlernen! Ich habe vor einiger Zeit ein Treatment von Ihnen gelesen, es schien mir … unwahrscheinlich begabt!«
Ehrlich gestanden, ich fühlte mich nicht allzu wohl bei dieser reizenden Begrüßung. Es macht mich unsicher, wenn Menschen gar zu liebenswürdig zu mir sind, selbst wenn sie es ehrlich meinen sollten.
Wir waren an den Kamin getreten, und Robby nahm mich beim Arm und führte mich zu Florian.
»Darf ich dich mit Florian Maria Reinberger bekannt machen, Mädchen? Florian Maria ist ein hochberühmter österreichischer Dichter!« spöttelte Robby.
»Wir kennen uns, Robby«, erklärte ich. »Guten Abend, Florian. Nett, daß wir uns doch noch treffen!«
Florian entgegnete nichts und sah mich an.
Robby machte mich mit seiner Schwester Marjorie bekannt, einer zierlichen kleinen Person mit Kulleraugen und braunen Stirnfransen, die ihr etwas Exotisches gaben. Sie war der Typ einer alternden munteren Naiven; nur wenn sie lachte, wie jetzt zur Begrüßung, wirkte sie plötzlich wie ein ganz junges Mädchen.
Dr. Sintesius drückte mir nicht die Hand, er hielt sie mir einfach so hin, eine Art, die mir verhaßt ist. Obwohl er Ansatz zu einer etwas schwammigen Fülle zeigte, war er keineswegs ein Fettwanst, wie Robby behauptet hatte. Auffallend an ihm waren seine sehr grünen Augen, die hinter scharfen Brillengläsern hervorblitzten und die irgendwie nicht zu seinem schütteren hellen Haar, seiner rosigen Haut und seiner stumpfen kleinen Nase paßten.
Helm Ritter verbeugte sich, als ich ihm die Hand gab, so formell, als wenn er auf der Bühne stände; seine eisblauen Augen sahen an mir vorbei.
Jan Guntram war trotz der festlichen Gelegenheit ostentativ in Lumberjack und Manchesterhosen erschienen, das unvermeidliche rote Halstuch umgeschlungen. Auf einem Polster zu seinen Füßen hockte Lisa, eine unscheinbare graue Maus in langen Hosen und Pullover.
»Warum kommt ihr erst so spät?« fragte sie vergnügt. »Den Clou des Abends habt ihr schon verpaßt!«
»Wieso?« wollte ich wissen.
»Was war los?« erkundigte sich Robby.
»Dreimal dürft ihr raten!« Lisa tat sehr geheimnisvoll.
»Mein Silvesterknallbonbon!« rief Cleo strahlend.
»Cleo hat ein Engagement nach Hollywood!« verriet Marjorie.
»Wahrhaftig?« Robby war sichtlich erstaunt.
»Gratuliere, Cleo!« sagte ich.
»Sie sollten sich das noch einmal überlegen, Cleo«, mahnte Jan Guntram und klopfte seine Pfeife bedächtig am Kamingitter aus.
»Zu spät«, entgegnete Cleo mit leuchtenden Augen. »Ich habe schon unterschrieben!«
»Sie passen nicht nach Hollywood«, beharrte Jan Guntram, stocherte in seinem Pfeifenkopf herum und zog einen ledernen Tabaksbeutel aus der Tasche.
»Es würde mich interessieren«, ging Robby aggressiv auf ihn los, »woher Sie Ihre genauen Kenntnisse über Hollywood schöpfen, Herr Guntram?!«
Jan Guntram stopfte seine Pfeife. »Sie werden sich daran gewöhnen müssen, junger Freund, daß es eine Menge Dinge gibt, von denen ich mehr verstehe als zum Beispiel Sie!«
»Ich habe bereits feststellen müssen, daß Sie mehr zu können vorgeben, als es in Wahrheit der Fall ist!« parierte Robby hitzig.
»Robby!« Cleo legte ihm besänftigend die Hand auf den Arm. »Robby, ich bitte dich!«
»Dafür sind Sie mir bisher noch den Beweis schuldig geblieben«, erklärte Jan Guntram und setzte behutsam seine Pfeife in Brand.
Robbys Gesicht hatte sich verzerrt. »Sie … Sie werden sehen!« Seine Stimme überschlug sich.
»Robby, hör auf damit!« mahnte Ftatateta.
»Ich … ich werde ….«
Jan Guntram zog an seiner Pfeife und sah Robby aus seinen ein wenig hervorquellenden Augen vergnügt an. Wie er da saß, breit, behäbig und glatzköpfig, glich er eher einem flämischen Bauern als dem gewiegten Schriftsteller, der er tatsächlich war. Robby, mager und zerbrechlich, wirkte ihm gegenüber sehr hilflos.
»Regen Sie sich nicht auf, junger Freund«, meinte Jan Guntram, »es lohnt sich wirklich nicht und schadet nur Ihrer Gesundheit!«
Robby drehte sich brüsk um und verzog sich in eine dunkle Ecke des Zimmers.
»Robby im Schmollwinkel«, hörte ich Marjorie leise sagen, sie kicherte.
Ich sah mich suchend nach einer geeigneten Sitzgelegenheit um.
Ftatateta zog aus einer der Ecken, die im Halbdunkel lagen, einen modernen, bequemen Sessel hervor und schob ihn gerade vor den Kamin, Einen besseren Platz hätte ich mir nicht wünschen können.
Niemand schien sich über den kleinen Zusammenstoß zwischen Jan Guntram und Robby Gedanken zu machen; harmlos und vergnügt ging die Unterhaltung darüber hinweg. Das Gespräch drehte sich um Wintersport und Wintersportmöglichkeiten.
Ich weiß nicht, ob das dekorative Zimmer mit dem prächtig lodernden Kaminfeuer oder was sonst daran schuld war, aber plötzlich kam es mir so vor, als wenn wir uns alle auf einer Bühne befänden. Personen in einem modernen Unterhaltungsstück. Die anderen schienen das Stück und ihre Rollen genau zu kennen, so, als ob sie es schon mehr als einmal gespielt hätten; nur ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen würde, ich fühlte mich wie eine Anfängerin, die plötzlich und ohne Probe hatte einspringen müssen.
Ich sah zu Cleo hin, die neben ihrem Bruder saß. Ein Geschwisterpaar, und doch, wie verschieden waren die beiden, die zarte weiße Cleo und der plumpe aufgeschwemmte Dr. Sintesius. Obwohl Cleo sich unverkennbar zurückhielt, war sie doch der Mittelpunkt unserer kleinen Gesellschaft. Sie spielte, ohne sich dessen bewußt zu sein, alle anderen an die Wand, neben ihr kam niemand sonst zur Geltung. Dabei war sie gar keine wirkliche Schönheit. Mit ihrem schimmernden Haar, mit den hellen Augen und dem sensiblen Mund war sie hübsch, nichts weiter; ihr Zauber hatte nichts mit ihrer äußeren Erscheinung zu tun, er kam ganz von innen her. Ja, jetzt wußte ich, wie sie wirkte – wie eines jener Räucherlämpchen, durch deren hauchdünne Wände man das leuchtende Flämmchen zittern sehen kann. Jetzt wußte ich auch, warum mich ihre Gegenwart irritierte – ich kam mir neben Cleo grob, primitiv und unbehauen vor.
Nur keine Minderwertigkeitskomplexe, Monte, sagte ich mir, dem Himmel sei Dank, du bist ja keine Schauspielerin, und Cleo ist auch nicht deine Rivalin.
Nein, wir waren keine Rivalinnen. Wenn ich auch im ersten Augenblick angenommen hatte, daß es eine Frau war, die Florian heute abend hierher gelockt hatte, so mußte ich doch bald einsehen, daß dies nicht zutraf. Er beschäftigte sich mit keiner der anwesenden Weiblichkeiten; er, den ich schon eine ganze Gesellschaft hatte verzaubern sehen, war aufallend still, ja nervös. Er sah großartig aus in seinem schwarzen Steireranzug, dem weißen Hemd und dem kleinen Mascherl, aber er schein sich sehr unbehaglich zu fühlen.
Auch Ftatateta war ständig unterwegs, wenn auch aus einer anderen Ursache. Sie bot Berliner Pfannkuchen und Neujährchen rund, füllte die Gläser immer wieder mit heißem Punsch, sah darauf, daß jeder zu rauchen hatte. Sie machte das so geräuschlos, so unauffällig und gewandt, daß ich wohl die einzige war, die ihre Geschäftigkeit bewußt bemerkte. Wenn Robby sie eine Eskimöse genannt hatte, so erinnerte sie mich eher an eine Indianerin. In ihren Slippers bewegte sie sich, schmalhüftig und breitschultrig, so leise und sicher wie in Mokassins, in ihrem pechschwarzen Haar fehlte nur noch die bunte Feder, um den Eindruck vollkommen zu machen.
Helm Ritter, herb, männlich und verschlossen, rauchte eine Zigarette nach der anderen und beteiligte sich nur mit einem hin und wieder dazwischengeworfenen Wort an der Unterhaltung.
Ich sah zu Lisa und Jan Guntram hinüber. Er tätschelte gerade ihren Kopf mit derselben herablassenden Freundlichkeit, mit der man einen kleinen Hund streichelt. Dann stand er auf, die Hände in den Taschen, die Pfeife im Mund, und schlenderte aus dem Zimmer.
Wie ein Schatten tauchte Robby hinter Lisa auf und beugte sich zu ihr nieder. Ich schaute in eine andere Richtung, aber ich spitzte die Ohren, um das Gespräch der beiden mitzubekommen.
»Haben Sie sich die Sache nun überlegt, Lisa?« fragte Robby leise.
»Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen!« verwahrte sich Lisa.
»Von meinem Angebot!«
»Dieses Thema ist doch wohl langsam totgeritten!«
»Haben Sie es sich überlegt?«
»Es … es ist bestimmt sehr freundlich von Ihnen, Robby … sehr ehrenvoll und das alles … aber …«
»Aber?«
»Robby! Ich habe es Ihnen schon hundertmal erklärt!«
»Sie könnten Jan Guntram damit schützen!«
»Ich glaube nicht, daß er einen Schutz braucht!«
»Vielleicht doch!« beharrte Robby.
Lisa lächelte freundlich zu ihm auf. »Was kümmert es den Mond, wenn ihn der Hund anbellt!« Sie sprang gewandt mit gekreuzten Beinen hoch und ließ sich dann auf der anderen Seite des Feuers zu Füßen von Helm Ritter nieder.
Ich hatte natürlich keine Ahnung, von was zwischen den beiden die Rede gewesen war, aber ich hatte begriffen, daß Robby wieder eine Abfuhr erlebt hatte, die zweite an diesem Abend.
»Robby, Brüderlein … Willst du nicht mit mir tanzen?« rief Marjorie ihm zu.
Robby gab keine Antwort, sondern zündete sich eine Zigarette an.
»Wenn Sie mit mir fürlieb nehmen wollen, Marjorie!« Dr. Sintesius verbeugte sich vor ihr.
»Wie lieb von Ihnen«, dankte sie vergnügt, »das hätte ich nicht zu hoffen gewagt!«
Jan Guntram war wieder ins Zimmer gekommen und ließ sich auf seinem alten Platz am Kamin nieder. Robby sah zu Florian hinüber und verließ das Zimmer. Zu meiner Überraschung folgte Florian ihm wenige Augenblicke später.





























