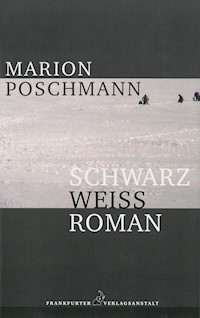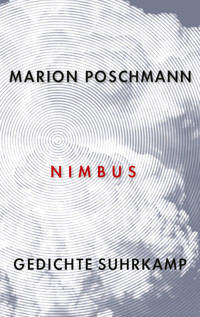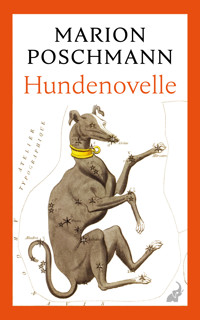10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der rundliche Rheinländer Altfried Janich findet nach der Wiedervereinigung eine Stelle im »Ostschloss«, einem alten Barockbau, der neuerdings eine psychiatrische Anstalt beherbergt. Hier hält er es für seine Aufgabe, seinen Patienten gegenüber die Sonnenposition einzunehmen, ihnen eine Orientierung zu geben. Als sein Freund Odilo durch einen rätselhaften Autounfall zu Tode kommt, gerät er selbst auf die Nachtseite der Dinge. Patienten rücken ihm zu nahe, Erinnerungen bedrängen ihn, seine Familiengeschichte holt ihn ein. Alle Geschichten seines Lebens scheinen hier zu enden, und bald stellt sich die Gewissheit ein, dass er aus dem Schloss nicht mehr wegkommen wird. Ein Roman über die Macht der Zeit, über Erinnerung und zeitlose Verbundenheit. Ein Roman über fragile Identitäten, über den schönen Schein und die Suche nach dem inneren Licht – funkelnd, glasklar und von subtiler Spannung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der rundliche Rheinländer Altfried Janich findet nach der Wiedervereinigung eine Stelle im »Ostschloß«, einem alten Barockbau, der neuerdings eine psychiatrische Anstalt beherbergt. Hier hält er es für seine Aufgabe, seinen Patienten gegenüber die Sonnenposition einzunehmen, ihnen eine Orientierung zu geben. Als sein Freund Odilo durch einen rätselhaften Autounfall zu Tode kommt, gerät er selbst auf die Nachtseite der Dinge. Patienten rücken ihm zu nahe, Erinnerungen bedrängen ihn, seine Familiengeschichte holt ihn ein. Alle Geschichten seines Lebens scheinen hier zu enden, und bald stellt sich die Gewißheit ein, dass er aus dem Schloß nicht mehr wegkommen wird.
Ein Roman über die Macht der Zeit, über Erinnerung und zeitlose Verbundenheit. Ein Roman über fragile Identitäten, über den schönen Schein und die Suche nach dem inneren Licht – funkelnd, glasklar und von subtiler Spannung.
Marion Poschmann, 1969 in Essen geboren, studierte Germanistik, Philosophie und Slawistik und lebt heute in Berlin. Für ihre Prosa und Lyrik wurde sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie 2011 den Peter-Huchel-Preis und 2013 den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis.
Marion Poschmann
Die Sonnenposition
Roman
Suhrkamp
Die Arbeit der Autorin am vorliegenden Buch wurde vom Deutschen Literaturfonds e.V. sowie vom Land Berlin gefördert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4546
© Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlagabbildung: Cecilia Paredes
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
eISBN 978-3-518-73460-5
www.suhrkamp.de
Inhalt
1 Prolog: Sol invictus
I Furor
2 Pompes funèbres
3 Tapeten eines Lebens
4 Glühbirnengleichnis
5 Verblendklinker
6 Dunkelbilder
7 Methoden der Jagd
8 Auerhähne
II Patientia oder Das Ostschloß
9 Anstaltskost
10 Tarnungsfehler
11 Spiegelsaal
12 Die Ursachen – Fallgeschichten
Flüssigstrümpfe
Demiurgenwahn
Der Tod im Schrank
Kreide fressen
Gefahren des Realismus
13 Schlafversager
14 Erlkönigjäger
15 Mischwesen
III Memoria
16 Gewittertiere
17 Glanzapparate
18 Rückenfiguren
19 Gedächtnispaläste
20 Sonnenstein
21 Weiße Maulbeeren
22 Wasserspeier
IV Splendor
23 Die Folgen – Fallgeschichten
Ruhekissen
Doppelgängergeschenke
Die Schönheit des Staubs
Blumenmumien
Die Wolkenformel
24 Die Arbeit an Gott
25 Irrgärten
26 Leuchtmäuse
27 Doppelsonnen
28 Die rotierenden Orte
29 Schwarze Maulbeeren
30 Epilog: Aurora borealis
1 Prolog: Sol invictus
Die Sonne bröckelt. Wenn im Speisesaal Betrieb herrscht, versetzen die schweren Schritte alles in Schwingung, und von der Decke fällt Stuck. Aus der Sonnenmitte hängt das Kabel für den Kronleuchter, ein Modell aus DDR-Zeiten. Messingstäbe spreizen sich von einer Mittelachse, an den Enden verdecken Milchglastrichter die Glühbirnen bis auf die Kuppe, sie sind geformt wie kleine Füllhörner, die Strahlen aussenden, Sonnenimitate.
Die Stucksonne darüber ist nur noch halb vorhanden. Bei jeder Mahlzeit rieseln Gipsteile herab, einmal fiel ein Placken einem Patienten in die Suppe, seitdem hat man die Tische umgestellt, und der Platz in der Mitte ist frei. Nach jedem Essen liegen dort weiße Stückchen auf dem Linoleumboden, ein feiner Puder, manchmal größere Brocken, nach jedem Essen wird der Raum gewischt.
Formlose graue Putzlappen trocknen auf den Heizkörpern; ein verlöschendes, alles auslöschendes Grau, das jahrelang den Staub geschluckt hat, ihn beständig weiterschluckt, nur in den Pausen schlapp und feucht über der Heizung hängt. Neben den ausgebreiteten Lappen erheben sich auf den weißlackierten Rippen metallene Pflanzenreliefs, altertümlich elegante Ranken, an denen sich Schwebstoffe ablagern, so daß ihnen der festsitzende Schmutz eine fast schon wieder edle Schattierung und Tiefe verleiht. Harte Akanthusgirlanden, schwer zu reinigen, es bedürfte eines Dienstmädchens, das täglich mit einem Federwedel zwischen die Rippen fährt, Flaumteile fliegen läßt, oder mit einer jener kunststoffborstigen Stangen stochert, die aussehen wie vergrößerte Flaschenreiniger, in Neonfarben leuchtend, kirmeshaft, und in ihrer Sterilität vielleicht passender für eine Einrichtung wie die unsere.
Das Schloß ist unbedeutend und heruntergekommen. Kein königliches, ein gräfliches Anwesen, für 1 DM stand es eine Weile zum Verkauf. Als sich kein privater Investor fand, hat das Land hier eine Heil- und Pflegeanstalt eingerichtet. Notdürftig vorerst, mit der endlosen Verzögerung und plötzlichen Hektik bürokratischer Beschlüsse, sind wir hier eingezogen, in ein stark renovierungsbedürftiges Gebäude. Mit der Sanierung, die eine akribische Restaurierung sein wird, kann erst begonnen werden, wenn die Fördergelder bewilligt sind. Bis dahin besitzt die Anlage den Charme eines Spukschlosses, verwildert, eingesponnen, verwunschen. Wer von den Bewohnern aus dem Westen kommt wie ich, mag von der Romantik schwärmen, den filmreifen Kulissen, der sichtbaren Vergangenheit, welche bei uns ja nach Kräften bereinigt ist, zu glatt wiederhergestellt oder gänzlich getilgt wurde. Wer von den Bewohnern aus dem Westen kommt wie ich, hat sein Glück in der Umbruchsituation gemacht, denn in den neuen Bundesländern waren plötzlich Stellen frei.
Im Ostteil des Landes war es die Regel, die verfügbaren Schlösser, Herrenhäuser, Burgen, die gräflichen Jagdsitze zu Sanatorien, Nervenkliniken, Altenheimen und Gefängnissen umzunutzen. Auch im Westteil werden Barockpaläste und Klostergebäude von sogenannten Insassen bewohnt, weil es praktisch ist, weil man die Leute unterbringen muß, weil das Gebäude sonst leerstünde. Im Ostteil ist man nicht nur aus praktischen Erwägungen so verfahren, sondern aus Prinzip. Das Hohe sollte niedrig werden. Das Feudale proletarisch. Das Schöne banal, das Vornehme allgemein verfügbar.
Unser Schloß hat im Zweiten Weltkrieg als Lazarett gedient, dann als Unterkunft für Zwangsarbeiter, als Materiallager, als Chemielabor. Jetzt ist es Teil der Psychiatrischen Kliniken, die nach der Wende ausgeweitet wurden. Die Zahl der Fälle hat vorerst nicht zugenommen. Aber man gesteht den Leuten mehr Platz zu. Sie müssen nicht mehr zu zehnt im Schlafsaal nächtigen. Sie dürfen im Bewußtsein der übrigen Bevölkerung vorkommen. Man gesteht ihnen zu, daß es sie gibt.
Die Patienten sind im Nebengebäude, im ehemaligen Kavaliershaus, untergebracht. Dort sind die Fenster vergittert, die Ausstattung ist schlichter. Im Schloß befinden sich die Aufenthaltsräume und Behandlungszimmer, hier wohnen die Ärzte, und aus der ehemaligen Empfangshalle hat man eine Turnhalle gemacht.
Viele der Patienten pflegen nervtötende Gewohnheiten oder nehmen sie augenblicklich an, sobald sie hier einquartiert werden. Sie kratzen mit den Fingernägeln nach und nach den Lack von den Fensterrahmen, sie zerschaben das Linoleum, weil sie auf ihrem Stuhl, festgeklammert am Sitz, langsam und hartnäckig den ganzen Tag von einem Ende ihres Zimmers zum anderen reiten. Was der Zahn der Zeit in langen Jahren abnagt, schaffen sie in wenigen Monaten. Sie beschleunigen den Verfall, als hätte sich die Macht der Zeit in ihnen konzentriert, als besäßen sie mehrere Leben auf einmal, die miteinander um einen Ausweg aus dem engen Körper ringen, als bräche die Energie der Zerrüttung, die sonst kaum merklich ihr stetiges Werk verrichtet, immer wieder geballt aus ihnen heraus, unbeherrschbar, unsinnig, gegen die Norm.
Die Sonne scheint durch die staubigen Fenster in den Speisesaal. Die Falten in den Gesichtern gewinnen an Tiefe, sie graben sich grauschattige Furchen, die vorher nicht auffielen, als sei das Alter über Nacht eingekehrt und jetzt etwas, das sich unwiderruflich festgesetzt hat: eine Vergangenheit, aus den Körpern nicht mehr herauszukriegen. Unsere Arbeit ist es, mit dem umzugehen, was bei Sonne an den Tag kommt, das Unausweichliche, vor dem wir des Nachts in Träume, Wahngebilde fliehen. Die Patienten blinzeln, wenn ein Strahl sie trifft, sie kneifen die Augen zu, ducken sich weg. Unsere Aufgabe ist es, mit dem zu operieren, was der Alltag sonst wie eine Wolkenschicht gnädig verdeckt.
Die Sonne bringt das dickwandige weiße Geschirr zum Glänzen, und sofort zieht Herr P. sein Ärmelbündchen über den Handballen und beginnt, seine Tasse an den Stellen, wo Reflexe funkeln, abzuwischen.
Das stumpfe Klicken, mit dem sich die Tassen und Untertassen, der schneidende Sang, mit dem sich Bestecke und Teller berühren.
Heilen – wovon? Vom Aufgang und Untergang der Sonne, vom Licht, das morgens durch die östlichen Fenster auf die Tische fällt, seine unausweichliche Runde macht, abends von Westen kommt, fatalistisch, wachsam, unhintergehbar?
Es dreht einmal durch den Saal, beleuchtet die Sprelacart-Tische und die einfache Bestuhlung, die halbblinden Spiegel, die zwischen die Fenster montiert sind und dadurch verwirren, daß man beim Blick in ein und dieselbe Richtung zugleich aus dem Raum hinaus und auch in ihn hinein sieht: Stücke von ausgewucherten Buchsbaumhecken, ungepflegte Rasenflächen, verwilderte Eibenpyramiden. Stücke von Teewagen, mit benutztem Anstaltsgeschirr behäuft, die von schlaffen Armen vorübergeschoben werden.
Es beleuchtet die opulenten Ölgemälde, die vielleicht deshalb noch vorhanden sind, weil man auf ihnen kaum etwas erkennt: stark nachgedunkelte Blumen- und Obstbuketts, Kirschen mit eckigen Glanzlichtern, schwarz gewordener Wein und erlegte Pelztiere, die mit dem Fond verschmelzen.
Die Bilder zumindest scheinen stabil zu bleiben und geben auch uns ein Gefühl von Stabilität, als verändere sich nichts, als sei die Gegenwart bereits die Ewigkeit, und als gleite die Zeit wie ein dünner Wasserstrom säuselnd über die Körper, als sei die Zeit den Körpern ein Reinigungsritual, das ihren Zustand unversehrt bewahrt, ja auffrischt, und nicht etwas, das sie permanent durchdringt, sich in ihnen ablagert, sie deformiert, umformt und auflöst, den Kaninchenkörper, der an den Hinterläufen hängt, den runden funkelnden Leib der Orange zwischen den Gläsern, den Körper des Kochs, der mit neckischem Kopfneigen ein Tablett präsentiert, verdreht und gebeugt auf Würdigung wartet. Als sei solches Warten die vordringliche Maßnahme in einer Zeit, die den Körper bildet und ausformt, ein Warten auf die Zukunft, in der dieser Körper endlich seinen Platz einnehmen wird, ein Warten auf den schmalen, feuchten Ort, wo er zur Ruhe kommt.
Ich liege in meinem Bett im Bereitschaftszimmer. Der Kühlschrank im Korridor rattert, der Boden vibriert. Feine Zuckungen übertragen sich auf das Bettgestell, elektrisieren mich, halten mich wach wie eine Vollmondnacht. Meine Nachttischlampe mit dem Plastikschirm, der Leinwand nachahmt, habe ich angelassen. Mein klösterliches Bett mit seinem hohen, schnitzverzierten Kopfteil, den schweren Sprungfedern, dem Birnenfurnier knarrt, auch wenn ich mich nicht bewege. Eine schwarzlackierte Leiste rahmt es ein, als schliefe ich in meiner eigenen Todesanzeige.
Mein Fenster steht offen. Aus dem Nebengebäude schallt der Patientenfernseher durch den Park. Es herrscht die Tendenz, das schlechte Bild durch maximale Lautstärke auszugleichen. Auch ich verfüge über einen alten Schwarzweißfernseher, dessen Empfang nicht optimal ist. Er zeigt mehrere Programme gleichzeitig, ein vordergründiges, durch das Schatten, Silhouetten, Unschärfen huschen. Die hintergründigen, die manchmal deutlicher werden und den Rest unkenntlich machen. Oft schlagen die Patienten deswegen Lärm. Immer wieder wird der Zivildienstleistende aufs Dach geschickt, um die Antenne zu verstellen und das Bild zu regulieren. Die Verbesserungen sind minimal, aber die Patienten beruhigen sich für eine Weile, sie haben das Gefühl, daß man sich für sie einsetzt, sich um sie bemüht, daß etwas geschieht.
Die Nächte unterscheiden sich durch die Träume. Die Tage sind gleich.
Nichts hat sich verändert, schon ist wieder Nacht. Ich ziehe mir die Schuhe an und hänge mir den Arztkittel über den Schlafanzug.
Ich durchquere den Speisesaal auf leisen Sohlen. Auch nachts, wenn niemand da ist, riecht es noch nach verschwitzten Trainingsjacken. Die Insassen tragen viel Sportkleidung, als handele es sich hier um ein Ferienlager, womöglich ein Trainingslager. Sie tragen bequeme Kleidung, die den Körper nicht einengt, wohl weil der Körper in diesen Mauern eingeengt genug ist, er wird betreut, beschützt, kontrolliert, er stößt an die Grenzen eines geregelten Ablaufs, den andere festlegen.
Neben dem Speisesaal liegt das Billardzimmer. Ehemals das Ankleidezimmer der Gräfin, hängt hier jetzt eine Garderobe aus dünnen Metallstangen an der Wand, Haken und Hutablage in funktionaler Schlichtheit, niemand hat sie jemals benutzt. Das Billardzimmer ist unbeliebt, hierhin zieht der Hauch der Sanitäranlagen, die seit Jahrzehnten nicht erneuert worden sind, deren Kabinen sich nicht abschließen lassen, in deren Rohren die Gerüche der vergangenen Jahre gespeichert scheinen. Die Sanitäranlagen werden weiterhin benutzt, das Billardzimmer meidet man. Nur der Zivildienstleistende kommt gelegentlich hierher, stößt eine Billardkugel über das Tuch, setzt sich auf den Stuhl neben der Yuccapalme, um der Gesellschaft der Patienten für eine Weile zu entfliehen.
Die allgemeinen Räume gehen ineinander über, sie sind allesamt Durchgangszimmer, die man in einem Kreis durchschreiten kann. Ich betrete das Billardzimmer und verlasse es, ich erreiche die Bibliothek, drei karge Regale in einem Saal. Blanke Fangarme wehen über meinem Kopf. Der Kronleuchter hängt hier nicht in der Mitte des Zimmers unter der Stuckrosette, sondern ein Stück versetzt, so daß er die Leseecke ausleuchtet. Aus dem Rosettenherz führt ein Kabel an der Decke entlang und senkt die Lampe mit ihren geschliffenen Glastropfen wie eine leuchtende Kronenqualle in den Raum, eine Qualle, deren harte Glastentakel mit einem schütteren Klirren aneinanderstoßen, wenn jemand die Tür aufreißt. Es ist ein einfacher Luftzug, der den spätbarocken Lüster bewegt, aber mir kommt es vor wie ein Beben, die stumme Erregung, die jeder menschliche Körper für gewöhnlich in sich selbst verschließt und die die Gegenstände an diesem Ort aufnehmen, als herrsche hier Sturm.
Nachts stehe ich mindestens einmal auf und geistere durch die verlassenen Säle. Ich schalte die Lampen an und aus, ich setze die Füße vorsichtig auf, um kein Geräusch zu verursachen. Eine peinigende Unruhe treibt mich um. Als müsse ich der Versehrtheit nachgehen, die sich in diesen Räumen hält. Eine Versehrtheit, die ich nicht fassen kann, die zu fassen ich aber, seit ich hier bin, für meine Aufgabe halte.
Der Kristallüster in der Bibliothek ist eines der wenigen beweglichen Inventarstücke, die die Kriege, Besatzungen, Plünderungen, Ausverkäufe unbeschadet überstanden haben. Die Vasensammlung ist erst später hierhin umgelagert und vergessen worden. Die schloßeigenen wertvollen Möbelstücke, Polsterstühle, Rokoko-Anrichten, Marmortischchen, Intarsienschränke befinden sich in Rußland. Ich imaginiere allnächtlich die fehlenden Teile, es fühlt sich fade und falsch an, es entwertet die Dinge, die da sind.
Ich mache die Runde, ich kehre in mein Zimmer zurück, hänge den Kittel an den Haken auf dem Türblatt, stelle die Schuhe unters Bett, lege mich wieder hin.
Bei meinem Einzug saßen große Kreuzspinnen zwischen den Doppelfenstern meines Zimmers. Ihre Radnetze spannten sich zwischen den Rahmen, sie waren von berückender Schönheit, von einem filigranen Gleichmaß wie das hauchdünne Porzellan im chinesischen Kabinett. Ich wagte nicht, mich zu rühren, ich stand, meinen Koffer noch an der Hand, versteinert in der Tür, während die Pflegerin, die mich begleitete, energisch vortrat, die Fenster umstandslos öffnete, eine Spinne nach der anderen in ihre hohlen Hände nahm und behutsam nach draußen warf. Manche von ihnen liefen in Panik von der Fensterbank in den Raum; die Pflegerin fing sie ein. Sie fegte mit einem Handfeger die Netze weg, fast tat es mir leid um die Arbeit der Tiere. Inzwischen haben sie ihr Werk erneuert, nicht ganz so umfangreich wie zu Beginn, so daß ich das eine Fenster öffnen kann. Im anderen beobachte ich sie. Sie arbeiten nachts.
Beständig hängt hier ein Pilzgeruch in der Luft; man hat es bisher vermieden, die Tapeten abzureißen, um zu kontrollieren, ob sich dahinter Schimmel gebildet hat. Man kann sie nicht einfach ersetzen, man müßte sie abnehmen und restaurieren. Der pilzige Geruch verwandelt sich im Mund in einen modrigen Geschmack. Und es scheint, als zerfalle das Schloß in meiner Mundhöhle, als zerfalle es, je mehr ich davon spreche, immer weiter, rieselnder Putz, Sonnentrümmer, Gipspulver. Ich knirsche nachts mit den Zähnen. Ich schlafe schlecht.
Draußen geht die Sonne auf und unter. Im Schloß verfallen die Kränze und Kreise. Die Stuckrosetten schwinden, das Deckengemälde Aurora verrottet, in die strahlig angelegten Achsen im Park frißt sich Gras. Draußen geht die Sonne auf und unter, während all unsere Nachahmungen nicht von Dauer sind. Gescheiterte Sonnen, untergegangene Sonnen – überall im Schloß sammeln sich die irdischen Reste, verdüsterte Sonnen aus grau gefaßtem Lindenholz über den Eingängen zum Speisesaal, Türklinken, die einmal vergoldet waren und jetzt ermattet sind, abgegriffene Sonnen, blind gewordene Sonnen, vor allem aber die angelaufenen Sonnenkopien in der muffigen Anstaltskapelle, sie umgeben die Kanzel und sind fast schwarz von dem Ruß in der Luft, dem feuchten Atem, der sichals düstere menschliche Schicht über den Glanz legt, das Feuer dämpft, es soweit verdunkelt, daß man sehenden Auges hineinblicken kann, ohne also Schaden zu nehmen, aber wohl auch, ohne entzündet zu sein.
Sonnenschiffe, Sonnenbrocken, Barocksonnen. Ihre gefilterten Strahlen um den Altar, ihre Schattenstrahlen, die aus imaginären Wolken brechen; den Staub, der gemeinhin in ihnen tanzt, haben sie auf ihre Oberfläche gezogen und sich mit ihm bedeckt: eine weiche graue Bemäntelung, um sich dem Irdischen soweit wie möglich anzugleichen.
Draußen geht die Sonne auf und unter. Wo ist draußen, frage ich mich, wenn ich nach dem Dienst müde das Gelände verlasse. Am Giebel des Torhauses bewacht ein steinernes Auge Gottes in seinem Dreieck meine Ein- und Ausfahrten.
Oft weiß ich selbst nicht, ob ich mich als Arzt oder als Patient hier aufhalte. (So geht es allen hier, nehme ich an.) Die Unterschiede verwischen, wenn man feststellen muß, daß nur der Status, den man einnimmt, die Macht, über die man verfügt, das Bild einer gefestigten Persönlichkeit hervorbringt, und daß es einer rätselhaften Vorsehung zu verdanken ist, daß ich den weißen Kittel trage und die anderen nicht.
Ich erzähle von der Sonnenwarte aus. Allsehendes Auge des Arztes.
Eine Position der Ferne, des generellen Überblicks. Ich behellige die Dinge mit meiner gleichmäßigen Aufmerksamkeit. Und doch entgeht mir mindestens die Hälfte, die Nachtseite, die Stellen, auf die der Schatten fällt. Das Interessante dabei ist die Hälfte, die im Dunklen bleibt. Die Sonne bescheint nur die Oberfläche. Und was sie sieht, ist nicht unbedingt das Entscheidende. Nicht das, worauf es ankommt. Nicht das, was eine Geschichte vorantreibt: daß sich die Körper vermischen, daß Intimität stattfindet, Auslöschung, Liebe und Haß.
Ein sonnenhafter Erzähler, rundlich gebaut, sonnigen Gemüts, der sich erlaubt, sich gegebenenfalls auch künstlicher Beleuchtung zu bedienen, mit Straßenlaternen zu operieren, Taschenlampen, Scheinwerfern, der Durchleuchtung anstrebt und doch achtgeben muß, daß ihm das Objekt seines Interesses dabei nicht abhanden kommt.
Wer des Nachts in ein Gebüsch leuchtet, scheucht Tiere auf und spielt ihnen Tag vor, er wird sie nie schlafend erwischen. Schatten läßt sich nur ableiten. Schatten ist da, wohin mein Blick nicht fällt. Dennoch weiß ich um ihn, denn das Licht entsteht aus der Finsternis.
I Furor
2 Pompes funèbres
Der schwarze Lack spiegelte stark, warf das Licht zurück und blendete mich. Die Sonne brannte an diesem Morgen wie auf einem Mafiabegräbnis, auf dem Parkplatz schimmerten teure dunkle Wagen wie hohe Wellen, ich setzte meinen roten Opel hinzu und schritt über den Schotterboden zum Friedhofstor, gehemmt, gebremst, mit schweren Beinen wie unter Wasser, mit den Armen ein prekäres Gleichgewicht errudernd, Gang über Meeresgrund.
Odilo war tot.
Ein ähnlicher schwarzer Wagen war über ihm zusammengeschlagen, hatte sich mit ihm eingerollt und ihn mitgerissen in die Nacht, über die Leitplanke, einen Hang hinab. Er war angeschnallt, der Airbag hatte funktioniert, aber ab einem bestimmten Maß der Gewalteinwirkung sind die Sicherheitseinrichtungen im Innern eines Gefährtes nur noch kosmetisch. Er war nüchtern, oder jedenfalls hatte er keinen Alkohol getrunken. Er fuhr schnell, es gab keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf dieser Strecke, die er hätte unzulässigerweise überschreiten können. Es war eine dunkle Nacht, mondlos, Schichtwolken. Er fuhr ohne Licht.
Diese Tatsache hatte mir seine Mutter am Telefon mitgeteilt. Sie berichtete die Fakten, sie wirkte gefaßt.
Jetzt stand sie am Friedhofstor, ihre Augen glitten unstet hinter den dünnen Schleiern, die von ihrem Hut fielen und jeden fremden Blick vor ihrem Gesicht zerstreuten, in oszillierende Muster auflösten, vernichteten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!