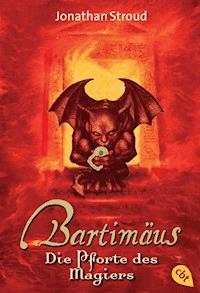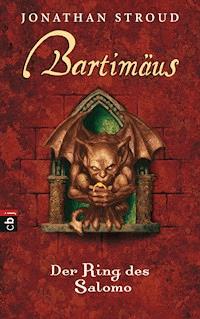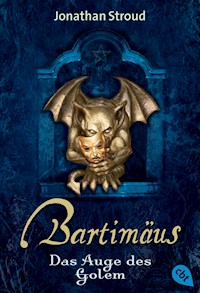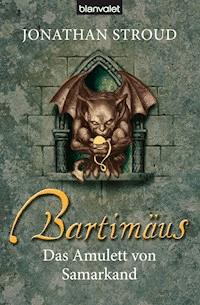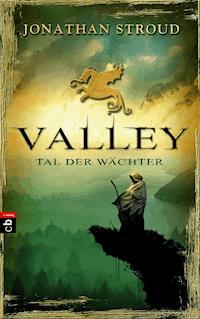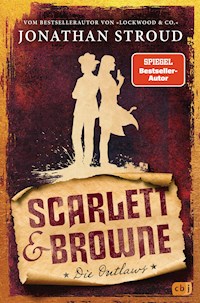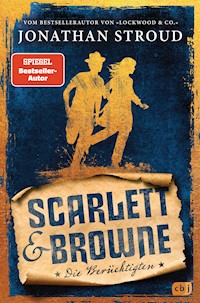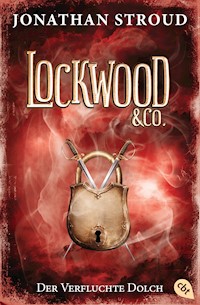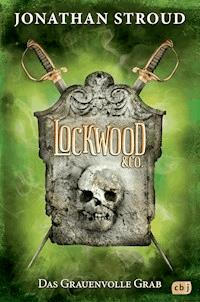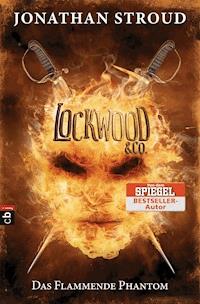7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Alle denken, Max wäre ertrunken. Nur seine beste Freundin Charlie glaubt das nicht. Schließlich war sie dabei, als er am Mühlsee ins Wasser sprang. Sie allein weiß, was genau dort passiert ist. Unheimliche Wesen haben ihn in eine andere Welt entführt! Aber Charlie kann Max in ihren Träumen sehen und sie ist überzeugt, sie muss nur seinen Spuren folgen, um ihn nach Hause zu holen. Und so folgt Charlie ihnen, selbst über die Grenzen dieser Welt hinaus – ins Schattenland ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Foto: © Rolf Marriot
DER AUTOR
Jonathan Stroud wurde in Bedford geboren. Er arbeitete zunächst als Lektor. Nachdem er seine ersten eigenen Kinderbücher veröffentlicht hatte, beschloss er, sich ganz dem Schreiben zu widmen. Er wohnt mit seiner Frau Gina und den gemeinsamen Kindern Isabelle, Arthur und Louis in der Nähe von London. Berühmt wurde er durch seine weltweite Bestseller-Tetralogie um den scharfzüngigen Dschinn Bartimäus.
Von Jonathan Stroud sind bei cbj ebenfalls erschienen:
Bartimäus – Das Amulett von Samarkand (Band 1)
Bartimäus – Das Auge des Golem (Band 2)
Bartimäus – Die Pforte des Magiers (Band 3)
Bartimäus – Der Ring des Salomo (Band 4)
Lockwood & Co. – Die Seufzende Wendeltreppe (Band 1)
Lockwood & Co. – Der Wispernde Schädel (Band 2)
Lockwood & Co. – Die Raunende Maske (Band 3)
Mehr zu den Büchern unter:
www.bartimaeus.de
www.lockwood-und-co.de
Jonathan Stroud
Die Spur ins
Schattenland
Aus dem Englischen von
Bernadette Ott
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
cbj Taschenbuch August 2016
© 2008, 2016 der deutschsprachigen Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2001 Jonathan Stroud
Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »The Leap«
bei Random House Children’s Books, London
Übersetzung: Bernadette Ott
Umschlag- und Innengestaltung: Geviert, Grafik & Typografie
unter Verwendung der Fotos von © Trevillion Images (Stephen Carroll); Shutterstock (echo3005, Dmitry Kulagin, tomertu)
MP • Herstellung: wei
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-19524-3V001
www.cbj-verlag.de
Für Nana und in Erinnerung an K. A. Stroud
Eins
Er schaut mich immer noch an. Das Wasser ist grün, Luftblasen steigen auf. Sein Gesicht leuchtet weiß zwischen dem Moos und den Unkrautschlingen.
Ich schaue ihn an, und da spricht sein Mund meinen Namen durch das stumme Wasser. Ein Schwall von Luftblasen explodiert auf seinen Lippen. Sie stürzen auf mich ein, heften sich auf meine Augen und mein Gesicht und einen Augenblick bin ich blind. Dann steigen sie sprudelnd nach oben ins Licht, dorthin, wo es Tag ist, und ich kann wieder sehen. Ein einziges Mal erhasche ich noch einen Blick auf seine Augen, dann wenden sie sich von mir ab, dem Schattenland entgegen, und sein Gesicht wird von dem dunklen Grün um uns herum verschluckt.
Er ist verschwunden. Ich schlage die Augen auf. In dem Krankenzimmer ist es dunkel und jemand weint. Ich brauche mich nicht zur Seite zu drehen, ich weiß auch so, wer es ist: der Junge am Ende der Reihe, in dem Bett neben dem trüben orangefarbenen Nachtlicht. Der Junge ist klein, mit einem schmalen Gesicht, er hat sein rechtes Bein in Gips und er hat schon oft geweint. Er fühlt sich heute Nacht allein und krank, heimwehkrank, und es wird viele Stunden dauern, bis seine Mutter ihn wieder besuchen kommt. Seine Schluchzer dringen dünn durch die stickige Luft des Krankensaals. Ich warte und beobachte aus dem Augenwinkel, was geschieht. Bald erscheint der rasche, tatkräftige Schatten der Krankenschwester neben seinem Bett. Der Umriss ihrer Hand senkt sich herab und berührt sein verborgenes Gesicht. Eine gemurmelte Frage, sanft und tröstend, dann der leise Klang seiner halbverschluckten Antworten. Er sinkt in die hohen Kissen zurück. Sie richtet sich auf und huscht davon. Ich liege auf dem Rücken und schließe die Augen.
Max kommt nicht wieder. Ich kann mich anstrengen wie ich will, ich sehe nichts – dafür wird mir umso stärker bewusst, wie beengt ich mich in der steifen Bettwäsche fühle, fast erdrückt unter der Decke. Meine Arme liegen eng neben dem Körper, und nur mein Kopf auf dem dicken Kissen kann sich drehen und wenden, wie er mag. Ich bin gut eingepackt worden. Um mich noch sicherer ans Bett zu fesseln, hätten sie eine Zwangsjacke benutzen müssen.
Meine Beine bewegen sich unruhig unter dem glatten, frisch gestärkten Laken. Ich bin jetzt schon die sechste Nacht hier und morgen lassen sie mich vielleicht nach Hause. Doch selbst dann werde ich noch jede Woche zum Arzt gehen müssen, aber nicht zu einem Lungenspezialisten. Ich hatte Probleme mit der Lunge, aber das ist schon seit Tagen vorbei, und trotzdem behalten sie mich immer noch hier und benutzen das als Vorwand, um mich noch weiter zu beobachten, mit mir zu sprechen und mir zu beweisen, dass ich verrückt bin.
Ein einsames Auto fährt durch die Nacht. Die Geräusche kommen von weit in der Ferne. Ringsum schläft die Stadt. Ich liege wach und denke an Max und daran, was mit ihm geschehen ist.
Sie passen jetzt alle auf, dass sie auf gar keinen Fall seinen Namen erwähnen. Aber er ist trotzdem immer da, ich kann es an ihren Gesichtern ablesen, am Gesicht von Mum und von den Ärzten, und ich habe es auch den Augen der netten Polizistin angesehen, die alles getan hat, um mich von meiner Geschichte abzubringen. Als hätten sie alle eine Scheu davor, seine Gegenwart zu beschwören. Als fürchteten sie sich davor, was er dann vielleicht tun könnte. Und ich helfe ihnen nie aus ihrer Verlegenheit heraus, nicht einmal wenn mich ihre bedeutungsvollen Pausen dazu einladen sollen, wieder von Max zu erzählen. Sie halten mir die Tür offen, aber ich gehe nie hindurch. Ich lerne schnell. Nach dem ersten Mal, und erst recht nach Mum, sage ich nichts mehr. Ich habe jetzt schon so lange nichts mehr gesagt, dass ich mir sicher bin, sie glauben allmählich, ich habe die Erinnerung an ihn ausgelöscht. Und ich weiß, dass Mum darauf hofft.
Das ist gut so, sollen sie das ruhig glauben. Am besten sie lassen mich einfach allein, damit ich hier liegen und an Max denken kann.
Ich mag die Dunkelheit. Sie ist wie ein schützender Schleier und gleichzeitig wie eine Leinwand, auf die man seine inneren Bilder projizieren kann. Für die Nachtschwester, den heimwehkranken Jungen und die anderen, die in der drückenden schwarzen Wärme des Krankensaals in ihren Betten schlafen, ist davon nichts zu sehen. Doch für mich ist der Raum auf allen Seiten mit hell leuchtenden Erinnerungen tapeziert. Ich kann sie alle in Ruhe betrachten, ich ganz allein.
Eine Szene, immer wieder. Max und ich, auf unseren Fahrrädern. Wir fahren die Straße entlang, in der er wohnt, den Hügel hinunter, aus der Stadt hinaus. Am Kanal entlang, vorbei an den Pubs und den blinden Fassaden der Fabrikgebäude, Max immer voraus, ich hinter ihm her. Unter der Überführung hindurch, dann kommt noch einmal ein altes Fabrikgelände und danach hinaus in die Felder. Ein Nachmittag im September, die Sonne scheint, wir strampeln auf unseren Rädern und der Wind treibt uns Tränen in die Augen. Wir fahren ziemlich schnell, so schnell, dass mir mein T-Shirt bald nass am Rücken klebt und mir die Oberschenkel allmählich wehtun.
Über die abgeernteten braunen Felder, jetzt langsamer. Max begann müde zu werden, und ich konnte aufholen, sodass ich bald neben ihm war. Er war ganz rot im Gesicht, das vor Anstrengung beinahe zu einer Grimasse verzogen war. Wir kamen zu dem Steg über den Fluss. Ganz nah am Ufer standen Weiden, und davor war eine struppige Wiese, die nicht zu sumpfig wirkte. Ich war dafür, es an der Stelle zu versuchen, weil das Wasser tief genug für Fische aussah, aber Max sagte nein, er wüsste einen besseren Platz. Wir radelten weiter.
Irgendwo auf der Krankenstation kann ich die Klingel der Nachtschwester summen hören. Ein schwaches, gedämpftes Geräusch. Die Schwester kommt näher, mit weichen Schritten huscht sie den Korridor entlang, nach dem blinkenden Licht suchend. In meinem Zimmer schlafen alle – bis auf mich, und ich bin ganz still. Jetzt ist sie an der Tür vorbei und die Schritte verstummen wieder. Aus irgendeinem Grund legt sich mir ein lähmendes Gewicht auf die Brust, und ich spüre, wie es mich in den Augen juckt. Gleich werden mir die Tränen kommen. Hör auf damit, Charlie, sei nicht so dumm – denk lieber nach, lass den Film auf der Leinwand der Nacht abspielen. Schau die Bilder an und erinnere dich.
Ich war schon einmal bei der Mühle gewesen. Zusammen mit Mum und James. Das war im Sommer vor einem Jahr. Der schmale Pfad war mit Unkraut und dornigen Ranken überwuchert und schlängelte sich zwischen zwei hässlichen elektrischen Zäunen entlang. Wir mühten uns auf unseren Fahrrädern keuchend ab, um zu dem breiten Feldweg zu kommen, der durch die Viehweiden zur Mühle und zum Fluss führt. Auf dem Weg ist die Durchfahrt erlaubt, die Mühle selbst aber wird von einer hohen Mauer verdeckt, sie ist in Privatbesitz und gehört einem Bäckereibetrieb in der Stadt.
Von der anderen Seite der roten Backsteinmauer waren Männerstimmen zu hören. Der Fluss verschwand unter einem flachen Mauerbogen. Wir fuhren um das Gelände herum auf die Rückseite der Mühle, wo das Mühlrad ist.
Es drehte sich. Wir standen auf einem Vorsprung am Rand der gemauerten Umfassung, wo man eine gute Sicht hat, und schauten in den tosenden Hexenkessel aus quirlender, schäumender weißer Gischt hinab. An der Seite spritzte es hoch. Die Steine waren mit nass glänzendem Moos bedeckt. Das Mühlrad stampfte dröhnend im Dunkel unter der Überdachung, seine riesigen hölzernen Schaufeln tauchten mit machtvollem Schwung aus dem Wasser auf, wurden nach oben getrieben, wieder und immer wieder, vollführten einen Bogen und griffen dann tief in das Wasser hinein. Der brausende Lärm machte uns taub. Die Luft war nass und kalt und kühlte uns nach der Fahrt schnell ab. Max machte auf dem rauen Steinvorsprung über dem schäumenden Wasser noch ein paar Schritte nach vorne und ließ dann die Beine über die Kante baumeln, als wollte er mit dem hellen, weißen Dunst verschmelzen.
Das Bild verblasst. Ich glotze nur noch wie ein blickloser Fisch in die Dunkelheit. Mein Hals fühlt sich steif an. Ich zapple im Bett herum und kämpfe gegen die festgezurrte Bettdecke, weil ich mich umdrehen will. Die fürsorgliche Arbeit der netten Krankenschwester wird damit zunichte gemacht, aber ich habe mich seit der Besuchszeit heute Nachmittag, nachdem Mum und James endlich gegangen waren, nicht mehr richtig bewegt. James war das erste Mal mit dabei. Ich habe gespürt, wie peinlich ihm die ganze Sache ist. Er hat mir nur ein einziges Mal in die Augen geschaut, als Mum eine ihrer nervenden Nicht-Geschichten erzählt hat. Aber er war auch wirklich betroffen. Das habe ich daran gemerkt, dass er mich zum Abschied ganz unbeholfen umarmt und geküsst hat. Ich wüsste gerne, wie viel sie ihm erzählt haben und was er jetzt über mich denkt. Das steife Kopfkissen presst sich gegen mein Gesicht und meine Wange fühlt sich wund und heiß an. Ich möchte mich kratzen, aber ich bleibe ruhig liegen und blicke zum Fenster und in die Nacht, wo das Mühlrad sich dreht.
Nach dem Mühlrad kommt eine Schleuse, und dahinter fließt der Fluss träge dahin, bis er sich zu einem schattigen Mühlteich weitet, der am Ufer mit Steinplatten eingefasst ist. Hier wollte Max angeln.
»Ich hab hier mal ziemlich große Fische entdeckt.« Er schmiss sein Fahrrad neben einen Pflaumenbaum hin und nestelte seine Angelrute von dem Rucksack los, der auf seinem Gepäckträger war. Um den Teich herum wachsen mehrere Pflaumenbäume, alle knorrig und gekrümmt vor Alter. Während Max den Köder am Angelhaken befestigte, betrachtete ich die Bäume. Ein paar Zweige ragten fast ins Wasser, die Pflaumen, die daran hingen, glänzten dunkel und reif.
Max war fertig. Wir setzten uns auf die Steinumfassung an dem friedlichen Teich und Max schleuderte den Köder hinein. Sein erster Versuch. Das Wasser lag ruhig und still da, die Sonne spiegelte sich faul in der glatten Oberfläche. Es war ein heißer Spätsommernachmittag.
Amseln zwitscherten in den Bäumen und die Sonne brannte uns auf den Rücken und wir haben überhaupt nichts gefangen. Ab und zu schwammen große fette Karpfen mit weißen Augen und gespenstischen grauen Schleiern an der Seite langsam aus dem Schlamm nach oben und schwebten eine Weile unter dem Köder, der im Wasser baumelte. Als würden sie abwarten und beobachten wollen, was weiter geschah. Kein einziges Mal versuchten sie, danach zu schnappen, sie glotzten nur blöd und machten sich dann mit einer schnellen Schwanzbewegung auf und davon. Max war ein sehr schlechter Angler. Ich habe es ihm gesagt. Er hat seine Angel hingeworfen. Wir lagen auf dem Rücken und schauten in den Himmel.
Ein dumpfer Schmerz durchzuckt meine Wade, obwohl sie mir den Verband schon lange abgenommen haben und die Spuren fast nicht mehr zu sehen sind. Die Ärzte sagen, dass Max hier mit seinen Fingernägeln über mein Bein gekratzt haben muss, und ich hasse sie dafür mehr als für alles andere. Nicht weil sie mir nicht glauben – sie glauben überhaupt nichts von dem, was ich erzählt habe. Nein, es macht mich ganz wahnsinnig, dass sie glauben, ich hätte mich mit aller Kraft nach oben gestoßen, während er noch gelebt und nach mir die Hand ausgestreckt hat. Mich nach oben gestoßen und ihn allein gelassen. Sie sagen mir nicht ins Gesicht, dass ich ein Feigling bin. Sie fragen mich immer nur, wie es mir geht, und blicken ganz traurig drein und erwähnen seinen Namen nicht mehr.
Dabei könnte ihnen jeder sagen, dass seine Fingernägel dafür gar nicht lang genug waren. Er hätte mich gar nicht so kratzen können.
Wahrscheinlich kaute er auf ihnen herum, als wir am Ufer des Teichs lagen und die Nachmittagssonne ihm das Gesicht wärmte. Er hasst es, nichts zu tun, und wird dann ganz unruhig. Ich döste neben ihm vor mich hin, die Hitze und die lange Radtour begannen ihre Wirkung zu tun. Aber lange schläfrig herumliegen, das ging nicht. Nach ungefähr einer Minute wurde Max zappelig und musste etwas Neues vorschlagen.
»Wenn das mit dem Angeln nichts ist, dann können wir doch schwimmen.«
Ich hob lustlos den Kopf und blickte auf das Wasser. »Sei nicht albern«, sagte ich. »So heiß ist es auch wieder nicht und ich habe nichts dabei.«
Von Max kam ein Lachen. Er lag immer noch auf dem Rücken und hielt die Hand vors Gesicht, um nicht direkt in die Sonne schauen zu müssen. »Ich habe auch nichts dabei«, sagte er. »Ich werde nackt ins Wasser springen. Das ist mir doch egal.«
Ich schüttelte den Kopf. »Dir vielleicht. Ich brauche einen Badeanzug.«
»Jetzt hab dich mal nicht so. Ich guck auch nicht.« Max stützte sich auf die Ellenbogen und blickte über den Teich.
Ich sagte nichts. Ich würde nicht ins Wasser gehen und Max würde es wahrscheinlich auch nicht. Seine Begeisterung schien einen kleinen Dämpfer abgekriegt zu haben. Vielleicht war es die stille Reglosigkeit des Teichs, vielleicht war es auch etwas anderes.
»Dann mal los«, sagte ich aufmunternd. »Ich pass auf deine Sachen auf.«
Max brummte etwas. »Vielleicht später.« Er blickte unruhig um sich. Irgendetwas hatte ihn gepackt.
»Wir hätten was zum Essen mitnehmen sollen«, sagte er. »Hier gibt es meilenweit nichts zu kaufen.«
Ich hob einen faulen Finger. »Hier gibt’s jede Menge gratis ringsum. Du brauchst nur deinen Hintern zu bewegen, wenn du hungrig bist.«
Die schwer beladenen Äste der Pflaumenbäume ragten bis übers Wasser, die vielen Sturmwinde hatten sie nur nach einer Seite wachsen lassen. Max kniff die Augen zusammen und musterte sie. Eine neue Herausforderung war entdeckt.
»Mach ich vielleicht, wenn du selbst dafür zu feige bist.«
»Wirf mir ein paar runter.« Ich legte mich wieder auf den Rücken und schloss die Augen. Dann hörte ich erst ein Scharren, danach ein Fluchen, und als ich einen Blick wagte, sah ich die Füße und den Hintern von Max in dem Baum über mir verschwinden.
»Pass auf, Max. Du bist gleich über dem Wasser.«
»Nur wer wagt, gewinnt eine Pflaume.«
Er schob sich auf einem dicken, knorrigen Ast nach vorne, bis er über dem Mühlteich war, ungefähr einen halben Meter von der Steinumfassung entfernt. Er rutschte noch etwas hin und her, dann saß er richtig, klaubte eine rötlich-blauschwarze Pflaume vom Baum und stopfte sie sich in den Mund. Blitzschnell hatte er sie verdrückt. Er spuckte den Kern ins Wasser, wo er mit einem dumpfen Glucksen verschwand. Ich verlangte meinen Anteil, aber ich musste warten, bis er zwei weitere Pflaumen gierig verschlungen hatte, erst dann warf er mir eine zu. Sie war sehr reif und sehr süß.
Ich saß zwischen dem Baum und der Steinkante auf dem Boden und aß noch ein paar von den Pflaumen. Doch ich hatte bald genug davon. Ob es nun die reifen Früchte waren oder nicht, ich spürte ein Drücken im Magen und wunderte mich, wie Max es schaffte, so viele Pflaumen in sich hineinzuschaufeln. Vom bloßen Zusehen wurde mir schon schlecht. Die ausgespuckten Kerne regneten auf das Wasser herab.
Dann hörte der Regen auf. Max musste sich so vollgestopft haben, dass er nicht mehr konnte. Ich sah zu ihm hoch. Er saß still und ruhig auf dem Ast, den Kopf etwas zur Seite geneigt. War er vielleicht eingeschlafen? Nein, seine Augen waren ganz weit offen, und sein Mund auch, und er starrte auf das Wasser hinunter, das ungefähr zwei Meter unter ihm war. Seine Hände waren weiß und umklammerten den Ast, als hätte er Angst hineinzufallen. Ich schaute ebenfalls auf das Wasser im Teich, aber ich konnte nichts erkennen, ich sah nur das Sonnenlicht, das sich auf der Oberfläche spiegelte, und meine Augen schmerzten davon.
»Was ist los, Max?«, rief ich laut und etwas schrill. Max hielt selten inne, um sich irgendetwas genauer anzuschauen. »He, Max, wirf mir noch eine runter.«
Es kam keine Antwort. Ich rief noch einmal. Er starrte in die Traumtiefen des Teichs hinab, rührte sich nicht und gab auch keinen Laut von sich. Eine plötzliche Panik umklammerte meine Brust, obwohl Max mich in der Vergangenheit oft nicht weiter beachtet hatte, ebenso wenig wie ich ihn.
»Max! Sag was! Hör auf damit – wenn das ein Witz sein soll, finde ich es nicht lustig. Du müsstest dich mal sehen, du sitzt wie ein Idiot da, mit offenem Mund. Komm wieder in die Wirklichkeit zurück.« Ich wusste nicht, warum ich so erschrocken war, und das verstörte mich zusätzlich. »Jetzt komm schon, antworte mir –«
Ich sprach nicht weiter. Als würde er von jemandem gerufen, schwang Max mit einem Mal sein Bein über den Ast, sodass beide auf einer Seite herunterhingen. Er blickte zwischen ihnen auf das Wasser hinunter. Und dann, fast noch im selben Moment und ohne seine Augen von dem Wasser zu lösen, stieß er sich mit einem kräftigen Ruck von dem Ast ab und fiel.
Er glitt fast geräuschlos in die Tiefe und das Wasser des Mühlteichs schloss sich über ihm. Ich sprang mit einem Schrei auf und beugte mich über die Steinkante, musterte die Wasseroberfläche. Keine Luftbläschen stiegen auf. Nur eine kreisrunde Welle, eine einzige, und dann war die Oberfläche so reglos und still wie vorher.
Ich wartete.
Die Zeit war wie festgefroren. Ich wartete und wartete darauf, dass sein Kopf wieder auftauchte.
In der Ruhe der Nacht ist der Junge im letzten Bett wieder aufgewacht. Er weint. Diesmal hört ihn die Schwester nicht. Er heult und seine Schluchzer verklingen in der Dunkelheit. Meine Augen sind weit aufgerissen, ich starre auf etwas. Das Bild auf der Leinwand der Nacht ist erstarrt; die Oberfläche ist vollkommen reglos. Langsam, sehr langsam heult sich der Junge in den Schlaf. Ringsum ist es wieder still.
Eine Taube von der Mühle gurrte und ihr schläfriger Ruf traf mich wie ein Messerstich. Auch das Vogelgezwitscher, das mit dem einsamen Aufspritzer im Wasser ausgesetzt hatte, fing wieder an. Die Zeit tickte wieder. Ich zog hastig die Schuhe aus und sprang in den Teich.
Als ich in das Wasser eintauchte, wich mit einem Schlag die Sonnenwärme aus meinem Körper, als wäre ich gehäutet worden. Mein Körper zog sich vor Kälte zusammen, in meinen Ohren pochte eine dumpfe Stille. Das heitere Summen und Rascheln, alle besänftigenden Laute des Spätsommertags waren verstummt. Ich öffnete die Augen und sah um mich herum eine graugrüne Leere. Hinter mir befand sich die Steinmauer an der zur Mühle gelegenen Seite des Teichs, sie war grün bemoost und mit Unterwasserfarnen bewachsen, die mit ihren langen, kräftigen Wedeln meine Beine streiften.
Ich machte ein paar Schwimmzüge. Ringsum, über mir und unter mir war nur dieser leere grüne Raum, hie und da von schwachen Sonnenstrahlen durchbohrt, die durch die Wasseroberfläche drangen und allmählich verblassten. Das Wasser war sehr tief.
Weit unter mir, in den smaragdgrünen Tiefen, sah ich Max. Er schwamm, aber er schwamm nach unten, sein Gesicht von der Sonne abgewandt. Ich verfolgte ihn mit anschwellender Panik im Bauch. Das Blut hämmerte mir in den Schläfen, als ich mich mit den Beinen so kräftig wie nur möglich nach unten stieß, aber ich konnte ihn nicht erreichen. Und dann bemerkte ich noch etwas anderes, das sich im Wasser bewegte: blasse feingliedrige Frauen mit langen Haaren, die sie wie dünne Gräser umschwebten. Sie legten ihre Arme um ihn, als wollten sie ihn bei sich behalten.
Ich schwamm auf sie zu und kam immer näher, und als sich plötzlich alle zu mir umdrehten, war das Gesicht von Max weiß und seine Augen waren offen, aber ich wusste, dass er mich nicht mehr sehen konnte. Er lächelte und die Frauen lächelten auch. Sie konnten mich sehen, das spürte ich ganz genau, sie musterten mich mit Augen, die wie nasse Kieselsteine grün leuchteten.
Eine der Frauen bewegte ihre Beine wie einen Fischschwanz und glitt auf mich zu; sie streckte ihre langen, dünnen Finger nach mir aus und lächelte. Die Berührung war kalt, wie wenn man Finger in einen Eisbach hält, und als sie ihren Mund öffnete, strömten daraus blubbernde Luftblasen hervor. Ihre langen Haare schwebten träge vor meinen Augen, ihre Finger strichen über meinen Nacken, und ich spürte, wie mich langsam eine unendliche Müdigkeit überkam, ein schläfriges Bedürfnis, zwischen allen diesen stillen Dingen in diesem friedlichen Teich zu ruhen, zwischen den Steinbrocken und den Holzstücken und all den verlorenen, vergessenen Gegenständen, und nie mehr die grelle Härte der Sonnenstrahlen zu spüren. Aber ich hatte die Augen meines Freundes Max gesehen, und ich hatte seine Haut gesehen, die fischig und weiß gewesen war, wie Füße, die man beim Angeln im Sommer einen ganzen Nachmittag lang im Fluss baumeln lässt. Und plötzlich sehnte ich mich nach der Berührung des Windes, nach den Farben des Himmels und der Erde und nach den Geräuschen, die von den Hügeln herüberwehen.
Deshalb schlug ich mit den Fäusten um mich und entwand mich den anschmiegsamen Armen der Frau. Ihr Mund öffnete sich zu empörtem Protest und das Wasser um uns herum sprudelte wild auf. Ich stieß mich nach oben, dem trüben Sonnenlicht entgegen, während ihre Wut mir eine Million Luftbläschen nachschickte, die um mich herum zischend zerplatzten.
Dann griff eine Hand aus der Tiefe nach mir und bekam meinen Knöchel zu fassen. Schrecken packte mich. Ich trat mit meinem freien Fuß danach und spürte einen Widerstand. Die Hand ließ los, doch im Wegsinken kratzte sie mit ihren scharfen Nägeln noch über meine ganze Wade.
Die Luftbläschen trugen mich jetzt wie in einem Schaumkissen nach oben, das Licht wurde heller und heller, bis es über meinem Kopf zerplatzte und mich die warme Luft des Spätsommernachmittags umgab. Ich strampelte keuchend in der Mitte des Mühlteichs, in meiner verletzten Wade spürte ich einen stechenden Schmerz. Das Wasser um mich herum war still und in den Pflaumenbäumen zwitscherten die Amseln. Es waren vielleicht zwei Minuten vergangen, seit ich ins Wasser gesprungen war, aber seit diesem Augenblick schien eine Ewigkeit vergangen zu sein, und das Vogelgezwitscher klang fremd und seltsam. Ich schwamm zum Ufer, hievte mich auf die warme Steinplatte hoch und starrte stumpf auf die ruhige Wasseroberfläche des Mühlteichs, der mir meinen Freund für immer genommen hatte. Meine Lungen atmeten die warme Spätsommerluft ein, aber durch mein Herz strömte kaltes grünes Wasser.
Zwei
Nach einer Stunde wurde ich ungeduldig. Mum konnte jetzt allmählich zurückkommen. Eine Stunde für einen Besuch im Krankenhaus reichte, fand ich, vor allem wenn man seinen Sohn ohne Essen und Trinken im Auto zurückgelassen hat. Wahrscheinlich konnte man dafür sogar angezeigt werden. Wie wenn man seinen Hund einfach auf dem Rücksitz einsperrt, ohne das Fenster einen Spalt offen zu lassen.
Die Zeit zog sich. Ich hatte aus dem letzten Mal gelernt und ein Buch mitgenommen, aber dummerweise war es eines, das ich schon fast ausgelesen hatte, und nach einer Viertelstunde war ich damit durch und es war wieder alles so langweilig wie immer. Ich hab noch mal hinten auf dem Buch den Text durchgelesen und die Lügen gezählt, die dort über den herausragenden Autor und sein glänzendes Werk standen. Dadurch verging noch eine Minute. Dann war ich wieder ganz auf mich selbst angewiesen – und es blieb mir leider nichts anderes übrig, als die Leute auf dem Krankenhausparkplatz zu beobachten. Um es etwas spannender zu machen, versuchte ich zu erraten, wer wohl welche Krankheit hatte, aber das hat nicht lange geholfen. Entweder war es zu leicht, wie bei dem Mann mit dem Gipsbein, der seine Frau beschimpfte, die ihn im Rollstuhl zum Eingang schob. (Sie hätte ihn die Rampe hinunterstoßen sollen, zwischen die Müllcontainer hinter der Kantine, aber nein, das tat sie natürlich nicht). Oder es war zu schwierig, wie bei fast allen anderen. Sie sahen alle nur blass und niedergeschlagen aus, und oft konnte ich nicht einmal sagen, ob es Patienten oder Besucher waren. Aber das war eigentlich auch egal, sie deprimierten mich alle.
Weitere zehn Minuten schlichen vorüber. Ich versuchte mir einzureden, dass ich wütend auf Mum war, weil sie mich mitgeschleppt hatte, und dass ich lieber zu Hause vor der Glotze abhängen würde. Aber das funktionierte nicht. Ich war wütend, weil sie mich wie ein kleines Kind hier im Auto gelassen hatte, wo ich eigentlich drinnen sein müsste, bei Charlie, um meine Rolle als großer Bruder zu erfüllen und mich um sie zu kümmern.
Am Tag vorher hatte ich sie das erste Mal gesehen. Aber ich hatte es vermurkst; Mum quasselte die ganze Zeit und ich saß nur daneben und sagte gar nichts, wie ein Blödmann. Und das absolut Idiotische daran war, dass ich ihr so viel zu sagen gehabt hätte, oder zumindest dachte ich das. Es war schon eine ganze Woche vergangen, und ich hatte sie seit dem Abend, bevor es passiert war, nicht mehr gesehen. Wir hatten im Gästezimmer zusammen Tischbillard gespielt. Charlie hat 3:2 gewonnen, beim letzten Stoß auf Pink. Ich hatte versucht, unseren Wettkampf auf best of seven auszuweiten, aber dann brüllte Mum durch die Wand und wir sind ins Bett gegangen. Als ich am nächsten Morgen aufgestanden bin, war Charlie schon weg, sie wollte wie immer zu Max.
Aus irgendeinem Grund kamen mir bei der Erinnerung an das Billardspiel die Tränen. Ich versuchte, irgendwo im Auto ein Papiertaschentuch zu finden, aber ich zog nur einen ölverschmierten Lappen unter dem Sitz hervor, und deshalb schniefte ich in den Ärmel. Genau diesen Augenblick hatte sich eine dicke Frau ausgesucht, um sich mit ihrem unförmigen Körper zwischen unser Auto und das nächste zu quetschen. Unsere Blicke trafen sich, als ich meine Nase gerade im Ärmel versenkt hatte. Das war mir peinlich, nicht wegen des Ärmels, sondern weil sie mitbekam, dass ich geheult hatte. Ich hatte eine richtige Freude daran zu beobachten, wie sie sich mühsam zwischen die Autos schob. Und noch viel mehr Spaß machte es zuzugucken, wie sie die Fahrertür einen schmalen Spalt aufmachte und sich schnaufend und ächzend hindurchzwängte, bis sie schließlich auf dem Sitz gelandet war. Doch dann fiel mir ein, dass sie wahrscheinlich von einem Besuch bei ihrem sterbenden Ehemann oder irgendeinem anderen unheilbar Kranken zurückkam, und ich fühlte mich schuldig und es war alles noch schlimmer als vorher.
Ich hatte Mum vor Augen, wie sie mit demselben erschöpften grauen Gesicht, das ich auch bei allen anderen gesehen hatte, in das Krankenhaus hineinging, und ich wünschte mir, sie hätte mich als moralische Stütze mitgenommen. Aber Mum mag alles immer möglichst niedrig hängen, und wenn ich dabei war, komplizierte das die Sache irgendwie. Ich glaube, sie wollte mich damals so lange wie möglich von Charlie fernhalten, bis sie halbwegs sicher sein konnte, dass mit ihr alles wieder in Ordnung war. Am Tag davor hatte ich es nur deshalb bis ins Krankenzimmer geschafft, weil ich vor den Schwestern einen Riesenaufstand veranstaltet hatte.
Charlie wirkte ruhig, als wir uns zu ihr ans Bett setzten, und führte mit uns ein Allerweltsgespräch über total unwichtige Dinge. Vernünftig. In ihren Augen blitzte es kein einziges Mal wild auf; sie freue sich darauf, aus dem Krankenhaus rauszukommen, sagte sie, und ihr sei langweilig. Mum hatte ihr ein paar Bücher mitgebracht. Sie sah eigentlich ganz gut aus, nur ein bisschen blass – aber irgendetwas war komisch an ihr, das spürte ich, ohne genau sagen zu können, was. Vielleicht kam es daher, weil sie so still war. Normalerweise geraten Mum und sie nach spätestens fünf Minuten aneinander, und Mum gab sich jetzt zwar besondere Mühe, aber sie brachte auch hier wieder ein paar von den Knallern, die Charlie sonst immer auf die Palme bringen. Doch sie saß nur still da, blass und beherrscht, ohne auf irgendein Reizwort zu reagieren. Ich war auch schweigsam. Ich musste die ganze Zeit daran denken, wie Mum an jenem schrecklichen Morgen total erschöpft von der durchwachten Nacht an Charlies Bett nach Hause gekommen war. Was sie mir erzählt hatte. Von dem Unfall. Wen sie im Teich gefunden hatten. Und vor allem die Geschichte, die Charlie ihr aufgetischt hatte.
Als Mum alles hervorstieß, konnte ich mir keinen Reim darauf machen. Es machte einfach keinen Sinn und passte überhaupt nicht zu meiner Schwester. Eine ganze Woche nagte die Geschichte jetzt schon in mir und ich hatte noch nichts davon verdaut. Als ich Charlie dann in ihrem Krankenhausbett dasitzen sah, ruhig, höflich und gelangweilt, traf es mich wieder wie ein Schlag – was sie Mum erzählt hatte, konnte einfach unmöglich tatsächlich passiert sein –, und ich spürte, dass ich viel zu aufgewühlt war, um mit ihr über belanglose Dinge reden zu können.
Eine Person eilte über den Parkplatz. Sie kam direkt auf unser Auto zu, aber es dauerte ein paar Augenblicke, bis ich Mum erkannte hatte.
Ich beugte mich zur Seite und öffnete von innen die Fahrertür. Mum ließ sich auf den Sitz plumpsen. Sie war ganz rot und außer Atem.
»Was ist los? Alles in Ordnung mit Charlie?«
»Sie kommt raus, Jamie. Lass mich erst mal verschnaufen. Ich bin drei Stockwerke runtergerannt.«
»Wann kommt sie raus? Heute?«
»Jetzt gleich. Warte noch ’ne Minute.« Und dann saß ich neben ihr und habe gewartet, bis sie genug gekeucht und geschnauft hatte. Sie schien einem Herzinfarkt nahe zu sein. Endlich ging ihr Atem ruhiger.
»Sie kommt jetzt raus, Jamie. Sie machen gerade die Entlassungspapiere fertig. Ich bin gekommen, um ihre Sachen zu holen.« Um für alle Fälle gewappnet zu sein, hatte Mum eine Tasche mit Kleidungsstücken von Charlie im Kofferraum deponiert.
»Das ist ja großartig, Mum. Dann ist bei Charlie alles okay?«
»Natürlich. Es geht ihr viel besser.« Sie hörte gar nicht richtig zu, sondern wühlte in ihrer Tasche nach den Autoschlüsseln herum.
»Aber die Ärzte – was haben die Ärzte gesagt?« Ich hätte nicht gedacht, dass mein Herz vor Angst und Aufregung so heftig klopfen würde.
»Sie sagen, dass bei ihr alles in Ordnung ist.« Auf Mums Stirn erschien eine Falte, als sie hochschaute. »Es geht ihr besser. Du hast sie gestern doch selbst gesehen. Sie ist fast wieder die alte Charlie. Nur sehr erschöpft.«
»Ja, aber ich meine … was sagt sie über das, was geschehen –«
»Sie erinnert sich jetzt besser. Sie redet keinen solchen Unsinn mehr. Und hör zu, James, weil wir gerade darüber reden –« Mum ließ mit einem metallischen Klicken ihre Handtasche zuschnappen und drehte sich zu mir. »Es ist wichtig, dass wir mit Charlie eine Zeit lang sehr behutsam umgehen. Die Ärzte sagen, wir dürfen mit ihr über nichts reden, was sie aufregen könnte. Das bezieht sich auf alles, was mit Max oder dem Begräbnis zu tun hat. Sie wird auch noch nicht in die Schule gehen. Sie ist im Augenblick sehr zerbrechlich, und wir wollen ihr alle dabei helfen, langsam und vorsichtig ins Leben zurückzufinden, nicht wahr?«
»Aber wissen sie, warum –«
»Versprich mir, dass du mir dabei hilfst, Jamie. Es ist ganz wichtig.«
»Ich habe es dir schon versprochen, Mum.«
»Ich weiß, dass du es bereits getan hast, Liebling. Es werden schwierige Wochen für uns werden, mein Schatz, aber wenn wir als Familie zusammenhalten, dann schaffen wir das. Ab und zu werden die Ärzte nach ihr sehen. Überprüfen, wie es ihr geht. Es wird alles gut werden. Aber denk immer daran, was ich gerade gesagt habe.«
»Ja, Mum.«
»Du bist doch mein Bester.« Mum war schon halb ausgestiegen, da wandte sie sich noch einmal um. »Weißt du, ich glaube, sie wird viel schneller darüber hinwegkommen, als die Ärzte geglaubt haben. Meine Tochter ist eben ein vernünftiges Mädchen. Aber jetzt muss ich mich beeilen. Wird nicht lange dauern.«
»Soll ich hier warten?«
Aber Mum hatte die Tür schon zugeknallt und stand hinten am Kofferraum, wo sie die Tasche herauszog. Dann hastete sie zwischen den Autos wieder davon und war weg.
So sollte das also laufen. Ich durfte mit ihr nicht darüber reden. Ich sollte so tun, als wäre überhaupt nichts passiert.
Ab und zu werden die Ärzte nach ihr sehen. Überprüfen, wie es ihr geht. Was bedeutete das? Ich setzte mich so, dass ich den Krankenhauseingang fest im Blick hatte. Mein Herz hämmerte stärker als jemals zuvor. Meine Gedanken wanderten. Ich sah Charlie in ihrem Krankenhausbett vor mir: wachsam, fast misstrauisch, zurückhaltend, auf alle Fragen antwortend, ohne selbst eine zu stellen. Das war nicht meine Schwester, so kannte ich sie nicht, und jetzt kam sie nach Hause und ich spürte, was für einen großen Schrecken mir das, was passiert war, einjagte – dabei war es noch nicht mal mir passiert, sondern ihr.
Und da war sie auch schon, Charlie stand schon am Auto und ich hatte sie nicht kommen sehen. Was für ein Idiot ich doch war.
Drei
Prof. Sir Peter Andover
Institut für Kinderpsychiatrie
– Traumaforschung –
St. Giles Hospital
London
WC1V 8EA
An
Dr. A. E. Brown
Praktischer Arzt
15 High View
Wrensham
WR13 7RT
Abschrift an: Dr. David Tilbrook
Schreiben-Nr.: FL1/1099
Betreff: Charlotte Fletcher
London, 20. September
Sehr geehrter Herr Dr. Brown,
vielen Dank für Ihren Brief vom 16. September. Wie von Ihnen gewünscht, schildere ich Ihnen hiermit den Eindruck, den ich von Ihrer Patientin Charlotte Fletcher bei meiner Visite im Allgemeinkrankenhaus Wrensham gewonnen habe.
Charlotte scheint ein kluges, aufgewecktes Mädchen zu sein, das sich klar ausdrücken kann. Unter normalen Umständen dürfte sie keine Schwierigkeiten haben, wahrheitsgemäße und genaue Schilderungen von Ereignissen zu liefern, die sie betreffen. Doch sie befindet sich gegenwärtig in einem Zustand, der sie gegenüber jeder Person, die sich für ihre Geschichte interessiert, ausweichend, zögerlich und misstrauisch reagieren lässt. Das, was sie mir und anderen erzählt hat, legt die Schlussfolgerung nahe, dass ihre Erinnerungen an den tragischen Zwischenfall in zwei Phasen untergliedert werden können, die in unmittelbaren Zusammenhang mit der Reaktion der Personen gebracht werden können, denen sie sich anvertraut hat.
1. Die ursprüngliche Geschichte
Diese Version ist mir nicht aus Charlottes eigenem Mund bekannt, doch habe ich eine schriftliche Zusammenfassung der Ärztin vorliegen, mit der Charlotte nach ihrer Einlieferung in das Krankenhaus gesprochen hat. Darüber hinaus habe ich ein Gespräch mit Charlottes Mutter geführt, der sie diese Version am ausführlichsten mitgeteilt hat. Die Reaktion der Mutter hat meines Erachtens Charlottes weiteres Verhalten und ihre Abwandlung der Geschichte entscheidend beeinflusst.
Der Inhalt der ursprünglichen Äußerungen ist Ihnen bekannt. Ich möchte vorausschicken, dass Erzählungen dieses Typs – also solche, die sich durch Irrealität bei gleichzeitiger detaillierter Schilderung auszeichnen – nach Traumatisierungen keineswegs ungewöhnlich sind, genauso wenig wie bei Fällen, in denen es beinahe zum Erstickungstod gekommen wäre. Beides trifft auf Charlotte zu. Um zunächst den zweiten Punkt zu erläutern: Die mangelhafte Blutversorgung des Gehirns führt häufig zu einer Störung der visuellen Wahrnehmung, was sich gemeinhin in verwirrenden farbigen Lichterscheinungen äußert und in selteneren Fällen auch zu anhaltenden traumähnlichen Halluzinationen führen kann. Diese Bilder sind gewöhnlich von starken körperlichen Empfindungen begleitet, was ihnen in der Erinnerung einen besonders »realistischen« Charakter verleiht. Wenn die Begleitumstände dieser Empfindungen äußerst ungewöhnlich sind – wie dies auf besonders tragische Weise hier der Fall ist –, kann der Patient sich umso schwerer dem Glauben entziehen, dass sein Erlebnis wirklich stattgefunden hat.
Ich komme jetzt zu dem ersten Punkt, den Äußerungsformen eines Traumas. Wie Sie zweifellos wissen, verläuft die psychische Verarbeitung eines Schocks oder eines großen seelischen Schmerzes fast immer in folgenden drei Etappen: Abwehr, Aggression und schließlich Akzeptanz. Es ist zudem bekannt, dass bei Kindern der Verlust einer nahen Person, deren Tod sie miterleben mussten, zu besonders heftigen »Erklärungsfantasien« führen kann, die im Kern darauf abzielen, das Geschehene zu verleugnen.