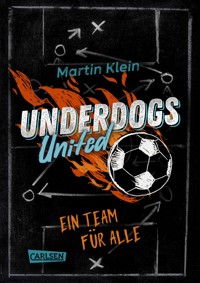6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Divan Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein seltsamer Gast besucht das Lagerfeuer in der großen Stadt, an dem sich abends das Bündnis der Tiere trifft. Hilfesuchend berichtet die magere Ratte von einer rätselhaften Appetitlosigkeit, die ihre Sippe jämmerlich zugrunde gehen lässt. Sandino, herrenloser Terrier und Anführer des Bündnisses, macht sich gleich am nächsten Tag mit seinen Freunden an die ersten Nachforschungen. Schon bald stoßen die Tiere auf ein Versuchslabor und ein dunkles Geheimnis. Sandino und seine Gefährten müssen beweisen, dass sie es auch in dieser Situation wagen, ihren Artgenossen zu helfen - gegen die Übermacht der Zweibeiner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Die Stadt der Tiere
Für Finn
»Wir wollten alles sehen, was in unsere Augen hineinging, um dabei zu denken, so viel wir konnten, und aus der beobachteten Realität so etwas wie einen Bau errichten.«
John Steinbeck
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen und existierenden Institutionen ist zufällig und nicht beabsichtigt.
Martin Klein
Die Stadt der Tiere
Roman
Inhalt
Der König von Kreuzberg
Die Witterung des Todes
Nebenbei bemerkt
Der Kater Finn
Bündnisrat
Dreieinhalb Leben
Gift
Happy Pharma
Die Fährte
Weg von hier!
Zwei Wölfe
Rat’s Finest
Theriak
Lobo macht mit
Der Weiße Fürst
Katzensommer
Im Engelsaal
Die Rache des Wolfs
Der König von Kreuzberg
Am südlichen Ende des lang gestreckten Görlitzer Parks bildete ein trüber Wasserlauf die Verbindung zwischen Landwehrkanal und Spree und gleichzeitig die Grenze zwischen den Berliner Stadtteilen Kreuzberg und Treptow.
Etwa zwei Dutzend Gefährte standen dort ohne eine bestimmte Ordnung kreuz und quer zwischen der Uferlinie und der nächstgelegenen Straße herum. An der Gewässerseite bildete eine kleine, von einer alten Esche und einer großen Eiche beschirmte Promenade die Grenze. In der anderen Richtung endete die Wagenburg am Asphalt des Bürgersteigs. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite schloss sich eine Häuserreihe an.
Einige Wohnwagen waren kaum größer als ein Schäferkarren, andere erreichten die Größe eines Eisenbahnwaggons. Ein paar alte LKWs, deren Aufbauten zu winzigen Wohnungen ausgebaut waren, standen auf dem Gelände, ohne dass ein Parkschein die Dauer begrenzte. Die Räder und Kotflügel waren von hohem Gras und großblättrigen Kletten überwachsen, und die Wagen wirkten wie bunte Blechpilze, die eines Tages zufällig zwischen Sträuchern und Stauden aus dem Boden geschossen waren.
Viele Wagen waren bunt bemalt, an einem hing ein Schild mit der Aufschrift Volxküche und auf der Rückwand eines großen Zeltes stand weithin lesbar: Die Grenze verläuft nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen oben und unten. Sandino hätte es etwas anders formuliert: Die Grenze verläuft zwischen denen mit zwei und denen mit vier Beinen.
Die Wagenburg war auf keinem Stadtplan verzeichnet und auf keinem Amt gemeldet, aber sie war trotzdem da. Ihre Bewohner lebten aus den unterschiedlichsten Gründen dort, aber die meisten hatten eine Gemeinsamkeit: Sie waren nicht bereit, jede Vorschrift anzuerkennen.
Als diese Geschichte begann, waren die Kastanien schon verblüht. Die Tage wurden länger und länger. Der Sommer ließ sich nicht mehr aufhalten, aber die Nächte blieben manchmal noch kühl.
Lobo war zu Besuch in der Wagenburg und lag mit Rocky und Erich im Staub. Zusammen blinzelten sie in das milde Licht des Abends und sahen träge zu, wie Sandino ziemlich eilig näher kam.
Lobos Statur mit der vom Nacken zum Schwanz etwas abfallenden Rückenpartie und die graubraune Färbung seines Fells erinnerten an einen Wolfshund, aber der Kopf war breiter und die Schnauze stumpfer. Von der Nase bis fast zur Stirn trug er eine breite Narbe und quer über seinen Rücken lief eine Reihe dunkler Streifen, die ihm den Spitznamen »Zebra« eingebracht hatte. Die anderen Hunde hatten keine Ahnung, welche seltsame Mischung von Rassen zu diesem wunderlichen Ergebnis geführt haben mochte.
Lobo lebte ohne Zweibeiner und Artgenossen zurückgezogen in einem stillgelegten Fabrikgelände in Schöneweide. Zu Menschen wahrte er stets große Distanz. Nicht einmal die Zweibeiner, die in der Wagenburg lebten, durften ihn anfassen. Manchmal suchte er aber die Gesellschaft der Hunde hier und holte sich nebenbei etwas zu fressen ab.
Sandino, der kleine Terrier, hatte seine Artgenossen erreicht.
»Gute Fährte!«
»Gute Fährte«, erwiderten drei tiefe Stimmen.
»Heute Nacht findet an der Feuerstelle eine Versammlung statt«, bellte Sandino. »Wir treffen uns, wenn der Mond am höchsten steht. Kann ich mit euch rechnen?«
»Klar«, brummte Rocky gutmütig.
»Um was geht’s?«, fragte Erich.
»Wahrscheinlich das Übliche.« Lobo gähnte. »Ein Tier ist in Schwierigkeiten und bittet euch um Hilfe.«
»So ist es.«
Sandino wandte sich ab.
»Entschuldigt mich, ich hab’s eilig. Ich will rechtzeitig alle informieren.«
Er lief davon.
»Was für ein Tier ist es denn diesmal?«, rief Lobo ihm nach.
Sandino hielt inne und drehte den Kopf.
»Neugierig?«
»Ach was.«
Lobo tat gleichgültig, aber ihm war anzusehen, dass er sehr gern eine Antwort bekommen hätte. Allem Argwohn zum Trotz konnte er das Interesse an der seltsamen Hilfsbereitschaft der Wagenburgtiere nicht verbergen.
»Es ist ein ungewöhnlicher Fall«, bellte Sandino. »Sehr ungewöhnlich. Ich hätte nicht erwartet, dass so jemand sich an uns wendet.«
»Na los, sag schon! Was für ein Tier ist es? Hund, Feind oder Beute?«
»Komm auch, dann wirst du’s sehen!«
»Das fehlte noch.«
Lobo sträubte ein wenig das Nackenfell. Der Gedanke, eine Katze zu unterstützen statt zu verjagen oder ein Kaninchen aus einer Notlage zu befreien, statt es zu fangen und zu fressen, war ihm zuwider, und als die Zusammenkunft stattfand, war er längst zur Jagd in sein Revier zurückgekehrt.
Mehr oder weniger häufig tauchten in der Wagenburg Tiere auf, die um Hilfe baten, und niemand wurde ohne Beratung abgewiesen. Längst hatte sich weit herumgesprochen, dass dort die unterschiedlichsten Tiere Freundschaft geschlossen und einen kleinen Bund mit großen Zielen gegründet hatten. Sie wollten den schier allmächtigen Zweibeinern eines Tages eine gleichberechtigte Partnerschaft abringen und sie hatten beschlossen, einander zu unterstützen, statt sich gegenseitig aufzufressen.
Sandino war der Motor dieses Experiments. Es war seine Idee, dass auch Tiere sich über Artgrenzen hinweg einigen und miteinander leben könnten.
Der Treffpunkt lag am straßenseitigen Rand der Wagenburg und war ringsum von Gebüsch und hohem Kraut verborgen. Ein etwa metergroßer Kreis aus Steinen markierte die Feuerstelle. Daneben befand sich ein Streifen Gras mit einigen Baumscheiben und Brettern, die einfache Sitzgelegenheiten boten.
Alle menschlichen Bewohner schliefen längst. Noch war Sandino mit dem Besucher allein. Eine nahe Straßenlaterne, das ferne Leuchten der nächtlichen Stadt und die Glut, die von einem abendlichen Feuer übrig geblieben war, sorgten für weiches, mattes Licht. Sandinos gedrungene Terriergestalt zeichnete sich als Schemen auf dem Boden ab.
Bei Licht wirkte sein Fell wie ein Flickenteppich mit dichten, kurzen Fasern und gleichmäßigen Anteilen von Schwarz, Weiß und Hellbraun. Der Kopf machte eine Ausnahme. Er war bis auf einen dunklen Fleck um das rechte Auge herum vollkommen weißfellig und nahm Sandino etwas von der Steifheit, die er ausstrahlte, wenn er seine Ohren tütenförmig aufstellte und den kurzhaarigen, auf die Hälfte der ursprünglichen Länge kupierten Schwanz aufrichtete wie ein Lehrer den Zeigestock.
Neben dem Terrier hockte ein kleiner, sehr hagerer Schatten mit spitzer Schnauze. Sein Blick war misstrauisch. Die Stimme glich einem heiseren Pfeifen:
»Kann ich wirklich jedem hier vertrauen?«
»Ja«, bellte Sandino.
»Auch den beiden Riesenhunden? Dem Alten und dem Monstrum?«
»Ja.«
Danach warteten sie schweigend, bis ein schleppendes Tappen Erich ankündigte. Viele Jahre hatte der greise Schäferhund an der Grenze, die Berlin jahrzehntelang geteilt hatte, Wache geschoben. Dann bröckelte das Bollwerk plötzlich, krachte zusammen und verschwand spurlos. Erich verlor seinen Job, irrte eine Zeit lang orientierungslos durch die Stadt und landete irgendwann in der Wagenburg. Hier verbrachte er nun seine alten Tage und wurde immer schwerhöriger und seniler.
»Freundschaft, Genosse. Steht ein operativer Einsatz an?«
»Vielleicht«, erwiderte Sandino.
Als Erich das Tier neben ihm bemerkte, leckte er sich irritiert über die graue Schnauze.
»Etwa für die da?«
Sandino nickte und Erich bellte ungnädig: »Solidarität hat ihre Grenzen.«
Ächzend streckte er neben der warmen Asche alle viere von sich.
Als Nächster kam Rocky. Er kroch von allerlei Geräuschen begleitet durchs Gebüsch, blieb an einer Astgabel hängen und schüttelte sich unwillig. Holz knirschte und brach. Rocky war eine riesige Dogge. Jeder Laut von ihm war ein tiefes Grollen, sein plumper Körper riesig, seine Augen trüb wie eine Schlammpfütze. Die Lefzen hingen an ihm herunter wie etwas, das alle Hoffnung verloren hatte. Rocky entdeckte den Gast und starrte ihn einfältig an.
»Uff«, grollte er und ließ sich mit einem dumpfen Geräusch neben Erich fallen.
Ignaz, der Igel, rumpelte wie ein aufgezogenes Blechspielzeug durch das Gras zum Versammlungsort und stoppte direkt vor Rockys gewaltigem Maul. Blitzschnell rollte er sich zu einem Stachelball zusammen.
»Ich bin’s nur«, grollte Rocky.
Ignaz’ Schnauze kam wieder zum Vorschein.
»Ich komm einfach nicht dagegen an.«
Er arbeitete hart gegen seine Natur, denn er war davon überzeugt, dass das zwanghafte Einigeln nicht mehr zeitgemäß war. Unzählige Igel bezahlten für diesen alten Schutzreflex auf den Straßen mit ihrem Leben, und Ignaz war fest entschlossen, seinesgleichen eines Tages vor dem kläglichen Tod durch Überfahren zu bewahren.
»Huch, was ist das denn?!«
Ignaz hatte das fremde Tier entdeckt. Schon verschwand sein Koboldgesicht mit den kleinen schwarzen Augen und der spitzen Nase erneut unter Stacheln. »Mist, schon wieder!«
Ein halbes Dutzend Spatzen flatterte geräuschvoll zum Treffpunkt. Rolf und seine Freunde. Niemand kannte die Ecken Kreuzbergs, die das ganze Jahr über einem Schlaraffenland glichen, besser als sie. Niemand holte sich dreister Pommes frites aus den Pappschalen der Zweibeiner. Niemand kam ihnen so nahe und wahrte dabei doch so konsequent Abstand.
Die Spatzen nahmen auf Rockys Rücken Platz, plusterten sich auf und zeterten durcheinander wie Verkäufer in einer Markthalle.
Hannes, der hinkende Fuchs, erschien, ohne dass seine Ankunft sich ankündigte. Plötzlich war er da. Die Spatzen zuckten zusammen, duckten sich unwillkürlich und verstummten.
»Da bin ich, Leute, und ihr habt mich nicht gehört, stimmt’s?«
Die anderen schüttelten bereitwillig die Köpfe. Hannes war im Wald aufgewachsen. Eines Tages verletzte er sich an einer Getränkedose und eine Vorderpfote blieb steif. Danach fiel es ihm schwer zu überleben. Schließlich hatte er den Wald verlassen und war in die Stadt gewandert. Seitdem ging es ihm besser. Hannes war sehr stolz darauf, dass er trotz seiner Behinderung lautlos schleichen konnte. Er schnüffelte, stellte die Ohren auf und bemerkte den Gast.
»Waidmannsheil! Was hat das zu bedeuten?!«
Der Fuchs suchte die Blicke der Freunde, aber er bekam keine Antwort.
Der letzte Ankömmling polterte so laut durchs Geäst, dass auch Erich es schon von weitem hörte.
»Sigrid«, brummte er.
Ein dickes Eichhörnchen sprang zwischen die anderen Tiere und begann auf der Stelle genüsslich, eine mitgebrachte Eichel zu knacken. »Die letzte aus meinem Wintervorrat«, verkündete es. »Ich habe sie extra lang aufgehoben. Eicheln sind einfach super! Wenn ihr wüsstet, wie ich mich jetzt schon auf die neuen freue! Haselnüsse sind allerdings auch nicht schlecht. Und Bucheckern. Oh ja, Bucheckern! Oder Holunderbeeren! Oder …«
»Sigrid!«, knurrte Erich.
Wahrscheinlich gab es kein Eichhörnchen in Berlin, das eine bessere Vorratshaltung betrieb als sie. Wahrscheinlich gab es auch keins mit größerem Appetit. Ganz sicher aber war Sigrid das einzige Eichhörnchen in der Stadt, das mit seinem Gewicht Türklinken niederdrücken und mit geschickten Pfoten Schlüssel in Schlösser stecken und herumdrehen konnte. Sie verstummte und hob den Blick von ihrer Frucht. Als sie das Tier neben Sandino erkannte, erstarrte sie.
Eine außergewöhnlich große, sehr hässliche und völlig abgemagerte Ratte hockte neben dem Terrier.
Es war still in der Runde. In der Glut knisterte leise ein rötlich leuchtendes Stück Holz. In der Ferne dröhnte die Stadt. Die Ratte musterte die Tiere mit schnellen, rastlosen Augen.
»Ein Bruder aus dem Volk der langschwänzigen Nager will mit uns sprechen«, sagte Sandino. »Deshalb habe ich euch zusammengerufen.«
Die Ratte richtete sich mühsam auf. Furchtlos schaute sie Erich und Rocky in die Augen. Die Hunde knurrten leise.
»Ich war der König von Kreuzberg«, pfiff sie heiser. »Der Herrscher über den größten Rattenclan weit und breit.«
»So siehst du aus«, tschilpte ein Spatz.
»Mein Reich erstreckte sich von den Landungsstegen des Landwehrkanals bis in die Keller am Alexanderplatz und von den Abflussrohren der Yorckbrücken bis zu den Lüftungsschächten der U-Bahn am Schlesischen Tor. Mein Wille galt an den Mülltonnen des tiefsten Hinterhofs genauso wie am hintersten Papierkorb der Hasenheide. Mein Pfiff war Gesetz.«
Die Ratte hielt inne und holte erschöpft Luft. Das Sprechen schien sie sehr anzustrengen. Die Tiere betrachteten sie argwöhnisch. Die Spatzen hüpften unruhig hin und her und Rocky grollte leise: »Seit wann ist ein Rattenpfiff Gesetz?«
Ignaz schnaufte unwillig.
»Der König von Kreuzberg!« Hannes kicherte in sich hinein.
»Ich hasse Könige«, knurrte Erich.
Die Ratte beachtete die Bemerkungen nicht.
»Vor vielen Monden, es war noch vor der Zeit, in der die Knospen aufbrechen, tauchte ein Fremdling bei uns auf. Er war eine Wanderratte wie wir, aber er sah merkwürdig aus mit seinem Fell weiß wie Schnee und Augen rot wie Blut. Er war so groß wie ich, und ich machte mich sogleich bereit, mit ihm um die Führerschaft zu kämpfen. Er aber unterwarf sich sofort, und zwar nicht nur mir, sondern auch allen anderen Mitgliedern meines Clans, selbst den jüngsten. Er beteuerte, er sei schon glücklich, wenn wir ihn nur am Leben ließen. Ich beschloss, ihn trotzdem herauszufordern. Ich war mir sicher, dass eine so starke Ratte wie er auf die Dauer nicht mit dem Platz des Giftvorkosters und Gefahrenkundschafters zufrieden sein würde. Aber noch bevor ich mit ihm kämpfen konnte, war der Fremdling wieder verschwunden.«
Die Ratte schwieg. Schwer atmend fuhr sie sich mit einer kleinen, spitzen Zunge über die Schnauze.
»Dann ist doch alles in Ordnung«, tschilpte Rolf, der Spatzen-Chef.
»Nichts ist in Ordnung!«, pfiff die Ratte aufgebracht. »Der Fremde hat uns eine Krankheit gebracht! Viele haben das Ende des Winters nicht mehr erlebt und noch heute werden Tiere meines Clans sterbenskrank! Selbst ich fühle mich mittlerweile nicht mehr ganz wohl!«
»Wie äußert sich diese Krankheit?«, fragte Sandino.
»Die Armen fressen nichts mehr«, klagte die Ratte. »Sie rühren kein Futter mehr an. Nicht einen Krümel fressen sie, bis sie schließlich vor Schwäche zugrunde gehen.«
»Wann hast du denn zuletzt etwas zu dir genommen?«, fragte Sigrid.
»Ich bin genügsam. Ich brauche nicht viel.«
Die Ratte starrte ins Leere.
»Auch ein König muss fressen«, stellte das Eichhörnchen fest. »Ohne Fressen geht gar nichts, wenn ihr mich fragt.«
»Ich bin immer noch stark genug!«, pfiff die Ratte wütend. »Stark, furchtlos und klug genug, um meinen Clan zu führen!«
Dann sackte sie zusammen.
»Trotzdem hat mich einer meiner Untertanen gestürzt. Ein kerngesunder, kräftiger und blutjunger Ratz. Einer von denen, die dank unserer Vermehrungskraft die Lücken füllen«, flüsterte sie.
»Es sind also nicht alle Tiere deines Clans erkrankt?«, fragte Sandino.
»Nein, aber die Zahl der Toten ist so groß, dass sogar ich nun vor lauter Sorge meine Kraft einzubüßen beginne!«
Der Terrier scharrte mit der Pfote. »Bist du zu uns gekommen, um uns diese Geschichte zu erzählen?«
Der magere Nager hob den Kopf.
»Ich bin gekommen, um euch um Hilfe zu bitten.«
»Ich fürchte, wir können nicht viel für dich tun«, bellte Sandino. »Rangkämpfe muss dein Volk unter sich ausmachen. Wir hier in der Wagenburg halten nichts davon. Ränge und Fressfeindschaften haben wir aufgehoben.«
»Ich weiß! Würde ich sonst ein Hunderudel besuchen?!«
Der Rattenblick glitt über Hannes und die Hunde und streifte Sigrid, Ignaz und die Spatzen.
»Ein Rudel, dem sogar andere Tiere angehören?! Kleine und schwache Kreaturen?!«
»Wen meint er?«, schnaufte Ignaz. Die Spatzen schimpften. Sigrid biss gleichmütig in die Eichel und kaute eifrig.
»Welche Art von Hilfe können kleine und schwache Kreaturen einem großen, ehemaligen Rattenkönig anbieten?«, fragte sie mit vollem Mund.
»Der Fremdling roch nach Mensch!«, schrie die Ratte. »Die Menschen stecken dahinter! Sie haben uns die Krankheit geschickt!«
»Wie meinst du das?«, fragte Sandino.
»Sie wollen uns vernichten! Seit wir sie begleiten! Vom Anbeginn der Zeit! Überall auf der Welt! Nie ist es geglückt. Doch jetzt ist es so weit.«
»Wie kommst du darauf?«
»Diese Ratte roch nicht wie mein stolzes Volk! Sie roch nach Zweibeinern und Zweibeiner-Apparaturen! Ich schwöre es bei meiner Königswürde!«
»Na ja«, brummte Erich. »Das taugt nicht viel. Schwöre lieber auf die Vierbeiner-Solidarität.«
»Sie sah auch nicht aus wie einer von uns. Sie sah aus wie … wie nach dem Willen von Zweibeinern geschaffen! Ja! Weiß und rot, wie die Menschen auch Hamster und Kaninchen zu ihrem Vergnügen hervorbringen! Gezüchtet! Abgerichtet! Ein Sklave! Geschaffen, um uns umzubringen! Uns feige mithilfe dieser Seuche zu töten! Weil sie kein anderes Mittel gegen uns haben!«
»Unmöglich.« Hannes schüttelte entschieden den Kopf. »Ich trau den Menschen einiges zu. Waidmannsheil! Einiges, aber so etwas nicht. Menschen wollen schießen. Hochsitze bauen, jagen und schießen.«
»Sie fuchteln ständig mit den Händen herum!«, rief ein Spatz. »Sobald wir in die Nähe ihrer Kuchenteller kommen. Das ist ihre Lieblingsbeschäftigung!«
»In riesigen Blechkisten sitzen und damit herumfahren!«, rief Ignaz. »Das ist typisch für sie. Blitzschnell alles platt walzen, was nicht ausweichen kann! Das finden sie gut.«
»Sie stellen auch Fallen. Sogar Gift streuen sie.« Sigrid bewegte bekräftigend ihren buschigen Schwanz. Er wedelte hinter ihr hin und her wie eine große braune Federboa.
»Gezielt Krankheiten verbreiten?« Rocky legte den Kopf schief und dachte so angestrengt nach, dass Speichel von seinen Lefzen tropfte. »Ich glaube, das macht kein Lebewesen auf dieser Erde.«
Er wandte sich an Sandino. »Was meinst du dazu?«
Sandino erhob sich unruhig, ergriff mit der Schnauze einen Stock und stocherte unbehaglich in der Asche herum. Der Zweig knackte zögernd. Dann durchdrang ihn die Hitze. Er begann rötlich zu glimmen und Sandino ließ ihn fallen.
»Leider ist es nicht so unwahrscheinlich, wie es klingt«, murmelte er. »Ich habe zum Beispiel schon mehrmals davon gehört, dass in einem fernen Land namens Australien, irgendwo auf der anderen Seite der Welt, einmal gezielt eine Krankheit verbreitet wurde, um die Kaninchen zu vernichten.«
»Hat es geklappt?«
Sigrid schaute Sandino zaghaft an.
»Nein. Zunächst schien es zwar so, denn die Kaninchen starben in Massen. Einige wenige jedoch überlebten. Sie waren gegen den künstlich ausgesetzten Krankheitserreger immun. Diese wenigen Tiere vermehrten sich umso besser, je mehr ihrer Artgenossen starben. So wurden aus wenigen schnell viele und am Ende waren die australischen Kaninchen zahlreicher als zuvor.«
»Immun?« Ignaz streckte dem Terrier seine Knopfnase entgegen. »Was bedeutet das?«
»Es bedeutet, dass dir eine bestimmte Krankheit nichts anhaben kann. Du trägst sie mit dir herum, aber sie bricht nicht aus. Dasselbe gilt normalerweise für deine Nachkommen und deren Kinder.«
»Wissen die Menschen nicht, dass alles so verlaufen kann?«
»Doch, sie wissen es.«
»Aber warum tun sie es dann trotzdem?«
»Keine Ahnung«, bellte Sandino.
»Vielleicht sind Menschen dumm«, brummte Rocky. »Ich habe sie schon lange im Verdacht.«
»Die Zweibeiner scheuen in ihren Rudelkämpfen nicht einmal davor zurück, sich gegenseitig mit giftigen Gasen und Krankheitserregern umzubringen«, bellte Erich.
»Sandino!« Sigrid sah den Terrier eindringlich an.
»Habe ich dich richtig verstanden? Du hältst die Vermutung, die unser, ähm … Gast geäußert hat, für möglich?«
»Ja.«
Der Zweig, den Sandino der Glut überlassen hatte, leuchtete hell auf.
»Sie ist genauso wahr, wie ich der König von Kreuzberg bin!«, pfiff die Ratte. »Wie ich es war«, setzte sie bitter hinzu. »Findet den Verräter! Stoppt ihn! Spürt ihn auf, bevor es zu spät ist!«
»Wie denkt ihr darüber?«
Sandino wandte sich an die anderen Tiere.
Unbestimmtes Schnaufen, Bellen, Keckern und Zwitschern antwortete ihm.
»Wieso gerade wir?«, fragte Hannes.
»Ihr seid mächtig! Ihr habt die Gesetze der Natur bezwungen! Ein Bündnis gegen die Macht der Menschen gegründet! Ihr lebt zusammen, ohne die Schwächeren zu fressen. Überall in der Stadt erzählen die Tiere von euren Taten.«
»Ach?« Rocky stellte die Schlappohren auf, die nicht recht zu seinem Doggenschädel passten. »Was erzählen sie denn so?«
»Ihr könnt Hunde von der Leine lösen! Jäger aus dem Wald vertreiben! Rinder aus dem Schlachthaus befreien! Es heißt, ihr vermögt sogar bunte Tiere vom anderen Ende der Welt dahin zurückzubringen, von wo die Menschen sie verschleppt haben!«
Sandino lachte mit einem kurzen, hellen Laut auf.
»Maßlos übertrieben! Das ist, als würde ich ein winziges, mageres Knöchelchen als großes, fettes Kotelett beschreiben.«
»Du, Hund, du bist der Mächtigste von allen!«, pfiff die Ratte. »Du hast dir sogar einen Kater untertan gemacht. Du bist der Hund, dem sogar die Katzen dienen! Vor allem aber: Du kannst die Zeichen der Zweibeiner lesen. Oder etwa nicht?!«
»Nein.« Sandino winkte mit einer Pfote ab. »Nur die einfachsten. Jeder Welpe könnte sie lernen. Und was den Kater betrifft: Er ist mein Freund, kein Untertan. Er dient weder mir noch irgendjemand anderem.«
»Auch deine Bescheidenheit wird gerühmt! Ich bin sicher, dass alle Geschichten stimmen. Es ist wahr, dass ihr Tieren in großer Not eure Hilfe gewährt. Glaubt mir, ich spreche nicht für mich allein. Ich spreche für alle Ratten von Kreuzberg, die von der Hunger-Krankheit heimgesucht werden. Wir sind Tiere wie ihr.«
Die Ratte war am Ende ihrer Kräfte. Wieder fiel sie in sich zusammen. Ihre Augen schlossen sich.
»He, Rattenkönig.« Sandino legte ihr vorsichtig eine Pfote auf den Nacken. »Was kann ich für dich tun?«
»Nichts.« Die Ratte blinzelte. »Mir persönlich geht’s immer noch gut. Sehr gut. Ich bin nicht krank.«
»Bist du sicher?« Sandino betrachtete sie ratlos. »Ich glaube, du solltest dringend etwas fressen.«
»Soeben war doch schon von fetten Koteletts die Rede«, bellte Rocky. »Du siehst aus, als könntest du eins schaffen.«
»Danke, ich bin satt.«
Die Ratte schüttelte matt den Kopf.
»Du magst keine Koteletts, stimmt’s? Kann ich sehr gut verstehen!« Sigrid nickte voller Überzeugung. »Einen Augenblick!«
Sie sprang ins Gebüsch und kehrte sogleich mit einer matschigen Erdbeere zurück.
»Eine der ersten aus meinem Sommervorrat! Ich würde sie liebend gern selbst verputzen, aber …« – sie zögerte kurz – »… du kannst sie haben. Jawohl, ich überlasse sie dir.«
»Ich habe keinen Hunger. Ich bin vollkommen satt.«
Der magere Gast verzog das Gesicht. Er rappelte sich ein letztes Mal auf. Mühsam begann er davonzukriechen. Die anderen Tiere glaubten, ein feines Schaben zu hören, als sein schlaffes Bauchfell den Boden streifte.
»Meine Untertanen werden sich freuen zu hören, dass ihr uns unterstützt.« Die Stimme flüsterte heiser aus dem Gebüsch. »Wenn ich ihnen die Nachricht überbracht habe, kehre ich zurück, um mit euch gegen die Krankheit und ihre zweibeinigen Erzeuger zu kämpfen.«
»Die Ratte ist verrückt«, murmelte Sigrid. »Sonst würde sie doch keine Erdbeere ablehnen.«
»Koteletts mag sie auch nicht.«
Rocky schüttelte fassungslos den Kopf.
»Ratten fressen normalerweise alles!«, rief ein Spatz. »Restlos alles.«
»Diese ist dabei zu verhungern«, schnaufte Ignaz. »Das sieht sogar ein Maulwurf. Aber sie fühlt sich satt und bemerkt nicht, dass sie ganz offenbar selber die Krankheit hat, von der sie berichtet.«
»Sie will es nicht wahrhaben.« Hannes schaute auf die feine Schleifspur, die der Besucher hinterlassen hatte. »Waidmannsheil!«
»Wir sollten uns umhören«, sagte Sandino. »Wenn wir mehr Informationen haben, können wir vielleicht etwas unternehmen. Möglicherweise weiß irgendein Tier in der Stadt etwas über eine weiße Ratte mit roten Augen, die ihren Artgenossen eine Krankheit bringt, die an einem …« – er suchte nach den richtigen Lauten – »… falschen Sattheitsgefühl zu erkennen ist.«
»Falsche Sattheit.« Sigrid verspeiste die Erdbeere. »Was für ein Quatsch.«
»Ratten-Quatsch«, zwitscherte ein Spatz.
»Sollen wir unsere Spürnasen wirklich auf Rattenprobleme richten?«
Hannes verzog seine spitze Schnauze.
»Ich hätte eher daran geglaubt, dass die Berliner Mauer wieder aufgebaut wird, als dass eine Ratte uns um Hilfe bittet«, bellte Erich. »Ausgerechnet eine Ratte!«
»Ich mag Ratten nicht«, knurrte Rocky.
»Niemand mag sie«, erwiderte Sandino. »Und trotzdem werden wir sehen, ob wir etwas wir für sie tun können.«
Er schaute in die Runde.
»Oder nicht?«
Rolf, der Spatz, plusterte sich ein wenig auf.
»Hilfe ohne Ansehen von Rang und Art. So haben wir es ausgemacht.«
»Das ist der Bund der Wagenburgtiere«, sagte Ignaz.
»Schon gut.« Der Fuchs nickte ergeben. »Klar, wir schauen uns um. Aber ich kann nichts daran ändern, dass mein Pelz sich dabei sträubt.«
»Ich bin natürlich dabei.« Rocky kratzte sich verdrießlich mit einer Hinterpfote am Ohr. »Aber mögen werde ich Ratten wahrscheinlich nie.«
»Hoch die Vierbeiner-Solidarität«, bellte Erich. »Ratten sind Ratten, aber vier Pfoten haben auch sie.«
»Gut gesprochen«, rief Sigrid. »Freundschaft!«
»Freundschaft!«, erwiderte ein gemischter Chor.
Die Tiere blieben noch eine Weile ohne viele Laute am niedergebrannten Feuer. Nach und nach suchten sie schließlich ihre Schlafplätze auf. Rocky und Erich trollten sich zum großen Zelt, die Spatzen verschwanden in den Zweigen der alten Esche, und Sigrid erkletterte die große Eiche, deren Krone ihren Kogel trug. Hannes und Ignaz begaben sich auf nächtliche Streifzüge. Der hinkende Fuchs verschwand lautlos in der Dunkelheit, während der Igel durchs Gras davonrasselte wie eine kleine, stachelige Lokomotive. Schließlich blieb Sandino allein zurück.
War es unsinnig, einer Ratte zu helfen? Es war seltsam. So seltsam wie der Bund der Tiere. Seltsam, aber gut.
Er gähnte, erhob sich schwerfällig und machte sich zu dem rotschwarz gestrichenen Wohnwagen auf, in dem eine junge Zweibeinerin namens Wildwuchs lebte. Mit ihr unterhielt der Terrier eine lose Gemeinschaft. Behaglich streckte er sich auf der Decke aus, die unter dem Wagen für ihn bereit lag, seufzte wohlig, schloss die Augen und wünschte sich selbst schöne Traumgerüche.
Die Witterung des Todes
Als Sandino die Augen wieder aufschlug, dämmerte der Morgen. Er liebte diese Zeit. Die Stadt war viel ruhiger als sonst, sie roch frischer und unzählige kleine Wassertropfen glitzerten auf Blättern und Halmen wie winzige, kostbare Bergkristalle. Am schönsten waren die Spinnennetze, deren kunstvolle Gewebe durch den Tau geschmückt waren wie von einem perfekten Bühnenbildner.
Der Hund durchquerte die Wagenburg, begann seine Runde wie immer an der Uferpromenade und setzte seine erste Urinmarke an den Fuß der alten Esche. Rolfs Freunde hatten sich längst in den Görlitzer Park aufgemacht, um all die Leckereien aufzupicken, die die Zweibeiner am Vortag hinterlassen hatten. Rolf saß allein auf einem unteren Zweig und genoss aufgeplustert das erste Sonnenlicht.
»Hallo, Sandino! Gut geschlafen?«
»Geht so. Ich habe geträumt, ich hätte Hunger und könnte nichts fressen.«
»Bei mir war’s anders herum«, tschilpte Rolf. »Ich träumte, ich sei satt und müsste Berge von alten Chips vertilgen. Das hat mich so geschafft, dass ich aufs Frühstück verzichte.«
»Seltsame Sache gestern, was?«
»Sehr seltsam.«
»Hört ihr euch heute beim gefiederten Volk um?«
»Klar!«
»Ich bin gespannt, was ihr herauskriegt.«
»Ich auch.«
»Freundschaft!«
»Freundschaft!«
Sandino schlenderte weiter. Er fügte Erichs und Rockys Urinmarken eigene hinzu und setzte einen gelungenen Haufen in ein Holundergebüsch. Er untersuchte die Markierungen fremder Hunde und schnüffelte zur reinen Unterhaltung an allen möglichen Fährten, die Menschen und Tiere hinterlassen hatten. In diesem Moment war der Terrier ein Hund wie jeder andere, ganz dem Augenblick zugewandt und bereit, jedem interessanten Geruch nachzuspüren.
Eine Witterung lautete feuchtes Fell und war noch so frisch, dass ihr Verursacher nicht weit sein konnte. Sandino folgte der Spur bis unmittelbar an den Kanal. Dort saß eine wohlgenährte Bisamratte, rollte die riesigen Blätter einer Pestwurz wie Pfannkuchen zusammen und machte sich schmatzend darüber her.
Jag sie, flüsterte ein Jahrtausende alter Instinkt Sandino zu. Manchmal gab er der Stimme nach, erschreckte ein paar Tauben, scheuchte ein Kaninchen durch die Gegend oder hetzte einer dreisten Katze hinterher. Die Gejagten kamen stets mit dem Schrecken davon und er hatte Spaß.
Frag sie nach hungrigen Ratten, befahl sein Verstand. Erkundige dich, ob sie jemals einen Albino gesehen hat.
Schnickschnack!, höhnte der Jagdtrieb.
Einen Moment hielt Sandino inne. Was wusste ein stinknormaler Bisam schon? Nichts! Er preschte los.
Der Nager ließ seinen Blattpfannkuchen fallen und hechtete mit einem eindrucksvollen Satz über die Spundwand hinweg in den Kanal. Ein Klatschen und eine Fontäne hoch fliegender Spritzer folgten. Dann erinnerten nur noch ein paar Kreise auf der Wasseroberfläche an das Tier, und Sandino setzte seinen Weg zufrieden fort. Bald witterte er wieder etwas Interessantes. Die Nase dicht am Boden, folgte er dem wohl bekannten Geruch. Er kam aus einem Brennnesselgestrüpp. Sandino schlüpfte hinein. Der König von Kreuzberg lag zwischen den grünen Trieben auf dem Boden, schwer atmend und mit zuckenden Ohren.
Unter seinem Fell zeichneten sich die Knochen ab wie auf einem Röntgenbild. Er lag auf der Seite und machte keine Anstalten, sich aufzurichten.
Sandino betrachtete ihn unschlüssig.
»Guten Morgen«, flüsterte die Ratte. »Wie geht’s?«
»Du musst unbedingt etwas fressen!«, rief Sandino.
»Bin satt.«
»Findest du nichts, was dir schmeckt?«
»Ich brauche nichts.«
»Ich komme gleich wieder.«
Sandino rannte zum Wohnwagen, klemmte den Blechteller mit dem restlichen Futter vom Vorabend zwischen die Zähne und kehrte zurück. Vorsichtig stellte er den Napf vor der Ratte ab. Sie schnupperte schwach und ihre Schnurrbarthaare zitterten.
»Futter«, sagte Sandino. »Für dich.«
Die Ratte rührte sich nicht.
»Kein Gift. Ehrlich.«
»Ich will nicht«, flüsterte die Ratte. »Futter. Igitt. Fressen. Pfui Teufel.«
»Futter und fressen.« Sandino bemühte sich, so freundlich und vertrauensvoll wie ein guter Krankenpfleger zu erscheinen. »Das ist es. Direkt vor deiner Nase. Darum geht’s. Das ist nicht eklig, sondern schmeckt sehr gut. Und jetzt friss endlich was davon!«
»Will nicht.«
»Aber warum denn nicht, verdammt noch mal!? Du verhungerst!«
»Bin satt.«
Sandino schob der Ratte ein saftiges, verführerisch duftendes Stück Schwarte unmittelbar vor die Schnauze. Als auch das nicht half, versuchte er sie zu füttern. Er nahm einen Brocken ins Maul, zwang die Ratte mit einer Pfote, ihres aufzusperren, und ließ das Stück hineinfallen.
Heftig begann sie zu husten, würgte die Nahrung wieder aus und ihren ausgemergelten Körper schüttelten Krämpfe.
»Schlucken!«, befahl Sandino. »Du musst kauen und dann schlucken! Fressen funktioniert anders nicht!«
Nach dem dritten Versuch gab er auf.
»Ich lass dir den Napf hier«, sagte er. »Später schau ich noch mal vorbei. Das ist alles, was ich für dich tun kann.«
Bedrückt setzte der Terrier seine Runde fort. Mittlerweile war die Sonne über die Dächer geklettert. Der Görlitzer Park füllte sich allmählich mit Menschen. Die Anlage gehörte zu seinem Revier. Sandino ignorierte die Duftmarken anderer Hunde. In Gedanken versunken, begann er die Anlage zu durchqueren, vorbei an Rasenflächen, auf denen es sich die ersten Zweibeiner bequem machten, vorbei an einem Kinderbauernhof mit anmutigen kleinen Ponys, ein paar Ziegen und Schafen und einem mächtig dicken Schwein und vorbei an einem Sportplatz. Auf der nächsten Grünfläche erregte ein gedrungenes, eifrig schnüffelndes Viech mit einem klobigen Kopf, einem Halsband und einem dünnen, wild pendelnden Schwanz seine Aufmerksamkeit. Ein paar Kinder zeigten staunend darauf und die Erwachsenen lachten oder schüttelten die Köpfe. Sie hatten ein Schwein vor sich, nur ferkelgroß, aber ausgewachsen.
»Wer bist du?«, fragte Sandino.
»Ich bin hip!«, grunzte es stolz. »Ich bin Porky, das Mini-Pig! Ich bin voll angesagt!«
»Gehörst du zum Kinderbauernhof?«
Porky grunzte entsetzt.
»Wo denkst du hin?! Ich bin kein ordinäres Hoftier, ich bin ein cooles Haustier! Mein Schlafkorb hat edelste Designerqualität!«
»Porky! Komm, Schatz, komm her!«, flötete ein schickes junges Menschenpaar und wedelte mit einer glitzernden Leine.
»Gehorchen tu ich natürlich nicht«, schnaufte Porky. »Bin schließlich kein Hund.«
Das Mini-Schwein wandte sich gemütlich ab und untersuchte grunzend einen überfüllten Papierkorb.
»Pfui, Porky, pfui!«, rief sein Frauchen. Sandino setzte seinen Weg fort.
Er lief an einer Frau mit orangefarbenem Irokesenschnitt vorbei, die mit ihrem kleinen Sohn Frisbee spielte, und an einem Typen mit Dreadlocks, der in ein Didgeridoo blies. Nicht weit davon trainierten ein paar junge Männer ihre Pitbulls. Sie ließen sie an die unteren Äste von Bäumen springen und sich dort verbeißen, bis sie mit stieren Augen am Holz hingen wie hässliche, zum Trocknen aufgehängte Felle.
Sandino schlug einen Bogen und lief durch eine Teich und Gebüschlandschaft. Wäre das Wasser nicht so brackig gewesen und hätte nicht zwischen allen Sträuchern Müll geleuchtet, hätte sie idyllisch wirken können.