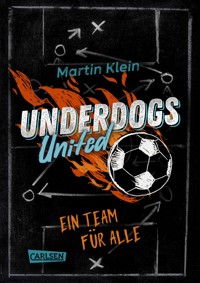6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
In 111 Gründe, Motorrad zu fahren geht es um nichts anderes als den kleinen Wahnsinn und die große Abenteuerlust, die immer mitfahren. Um Evel Knievels 433 Knochenbrüche, Steve McQueens Teilnahme an der Internationalen Sechstagefahrt in der DDR, um den reaktionären Senator McCarthy, der Marlon Brando das Harley-Fahren verbot. Es geht um Women on Wheels, um die Geheimnisse der Route 66 und des Julierpasses, um Rekorde, Meisterleistungen und tragische Fehlschläge. Und die große Freiheit, die man auf zwei Rädern erlebt. In 111 kurzweiligen Kapiteln widmet sich Martin Klein, selbst passionierter Motorradfahrer, mit Humor und Liebe zum Detail den Menschen und ihren Maschinen, den heldenhaften Pionieren und der Zukunft des Motorrads. Er beschreibt Bikertreffen, die sich wie Zeitreisen anfühlen, und diskutiert Stilfragen. Und natürlich geht es in diesem Buch auch ums Wetter: Denn anders als von vielen behauptet, ist jedes Wetter Motorradwetter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Martin Klein
111 Gründe, Motorrad zu fahren
Eine Liebeserklärung an das letzte Abenteuer der Straße
INHALT
VORWORT
Mein ganz persönlicher Grund
Weil man auf dem Motorrad Dinge erleben kann, wie sie anders nicht zu erleben sind
Das erste Mal war wie das erste Mal. Nur schneller. Bestimmt waren die beiden ersten Male etwas ungelenk, hastig und viel zu schnell vorbei. Kurzum alles andere als eine super Performance, aber beide Male wusste ich: Das ist es also, was das Leben an magischen Momenten bereithält. Davon kann es gar nicht genug geben! Und seit dieser ersten Fahrt mit der geliehenen Maschine eines Freundes hat mich die Faszination Motorradfahren nie wieder verlassen. Im Gegenteil, sie nimmt noch immer zu.
Angefangen hat es wie bei Millionen Jungs – und sehr vielen Mädels – im Kinderzimmer. Mit dem Poster eines namenlosen Rennfahrers an der Wand und einem Motorrad-Quartett, bei dem die Münch Trumpf war und alle anderen Karten in Grund und Boden spielte. Später unterbrachen wir das Kicken auf der Straße, als die großen Nachbarjungs auf den Mofas kamen. Sie waren schon von Weitem zu hören, wenn sie bis zum Anschlag Gas gaben auf ihren jaulenden Fahrrädern mit Hilfsmotor.
Als die Mofas von Mokicks abgelöst wurden, durfte ich hintendrauf mitfahren, wenn die Großen einen großzügigen Tag hatten und ihnen die Kleinen ausnahmsweise mal nicht peinlich waren. Mit 15 folgten endlich die ersten Fahrversuche im Wald, immer in Angst vor dem Förster oder gar einer Polizeistreife. Pünktlich zum 18. Geburtstag wurde der Schein gemacht – und mit dem geliehenen Motorrad des Freundes losgefahren. Hätte ich nicht gewusst, dass er ein bisschen nervös auf meine baldige Rückkehr wartete, ich wäre ewig weitergefahren. Ich wollte nie wieder absteigen.
Irgendwer hat Motorradfahren einmal als eine Kombination aus Reiten und Fliegen beschrieben, als eine Bewegung, die die dritte Dimension streift. Da ist was dran, es gibt diese Augenblicke, in denen man eins wird mit seinem Motorrad und am Scheitelpunkt einer Kurve oder beim Überfliegen einer Straßenkuppe kurze kosmische Gefühle erlebt, die mit nichts anderem zu vergleichen sind.
Es gibt noch unendlich mehr Gründe, Motorrad zu fahren. Die auf den folgenden Seiten genannten 111 Gründe sind weiß Gott nicht alle, sondern nur eine kleine Auswahl: Es geht um Männer und Frauen, die mit ihren Motorrädern Dinge erlebt haben, wie sie anders nicht zu erleben sind – auch wenn dafür manchmal hohe Preise gezahlt werden. Es geht um Techniker und Tüftler, die unbeirrbar realisiert haben, was als unrealistisch galt. Es geht um die Geheimnisse von Highway No 1 und von Alpenpässen, um Rekorde, Meisterleistungen und tragische Fehlschläge. Es geht um Bikertreffen als Zeitreisen und um Stilfragen beim Helmkauf. Immer aber geht es um Menschen und ihre Maschinen. Und natürlich auch ums Wetter: weil jedes Wetter Motorradwetter ist.
Wie sich die allererste Motorradfahrt anfühlte, daran erinnere ich mich in allen Details. Ich erinnere mich an den Fahrtwind und die Wärme der Sommerluft, an den Klang des Motors, die Beschleunigungskräfte, an das Tauchen in die erste Kurve. Und auch an den Motorradtyp erinnere ich mich genau. Das ist der Unterschied zum anderen ersten Mal.
Martin Klein
Kapitel 1
Ein Motorrad ist mehr als ein Motor mit Rädern
Weil ein Leben ohne Motorrad möglich, aber sinnlos ist
So lässt es sich frei nach Loriot auf den Punkt bringen. Eine Erkenntnis, die noch weit vor dem ersten Bartflaum reifte. Als kleiner Junge stellte ich mir das Erwachsenwerden vor wie ein steigendes Flugzeug, das durch die Wolken fliegt: Was wird passieren, wenn es in den Wolken verschwindet und selbst der Pilot nicht mal mehr drei Meter weit blicken kann? Aber vor allem: Was ist über den Wolken, wie sieht es aus, wenn sie auf einmal unter einem sind? Erwachsen zu werden erschien mir beängstigend. Aber am schlimmsten war die Vorstellung, erwachsen zu sein. Denn Erwachsene waren so … alt!
Von dieser Regel gab es nur wenige Ausnahmen – und diese Ausnahmen fuhren Motorrad. Motorradfahrer waren zwar auch erwachsen, aber anders. Sie gingen anders, nicht so steif und ungelenk, sondern lässig und schlurfend. Sie trugen keine Anzüge, sondern schwarze Jacken aus Leder mit Schnallen, Gürteln und hochgeschlagenen Kragen. Und wenn sie den Helm nicht auf dem Kopf hatten, dann trugen sie ihn am Arm wie kolossale Schmuckstücke.
An Motorradfahrerinnen erinnere ich mich kaum, aber an Beifahrerinnen, die in Leder, T-Shirt, Jeans und Stiefeln noch fantastischer aussahen als die Männer. Auf dem Schulhof machten verbotene Bilder die Runde: von Harley-Treffen im fernen Amerika, auf denen die Sozias sogar oben ohne zu sehen waren. Was für eine fremde und seltsame Welt und wie erstrebenswert! Von dieser Welt wollten wir Teil sein, sie war das einzige aufregende Versprechen, das uns das Erwachsenwerden gab. Wir hatten keine Ahnung, was uns die Schulzeit noch bringen sollte, keinen Plan, in welche Jobs wir danach gehen könnten, eins war aber ausgemachte Sache: Sobald wir volljährig waren, würden wir den Motorradführerschein machen, unabhängig davon, ob das Geld danach noch für eine Karre reichen würde oder nicht.
Bis dahin wurde Motorradquartett gespielt, bis die Spielkarten so weich waren wie unsere Frottee-Schlafanzüge. Bis dahin wurden die Bonanzaräder mit zusätzlichen Scheinwerfern und Rückspiegeln versehen, an denen Fuchsschwänze oder bunte Flatterbänder befestigt waren. Bis dahin lag man abends fiebrig im Bett unter dem Poster von Giacomo Agostini auf MV Agusta. Beim Aufwachen vor der Schule lag Ago immer noch in der Kurve, genauso wie später beim lästigen Hausaufgabenmachen. Die nächsten Jahre wurden auf Mofas und Mokicks verbracht. Das Gefühl, bereits ein echter Motorradfahrer zu sein, fuhr in diesen Tagen immer mit – bis man mal wieder von einem richtigen Motorrad überholt wurde. Denn beachtet wurde man ja auf diesen Fahrrädern mit Hilfsmotor von Hercules, Zündapp, KTM oder Malaguti noch nicht. Motorradfahrer grüßen eben nur Motorradfahrer. Das hat sich bis heute nicht geändert und das ist auch gut so.
Der Schwur, den man als kleiner Junge abgelegt hatte, wurde natürlich eingelöst: Pünktlich zum 18. Geburtstag machte man den Führerschein, die heilige Klasse 1. Das erste eigene Motorrad löste dann das andere Versprechen ein: dass man nun zwar irgendwie erwachsen war, aber ganz, ganz anders.
Weil jedes Wetter Motorradwetter ist
In vollem Ornat, sprich: Motorradhelm, Motorradjacke, Motorradprotektoren, Motorradhose, Motorradhandschuhe, Motorradstiefel, ist es eigentlich immer zu warm. Am Baggersee kommen einem die anderen Gäste in Flipflops, Bermudas oder Bikinis entgegen, während man als sicherheitsbewusster Fahrer auftritt wie ein Feuerwehrmann nach getanem Großeinsatz: verschwitzte Haare, klebende Klamotten und dampfende Stiefel. Jeder Fahrer kennt das und jeder weiß, dass nun zwei Dinge zu tun sind, die sich zum Glück wunderbar ergänzen: langsam Richtung Strand schlendern und Haltung bewahren. Auf keinen Fall hektisch werden und Klamotten vom Leib reißen – voller Panik ob des drohenden Hitzetods –, sondern so cool bleiben wie ein Marine beim Einsatz im Irak. Der behält Helm, Handschuhe und schusssichere Weste ja auch bei 45 Grad im Schatten an und sei es wegen der Stechmücken. So sieht sich auch der Motorradfahrer als Kämpfer für eine gute Sache. Für die eigene, denn er hat wenig Lust, vierzig Meter in einer Badehose über den Asphalt zu rutschen, nur weil ihm das bisschen Gluthitze zu schaffen macht und er partout nicht mehr in die gepolsterte Hose schlüpfen will. Nein, lieber mit stoischer Miene auch die grausamste Schwüle aushalten, als gegen den Dresscode zu verstoßen. Umgekehrt nützt das beste Equipment nichts oder nur wenig, wenn es richtig scheißkalt ist, regnet, hagelt oder schneit. Dann ist es einfach irgendwann alles andere als vergnüglich. Doch auch hier hilft wieder ein Kniff aus dem Feld der Kriegsführung: die Vorfreude auf die schöne Zeit nach dem Sieg, aufs Veteranentum. Das nahezu eingefrorene Hirn freut sich, später einmal sagen zu können: Ja, ich war dabei! Wisst ihr noch, damals, Splügenpass und Stilfserjoch? War das eine barbarische Kälte! Unser ganz persönliches Stalingrad, allerdings mit komfortablem Ausgang. Happy End in einer gut beheizten bikerfreundlichen Pension, wenn nicht sogar in der Sauna eines feinen Hotels mit anschließendem Mehr-Gänge-Menü am Kamin.
Klar, es gibt beheizte Handgriffe und beheizbare Hosen, Heizwesten, sogar beheizbare Unterwäsche und Socken und für die Dame nicht zuletzt den beheizbaren Muff. Doch wer möchte schon als wandelnder Warmduscher durch den Eisregen fahren, ausgestattet wie ein elektrischer Christbaum mit Akku, Adapter, Kabel und Stecker? Nein, diese technischen Spielereien sorgen definitiv nicht für die wahre Gemütstemperatur des echten Bikers. Extremes Wetter, Hitze wie schneidende Kälte – eigentlich jedes Wetter ist Motorradwetter, es gilt nur, ein paar Mythen zu kreieren, und schon sind schäbige Schweißflecken oder bibbernde blaue Lippen der Stoff, aus dem wenig später heroische Benzingeschichten werden.
Weil Gott und Ralf Waldmann nicht wollen, dass man läuft
»Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass die Menschen laufen, hätte er nicht das Motorrad erfunden.« Wer so einen Spruch raushaut, verdient eigentlich ein eigenes Buch und nicht nur ein Kapitel. Denn Ralf Waldmanns Sprüche sind nicht nur Gags, beispielsweise seine Antwort auf die Frage nach mehr Sicherheit bei Motorradrennen. »Nur wenn Motorradrennen verboten werden, ist Sicherheit da«, sagte der 20-fache Grand-Prix-Sieger und zweifache Vize-Weltmeister. Ein solches Verbot will er freilich nicht, denn dann könnte man ja mit dem Verbieten gar nicht mehr aufhören: Radrennen, Bobrennen, Bergsteigen, Marathon, Reiten … Außer Schach und vielleicht noch Synchronschwimmen gibt es wenig Sportarten, die noch keine Toten hervorgebracht haben. Seinem eigenen Sohn, der sich anschickt, in die großen Motorradstiefel des Vaters zu steigen, würde Waldmann den Rennsport nie verbieten, er würde ihn aber auch nicht umstimmen wollen, wenn der keinen Bock mehr hätte, im Kreis zu fahren.
Ralf Waldmann nahm 1986 als 20-Jähriger an seiner ersten Weltmeisterschaft teil. Er debütierte auf dem Hockenheimring mit einer 80-ccm-Rieju. Das spanische Gerät warf ihn aber öfter ab. Erst mit besseren Maschinen blieb er länger im Sattel, wurde selbst immer besser und gewann 1991 mit einer Honda seinen ersten Grand Prix. Die 1990er hätten sein Jahrzehnt werden können, wenn da nicht dieser Italiener gewesen wäre: Max Biaggi, dessen Hinterreifen Waldmann fast immer vor seinem Vorderreifen hatte. Immerhin gab es außer Waldmann wenig Fahrer, die Biaggi überhaupt einmal Paroli bieten konnten.
Das Jahr 2000 war Waldmanns letztes WM-Jahr. Er versuchte es kurz mit Autorennen, doch dabei stellte er wohl fest, was er besser kann. 2005 startete er noch einmal in der Superbike-Klasse der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft, dann war aber endgültig Schluss. Fast. 2009 feierte er als Ersatzfahrer beim Großen Preis von Großbritannien ein Mini-Comeback, bei dem er mit seiner Aprilia nach wenigen Runden stürzte und ausschied. Nun war es wirklich und für immer vorbei. Aber er durfte sich über einen ganz besonderen Ehrentitel freuen: Mit zwanzig Siegen bei 169 Grand-Prix-Rennen ist Ralf Waldmann der erfolgreichste Motorradfahrer in der Motorrad-WM-Geschichte, der nie Weltmeister wurde!
Sein nächster Coup war der Kauf von MZ im Jahr 2009. Mit dem Rennfahrerkollegen Martin Wimmer übernahm er in besten Sanierungsabsichten die Traditionsmarke, bei der es seit der Wiedervereinigung rumpelt, schleift und kracht. Vielleicht muss Ralf Waldmann ja mal wieder Gott ins Spiel bringen.
Weil Geld nicht alles ist
Wie bei allen Dingen geht es auch bei Motorradrennen um Geld. Um viel Geld. Richtig viel Geld. Wenn der Weltmeistertitelsammler Valentino Rossi vom italienischen Fiskus darauf hingewiesen wird, dass er für vier Jahre Steuern in einer Höhe von sechzig Millionen Euro nachzuzahlen habe, dann wird klar, dass nicht nur in der Formel 1 Reichtümer bewegt werden. Wer mitspielen will, sollte also zuallererst Kohle auf den Tisch legen. Das gilt besonders für die Orte, die Rennen veranstalten wollen. Und weil sich das Geld inzwischen auf eine Reise von Mitteleuropa nach Ländern wie Russland, China und Indien gemacht hat, ist Neu Delhi inzwischen für die Macher eine attraktive Alternative zum – sagen wir mal – Sachsenring. Da können die Sachsen noch so heftig mit schönen alten Schwarz-Weiß-Fotos aus der Vorkriegszeit winken, die smarten Chief Executive Officers der Lizenzagenturen beeindruckt das wenig, denn sie denken nicht in historischen Fotos, sondern in Zahlen mit möglichst vielen Stellen vor dem Komma. Was sind schon Bilder vom 26. Mai 1927, als in Sachsen vor mehr als 140.000 Zuschauern das erste Motorradrennen gestartet wurde – damals noch als Badberg-Viereck-Rennen –, gegen einen Scheck über drei Millionen Euro? So viel muss hinlegen, wer einen Motorrad-Grand-Prix anbieten möchte. Für Neu Delhi ist das seit einigen Jahren ein geringeres Problem als für den Osten der Bundesrepublik. Die Zukunft des Sachsenrings als Austragungsort des MotoGP ist ungewiss. Was bleibt, ist die einzigartige und unzerstörbare Historie im kollektiven Gedächtnis geschichtsbewusster Biker. Namen wie Ewald Kluge, Georg Meier, Jimmie Guthrie ragen aus der Vorkriegsgeschichte der Naturrennstrecke heraus.
Auch nach dem Krieg ging es bald erfolgreich weiter: 1950 hatte der Sachsenring mit 480.000 Besuchern allein am Rennsonntag seine Höchstmarke. Ab 1961 wurde der Große Preis der DDR auf dem Sachsenring ausgetragen, der mehrfach an Ikonen wie Mike Hailwood, Jim Read, Phil Redman und Giacomo Agostini ging. Auch der westdeutsche Rennfahrer Dieter Braun siegte in Ostdeutschland. Vielleicht war dieser Triumph des Klassenfeinds 1971 auch ein Grund, ab 1973 keine internationalen Rennen mehr zu starten, sondern nur noch Fahrer aus den Bruderländern einzuladen. Schon während Dieter Brauns Siegerehrung waren die Lautsprecher abgeschaltet worden, die bundesdeutsche Hymne sollte nun wirklich nicht durch das sozialistische Sachsen schallen. Braun war’s egal, denn nun sangen die ostdeutschen Fans das westdeutsche Lied – laut und deutlich, soweit das auf Sächsisch möglich ist.
Gesamtdeutsch ging es erst 1990 weiter. Doch das neue Kapitel begann tragisch. Für die alte Rennstrecke, die auch durch Karl Mays Geburtsstadt Hohenstein-Ernstthal führte, wo die Zuschauer beinahe vom Bürgersteig aus die Maschinen hätten streicheln können, waren diese inzwischen zu schnell geworden. Am 8. Juli 1990, dem Sonntag, an dem Deutschland in Italien Fußballweltmeister wurde, starben bei dem Rennen, das ein Neuanfang werden sollte, drei Menschen. Damit war das neue Kapitel sehr schnell wieder beendet. Erst 1996 glückte der Neustart. Der neue Sachsenring hat Teile des alten integriert, aber Ortschaften samt Bordsteinkanten und Kanaldeckeln gehören jetzt nicht mehr dazu. 1998 kehrte der Grand-Prix-Zirkus nach Sachsen zurück, der mit zeitgemäßen Boxenanlagen, neuem Start- und Zielturm sowie modernster Race Control glänzt und auch wieder Hunderttausende Zuschauer an die Strecke lockt. Ob der Grand Prix auch in Zukunft in diese besondere Landschaft einfällt, hängt aber von all diesen Faktoren nur bedingt ab.
Weil zu viel Vernunft nach Unvernunft verlangt
Mit Erscheinen dieses Buchs ändert sich etwas im unendlichen Kosmos der Motorräder. Das hat zwar nichts mit dem Buch zu tun, darf aber nicht unerwähnt bleiben. Vielleicht ist es nur eine Momentaufnahme, eine Zeiterscheinung, vielleicht aber auch eine Trendwende von kontinentalem Ausmaß: Europa brummt und Japan kämpft – um Marktanteile. Waren Honda, Kawasaki, Yamaha und Suzuki seit den 1980ern marktbeherrschend und wechselten sich in schöner Eintracht als Marktführer ab, so präsentieren sich die europäischen Hersteller seit der Jahrtausendwende mit immer breiterer Brust. Mutig und mit Lust auf das Bike der Zukunft zeigten sich auf den jüngsten Motorradmessen die Hersteller aus Italien, aus England und aus Deutschland. Nach Jahren der Krise, sinkender Zulassungszahlen und einer spürbaren Richtungslosigkeit rauchten in den Zentralen der großen Schmieden die Köpfe und man fragte sich, wie es weitergehen soll.
Es gab zwei Möglichkeiten, sich der Zukunft zu stellen: vorsichtig, abwartend, defensiv und rational oder irrational, risikofreudig und mutig. Zwei Philosophien also. Man konnte sich sozusagen zwischen erfrischendem Offensivfußball und Mauern entscheiden. Für Letzteres entschieden sich – eigentlich überraschend – die Japaner, die mit Vernunftmodellen auf wirtschaftliche Schadensbegrenzung in der Krise setzen. Dagegen will Europa mit Vollgas aus der Krise fahren und zeigt provozierende, aufreizende und verführerische Entwürfe.
Beispiel Ducati: Die sportlichen Italiener, die keine 50.000 Maschinen im Jahr verkaufen, haben mit der 1199Panigale ein Superbike in die Welt gesetzt, an dem nur der achtlos vorbeigeht, dessen Blut oktanfrei ist. Dass Ducati mit der Panigale ganz bei sich ist, zeigt schon der Name. Benannt ist die Maschine nach jenem Stadtteil von Bologna, in dem die Schmiede seit Gründung ihren Sitz hat. 195 PS leistet der Zweizylinder der roten Panigale, die Auge und Seele stimuliert und manipuliert, bis man so weich in der Birne ist, die geforderten zwanzig 1000-Euro-Scheine auf den Tisch zu legen. Auch Aprilia und MV Agusta mit der Brutale 675 setzen Maßstäbe und zelebrieren die neue Philosophie: Wenn in der Krise nur noch Vernunft gefragt ist, geht die Lebensfreude verloren, also lasst uns unvernünftig sein!
So südeuropäisch denkt BMW nicht, auch wenn München schon fast in Italien liegt. Mit der R 1200 GS haben die Bayern das seit Jahren meistverkaufte Motorrad. Das ohnehin schon innovative Gerät mit immer weiteren Innovationen zu verfeinern genügt, um diese Position zu halten, während die Kollegen von Triumph auf der Insel immer neu beweisen, dass vier Zylinder einer zu viel sind.
Eins wird klar: Die Europäer setzen in der Krise auf Käufer, die nur aus der Zeitung erfahren, dass Krise ist, weil sie es im eigenen Portemonnaie kaum spüren. Mit wenig Geld in der Hose müssen europäische Maschinen ein Poster an der Wand bleiben. Erschwinglicher sind die Japaner. Ob Honda mit der neuen 700er-Linie, Suzuki mit einer kleinen 250er, Einsteiger und Sparer werden mit unkomplizierten Modellen gezielt umworben. Aber die Avantgarde hat ihre Heimat bis auf Weiteres nicht in Asien, sondern im guten alten Europa.
Weil Stehen Steherqualitäten verlangt
Es gibt Sportarten, die fordern einem Respekt, Hochachtung und mindestens fünfzig tiefe Verbeugungen ab, obwohl man sie nie richtig kapieren wird. Baseball, Kricket und Krocket gehören dazu – oder auch Gehen. Obwohl eine olympische Disziplin, sieht’s seltsam bescheuert aus, besonders wenn die Geher gar nicht mehr stehen bleiben wollen, selbst wenn die Ziellinie schon längst überschritten ist.
Auch der Motorsport wartet mit einer Disziplin auf, die auf Unbeteiligte mehr als sonderbar wirkt: das Steherrennen. Da steht ein Mensch auf seinem Motorrad, obwohl er doch auch sitzen könnte, und dreht in einem Oval stoisch seine Runden. Hinter ihm schindet sich ein anderer Mensch auf seinem Rennrad, klebt förmlich im Windschatten des Motorradfahrers und gibt alles, um den Anschluss nicht zu verlieren. Zwischen dem Motorradfahrer, der sich so breit wie möglich macht, um einen möglichst großen Windschatten zu erzeugen, und dem Radfahrer befindet sich die charakteristische Rolle, die zum Steherrennen gehört wie die Nasenklammer zum Synchronschwimmen. Die hinten am Motorrad angebrachte Abstandsrolle sollte möglichst nicht berührt werden, da die Reibung Kraft und Zeit kosten würde. Der Abstand zur Rolle darf aber auch nicht zu groß werden, um nicht aus dem Windschatten zu geraten. Das würde den Radfahrer zurückwerfen oder – um es mit einer Redensart zu sagen, die in diesem Sport ihren Ursprung haben soll – er wäre »von der Rolle«.
Ende des 19. Jahrhunderts, als dieser Sport aufkam und sehr schnell zum Publikumsmagneten avancierte, wurde noch ohne Rolle gefahren. Vorschrift wurde die Schutzrolle erst nach der Berliner Rennbahnkatastrophe vom 18. Juli 1909. Da kam es auf der neuen Radrennbahn Botanischer Garten zu einem Unglück, als ein Motorrad auf die Holztribüne geschleudert wurde und explodierte. Neun Menschen starben in den Flammen, mehr als vierzig wurden verletzt.
Zu einem weitverbreiteten Missverständnis im Zusammenhang mit Steherrennen führt bereits der Name. Er kommt keineswegs daher, dass der Motorradfahrer, der in diesem Sport als Schrittmacher bezeichnet wird, steht. Die Rennen heißen so, weil der Radfahrer Steherqualitäten beweisen muss, um Distanzen von fünfzig oder hundert Kilometern bei konstant hohem Tempo durchzustehen. »Steher« wurde vom englischen »Stayer« bei Pferderennen abgeleitet, während der Sport in Deutschland zunächst auch unter dem Begriff »Dauerrennen« lief.
Im Rahmen von Sechs-Tage-Rennen waren diese Rennen einst absoluter Publikumsmagnet. Doch irgendwann traf dieser Zwitter aus Motorsport und Radrennen den Nerv der Zuschauer nicht mehr. Seit 1994 gibt’s keine Weltmeisterschaften mehr, immerhin aber tragen ein paar Länder – darunter auch Deutschland – noch Europameisterschaften aus. Berlin und Nürnberg, also Städte mit großer Zweiradvergangenheit, sind regelmäßig Gastgeber für die Dauerfahrer. Auch auf der ältesten Radrennbahn der Welt – Andreasried in Leipzig, 1885 mit einer Sandbahn eröffnet – werden solche Wettbewerbe ausgetragen. Darunter gibt es lange Nächte, bei denen, um den Begriff ein letztes Mal zu strapazieren, auch vom Publikum Steherqualitäten verlangt werden.
Auch Steherrennen bringen ihre Stars hervor, nur werden diese selten Sportler des Jahres. Helmut Baur ist so ein Superstar der Steherszene. Er wurde mehrfach Deutscher und Schweizer Meister. Das ist möglich, weil die Nationalität des Radfahrers entscheidend ist. Wenn Baur also Schrittmacher des Schweizer Stehers Peter Jörg ist und dieser die Meisterschaften seines Landes gewinnt, dann ist auch Baur Schweizer Meister. Sprachprobleme gibt’s sowieso nicht, die Teams werfen sich lediglich international festgelegte Kommandos zu. Helmut Baur ist übrigens Jahrgang 1944, aber immer noch aktiv – jetzt aber wirklich keine Witze mehr über Steherqualitäten.
Weil es Industriegeschichte erzählt
Lassen wir NSU, DKW, Horex und all die anderen großen Toten mal beiseite: Wer erinnert sich noch an Rabeneick oder Böhmerland, an Krieger-Gnädig, an Hulla, Lito oder Rixe? Die Liste der verblichenen Motorradmarken, die aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden sind, ist lang. Allein Wikipedia nennt weit über 200 Namen, manche so wohlklingend wie Orionette oder Viratelle, einige kurz und pragmatisch wie A.W.D. oder Mota, andere Marken trugen selbstbewusst die Namen ihrer Väter: Rickman, Ardie, Dürkopp.
Die Geschichte der ehemaligen Motorradmarken ist immer auch Industrie- und Zeitgeschichte. Die Schauplätze in Deutschland sind vor allem Berlin, Nürnberg, Zschopau und Köln. Ja, sogar Köln, das heute keiner mehr mit dem Bau von Motorrädern in Verbindung bringt, sondern nur noch mit dem Einsturz von Stadtarchiven und den regelmäßigen Abstürzen seines größten Fußballvereins.
Der stolze Name einer dieser Kölner Motorradfirma, die gerade mal ein Jahrzehnt existierte und trotzdem Duftmarken setzen konnte, war Imperia. 1924 wurde die Firma als Kölner Motorrad- und Maschinenbau Dr. Franz Becker gegründet, ein Jahr später folgte die Umbenennung. Bester Mann an Bord war Ernst Loof, der als Teilhaber, Ingenieur und Werksrennfahrer fungierte. 1932 und 1933 machte er die Marke mit Siegen bei den Eifelrennen auf dem Nürburgring international bekannt. Auch bei Bergrennen und als Seitenwagenfahrer war er erfolgreich. Imperia verwendete Einzylinder-Motoren des englischen Herstellers Rudge – und genau das führte dann auch das Ende dieser kurzen Erfolgsgeschichte herbei. Denn am Vorabend des Zweiten Weltkriegs stellten die Engländer die Lieferung ihrer Motoren an den zukünftigen Kriegsgegner ein. Die Versuche, einen eigenen Zweitakter zu konstruieren, scheiterten an den Entwicklungskosten. 1935 musste Imperia den Motorradbau aufgeben.
An der Motorradmarke Krieger-Gnädig ist die ganze Geschichte des Deutschen Reichs abzulesen. Karl Krieger war der Fahrer von Kaiser Wilhelm. Zunächst war er begeistert von der Fliegerei, baute kleine Eindecker und erwarb eine Fluglizenz, die ihm nichts mehr nützte, als der Versailler Vertrag nach verlorenem Ersten Weltkrieg den Flugbetrieb in Deutschland massiv einschränkte. Mit seinen Brüdern und dem Konstrukteur Franz Gnädig verlegte sich Krieger auf den Motorradbau und entwickelte noch vor BMW einen Kardanantrieb. Ihr Einzylinder-Blockmotor mit 500 ccm Hubraum verfügte über zwei Ölpumpen – auch das war revolutionär. Doch die Zeiten waren schwer und die Inflation hoch, daher wurde das Unternehmen 1922 von den Cito-Werken übernommen, die ihrerseits ein Jahr später von der Kölner Schmiede KLM aufgekauft wurden, die unter anderem die Motorradmarke Allright verantworteten. Das Motorrad Original Allright K-G wurde noch bis 1931 gefertigt.
Die weitere Unternehmensgeschichte ist gezeichnet von der Katastrophe, die sich bereits anbahnte: Jüdische Ingenieure und Teilhaber mussten gehen, wurden enteignet, deportiert und ermordet. Mit Kriegsende waren sehr viele dieser Geschichten zu Ende.
Weil es gar nicht schnell genug gehen kann
Seit sich der Mensch bewegt, versucht er, schneller zu werden. Usain Bolt läuft hundert Meter mit einer Geschwindigkeit von fast 45 km/h – als Mofa wäre er damit stillgelegt worden, für einen Radfahrer wäre das aber ein guter Schnitt. Der Niederländer Fred Rompelberg aber kann richtig flott radeln: 269 km/h fuhr der Radsportler kurz vor seinem fünfzigsten Geburtstag auf einem Salzsee in Utah, dem Hotspot aller Highspeed-Junkies. Im Windschatten eines Dragsters mit einer großen Windschutzhaube am Heck gelang ihm 1995 dieser unfassbare Rekord auf einem Fahrrad.
Bereits 1903 wurde auf Schienen die 200-km/h-Grenze durchbrochen, inzwischen geht’s mit Volldampf auf die 600er-Marke zu – auch ohne Transrapid. In der Luft bewegt sich der Mensch, seit er fliegen kann, noch zügiger und das kann er noch gar nicht so lange. Swetlana Sawizkaja wurde Heldin der Sowjetunion als schnellste Frau. 1975 flog sie mit ihrer MIG 25 satte 2683 km/h. Die Ehre der USA und der Männer stellte im folgenden Jahr Eldon Joersz wieder her – mit einer Lockheed SR-71 und 3529 km/h.
Bleiben wir am Boden und staunen, was mit Motorrädern möglich ist. Seit erstmals ein Verbrennungsmotor zwischen zwei Räder geklemmt wurde, wird ausgelotet, welche Geschwindigkeiten möglich sind. Der Motorrad-Weltverband FIM stoppt seit 1920 eifrig mit und hielt in diesem ersten Jahr die Bestzeit von Ernest Walker fest. Mit seiner 994-ccm-Indian schaffte Walker 167 km/h. 200 km/h schaffte acht Jahre später erstmals der Brite Oliver Baldwin ganz knapp mit einer Zenith-JAP. Zenith war zu dieser Zeit das Maß aller Dinge, wenn’s schnell gehen sollte. Das führte sogar dazu, dass die Engländer wegen ihrer drückenden Überlegenheit von vielen Rennveranstaltern ausgesperrt wurden. Die Engländer wiederum machten das Beste daraus und nahmen einen Hinweis darauf in ihr Logo auf, das ein Motorrad hinter Gittern zeigte und dazu den Schriftzug »Barred« – gesperrt.
Jetzt wollten aber auch die Ingenieure in München zeigen, was sie konnten, und schickten ihre BMW-Maschinen mit Ernst Henne ins Rennen. 1929 fuhr Henne seinen ersten Rekord mit 216 km/h, nach zahlreichen weiteren Weltrekorden war er im Jahr 1937 bei 280 km/h angekommen, gefahren auf einem gesperrten Teilstück der Autobahn Frankfurt – Darmstadt. Die stetige Steigerung der Geschwindigkeiten verdankte der Weltrekordler der immer weiter verbesserten Aerodynamik. Anfangs startete er noch ohne Verkleidung, dann bekam er einen tropfenförmigen Helm und einen Spoiler, der ihm einfach an den Hintern geschnallt wurde. Schließlich kamen Windkanal-geteste Vollverkleidungen zum Zuge. Henne hielt seinen Rekord von 1937 14 Jahre lang, erst 1951 war ein weiterer Deutscher mit einem anderen deutschen Fabrikat schneller: Wilhelm Herz auf NSU. Dessen Delphin war ein Meisterstück der Verkleidung, er ähnelte weniger einem Straßenmotorrad denn einem Torpedo. So fuhr dieser Delphin auch: 290 km/h und 1956 sogar 338 km/h. Dann war’s vorbei mit der europäischen Vorherrschaft.
Seit den 1960ern reizen amerikanische Piloten in ihren Salzwüsten immer neue Geschwindigkeiten aus. Im September 2010 schraubte Rocky Robinson zwei Suzuki-Motoren mit zusammen 2600 ccm in seinen überlangen Dildo und stellte mit 606 km/h einen Rekord auf, der eins ganz bestimmt nicht sein wird: der letzte.
Weil man gar nicht früh genug anfangen kann
2011 muss über Deutschland mehr Benzin als gewöhnlich in der Luft gelegen haben. Erst stand Sebastian Vettel als Weltmeister in der Formel 1 fest, dann wurde Motorrad-Pilot Stefan Bradl Moto2-Weltmeister, schließlich gelang Ken Roczen dieser Triumph beim Motocross. Der Weltmeisterschaftsgewinn des Teenagers aus Thüringen ging dabei zunächst ein wenig unter, weil Motocross nicht gerade auf den Titelseiten der Tageszeitungen zu finden ist.
Roczen wurde im Oktober 2011 als 17-Jähriger Weltmeister, zu diesem Zeitpunkt war er bereits ein ganz alter Hase mit über mehr als 14 Jahren Motocross-Erfahrung. Denn Ken war zweieinhalb, als er zum ersten Mal auf einer Motocross-Maschine Platz nahm. In einem Alter also, in dem Gleichaltrige auf dem Kinderstühlchen hin und her rutschen und kaum geradeaus laufen können. Dann geht’s ganz schnell: mit drei Jahren die ersten Rennen, mit sechs im Jahr 2000 erstmals Gewinner der DJFM-Outdoormeisterschaften, mit zwölf Gewinner des ADAC MX Junior-Cups, mit 13 Jahren Weltmeister bei der Junioren-WM 2007. Zwei Jahre später dann Gewinner des Großen Preises von Deutschland sowie erstmals die Teilnahme an den MX2-WM.
2011 schließlich gewann er vier Rennen vor Ende der Saison den MX2-Weltmeistertitel im schwäbischen Gaildorf. So cool er seine Rennen fährt, so hemmungslos lässt er hinterher seinen Tränen freien Lauf. Er sei eben ein richtiger Racer und ein wahrer Champion, sagt Kens Rennchef Pit Beirer, der nach einem Motocross-Unfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. Ken könne immer dann seine Qualitäten abrufen, wenn es darauf ankomme.
Bei all seinen Siegen war Ken immer der jüngste Fahrer. Jung, aber nicht unreif. »Ich habe Spaß am Fahren, aber ich fahre nicht zum Spaß«, sagt er gern und: »Warum soll ich mich damit begnügen, Zweiter zu werden?« Wie bei Stefan Bradl liegt’s bei ihm in den Genen und in der Familie. In beiden Fällen waren schon die Väter aktive Motorradsportler, wenn auch bei Weitem nicht so erfolgreich wie die Söhne, die eine Generation später den Sack zumachen. Kens Vorbild jedoch war nicht der Vater, sondern der letzte deutsche Motocross-Weltmeister: Paul Friedrichs, der 43 Jahre vor Ken den Weltmeistertitel nach Deutschland holte, damals nach Ostdeutschland. Der Erfurter Friedrichs hatte in den 1960ern einen ordentlichen Hattrick hingelegt: 1966 wurde er auf seiner Zweitakter-CZ erstmals Weltmeister in der 500-ccm-Klasse und verteidigte diesen Titel die nächsten zwei Jahre. Mittlerweile über siebzig Jahre alt, gehörte Friedrichs zu Ken Roczens ersten Gratulanten. Gleich nach den Eltern, die bei ihrem Sohn angestellt und immer dabei sind.
Der Weltmeistertitel 2011 ist der vorläufige Höhepunkt einer Laufbahn, die Ken Roczen über den Atlantik führt. Denn statt in die Klasse MX1 aufzusteigen, sucht er das Glück und neue Herausforderungen in Amerika. Der junge Ehrenbürger seines thüringischen Städtchens Mattstedt sieht in Kalifornien bessere Möglichkeiten, seine Qualitäten vor großem Publikum zu zeigen und zu versilbern. Fan-Artikel mit der Startnummer 94, seinem Geburtsjahr, liefen bereits ganz fantastisch, als Ken Anfang 2011 probeweise ein paar Rennen in den USA mitfuhr und das Finale in Las Vegas gewann – vor 70.000 Zuschauern. Zwischen Motocross in Europa und Supercross in Amerika bestehen große Unterschiede: Hier wird draußen gefahren, drüben in Hallen, hier werden in der Regel zweimal vierzig Minuten gefahren, in den USA dauert ein Rennen 15 Minuten. Ken Roczen weiß, dass er sich in den großen Baseballstadien an der Westküste Amerikas durchsetzen wird – er hat kein Rückflugticket gekauft.
Weil die Lobby gute Arbeit macht
Europäische Lobbypolitik – das weckt fiese Assoziationen. Man denkt sofort an heimliche Absprachen in Hinterzimmern und Hotelbars, an schmierige Anzugträger, die in feinen Restaurants diskret Schecks über den Tisch schieben, um beim Verkauf von Waffen vielleicht doch eine kleine gesetzliche Ausnahme erwirken zu können, an Pharma-Vertreter, die billige Wettbewerber nicht auf den europäischen Markt lassen wollen, an große Versicherungen, die es für der Sache dienlich halten, wenn vertrauliche Gespräche am besten im Bordell stattfinden. Lobbypolitik wirkt oft schäbig und böse. Dabei versuchen natürlich auch die »Guten« Einfluss zu nehmen in Brüssel, Straßburg und in sämtlichen Hauptstädten Europas. Also auch Menschenrechtler, Naturschützer, Motorradfahrer … Motorradfahrer?! Oh ja, die hochoffizielle Lobby der Biker sitzt in Brüssel und heißt FEMA – Federation of European Motorcyclists’ Associations.
Die Idee, sich europapolitisch zu positionieren, entstand im Sommer 1988 mit Gründung der FEM (Federation of European Motorcyclists). Auf deutscher Seite als Gründungsmitglied dabei: der Biker-Verband Kuhle Wampe. Zehn Jahre später schloss sich die Interessengemeinschaft mit der European Motorcyclists’ Association zur FEMA zusammen. 24 nationale Organisationen aus 19 Ländern Europas sind in der FEMA vertreten und nehmen die Interessen von 350.000 europäischen Motorradfahrern wahr. Immer mehr Regelungen und Gesetze, die auch oder nur Biker betreffen, werden auf europäischer Ebene gestaltet. Einer der ersten Erfolge der FEMA war in den 1990ern das Kippen der 100-PS-Grenze für Motorräder. Um sich Gehör zu verschaffen, wurden europaweite Demos organisiert. Bereits in den 90ern fuhren in Paris 20.000 und in Brüssel sogar 30.000 Motorradfahrer mit ihren Maschinen auf die Straße.
Die schlimmsten Gegner der Rechte der Biker seien die Ahnungslosen, beteuern die FEMA-Vertreter, und in Brüssels Hinterbänken wimmelt es von Abgeordneten, für die Motorräder ausschließlich für Lärm und Gefahr stehen. Oder für völlig nichtsnutziges Privatvergnügen. Denen hält die Biker-Lobby unter anderem entgegen, dass das Motorrad als Einspurfahrzeug einiges gegen Staus und den drohenden Verkehrskollaps in den Metropolen leisten kann.
Gleichzeitig erkennt die FEMA an, dass auch Motorräder ihre Beiträge zum Umweltschutz leisten müssen. Doch statt Fahreinschränkungen werden innovative technische Lösungen gefordert und gefördert. Weil die Erderwärmung eben kein regionales Phänomen ist, wird global gedacht und gehandelt. So kooperieren FEMA und AMA, die American Motoryclist Association, und nutzen den beratenden Status bei den Vereinten Nationen.
Vor lauter Lobbypolitik, Aktenstudiererei und Mund-fusselig-Reden verlieren die Motorrad fahrenden Europaabgeordneten und Interessenvertreter nie aus dem Auge, was aus ihrer Sicht das Wichtigste ist. Die zwei höchsten Ziele hat die FEMA in ihrer Charta schriftlich festgehalten: Freedom und Fun.
Kapitel 2
Bikes im Film
Weil Steve McQueen fuhr, wie er lebte
Für seinen Film Ich, Tom Horn