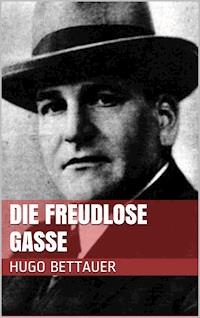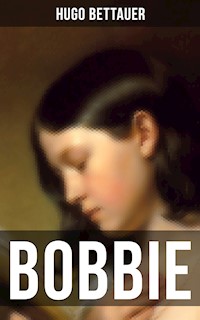1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
In "Die Stadt ohne Juden" entwirft Hugo Bettauer eine dystopische Gesellschaft, in der das jüdische Leben aus der Wiener Stadtlandschaft vollständig verdrängt wurde. Der Roman, der 1922 erschienen ist, nutzt einen satirischen und gleichzeitig packenden Erzählstil, um die Konsequenzen des Antisemitismus und der sozialen Entfremdung zu beleuchten. Bettauer kombiniert dabei soziale Kritik mit fantastischen Elementen und schafft so eine eindringliche Reflexion über Identität, Zugehörigkeit und die Gefahren des Hasses. Sein Werk ist nicht nur ein überzeugendes literarisches Dokument seiner Zeit, sondern auch eine warnende Stimme gegen die Diskriminierung und Ausgrenzung, die in den 1920er Jahren an Bedeutung gewannen. Hugo Bettauer, ein österreichischer Schriftsteller und Verleger, war ein engagierter Kämpfer für soziale Freiheit und Menschenrechte. Seine eigenen Erfahrungen in einer von Vorurteilen und politischen Umwälzungen geprägten Gesellschaft motivierten ihn, sich mit der jüdischen Identität und dem Schicksal der Juden in Europa zu befassen. Bettauer war Zeitzeuge der wachsenden Antisemitismusbewegungen und kritisierte ebenso gesellschaftliche Konventionen, was seiner Arbeit einen hohen gesellschaftlichen Relevanz verleiht. "Die Stadt ohne Juden" ist eine eindringliche und nachdenklich stimmende Lektüre, die sowohl als literarisches Meisterwerk als auch als wertvolle Mahnung dient. Leserinnen und Leser, die sich mit Fragen der Toleranz, Identität und den Gefahren des Hasses auseinandersetzen möchten, finden in Bettauers Werk eine tiefgründige Analyse, die auch in der heutigen Zeit von großer Bedeutung ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Stadt ohne Juden
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel. Das Antijudengesetz
Inhaltsverzeichnis
Von der Universität bis zur Bellaria umlagerte das schöne, ruhige und vornehme Parlamentsgebäude eine einzige Menschenmauer. Ganz Wien schien sich an diesem Junitag um die zehnte Vormittagsstunde versammelt zu haben, um dort zu sein, wo sich ein historisches Ereignis von unabsehbarer Tragweite abspielen sollte. Bürger und Arbeiter, Damen und Frauen aus dem Volke, halbwüchsige Burschen und Greise, junge Mädchen, kleine Kinder, Kranke im Rollwagen, alles quoll durcheinander, schrie, politisierte und schwitzte. Und immer wieder fand sich ein Begeisterter, der plötzlich an den Kreis um ihn herum eine Ansprache hielt und immer wieder brauste der Ruf auf:
»Hinaus mit den Juden!«
Sonst pflegten bei ähnlichen Demonstrationen hier und dort Leute mit gebogener Nase oder besonders schwarzem Haar weidlich verprügelt zu werden; diesmal kam es zu keinem solchen Zwischenfall, denn Jüdisches war weit und breit nicht zu sehen, und zudem hatten die Kaffeehäuser und Bankgeschäfte am Franzens-und Schottenring, in weiser Erkenntnis aller Möglichkeiten, ihre Pforten geschlossen und die Rollbalken herabgezogen.
Plötzlich zerriß ein einziges Aufbrüllen die Luft.
»Hoch Doktor Karl Schwertfeger, hoch, hoch, hoch! Hoch der Befreier Österreichs!«
Ein offenes Auto fuhr langsam mitten durch die Menschenmassen hindurch, die zurückdrängten und Bahn machten. Im Auto saß ein großer älterer Herr, dessen mächtiger Schädel mit willkürlichen Büscheln weißer Haare bedeckt war.
Er nahm den grauen, weichen Schlapphut ab, nickte der jubelnden Menschenmenge zu und verzerrte das Gesicht zu einem Lächeln. Aber es war ein saures Lächeln, das von den zwei Falten, die von den Mundwinkeln abwärts liefen, gewissermaßen dementiert wurde. Und die tiefliegenden grauen Augen blickten eher finster als vergnügt drein.
Lachende Mädchen drängten sich vor, schwangen sich auf das Trittbrett, die eine warf dem Gefeierten Blumen zu, eine andere war noch dreister, schlang ihren Arm um seinen Hals und küßte den Dr. Schwertfeger auf die Wange. Als ob der Chauffeur ahnte, wie seinem Herrn bei solchen Gefühlsausbrüchen zumute wurde, ließ er das Auto vorwärts springen, so daß die Mädchen mit jähem Ruck nach rückwärts fielen. Sie taten sich dabei nicht wehe, denn die Menschenmauer fing sie auf.
Im Parlamentsgebäude herrschte nicht die laute Begeisterung der Straße, sondern fieberhafte Erregung, zu stark, um Ausdruck nach außen zu finden. Die Abgeordneten, die sich bis zum letzten Mann eingefunden hatten, die Minister, die Saaldiener gingen schweigend und unruhig umher, sogar die überfüllten Galerien verhielten sich lautlos.
In der Journalistenloge, in der es sonst am ungeniertesten zuzugehen pflegte, wurde nur im Flüsterton gesprochen. Und eine bemerkenswerte räumliche Spaltung hatte sich eingestellt. Die kompakte jüdische Majorität der Berichterstatter drängte ihre Stühle zusammen, die Referenten der christlichsozialen und deutschnationalen Blätter bildeten ihrerseits eine Gruppe. Sonst mischten sich die jüdischen und christlichen Journalisten fröhlich durcheinander, im Berufskreis war man nicht Parteigänger, sondern nur der Herr Kollege, und da die jüdischen Journalisten gewöhnlich mehr Neuigkeiten wußten und sie besser verwerten konnten, standen die antisemitischen zu ihnen in einem starken Abhängigkeitsverhältnis. Heute aber flogen hämische Blicke von der christlichen Ecke in die jüdische, und als der kleine Karpeles von der »Weltpost«, der eben erst eingetreten war, den Dr. Wiesel von der »Wehr« mit »Servus, Herr Kollege!« begrüßte, wandte ihm dieser ohne Erwiderung den Rücken.
Es drängten immer noch Journalisten herein, darunter Vertreter ausländischer Zeitungen, die heute in Wien angekommen waren.
»Nicht rühren kann man sich«, brummte der Herglotz vom christlichen »Tag«, worauf ihm ein Kollege mit kleinem, bärtigem Kopf und mächtigem Bierbauch erwiderte:
»Na, ein paar Tage noch und wir werden hier Platz genug haben!«
Hüsteln, Lächeln, Lachen auf der einen Seite, gegenseitige bedeutungsvolle Blicke auf der anderen.
Ein junger blonder Herr mit roten Backen machte nach links und rechts eine leichte Verbeugung.
»Holborn vom ›London Telegraph‹! Bin eben vor einer Stunde angekommen und kenne mich wahrhaftig nicht aus. Vorgestern kam ich aus Sidney nach halbjähriger Abwesenheit in London an, eine Stunde später saß ich wieder im Zug, um nach Wien zu fahren. Unser Managing-Editor, das Kamel, hat mir nichts gesagt, als: In Wien wird es jetzt lustig, da schmeißen sie die Juden hinaus! Fahren Sie hin und berichten Sie, daß das Kabel reißt! Also bitte, wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie mich rasch instruieren wollten.«
Das alles war in so drolligem Englisch-Deutsch herausgekommen, daß sich die Spannung ein wenig löste. Minkus vom »Tagesboten« bemächtigte sich, heftig gestikulierend, des englischen Kollegen und begann mit den Worten:
»Also, ich werde Ihnen alles genau erklären –.« Aber Dr. Wiesel ließ ihn nicht weitersprechen. »Sie verzeihen, aber diese Aufklärung wird besser vonunsausgehen.«
Tonfall drohend, das »uns« bedeutungsvoll unterstrichen. Und schon befand sich Holborn in der christlichen Ecke, wo Wiesel kurz und sachlich erklärte:
»Was geschehen soll, werden Sie sofort aus dem Munde unseres Bundeskanzlers Doktor Karl Schwertfeger erfahren, der das Gesetz zur Ausweisung aller Nichtarier aus Österreich eingehend begründen wird. Die Vorgeschichte ist, kurz gesagt, folgende: Nach der sogenannten Sanierung, die zwei Jahre andauerte, gerieten die Finanzen Österreichs wieder in Unordnung. Als die österreichische Krone auf den Wert eines zweihundertstel Centimes herabgesunken war, begann das Chaos einzutreten. Ein Ministerium nach dem anderen mußte gehen, es entstanden Unruhen, täglich kam es zu Plünderungen der Geschäfte, zu Pogromen, die Wut und Verzweiflung der Bevölkerung kannte keine Grenzen mehr und schließlich mußte zu Neuwahlen geschritten werden. Die Sozialdemokraten traten ohne neues Programm in den Wahlkampf, die Christlichsozialen hingegen scharten sich um ihren geistvollen Führer Doktor Karl Schwertfeger, dessen Losungswort lautete: Hinaus mit den Juden aus Österreich! Nun, vielleicht ist es Ihnen bekannt«, – Holborn nickte, obwohl er keine Ahnung hatte – »daß die Wahlen den völligen Zusammenbruch der Sozialdemokraten, Kommunisten und Liberalen brachten. Selbst die Arbeitermassen wählten unter der Parole ›Hinaus mit den Juden!‹, und die sozialistische Partei, vordem relativ die stärkste, konnte knapp elf Mandate retten. Die Großdeutschen aber, die gut abschnitten, hatten sich ebenfalls auf das ›Hinaus mit den Juden!‹ eingestellt.
Nun, der Genialität des Doktor Schwertfeger, seiner unerschrockenen Energie, seiner kühnen Impetuosität und Beredsamkeit gelang es, dem Völkerbund, der vor die Alternative Anschluß Österreichs an Deutschland oder Gewährenlassen gestellt war, die Zustimmung zur großen Judenausweisung abzuringen. Und jetzt wird Schwertfeger selbst das Gesetz einbringen, das sicher angenommen werden wird. Sie sind also Zeuge eines historischen –.«
»Pst!«-Rufe wurden laut. Wiesel konnte nicht weiterreden, denn der Präsident des Hauses, ein Tiroler mit rötlichem Vollbart, schwang die Glocke und erteilte dem Bundeskanzler das Wort.
Grabesstille, in der das Surren der Ventilatoren unheimlich klang. Das leiseste Räuspern, das Rascheln der Papiere in der Journalistenloge wurde gehört und empfunden.
Übergroß, trotz des vorgebeugten Schädels und gewölbten Rückens, stand der Bundeskanzler auf der Rednertribüne, die Hände, zu Fäusten geballt, stützten sich auf das Pult, unter den grauen, buschigen Brauen glitzerten die scharfen Augen über den Saal hinweg. So stand er bewegungslos, bis er plötzlich den Schädel ins Genick warf und mit seiner mächtigen Stimme, die sich in den turbulentesten Versammlungen immer hatte Gehör erzwingen können, begann:
»Verehrte Damen und Herren! Ich lege Ihnen jenes Gesetz und jene Änderungen unserer Bundesverfassung vor, die gemeinsam nichts weniger bezwecken, als die Ausweisung der nichtarischen, deutlicher gesagt, der jüdischen Bevölkerung aus Österreich. Bevor ich das tue, möchte ich aber einige rein persönliche Bemerkungen machen. Seit fünf Jahren bin ich der Führer der christlichsozialen Partei, seit einem Jahr durch den Willen der überwiegenden Mehrheit dieses Hauses Bundeskanzler. Und durch diese fünf Jahre hindurch haben mich die sogenannten liberalen Blätter wie die sozialdemokratischen, mit einem Wort alle von Juden geschriebenen Zeitungen, als eine Art Popanz dargestellt, als einen wütenden Judenfeind, als einen fanatischen Hasser des Judentums und der Juden. Nun, gerade heute, wo die Macht dieser Presse ihrem unwiderruflichen Ende entgegengeht, drängt es mich, zu erklären, daß das alles nicht so ist. Ja, ich habe den Mut, heute von dieser Tribüne aus zu sagen, daß ich viel eher Judenfreund als Judenfeind bin!«
Ein Murmeln und Surren ging durch den Saal, als flöge eine Schar Vögel aus dem Felde auf.
»Ja, meine Damen und Herren, ich bin ein Schätzer der Juden, ich habe, als ich noch nicht den heißen Boden der Politik betreten, jüdische Freunde gehabt, ich saß einst in den Hörsälen unserer Alma mater zu Füßen jüdischer Lehrer, die ich verehrte und noch immer verehre, ich bin jederzeit bereit, die autochthonen jüdischen Tugenden, ihre außerordentliche Intelligenz, ihr Streben nach aufwärts, ihren vorbildlichen Familiensinn, ihre Internationalität, ihre Fähigkeit, sich jedem Milieu anzupassen, anzuerkennen, ja zu bewundern!«
»Hört! Hört!«-Rufe wurden laut, sensationelle Spannung bemächtigte sich der Abgeordneten und des Auditoriums, und der englische Journalist Holborn, der nicht alles verstanden hatte, fragte interessiert den Dr. Wiesel, ob der Mann da unten der Vertreter der Judenschaft sei.
Der Kanzler fuhr fort.
»Trotzdem, ja gerade deshalb wuchs im Laufe der Jahre in mir immer mehr und stärker die Überzeugung, daß wir Nichtjuden nicht länger mit, unter und neben den Juden leben können, daß es entweder Biegen oder Brechen heißt, daß wir entweder uns, unsere christliche Art, unser Wesen und Sein oder aber die Juden aufgeben müssen. Verehrtes Haus! Die Sache ist einfach die, daß wir österreichische Arier den Juden nicht gewachsen sind, daß wir von einer kleinen Minderheit beherrscht, unterdrückt, vergewaltigt werden, weil eben diese Minderheit Eigenschaften besitzt, die uns fehlen! Die Romanen, die Angelsachsen, der Yankee, ja sogar der Norddeutsche wie der Schwabe – sie alle können die Juden verdauen, weil sie an Agilität, Zähigkeit, Geschäftssinn und Energie den Juden gleichen, oft sie sogar übertreffen. Wir aber können sie nicht verdauen, uns bleiben sie Fremdkörper, die unseren Leib überwuchern und uns schließlich versklaven. Unser Volk kommt zum überwiegenden Teil aus den Bergen, unser Volk ist ein naives, treuherziges Volk, verträumt, verspielt, unfruchtbaren Idealen nachhängend, der Musik und stiller Naturbetrachtung ergeben, fromm und bieder, gut und sinnig! Das sind schöne, wunderbare Eigenschaften, aus denen eine herrliche Kultur, eine wunderbare Lebensform sprießen kann, wenn man sie gewähren und sich entwickeln läßt. Aber die Juden unter uns duldeten diese stille Entwicklung nicht. Mt ihrer unheimlichen Verstandesschärfe, ihrem von Tradition losgelösten Weltsinn, ihrer katzenartigen Geschmeidigkeit, ihrer blitzschnellen Auffassung, ihren durch jahrtausendelange Unterdrückung geschärften Fähigkeiten haben sie uns überwältigt, sind unsere Herren geworden, haben das ganze wirtschaftliche, geistige und kulturelle Leben unter ihre Macht bekommen.«
Brausende »Bravo!«-Rufe. »Sehr richtig!« »So ist es!«
Dr. Schwertfeger führte mit der knochigen Rechten das Glas zu den dünnen Lippen und sein halb spöttischer, halb befriedigter Blick kreiste im Saal.
»Sehen wir dieses kleine Österreich von heute an. Wer hat die Presse und damit die öffentliche Meinung in der Hand? Der Jude! Wer hat seit dem unheilvollen Jahre 1914 Milliarden auf Milliarden gehäuft? Der Jude! Wer kontrolliert den ungeheuren Banknotenumlauf, sitzt an den leitenden Stellen in den Großbanken, wer steht an der Spitze fast sämtlicher Industrien? Der Jude! Wer besitzt unsere Theater? Der Jude! Wer schreibt die Stücke, die aufgeführt werden? Der Jude! Wer fährt im Automobil, wer praßt in den Nachtlokalen, wer füllt die Kaffeehäuser, wer die vornehmen Restaurants, wer behängt sich und seine Frau mit Juwelen und Perlen? Der Jude!
Verehrte Anwesende! Ich habe gesagt, daß ich den Juden, an sich und objektiv betrachtet, für ein wertvolles Individuum halte und ich bleibe dabei. Aber ist nicht auch der Rosenkäfer mit seinen schimmernden Flügeln ein an sich schönes, wertvolles Geschöpf und wird er von dem sorgsamen Gärtner nicht trotzdem vertilgt, weil ihm die Rose näher steht als der Käfer? Ist nicht der Tiger ein herrliches Tier, voll von Kraft, Mut und Intelligenz? Und wird er nicht doch gejagt und verfolgt, weil es der Kampf um das eigene Leben erfordert? Von diesem und nur von diesem Standpunkt kann bei uns die Judenfrage betrachtet werden. Entweder wir oder die Juden! Entweder wir, die wir neun Zehntel der Bevölkerung ausmachen, müssen zugrunde gehen oder die Juden müssen verschwinden! Und da wir jetzt endlich die Macht in den Händen haben, wären wir Toren, nein, Verbrecher an uns und unseren Kindern, wenn wir von dieser Macht nicht Gebrauch machen und die kleine Minderheit, die uns vernichtet, nicht vertreiben wollten. Hier handelt es sich nicht um Schlagworte und Phrasen, wie Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Toleranz, sondern um unsere Existenz, unser Leben, das Leben der kommenden Generationen! Die letzten Jahre haben unser Elend vertausendfacht, wir stehen mitten im vollen Staatsbankerott, wir gehen der Auflösung entgegen, ein paar Jahre noch und unsere Nachbarn werden unter dem Vorwand, bei uns Ordnung schaffen zu müssen, über uns herfallen und unser kleines Land in Stücke zerreißen – unberührt von allen Geschehnissen aber werden die Juden blühen, gedeihen, die Situation beherrschen und, da sie ja nie Deutsche im Herzen und im Blut waren, unter den geänderten Verhältnissen Herren bleiben, wenn wir Sklaven sind!«
Das ganze Haus geriet jetzt in furchtbare Aufregung. Wilde Rufe wurden ausgestoßen. »Das darf nicht sein! Retten wir uns und unsere Kinder!« Und als Echo klang es von der Straße her aus zehntausend Kehlen. »Hinaus mit den Juden!«
Dr. Schwertfeger ließ die Erregung auslaufen, nahm von den Ministerkollegen Händedrücke entgegen und sprach dann über die Durchführung des Gesetzes. Gemäß den Forderungen der Menschlichkeit und den Bedingungen des Völkerbundes würde mit größter Milde und Gerechtigkeit vorgegangen werden. Jeder habe das Recht, sein Vermögen mitzunehmen, soweit es aus Bargeld und Wertpapieren oder Juwelen bestehe, Immobilien zu veräußern, sein Geschäft freihändig zu verkaufen. Unternehmungen, die nicht veräußerlich seien, würden vom Staat übernommen werden, und zwar derart, daß nach dem Steuerbekenntnis des letzten Jahres der Reinertrag fünfprozentig kapitalisiert werden würde. Hätte also zum Beispiel ein Unternehmen im vergangenen Jahr eine halbe Million Reinertrag aufgewiesen, so würde es mit zehn Millionen abgelöst werden. Ein boshaftes Lächeln kräuselte die Lippen des Kanzlers.