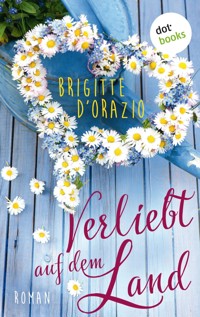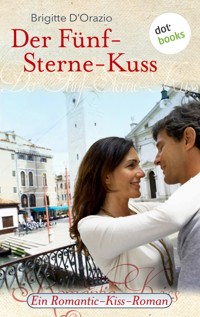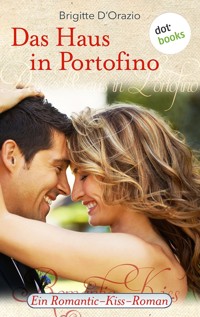Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben ist ein wunderbares Abenteuer – wenn man sich darauf einlässt: Brigitte D'Orazios Roman "Die Sterne über Florenz" als eBook bei dotbooks. Vor dem Schicksal davonlaufen – ist das möglich? Lisa hat ein Leben lang getan, was von ihr verlangt wurde. Doch nun ist sie eine erwachsene Frau und nicht länger bereit, sich den Wünschen ihres strengen Vaters zu beugen. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin bricht Lisa aus dem goldenen Käfig aus. Schon immer hatte sie diesen tiefen, unerklärlichen Wunsch, die Toskana zu erkunden und hier ihr Glück zu suchen. Als sie in Florenz dem attraktiven Paolo begegnet, scheint sich dieser Traum zu erfüllen. Aber ist es wirklich so einfach? Lisa muss erkennen, dass man tatsächlich nicht vor seinem Schicksal davonlaufen kann – und sie es deswegen in die eigenen Hände nehmen muss! Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Sterne über Florenz" von Brigitte D'Orazio. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Vor dem Schicksal davonlaufen – ist das möglich? Lisa hat ein Leben lang getan, was von ihr verlangt wurde. Doch nun ist sie eine erwachsene Frau und nicht länger bereit, sich den Wünschen ihres strengen Vaters zu beugen. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin bricht Lisa aus dem goldenen Käfig aus. Schon immer hatte sie diesen tiefen, unerklärlichen Wunsch, die Toskana zu erkunden und hier ihr Glück zu suchen. Als sie in Florenz dem attraktiven Paolo begegnet, scheint sich dieser Traum zu erfüllen. Aber ist es wirklich so einfach? Lisa muss erkennen, dass man tatsächlich nicht vor seinem Schicksal davonlaufen kann – und sie es deswegen in die eigenen Hände nehmen muss!
Über die Autorin:
Brigitte D’Orazio ist ein Pseudonym der erfolgreichen Autorin Brigitte Kanitz, unter dem sie ihre romantischen Unterhaltungsromane veröffentlicht. Sie arbeitete viele Jahre als Redakteurin für Zeitungen und Zeitschriften in Hamburg und in der Lüneburger Heide. Heute lebt sie gemeinsam mit ihren Zwillingstöchtern an der Adria.
Brigitte D’Orazio veröffentlichte bei dotbooks die Romane »Villa Monteverde« und »Verliebt auf dem Land« sowie die Kurzromane »Das Haus in Portofino«, »Geliebte Träumerin«, »Der Fünf-Sterne-Kuss«, »Sing mir das Lied von der Liebe« – diese vier Titel auch erhältlich im Sammelband »Zum Verlieben schön« –, »Fundstücke des Glücks«, »Kapitäne küsst man nicht« und »Ti amo heißt Ich liebe dich« – diese drei Titel auch erhältlich im Sammelband »Zum Träumen romantisch«.
***
eBook-Neuausgabe September 2014
Copyright © der Originalausgabe 2003 by Scherz Verlag, Bern, München, Wien
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: init | Kommunikationsdesign, Bad Oeynhausen, unter Verwendung eines Motivs von thinkstockphotos, München
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-727-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Sterne über Florenz« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Brigitte D‘Orazio
Die Sterne über Florenz
Roman
dotbooks.
Für meinen verstorbenen Mann Giancarlo
Kapitel 1
»Florenz? Vergiss es!« Mit einer abrupten Kopfbewegung warf Maren ihre langen schwarzen Haare so heftig zurück, dass sie in der Abendsonne Funken sprühten.
»Ich habe genug von alten Gemäuern, großer Geschichte und anbetungswürdigen Gotteshäusern! Ohne mich!«
Lisa erschrak. Mit Marens Temperamentsausbrüchen hatte sie noch nie umgehen können. Andererseits war es gerade dieses Temperament, das sie so an ihrer Freundin faszinierte. Sich selbst hielt sie im Vergleich dazu für langweilig.
»Aber wir hatten das doch so geplant«, warf sie vorsichtig ein.
»Geplant! Geplant! Mensch, sei doch mal ein bisschen flexibel!«
Wenn das nur so einfach wäre, dachte Lisa und wich Marens Blick aus. Laut sage sie:
»Wo möchtest du denn gern hinfahren?«
»Was weiß ich. Dahin, wo was los ist. Rimini, Riccione, Cattolica – bloß weg von hier.«
Lisa unterdrückte ein Lächeln. Die halbe Welt träumte davon, einmal im Leben nach Venedig zu kommen, doch Maren war anders. Sie knirschte seit drei Tagen mit den Zähnen, wenn Lisa auf der Rialtobrücke oder in der Markuskirche in Begeisterungsrufe ausbrach, und nicht einmal ein blonder Venezianer namens Bosco hatte sie aufheitern können.
»Bosco? Wie Wald? Du heißt Wald mit Vornamen? Das ist ja wohl ein Witz. Hör mal, Lisa, unser Freund hier heißt Wald, in einer Stadt, in der ich noch keinen einzigen Baum entdeckt habe.«
Sie hatten in einem der Straßencafés vor den Arkaden gesessen und die einmalige Atmosphäre des Markusplatzes genossen. Das hieß: Lisa hatte sie genossen. Sie hatte den Musikkapellen zugehört, Touristen beim Füttern der Tauben zugeschaut und Einheimische beim abendlichen Schwätzchen beobachtet. Ihrem Fremdenführer zufolge hatte Napoleon I. den Platz einmal den »schönsten Salon der Welt« genannt.
Der Mann mit dem seltsamen Namen war ihr erst aufgefallen, als Maren ihn bereits eingeladen hatte, sich an ihren Tisch zu setzen. Er war nur kurz geblieben, doch lange genug, um sich mit Maren für den nächsten Abend am selben Ort zu verabreden.
Sie warteten bereits seit einer Stunde, und Lisa spürte, wie Maren nervös wurde. Die schwarzen Haare flogen ein weiteres Mal über die Schulter.
»Venedig ist todlangweilig«, stöhnte Maren, »und Florenz ist mit Sicherheit noch schlimmer.«
Um einen Streit zu vermeiden, zuckte Lisa nur stumm die Schultern. Sie war müde und sehnte sich nach ihrer herrlichen Badewanne im Hotel »Danieli«, gleich neben dem Dogenpalast. Die Luxusherberge war Marens Wahl gewesen. Und selbst die Tatsache, dass jetzt, Ende Juni, nur eine horrend teure Suite frei war, konnte sie nicht abschrecken.
»Herbert zahlt«, hatte sie grinsend gesagt und eine ihrer drei goldenen Kreditkarten gezückt. Herbert war Marens Mann und hatte keine Ahnung, wo sich seine Frau zur Zeit aufhielt. Dieses Schicksal teilte er mit Walter Mayer, der im Augenblick vermutlich bei Lisas Eltern in München auf dem Sofa saß und verzweifelt die Hände rang. Sie unterdrückte einen Seufzer, als sich ihr schlechtes Gewissen meldete. Die ganze Reise ist eine Schnapsidee, schoss es ihr durch den Kopf, und ich möchte wissen, wohin uns das noch führen soll. Sie selbst versuchte, dem Abenteuer wenigstens einen kulturellen Anstrich zu geben, doch ihre Freundin hatte andere Vorstellungen.
»Na also! Das wurde aber Zeit!« Marens Gesichtsausdruck wechselte von gelangweilt zu freudig erregt. Lisa sah Bosco über den Platz auf sie zukommen. Er war ein gut aussehender, groß gewachsener Mann, und für eine Sekunde verspürte sie einen Anflug von Neid.
»Buona sera«, sagte er und schaute Maren tief in die Augen. Für Lisa hatte er nur einen höflichen Seitenblick übrig. Verlegen fuhr sie sich durch das kurze, aschblonde Haar. Wahrscheinlich überlegt er gerade, wie er mich am schnellsten los wird, dachte sie, und konnte ihm nicht einmal böse sein. Sie fand selbst, dass sie nicht attraktiv war, aber neben der rassigen Maren wirkte sie besonders durchschnittlich. Dem schnellen Wortwechsel der beiden konnte sie nicht folgen. Maren sprach fließend Italienisch, während sie selbst nur ein paar Brocken konnte. Überrascht bemerkte sie kurz darauf, wie der Venezianer sich wieder verabschiedete.
»Nanu? War das schon alles?«
Maren lachte.
»Aber nein. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich erst frisch machen will. Er soll mich um neun im Hotel abholen, mit mir zum Lido fahren und mich edel zum Dinner einladen.«
»Wie du das immer machst«, meinte Lisa bewundernd.
»Was denn?«
»Wie du die Männer herumkommandierst. Ich könnte das nie.«
»Ich weiß, du Schäfchen. Das lernst du auch nicht mehr.«
Maren holte aus ihrer Handtasche die Schachtel Zigaretten heraus, steckte sich eine davon zwischen ihre vollen, rot angemalten Lippen und zündete sie an. Zum hundertsten Mal wünschte sich Lisa, so wie ihre Freundin sein zu können: schön, lässig und selbstbewusst. Seit ihrer ersten Begegnung vor zehn Jahren empfand sie so.
Maren war schon mit zwanzig etwas Besonderes gewesen, und Lisa hatte sie von Anfang an rückhaltlos bewundert. Sie hatten schnell Freundschaft geschlossen – Maren, die lebhafte schwarzhaarige Schönheit, aus einfachen Verhältnissen stammend, aber mit dem brennenden Wunsch, im Leben vorwärts zu kommen, und Lisa, die farblose, schüchterne Tochter aus reicher Familie, mit Villa in Grünwald.
Damals an der Uni, wo Lisa mit großem Eifer Sonderschulpädagogik studierte und Maren in der Mensa Essen austeilte, hatten sie zunächst keine Notiz voneinander genommen. Bis die Geschichte mit dem Vanillepudding passierte. Lisa griff gerade nach dem letzten Schälchen, als eine gertenschlanke, blonde Kommilitonin neben ihr sagte: »Den lass mal lieber mir, der tut dir sowieso nicht gut.«
Lisa lief dunkelrot an.
»Wie bitte?«
»Du hast mich schon verstanden.« Mit einem abschätzigen Grinsen starrte sie auf Lisas etwas zu breite Hüften. Neben ihnen lachten zwei Mädchen, anscheinend Freundinnen der Studentin. Lisa schämte sich schrecklich und war schon bereit, den Pudding zurückzustellen, als auf der anderen Seite des Tresens eine raue Stimme ertönte: »Von so 'nem eingebildeten Hungerhaken würde ich mir an deiner Stelle nichts gefallen lassen!«
Überrascht begegnete Lisa dem frechen Blick aus einem Paar grüner Katzenaugen.
»Seit wann haben Kellnerinnen hier etwas zu melden?«, erkundigte sich die Blonde lautstark und erntete weiteres Gelächter.
»Ungefähr seit jetzt«, kam es ruhig zurück, und bevor Lisa reagieren konnte, hatte Maren ihr das Puddingschälchen aus der Hand gerissen und zielsicher im Gesicht der Blonden platziert.
»Unsere Freundschaft wurde mit Vanillepudding besiegelt«, erzählten sie beide seitdem gern und lachten noch oft über den Vorfall in der Mensa. Dummerweise verlor Maren damals ihren Job, aber da Lisa sich dafür verantwortlich fühlte, bat sie ihren Vater um Hilfe. Karl Wagner, ein mächtiger Bauunternehmer mit weit reichenden Verbindungen, tat ihr den Gefallen und besorgte ihrer neuen Freundin eine Stellung in einem französischen Bistro in Schwabing. Er tat sogar noch ein bisschen mehr als nötig, was er seiner naiven Tochter allerdings nicht mitteilte.
Als Maren es einige Jahre später schaffte, in die bessere Gesellschaft einzuheiraten, freute sich Lisa aufrichtig. Sie selbst hatte ihr Studium abgeschlossen und unterrichtete voller Idealismus an einer Sonderschule. Für sie war es das Schönste auf der Welt, benachteiligten Kindern zu helfen, aber sie konnte auch Maren verstehen, die sich so sehr abgestrampelt hatte und nun die Sonnenseite des Lebens in vollen Zügen genoss.
Manchmal versuchte Lisa, sich ein wenig von Maren zu lösen, doch es gelang ihr nie. Sie war ihre einzige wirkliche Freundin, trotz der unsichtbaren Schatten, die sich ab und zu zwischen sie drängten.
Maren nahm einen tiefen Zug von der Zigarette und blies Lisa den Rauch ins Gesicht.
»Also? Was hast du heute noch vor?«
»Wie bitte?« Geistesabwesend wedelte sie den Qualm fort.
»Venedig! Gondeln! Mondschein! Schöne Männer!«
Lisa lachte.
»Ich glaube, das ist nichts für mich.«
»Nein, das glaub ich auch, Fräulein Nonne.«
»Ich bin eben anders als du.« Sie empfand Marens Bemerkung als beleidigend.
»Ach, komm, nun sei nicht eingeschnappt. Du hast doch erst vor ein paar Tagen selbst gesagt, dass du nie im Leben den guten Walter heiraten wirst. Versprechen hin oder her. Mein Herr Vater kann sich auf den Kopf stellen. Waren das nicht deine Worte?«
»Ja, schon.« Lisa seufzte leise. Nicht zum ersten Mal bedauerte sie es, die Freundin in ihre geheimen Gedanken eingeweiht zu haben. Die Zigarette war aufgeraucht, und Maren drückte die Kippe in den Aschenbecher.
»Ich gehe mich jetzt für den Abend schön machen. Kommst du mit?«
»Noch nicht«, sagte Lisa müde. Sie sehnte sich plötzlich danach, eine Weile allein zu sein.
»Wie du willst. Wir sehen uns dann spätestens morgen beim Frühstück. Und über Florenz reden wir noch mal.«
Auf hohen Absätzen stolzierte Maren davon. Lisa sah ihr eine Weile nach. Wie gut ihr das enge grüne Samtkleid stand! Und die schlanken Waden kamen mit den Stöckelschuhe erst richtig zur Geltung. Resigniert dachte sie an ihre eigenen, zu kräftig geratenen Beine, die sie stets unter weiten Hosen verbarg. Lisa trug grundsätzlich nur schwarze oder dunkelblaue Sachen. Sie fand, dass sie so ein bisschen schlanker wirkte. Und an Stöckelschuhe als Blickfänger konnte sie bei einem Meter achtzig Körpergröße schon gar nicht denken.
»Versprechen hin, Versprechen her«, murmelte sie und trank einen Schluck von ihrem Campari. Allein der Versuch, mit ihrem Vater über das Thema zu sprechen, hatte sie vor einer Woche in tiefe Verzweiflung gestürzt. Dabei hatte sie nur zaghaft erwähnt, dass sie daran dachte, sich von Walter zu trennen.
»Lisa, das verbiete ich dir!« Wütend war ihr Vater aufgesprungen, und sofort hatte sie ihre Worte bedauert. Furcht, eine alte unbestimmte Furcht, hatte von ihr Besitz ergriffen und sie verstummen lassen. So war das immer. Jede Auseinandersetzung mit dem Vater endete damit, dass er wütend wurde und ihr vor Angst die Knie zitterten. Aber sie begriff nie, warum.
Karl Wagner war kein großer Mann und wirkte eher zierlich. Seit sie denken konnte, hatte Lisa ihn niemals die Hand gegen jemanden erheben sehen. Warum also fürchtete sie sich dermaßen, dass sie es nie schaffte, sich gegen ihn durchzusetzen? Einmal, vor Jahren, hatte sie versucht, mit ihrer Mutter darüber zu reden. Doch Dagmar Wagner war nur blass geworden und hatte kein Wort gesagt. Manchmal glaubte Lisa, sich an etwas erinnern zu können. Aber sie sah dabei immer nur Dunkelheit und spürte diese heftige, unkontrollierbare Angst. Für ihren Vater war das Thema an dem Tag keineswegs erledigt gewesen, nur weil Lisa kein Wort mehr herausbekommen hatte. Aber daran wollte sie jetzt nicht denken. Sie schüttelte leicht den Kopf, als könne sie auf diese Weise alle bösen Erinnerungen vertreiben.
Maren war inzwischen unter den Arkaden verschwunden, und Lisa beschloss, trotz ihrer Müdigkeit noch einen Spaziergang zu unternehmen. Sie wollte in einer kleinen Trattoria einen Teller Pasta essen und erst nach neun ins Hotel zurückkehren. Dann würde sie den Rest des Abends damit verbringen, sich Argumente zurechtzulegen. Ich muss Maren unbedingt dazu überreden, mit mir nach Florenz zu fahren, überlegte sie. Und dabei ging es ihr nicht nur um die Kulturschätze. Eine unerklärliche Sehnsucht trieb sie in die Toskana, und sie musste herausfinden, was es damit auf sich hatte. Eine innere Stimme sagte ihr, dass möglicherweise das Glück ihres Lebens davon abhing.
Kapitel 2
Er war ein schöner Mann, und an manchen Tagen hasste er das.
Schon morgens, wenn er müde und unrasiert in der Bar seinen Espresso schlürfte, drehten sich die Leute nach ihm um. Und das in einer Stadt wie Florenz, wo es Tausende gut aussehender Menschen gab. Als Junge hatte Paolo es genossen, von den Mädchen umschwärmt zu werden. Aber das war lange vorbei. Und so wie andere Männer sich ein paar Zentimeter mehr Körperlänge oder eine gerade Nase wünschten, träumte Paolo hin und wieder davon, ein kleines bisschen durchschnittlicher zu sein. Natürlich nicht wirklich hässlich, aber etwas weniger auffallend. Bestimmt, so glaubte er, würde sein Leben dann auch weniger kompliziert sein. Er hatte gehofft, diesem Ziel näher zu kommen, wenn er älter wurde, aber mit seinen knapp vierzig Jahren, den grau melierten Schläfen und den feinen Augenfältchen sah er sogar noch besser aus als früher. Sein einziger Trost waren die Haare. Als Kind hatten goldene Locken ihm ein geradezu engelhaftes Aussehen verliehen. Doch wie bei den meisten Südländern verlor sich die Farbe mit den Jahren und machte einem satten Dunkelbraun Platz. Aber die Augen, die leuchtend grünen Augen waren ihm geblieben. Dazu das vollendete Gesicht mit den etwas zu sanften Rundungen, die perfekte römische Nase, der volle, sinnliche Mund und schließlich der hoch gewachsene, athletische Körper, dem die Zeit kaum etwas hatte anhaben können.
»Il mio angelo – mein Engel«, nannte ihn seine Mutter. Und nichts hatte Signora Mafalda je von dieser Meinung abbringen können. Weder seine unzähligen Streiche als Kind, noch die wilden Ausschweifungen seiner Jugendjahre, und schon gar nicht sein heutiger Ruf als unerbittlicher Scheidungsanwalt, der mit kompromissloser Härte seinen vorwiegend weiblichen Klienten zu satten Abfindungen und Alimenten verhalf. Nein, für Mafalda Pitti war Paolo ein Engel auf Erden, und er hatte es schon vor langer Zeit aufgegeben, ihr diese Illusion nehmen zu wollen. Er wusste, sie liebte ihn abgöttisch, denn seit dem Tod ihres Mannes vor fünfzehn Jahren war er alles, was sie hatte. Und er kannte auch ihren sehnlichsten Wunsch: Enkelkinder. Tag für Tag verließ sie bereits im Morgengrauen das Haus, lief zu Fuß bis zum Dom und betete darum, dass er endlich heiraten möge.
»Arme Mamma«, murmelte Paolo. Wie an jedem Morgen brauchte er nur durch das große Fenster der Bar zu schauen, um sie heimkehren zu sehen. Ihr Schritt hatte etwas Schwungvolles, und ihre Augen leuchteten. Sie zog viel Kraft aus ihrem Glauben, und manchmal beneidete er sie darum. Dann bog sie um die Ecke und verschwand aus seinem Blickfeld. Eine kleine dünne Frau, mit grauen Haaren und sinnlosen Träumen. Ja, sinnlos. Paolo runzelte verärgert die Stirn. Sie sollte es endlich aufgeben, dachte er. Ich heirate niemals. Er trank den letzten winzigen Schluck Espresso, nahm seine Zeitung und machte sich auf den kurzen Weg zur Kanzlei.
Es war ein warmer Junimorgen, und Paolo schwitzte bereits in seinem dunkelblauen Anzug, während er an leicht bekleideten Touristen vorbeieilte. Eine Gruppe Frauen unbestimmbaren Alters hatte sich vor dem Palast der Uffizi aufgebaut, um als erste in die Gemäldegalerie eingelassen zu werden. Paolo fühlte ihre Blicke auf sich ruhen. Er verstand ihre Scherze nicht, sie sprachen einen starken frankokanadischen Dialekt, aber es war klar, dass sie ihn meinten. Wie konnten sie es wagen! Er war ein gebildeter, intelligenter und erfolgreicher Anwalt, aber diese Kanadierinnen rissen ihre Witze über ihn, als sei er irgendein x-beliebiger Gigolo! Mit langen, wütenden Schritten überquerte er die Piazza della Signoria, bog in die Via Condotta ein und erreichte kurz darauf seine Kanzlei. Sie befand sich in einem Palazzo aus der Renaissance und nahm das gesamte dritte Stockwerk ein. Wie jeden Tag holte Paolo ein Papiertuch aus der Tasche und fuhr damit leicht über das Messingschild am Eingang. »Studio legale Pitti«, Anwaltsbüro Pitti, stand dort schlicht. Er war stolz auf dieses Schild, so wie er auch auf seine Karriere stolz war.
Auf dem Weg nach oben vergaß er den dummen Zwischenfall mit den Touristinnen und konzentrierte sich auf seinen ersten Fall an diesem Tag. Die Signora hatte geheimnisvoll geklungen, als sie um den Termin gebeten hatte, und er war gespannt auf sie.
Das Handy klingelte, als er den zweiten Stock erreichte.
»Paolo, hier ist Marco.«
Ein eisiger Schauer fuhr ihm über den Rücken, und er fror plötzlich in seinem verschwitzten Hemd. Unwillkürlich berührte er das Muttermal auf seiner rechten Wange. Es war der einzige Makel in seinem Gesicht, aber nicht deshalb machte es ihm Sorgen.
»Hallo, wie geht's?« Es sollte forsch klingen, doch es klang gezwungen.
Marco war seit zwanzig Jahren ein guter Freund, und sie riefen einander oft an, um Neuigkeiten auszutauschen oder um sich zu verabreden. Doch dies war kein freundschaftlicher Anruf.
»Gut, danke«, erwiderte Marco die Floskel. Er machte eine kurze Pause, bevor er weitersprach. »Ich wollte dich nicht zu Hause stören, um deine Mutter nicht aufzuregen.«
»Das klingt ja dramatisch«, versuchte Paolo einen Scherz. Aber ihm war nicht nach scherzen zumute. Angst kroch in ihm hoch, setzte sich in seiner Kehle fest und nahm ihm die Luft zum Atmen. Einen Hauch dieser Angst hatte er zum ersten Mal vor vier Wochen verspürt. Damals war er mit Marco wie in jedem Frühling ans Meer nach Viareggio gefahren, um ihr gemeinsames Segelboot zu Wasser zu lassen.
»Was hast du da?«, hatte der Freund auf einmal gefragt.
»Ich? Wo? Was meinst du?« Er wusste es ganz genau, aber er gab sich absichtlich ahnungslos.
»Dieses Muttermal, Paolo, das ist neu. Seit wann hast du das?«
Paolo trat einen Schritt zurück, als Marco das Mal berühren wollte. Der Freund zuckte kurz die Schultern.
»Entschuldige. Ich wollte es mir nur mal näher ansehen. Für einen Schönheitsfleck ist es ein bisschen zu groß und zu rot.«
»He, was soll das, hast du unsere Abmachung vergessen? Beruf ist Beruf, und Privatleben ist Privatleben. Also lass gefälligst deine Hautarzt-Praxis in Florenz und hilf mir, die Segel auszurollen.«
Marco sah ihn lange an, sagte aber nichts mehr. Erst am Abend, als sie schon fast wieder zu Hause waren und in der Ferne die Kuppel des Dorns in der untergehenden Sonne glitzern sahen, kam Marco auf das Thema zurück: »Ich schlage vor, du besuchst mich in den nächsten Tagen mal in meiner Praxis, damit ich mir die Sache genauer ansehen kann. Wahrscheinlich ist es nur ein ganz normales Muttermal, aber lass uns lieber auf Nummer sicher gehen, okay?«
»Wenn's sein muss«, brummte Paolo, während er sich vorsichtig in den Stadtverkehr einordnete. »Du gibst ja sonst doch keine Ruhe.« Insgeheim aber war er froh über die Aufforderung. Dieser kleine rötliche Fleck machte ihm Sorgen, auch wenn es ihm bisher gelungen war, ihn zu übersehen.
»Mein Terminkalender ist in den nächsten Tagen ziemlich voll«, sagte er, »aber ich werde versuchen, mich eine halbe Stunde frei zu machen.«
»Tu das«, erwiderte Marco, und es hörte sich seltsam eindringlich an.
Dennoch vergingen mehr als drei Wochen, bis Paolo endlich den Weg in die Praxis seines Freundes fand. Er hatte sich eingeredet, dass ihm wirklich die Zeit fehlte, aber im Grunde wusste er genau, dass er sich einfach nur fürchtete. Marco war verärgert und murmelte etwas über die Dummheit von Patienten, die sich ihr eigenes Grab schaufelten, aber dann setzte er eine professionelle Miene auf und begann, das Muttermal gründlich unter dem Dermatoskop, einer speziellen Lichtlupe, zu untersuchen. Anschließend wies er Paolo an, sich auszuziehen und führte die Untersuchung am gesamten Körper fort, bis er nach einer endlosen halben Stunde wieder zu dem Fleck im Gesicht zurückkehrte, um ihn zu fotografieren. Er machte eine Aufnahme von oben und zwei schräg von der Seite.
»Nun, Herr Professor?«, fragte Paolo spöttisch und zog rasch Hemd und Hose wieder an. »Wie lautet die Diagnose?«
Marco bedachte ihn mit einem Lächeln, aber es war kein fröhliches Lächeln.
»Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich ruf dich an.«
»Na hör mal, du kannst mir doch nicht erst so einen Schrecken einjagen, und mich jetzt einfach fortschicken!«
Der Freund, der nun sein Arzt war und vielleicht der Überbringer einer schlimmen Botschaft werden musste, sah ihn ruhig an.
»Nur keine Panik, Paolo.«
»Aber du glaubst, dass ... ich meine, es könnte sein, dass ich ...« Er brachte es nicht fertig, das Wort Krebs auszusprechen. Er, der sonst nie an etwas glaubte, wurde plötzlich abergläubisch. Er hatte Angst, die Krankheit herbeizureden, wenn er das Wort nur ein einziges Mal in den Mund nahm.
»Ich glaube gar nichts, ich bin Mediziner und halte mich an die Fakten«, erwiderte Marco sachlich. Aber Paolo spürte, dass der Freund nicht ehrlich war. Er sah ihn lange an und wartete. Schließlich rang sich Marco zu einer Antwort durch:
»Also gut. Ich glaube, es handelt sich hierbei um ein Basaliom. Aber eigentlich bist du zu jung dafür.«
»Ein was?«
»Ein Basalzellkarzinom«, erklärte der Freund sachlich. »Siehst du die Farbe?« Er hielt ihm einen Spiegel vors Gesicht. »Es ist gelblich-rot, das ist typisch. Außerdem ist es ein flach erhabenes Mal mit einem perlschnurartigen Randsaum. So ein Karzinom kann sich über Monate und Jahre entwickeln. Die Gefahr einer Metastasierung ist sehr gering. Das kommt höchstens in einem von tausend Fällen vor.«
»Was bedeutet das genau?«
»Ganz einfach: Wir operieren, und dann kannst du die ganze Geschichte vergessen.«
»Aber du hast eben gesagt, ich wäre eigentlich zu jung dafür.«
»Stimmt, normalerweise bekommen das nur ältere Leute. Zur Sicherheit müssen wir auf jeden Fall eine histologische Untersuchung machen lassen.«
Marco wandte sich ab und nahm ein ungewöhnlich aussehendes Skalpell zur Hand.
»Ich stanze jetzt mit diesem Rundmesser einen winzigen Zylinder heraus und schicke ihn ins Labor. Sobald die Laborergebnisse da sind, rufe ich dich an.«
Paolo war zu erschrocken, um den Schmerz zu spüren, und als er die Praxis verließ, nahm er sich vor, nicht in Panik zu geraten. Nicht wegen so einem dummen kleinen Fleck.
Das war vor drei Tagen gewesen, und nun starrte Paolo sein Handy an und musste sich auf eine Treppenstufe setzen, weil ihm die Knie weich wurden.
»Also, spuck's schon aus!«, rief er mit zitternder Stimme, als Marco am anderen Ende der Leitung immer noch schwieg.
»Es wäre mir lieber, du würdest herkommen.«
»Wieso? Ist es so schlimm?«
Kalter Schweiß lief ihm über die Stirn, und sein Herz hämmerte wie wild gegen die Rippen.
»Paolo, komm einfach her, sobald du kannst. Am besten sofort.«
»Bitte sag mir wenigstens, ob ...« Er brach ab, beschämt über den flehenden Klang seiner Stimme. Ein Rauschen zog durch das Handy, der Empfang war plötzlich gestört. Doch dann hörte er noch ganz deutlich den Freund sagen:
»Es ist ziemlich ernst.«
Ziemlich ernst! Ziemlich ernst! Einen Moment verschwamm ihm alles vor Augen, während er in Gedanken immer wieder diese zwei Worte sagte: Ziemlich ernst!
»Mein Gott!« Er kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen an. Ziemlich ernst! Sicher, er hatte gewusst, dass dieses Muttermal ein Problem darstellte. Aber so etwas konnte man doch operieren! Und dann war die Sache ausgestanden! Das hatte Marco doch selbst gesagt! Und sollte es plötzlich schlimm um ihn stehen? Viel schlimmer, als er sich je hätte ausmalen können? Später wusste Paolo nicht mehr zu sagen, wie lange er noch dort auf der Treppe sitzen geblieben war und gewartet hatte, dass die Panik ein wenig nachließ. Irgendwann stand er auf und setzte seinen Weg in den dritten Stock fort. Rita, seine Sekretärin, begrüßte ihn wie jeden Morgen mit einem Lächeln. Sie war eine kleine Frau mittleren Alters, reizlos bis zur Unscheinbarkeit, aber hundertprozentig zuverlässig und hochintelligent.
»Sie sind spät dran, Signora del Vecchio läuft im Wartezimmer herum wie eine Tigerin im Käfig. Sie sollten schnell ... aber, Avvocato, was ist denn mit Ihnen?«
Er bemerkte ihren erschrockenen Gesichtsausdruck, als sie seine ganze Erscheinung wahrnahm.
»Was soll schon sein? Nichts.« Er hoffte, das würde streng genug klingen, um ihre Neugierde zu zügeln.
»Aber Sie weinen ja.»
»Unsinn. Ich gehe einen Moment ins Bad. Bitten Sie die Signora schon mal in mein Büro.«
Zehn Minuten später hatte er sich wieder in der Gewalt. Er war rasiert und hatte das Gesicht mit kaltem Wasser abgewaschen. Als er seiner neuen Klientin gegenübertrat, war er wieder Dr. Paolo Pitti, einer der erfolgreichsten Scheidungsanwälte der Stadt. Alles andere schob er beiseite.
»Bitte entschuldigen Sie meine Verspätung«, begann er und wollte eine höfliche Ausrede anfügen. Doch er brach mitten im Satz ab. Die Frau, die ihm eben noch den Rücken zugekehrt hatte, drehte sich um und funkelte ihn erbost an.
Aber es war nicht ihr Zorn, der ihm die Sprache raubte.
Es war ihre Schönheit.
Ritas Vergleich mit einer Tigerin ist äußerst treffend, dachte er.
Paolo konnte nicht anders, er musste sie anstarren. Sie war groß, fast so groß wie er selbst, mit Beinen, die kein Ende nehmen wollten. Das hautenge Minikleid endete dort, wo schickliche Kleider wenigstens noch zwei Zentimeter Stoff mehr hatten. Und der tiefe Ausschnitt erlaubte einen Panoramablick auf einen prachtvollen Busen. Ja, prachtvoll, ein anderes Wort fiel Paolo beim besten Willen nicht ein. Aber ihr Gesicht! Dieses Gesicht hätte sie selbst dann zu einer Schönheit gemacht, wenn ihr Körper mager und flach wie ein Brett gewesen wäre. Eine wallende hellbraune Haarmähne umgab ein perfekt geformtes Antlitz mit einem großen Mund, einer vollkommenen Nase und hohen Wangenknochen. Darüber diese hinreißenden, schräg stehenden Augen, deren warmer Braunton von gelben Tupfern durchbrochen wurde. Im Augenblick funkelten diese Augen ihn wütend an, und auf der hohen Stirn stand eine tiefe Zornesfalte.
»Ich bin es nicht gewöhnt, dass man mich warten lässt«, sagte Tiziana del Vecchio. Ihre Stimme enttäuschte ihn. Er hatte einen rauen, beinahe erotischen Tonfall erwartet, aber sie klang ein bisschen zu schrill und ein bisschen zu gewöhnlich.
Während er eine weitere Entschuldigung murmelte und ihr in der Sitzecke den bequemsten Ledersessel anbot, rekapitulierte er im Stillen ihren Fall. Tiziana del Vecchio, einunddreißig Jahre alt, zweite Frau von Edoardo del Vecchio, einem der reichsten Männer der Region, wenn nicht ganz Italiens. Er besaß eine Supermarktkette, drei Radiosender, mehrere Restaurants und Hotels. Reich, stolz und mächtig. Kein Mann, den man sich als Feind aussuchen würde. Tatsächlich hatte Paolo lange gezögert, bevor er Tiziana einen Termin gegeben hatte. Für einen Anwalt, dem etwas an seiner Karriere lag, war es nicht ratsam, sich mit Edoardo del Vecchio anzulegen. Schließlich verkehrte dieser in höchsten politischen Kreisen, und Paolo war davon überzeugt, dass er im Hintergrund viele Fäden zog, auch wenn er selbst nie auf der bewegten politischen Bühne Italiens in Erscheinung trat.
Aber seine Neugierde war stärker gewesen als die Vorsicht, denn er erinnerte sich nur zu gut an den Skandal, den Tiziana vor vier Jahren ausgelöst hatte. Alle Zeitungen waren damals voll gewesen von der Affäre des knapp Sechzigjährigen mit der schönen Studentin. Del Vecchios Frau Marta, Mutter seiner vier Söhne, hatte sich zu einem tränenreichen Fernsehauftritt hinreißen lassen, der das Herz der gesamten Nation erweichte, nur nicht das ihres untreuen Mannes. Dadurch hatte sich der Industriemagnat damals viele Sympathien verscherzt, und als er die Familie verließ, um mit Tiziana zu leben und sie nach seiner Scheidung zu heiraten, da schlugen die Wellen der Empörung noch einmal hoch. Doch die Italiener waren ein leidenschaftliches Volk, und angesichts dieser mitreißenden Liebesgeschichte war man bald bereit, zu verzeihen. Manchmal las Paolo in den folgenden Jahren kurze Artikel über das liebende Paar, eingerahmt von Urlaubsfotos. Er hatte gewusst, dass sie eine schöne Frau war, aber er hatte nicht geahnt, wie schön sie tatsächlich war.
Es kostete ihn große Mühe, den Blick von ihr abzuwenden und die schmale Akte aufzuschlagen.
»Was führt Sie zu mir?«, fragte er und hoffte, einigermaßen sachlich zu klingen.
»Ich will mich scheiden lassen.«
»Verstehe. Darf ich fragen, warum?«
»Nein.«
»Wie bitte?«
»Sie dürfen nicht fragen, warum. Meine Gründe gehen niemanden etwas an.«
»Aber verehrte Signora, als Ihr Anwalt muss ich ...«
»Wer sagt denn, dass Sie schon mein Anwalt sind? Ich bin nur zu einem Informationsgespräch hier. Und wenn Sie es genau wissen wollen, habe ich noch Termine bei drei weiteren Rechtsverdrehern.«
Wieso stand er nicht einfach auf und begleitete sie höflich zur Tür? Er war ein viel beschäftigter Mann und hatte es nicht nötig, seine Zeit mit einer arroganten Dame zu vergeuden, die hier anscheinend nur ein Spielchen mit ihm spielte. Ja, er würde ihr einfach sagen, dass sie bei einem seiner Kollegen besser aufgehoben wäre.
»Also, ich schlage vor ...« Weiter kam er nicht. Tiziana schlug die Beine übereinander, und er entdeckte eine große Prellung an ihrem Oberschenkel. Er betrachtete die Frau genauer. Sie war stark geschminkt, aber er glaubte dennoch, unter dem linken Auge einen blauen Schimmer auszumachen. Und dieser dunkelrote Fleck am Hals, wieso hatte er den nicht gleich bemerkt? Paolo schluckte. Auf einmal tat sie ihm Leid. Kein Wunder, dass sie über ihre Gründe schwieg. Nicht auszudenken, was passierte, wenn so etwas bekannt wurde. Edoardo del Vecchio schlug seine junge Frau. Der Mann wäre ruiniert, verzweifelt. Und verzweifelte Männer ließen sich manchmal zu Verzweiflungstaten hinreißen. Paolo verspürte den heftigen Impuls, Tizianas Hand zu nehmen, um sie beruhigend zu streicheln. Am liebsten hätte er ihr gesagt, dass sie keine Angst haben musste, denn er würde sie beschützen. Doch er tat nichts dergleichen, sondern beschränkte sich auf ein verständnisvolles Lächeln.
»Gut«, sagte er. »Ganz allgemein läuft ein Scheidungsverfahren folgendermaßen ab.« Knapp und sachlich schilderte er die Prozedur. Ihr ausdrucksloses Gesicht verriet nicht, ob sie zufrieden oder enttäuscht war.
»Drei Trennungsjahre sind sehr lang«, meinte sie nur, als er geendet hatte. Paolo schloss die dünne Akte.
»Nun, es gäbe vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, das Verfahren zu beschleunigen.«
»Ach ja?« Ihr Blick wirkte auf ihn unschuldig und hoffnungsvoll zugleich. Sie änderte ein wenig ihre Stellung und verzog dabei schmerzhaft den Mund.
»Ja, zum Beispiel bei Misshandlungen«, sagte er so emotionslos wie möglich. Sofort bereute er seine Offenheit. Tiziana stand auf und funkelte ihn böse an.
»Wie kommen Sie dazu, so etwas zu behaupten? Edoardo ist der beste und liebevollste Mann der Welt. Ich glaube nicht, dass Sie der richtige Anwalt für mich sind.« Damit ging sie zur Tür. Doch sie drehte sich noch einmal um, und ihre Worte trafen ihn wie ein Schlag:
»Übrigens, diesen hässlichen Flecken da sollten Sie mal untersuchen lassen. Der sieht gar nicht gut aus.«
Kapitel 3
Lisa spürte die Kopfschmerzen schon, bevor sie richtig wach war. Ein Ring aus Stahl hatte sich um ihre Stirn gelegt und jagte Feuerblitze durch ihre Schläfen. Sie holte die Tabletten aus dem Nachttisch und steckte sich zwei in den Mund. Allein diese Bewegung ließ sie vor Qual aufstöhnen. Doch sie musste auch noch den Kopf heben, um einen Schluck Wasser zu trinken. Irgendwie schaffte sie es, ohne laut zu schreien. Das Zimmer drehte sich vor ihren Augen, und gleichzeitig überfiel sie eine heftige Übelkeit, während böse, unsichtbare Klauen den Ring um ihren Kopf fest zusammenpressten. Schließlich schluckte sie die Tabletten mit dem Wasser hinunter und ließ sich vorsichtig zurück ins Kissen sinken. Sie atmete tief durch, zählte langsam bis hundert und wartete auf Besserung. Es dauerte lange, viel länger als sonst, bis das Medikament wirkte. Erst nach einer Viertelstunde wagte es Lisa, aufzustehen. Ich sollte den Arzt wechseln, überlegte sie und musste bitter auflachen. Die besten Ärzte in München hatte sie längst durch, und selbst die drei Spezialisten, die sie im Laufe der Jahre in Wien aufgesucht hatte, waren machtlos gewesen. Medikamente, immer neue, immer stärkere Medikamente, hatten sie ihr verschrieben.
»Gegen Migräne gibt es nun mal keine Wundermittel«, war der niederschmetternde Kommentar des letzten Neurologen gewesen. Lisa hatte es daraufhin mit alternativer Medizin versucht. Doch weder Akupunktur noch Hormontherapie oder Entspannungsübungen hatten geholfen.
Es gab Tage, da war sie verzweifelt, hilflos in ihrem Schmerz, verletzbar wie ein kleines Tier auf seiner sinnlosen Flucht vor einem übermächtigen Jäger. Doch es gab auch Momente der Erkenntnis. Wenn sie allein einen Waldspaziergang unternahm, einem Violinkonzert lauschte oder aus einem schönen Traum erwachte – wenn sie dem Glück so nah war, dass sie es beinahe greifen konnte, dann spürte Lisa deutlich, wie ihr geplagter Kopf zur Ruhe kam. Ich müsste versuchen, glücklicher zu sein, dachte sie in solchen Augenblicken, dann bräuchte ich keine Angst mehr vor dem nächsten Anfall haben. Doch wie stellte man das an, glücklich zu sein? Vielleicht bot sich hier in Italien eine Chance, obwohl die Reise anders verlief, als sie erhofft hatte. Sie befand sich in Riccione und nicht in Florenz, und der Migräneanfall, das begriff Lisa jetzt, war von dem Meeresrauschen vor ihrem Fenster ausgelöst worden. Der alte, schreckliche Traum hatte sie eingeholt. Er hatte keine Handlung, keinen Anfang und kein Ende. Aber jedes Mal erinnerte sich Lisa nach dem Aufwachen an schwarzes, kaltes Wasser und an das Gefühl grenzenloser Hilflosigkeit. Und jedes Mal folgte auf diesen Traum ein Migräneanfall. Lisa stand vorsichtig auf, ging zum Fenster und sah durch eine Spalte in den Rollos hinaus. Die Adria glitzerte ruhig im Morgenlicht, unten am Strand öffneten die Bademeister ihre bunt gestreiften Sonnenschirme für die frühen Gäste. Es musste herrlich sein, ins warme Wasser zu laufen und weit, weit hinauszuschwimmen.
»Aber daraus wird heute nichts«, murmelte sie leise. Aus Erfahrung wusste sie, dass sie an einem solchen Tag Ruhe brauchte.
Mit einem Schwung wurde die Zimmertür geöffnet.
»Hallo! Endlich auf den Beinen? Hier, ich habe dir Milchkaffee und Croissants mitgebracht!«
Maren, nach zwei Tagen am Meer schon braun gebrannt und wie ausgewechselt in ihrer Fröhlichkeit, stellte das Tablett ab und wollte die Jalousien hochziehen.
»Bitte nicht«, sagte Lisa schnell.
»Wieso? Ach, sag bloß, es ist wieder so weit.«
Lisa nickte nur und ging zum Bett zurück.
»Du Ärmste! Soll ich einen Arzt rufen? Brauchst du etwas aus der Apotheke?«
Maren schüttelte ihre Kissen auf und deckte sie mit dem Laken zu. Die Fürsorge tat Lisa gut. Sie lehnte sich erschöpft zurück.
»Nein, nicht nötig, ich habe schon meine Tabletten genommen. Ich muss nur möglichst still liegen und vielleicht noch eine Weile schlafen.«
»Ja«, sagte Maren sanft, »tu das.« Dann zögerte sie und blickte die Freundin nachdenklich an.
»Was ist?«
»Meinst du, du schaffst den Umzug heute?«
Lisa brauchte einen Moment, um zu begreifen, was sie meinte, dann fiel es ihr wieder ein. Als sie vor zwei Tagen spät am Abend in Riccione eingetroffen waren, hatte sich Maren selbstverständlich für eines der besten Hotels am Platz, das »Grand Hotel«, entschieden. Doch weder ihr knallroter Porsche noch die goldenen Kreditkarten hatten ihr angesichts des ausgebuchten Hauses helfen können.
»Solo per due notti«, bedauerte der Portier. Nur für zwei Nächte hätten sie noch ein Zimmer frei. Danach müssten sie leider umziehen. Immerhin versprach er ihnen, bei der Suche nach einem anderen Hotel zu helfen, und hielt Wort. Nun sollten sie ins »Imperial« wechseln, das zwar einen Stern weniger trug, aber hoffentlich den »Mindestansprüchen« genügen würde, wie Maren es ausdrückte.
»Ich denke, das wird schon gehen«, sagte Lisa. »Wir haben ja bis zum Nachmittag Zeit, nicht wahr?«