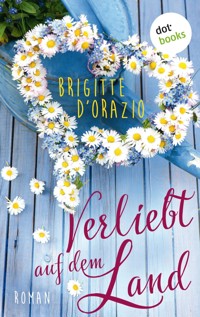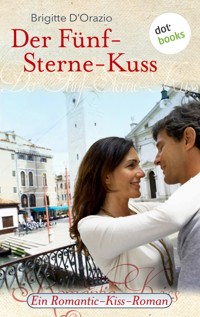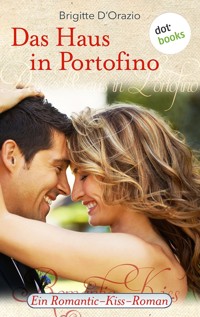Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gönnen Sie sich Urlaub vom Alltag: der ebenso spannende wie gefühlvolle Roman "Villa Monteverde" von Brigitte D'Orazio jetzt als eBook bei dotbooks. Hat die junge Archäologin Anne einem Kunstbetrug entdeckt – und kann es wirklich sein, dass ihr Lebensgefährte darin verwickelt ist? Anne weiß nur eins: Sie muss Hamburg sofort verlassen, um wieder durchatmen zu können. Ausgerechnet in dieser Situation enthüllt ihre lebenslustige Hippiemutter, dass sie seit vielen Jahren ein Ferienhaus in Umbrien besitzt. Ein weiteres Geheimnis? Anne ahnt noch nicht, dass sie im Tal des Tibers mehr als eine unerwartete Entdeckung machen wird. Dass sie dort einem ganz besonderen Mann begegnen soll. Und dass sie schon bald um ihr Leben fürchten muss … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Villa Monteverde" von Brigitte D'Orazio. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Hat die junge Archäologin Anne einen Kunstbetrug entdeckt – und kann es wirklich sein, dass ihr Lebensgefährte darin verwickelt ist? Anne weiß nur eins: Sie muss Hamburg sofort verlassen, um wieder durchatmen zu können. Ausgerechnet in dieser Situation enthüllt ihre lebenslustige Hippiemutter, dass sie seit vielen Jahren ein Ferienhaus in Umbrien besitzt. Ein weiteres Geheimnis? Anne ahnt noch nicht, dass sie im Tal des Tibers mehr als eine unerwartete Entdeckung machen wird. Dass sie dort einem ganz besonderen Mann begegnen soll. Und dass sie schon bald um ihr Leben fürchten muss …
Über die Autorin:
Brigitte D’Orazio ist ein Pseudonym der erfolgreichen Autorin Brigitte Kanitz, unter dem sie ihre romantischen Unterhaltungsromane veröffentlicht. Sie arbeitete viele Jahre als Redakteurin für Zeitungen und Zeitschriften in Hamburg und in der Lüneburger Heide. Heute lebt sie gemeinsam mit ihren Zwillingstöchtern an der Adria.
Brigitte D’Orazio veröffentlichte bei dotbooks die Romane »Die Sterne über Florenz« und »Verliebt auf dem Land« sowie die Kurzromane »Das Haus in Portofino«, »Geliebte Träumerin«, »Der Fünf-Sterne-Kuss«, »Sing mir das Lied von der Liebe« – diese vier Titel auch erhältlich im Sammelband »Zum Verlieben schön« –, »Fundstücke des Glücks«, »Kapitäne küsst man nicht« und »Ti amo heißt Ich liebe dich« – diese drei Titel auch erhältlich im Sammelband »Zum Träumen romantisch«.
***
eBook-Neuausgabe März 2015
Dieses Buch erschien bereits 2008 unter Autorenpseudonym Letizia Conte.
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: HildenDesign, München © HildenDesign unter Verwendung eines Bildmotivs von Petr Jilek
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-801-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Villa Monteverde« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Brigitte D‘Orazio
Villa Monteverde
Roman
dotbooks.
Für meine Schwägerin Maria D'Orazio –
die Frauenfiguren in diesem Roman haben alle etwas von dir, vor allem deinen Mut und deinen unerschütterlichen Humor. Aber keine kann so gut kochen wie du.
Und für meinen Schwager Lazzaro (Neno) D'Orazio –
danke für deine unendliche Hilfsbereitschaft und dafür, dass du meinen Töchtern ein liebevoller Vaterersatz und Onkel bist.
Prolog
Um sie herum herrschte vollkommene Dunkelheit. Wie blind tastete Anne die lehmige Wand ab, hockte sich dann auf den Boden und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Irgendwo über ihr nahm sie das Geräusch von fallender Erde wahr. Dann herrschte Stille.
Grabesstille, dachte sie und musste plötzlich kichern. Wie passend!
Sie verstummte, fest entschlossen, nicht den Verstand zu verlieren.
Jemand würde sie finden. Schon bald. Bis dahin musste sie ruhig bleiben, flach atmen, um so lange wie möglich mit dem wenigen Sauerstoff auszukommen, und fest an ihre Rettung glauben. Aber sie konnte nur daran denken, wie dumm sie gewesen war. Wie unglaublich dumm. Sie hatte dem falschen Menschen vertraut und nicht erkannt, wer es wirklich gut mit ihr meinte. Und den Mann, den sie über alles liebte, hatte sie sich zum Feind gemacht.
Ein Stöhnen entfuhr ihr und hallte von den schwarzen Wänden zu ihr zurück.
Um ihre Panik niederzukämpfen, erinnerte sich Anne an den Tag, an dem alles begonnen hatte. Es war der Tag, an dem sie zum ersten Mal Verdacht geschöpft hatte ...
Kapitel 1
Im scharfen Licht der Neonlampe leuchtete die Bronzefigur hell auf. Anne drehte sie langsam in der Hand hin und her, betrachtete sie von allen Seiten und runzelte die Stirn. Irgendetwas stimmte nicht damit, doch sie kam nicht darauf, was es war. Die Schimäre besaß den Kopf eines brüllenden Löwen und die Hufe eines Pferdes. Der lange magere Körper duckte sich kurz vor dem Sprung. Aus dem Rücken wuchsen die Hörner eines Steinbocks, und der Schwanz entpuppte sich bei näherem Hinsehen als eine Schlange. Ein Trugbild eben. Aber unter dem vollkommenen kleinen Kunstwerk schien sich noch ein weiteres Geheimnis zu verbergen, eines, das nicht aus alter Zeit stammte.
Nachdenklich fuhr Anne mit dem Zeigefinger die perfekten Formen entlang. Das Artefakt stammte aus Perugia in Umbrien, dem alten etruskischen Perusia, und war eine Leihgabe eines dortigen kleinen, aber gut bestückten Museums. Sie musste es jetzt nur auf ihrer Liste abhaken und damit seine Echtheit bestätigen.
Warum tat sie es nicht einfach? Einige weitere Dutzend Ausstellungsstücke warteten noch darauf, von ihr ausgepackt und beurteilt zu werden. Höchste Zeit, dass sie mit der Arbeit fortfuhr. Es war spät, und sie freute sich darauf, nach einem langen Tag hinaus an die Luft zu kommen.
Aber Anne zögerte. Fast kam es ihr so vor, als wollte die Schimäre ihr etwas mitteilen. Doch was? Der brüllende Löwenkopf wirkte echt, und auch die anderen Elemente schienen zu stimmen. Vielleicht bilde ich mir nur etwas ein, dachte sie müde. Klarer Fall von Überarbeitung.
»Alles in Ordnung?« Johanns Stimme ließ sie zusammenzucken. Er war unbemerkt hinter ihr aufgetaucht und schaute ihr nun über die Schulter.
Anne fröstelte auf einmal. »Ja, sicher. Wo warst du so lange?«
Er gab keine Antwort, sondern nahm ihr die Figur aus der Hand und legte sie zurück in die mit Holzwolle gepolsterte Transportkiste. Dann sah Johann, der Kurator, seine Mitarbeiterin an und schien in ihrem Gesicht nach etwas zu suchen. Endlich meinte er: »Die Angaben sind korrekt. Du kannst sie abzeichnen.«
»Ich weiß nicht«, sagte Anne langsam. Sie begegnete seinem Blick und spürte einen leisen Stich im Herzen, wie immer, wenn er diesen kühlen Ausdruck in den Augen bekam.
»Was soll das heißen?«
Anne sah weg und seufzte innerlich. Er war schon wieder verärgert. In letzter Zeit konnte sie ihm offenbar nichts mehr recht machen. Immer hatte er an ihrer Arbeit etwas auszusetzen, nie fand er anerkennende Worte. Ganz abgesehen davon, dass er sie zwang, hier unten im Keller des Hamburger Museums für Altertum zu sitzen und ohne seine Hilfe die große Ausstellung über die Etrusker in Umbrien vorzubereiten. Sie hatte es so satt!
Vielleicht wurde sie ja verrückt und vermutete Fehler, wo keine waren. Wer von frühmorgens bis spätabends Fundstücke auspackte und katalogisierte, ohne je ans Tageslicht zu kommen, konnte schon mal Gespenster sehen.
»Was ist dein Problem?« Johann ging um den Arbeitstisch herum, setzte sich auf den freien Platz ihr gegenüber und ließ sie nicht aus den Augen, gerade so, als hätte er Angst vor dem, was sie sagen könnte.
Du bist mein Problem!, hätte Anne am liebsten geschrien. Du lässt mich im Stich! Du bist mir so fremd geworden. Ich weiß gar nicht mehr, wer du bist.
Erschrocken hielt sie sich die Hand vor den Mund, als könnte sie damit ihren Gedanken Einhalt gebieten. Natürlich wusste sie, wer er war. Johann war der Mann, den sie liebte. Der Mann, den sie eines Tages heiraten würde, sobald nur ... sobald diese Phase erst einmal vorbei war. So nannte sie es bei sich, wenn sie vergeblich nach Wärme in seinem Blick suchte, wenn er für Stunden aus dem Museum verschwand, ohne zu sagen, wohin, wenn er fortwährend die Geduld mit ihr verlor und so seltsam gehetzt wirkte. Genau wie jetzt.
Verstohlen betrachtete sie ihn. Wie müde er aussah! Der Altersunterschied von sechzehn Jahren zwischen ihnen hatte ihr nie etwas ausgemacht. Aber nun war ihm anzusehen, dass er bald fünfzig wurde. Sein Gesicht wirkte eingefallen, die Falten auf seiner Stirn bildeten zwei tiefe gezackte Linien.
Anne wollte über den Tisch greifen, mit den Fingerspitzen seine Stirn berühren und alle Sorgen von dort vertreiben, aber sie tat nichts, straffte bloß die Schultern und sagte leise, flüsternd fast: »Es ist nur so ein Gefühl. Ich finde ...«
»Ein Gefühl?« Seine Stimme war auf einmal schneidend, so als würde er es darauf anlegen, sie zu verletzen. »Seit wann verlässt du dich auf dein Gefühl? Muss ich dich daran erinnern, dass du klassische Archäologie studiert hast? Du bist spezialisiert auf die Etrusker in Verbindung mit italischer Altertumskunde. Und im Nebenfach hast du dich zusätzlich mit den alten Griechen beschäftigt. Schon vergessen? Aber vielleicht stimmt das gar nicht? Vielleicht hast du uns allen etwas vorgemacht und in Wirklichkeit nur ein paar Kurse in Esoterik belegt? So mit Räucherstäbchen, Pendeln, Orakeln und ähnlichem Zeug? Bei der verrückten Mutter, die du hast, wäre das ja kein Wunder.«
Es waren weniger die Worte, die sie so trafen, als vielmehr sein eisiger Ton. Fassungslos starrte Anne ihren Freund und Vorgesetzten an.
»Johann ...« Sie musste sich räuspern. »Johann, jetzt gehst du zu weit. Ich trage hier die Verantwortung und habe wohl noch das Recht, meine Zweifel an einem Kunstwerk zu äußern.«
»Aber sicher doch, meine Liebe, sofern diese Zweifel wissenschaftlich begründet sind und nicht irgendeinem Gefühl entspringen. Wir können uns auch gern noch ein paar Stunden länger unterhalten, aber die Ausstellung verschieben wir dann wohl auf Weihnachten. Wenn du nämlich bei jedem Fundstück erst einmal auf dein Gefühl hören musst, kann das hier ja noch ein paar Monate dauern.«
Anne biss sich auf die Lippen. Sie wollte keinen Streit. Nicht jetzt. Ruhig erwiderte sie: »Ich werde mit dem Katalogisieren wie geplant in spätestens einer Woche fertig sein. Du kannst dann alles Weitere in die Wege leiten, während ich ...« Sie brach ab, als sie den spöttischen Zug um seinen Mund bemerkte. O nein, dachte sie und ahnte, was kommen würde. »Während du dir auf Kreta eine schöne Zeit machst? Wolltest du das sagen? Tja, ich fürchte, da muss ich dich enttäuschen.«
Anne brachte kein Wort heraus. In ihrem Inneren erstarb etwas.
»Nun guck nicht so entsetzt.« Johann wand sich unter ihrem Blick. »Hast du wirklich geglaubt, ich lass dich gehen? Deine Stärken liegen in der Museumsarbeit.«
Sie konnte ihn nicht länger ansehen und schaute an ihm vorbei auf die schmucklose Wand hinter seinem Rücken. Plötzlich entstand dort das Bild einer kretischen Landschaft, mit blühenden Mandel-, Zitronen- und Orangenbäumen, mit Feldern, bedeckt von Anemonen und Margeritenteppichen. In einem Olivenhain schnitten Bauern die Äste zurück, etwas entfernt weidete ein Hirtenjunge seine Ziegen, und im Hintergrund erhoben sich die Nordausläufer des mächtigen Ida-Gebirges.
So real war das Bild, dass Anne glaubte, die Sonnenhitze auf ihrem Gesicht zu spüren. Sie fühlte den festgestampften Boden unter ihren Knien, als sie sich bückte, um mit einem feinen Pinsel aus Rosshaar die letzten Sandkörner von einem Fundstück zu entfernen. Staub drang in ihre Lungen. Neben ihr widmeten sich Experten aus aller Welt mit derselben Begeisterung und Konzentration ihrer Arbeit.
Es ging darum, einen Palast der minoischen Hochkultur auszugraben, und die Vermessung hatte bisher ergeben, dass er mindestens so prachtvoll war wie der berühmte Palast von Knossos. Eine Sensation in der Welt der Archäologie. Das Bild zerbrach, zurück blieb eine weiß getünchte leere Wand. Die Ausgrabung auf Kreta würde ohne Anne Martin stattfinden. Wie schon das Projekt vor zwei Jahren in der Toskana, als ein weiterer Teil der etruskischen Nekropole von Populonia freigelegt wurde. Ihr Traum, endlich hinaus in die Welt zu reisen, um ihrer wahren Leidenschaft nachzugehen, scheiterte wieder einmal an Johann. Anne hatte ihre Bewerbung dem Museumsdirektor vorlegen müssen, und dieser hatte wie immer ihren unmittelbaren Vorgesetzten um Rat gefragt.
Auf einmal erfüllte sie eine wilde, ungezügelte Wut. »Du Mistkerl! Wie kannst du mir das antun!«
»Aber Liebling ...« Einen Moment lang verstummte Johann. Ihr Zorn schien ihn zu verwirren. Dann sagte er: »Dir ist doch hoffentlich klar, dass ich dich brauche. Wie soll ich ohne dich klarkommen?«
»Es wäre doch nur für drei Monate gewesen.« In ihre Stimme schlich sich jetzt ein Schluchzen, das sie kaum unterdrücken konnte. »Seit Jahren bin ich hier eingesperrt. Meine Welt endet hinter den Mauern dieses Museums. Das hatte ich mir im Studium anders vorgestellt.« Sie legte eine kurze Pause ein und fügte dann leise hinzu: »Und ich habe mich auf Kreta gefreut.«
Johann griff über den Tisch nach ihrer Hand, aber sie zog sie schnell zurück. Er lächelte schief. »Es tut mir leid, wirklich. Vielleicht ergibt sich nächstes Jahr eine andere Gelegenheit.«
»Das hast du auch gesagt, als ich nicht in die Toskana gefahren bin.« Wieder gewann ihre Wut die Oberhand. »Du willst mich nur hier festhalten. Wie in einem Gefängnis.«
»Jetzt übertreib nicht. Ich denke, der Palast wird auch ohne dich zum Vorschein kommen. Aber für die Ausstellung bist du unersetzlich. Du solltest jetzt weitermachen, uns läuft die Zeit davon.«
»Nein!« Anne stand auf. »Mach du doch weiter. In den letzten drei Stunden habe ich hier allein geschuftet, während du sonst wo warst. Ich finde, du hast einiges nachzuholen.«
»Anne, ich warne dich nur einmal. Wenn du jetzt gehst ...«
»Was dann? Willst du dem Direktor erzählen, dass ich ausnahmsweise einmal pünktlich Feierabend gemacht habe? Sollte ich ihm dann vielleicht auch verraten, wie oft du an deinem Arbeitsplatz fehlst? Weißt du, Johann, ich wäre genau in der richtigen Stimmung dazu, und das verdanke ich dir.«
»Du würdest es nicht wagen.« Er war ebenfalls aufgestanden, und nun starrten sie einander feindselig über die Arbeitsplatte hinweg an.
»Willst du es darauf ankommen lassen?« Sie wich keinen Millimeter zurück.
Schweigen breitete sich aus, erfüllte den grell beleuchteten Kellerraum und setzte sich in den schattigen Ecken fest. Anne forschte in Johanns Gesicht nach der sanften, unerschütterlichen Kraft, die ihn einst zum Ruhepol in ihrem Leben gemacht hatte. Sie fand nur schlecht verborgene Furcht. Wovor hatte er Angst? Wohin war der Mann verschwunden, den sie einmal bewundert hatte? Wann war Johann Wedekind, ein in der Fachwelt anerkannter Archäologe, väterlicher Freund, gerechter Chef und zärtlicher Liebhaber, gegen diesen fremden Mann hier vor ihr ausgetauscht worden? Würde sie je den Johann wiederfinden, den sie liebte?
Ich vermisse ihn, schoss es Anne durch den Kopf. Alle Wut verließ sie, zurück blieb nur Sehnsucht. Sie dachte an die vielen gemütlichen Abende bei ihm zu Hause, an die Geborgenheit, die sie stets in seiner Gesellschaft verspürt hatte. Wann waren sie überhaupt das letzte Mal zusammen gewesen? Sie konnte sich kaum daran erinnern.
»Du fehlst mir so«, sagte sie leise.
»Was?« Seine Haltung veränderte sich schlagartig, und er kam um den Arbeitstisch herum.
Anne wartete darauf, dass er sie in die Arme nahm, aber er legte ihr nur leicht eine Hand auf die Schulter. »Ich glaube, du bist wirklich überarbeitet, Liebling. Du nimmst alles viel zu schwer. Geh nach Hause und entspann dich. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus.«
»Johann ...«, begann sie, sprach aber nicht weiter. Sie wusste nicht, worüber sie sich mehr ärgern sollte, über seine Art, sie wie ein kleines Kind zu behandeln, oder darüber, dass er keinerlei Gefühlsregung zeigte. Und da war noch etwas anderes in seinen Worten. Etwas, das mit der bronzenen Schimäre zu tun hatte. Die Wissenschaftlerin in ihr versuchte eine Verbindung herzustellen, während die Frau mit ihrer Enttäuschung und ihrem verletzten Stolz fertig werden musste. Langsam wandte sie sich ab und marschierte steifbeinig auf die Tür zu.
»Wir sehen uns morgen früh um acht!«, rief Johann ihr nach.
Anne erwiderte nichts. Sie ging am Fahrstuhl vorbei und nahm die Treppe nach oben, aus Angst, sich nie wieder bewegen zu können, wenn sie stehenblieb. In der Haupthalle brannte um diese Zeit nur noch die Notbeleuchtung. Ein Kurator aus der babylonischen Abteilung hielt ihr die Tür auf, der Pförtner schaute kurz von der Abendzeitung auf und tippte an seine Mütze. Anne zwang sich zu einem Kopfnicken.
Draußen auf der Freitreppe atmete sie tief durch, und mit jedem Meter, den sie zurücklegte, wurde ihr Schritt schneller. Aus ihrem schönen Gesicht verschwand alle Bitterkeit und machte einem nachdenklichen Ausdruck Platz.
Anne war ein klassischer Typ, großgewachsen, mit graugrünen Augen, einer geraden Nase und sinnlichen Lippen. Einzig die prachtvollen Haare, dunkel und schimmernd wie schwarzer Samt, wollten nicht zum nordischen Gesamtbild passen, waren jedoch ein reizvoller Kontrast.
Im Gegensatz zu anderen Frauen zog Anne es vor, ihr gutes Aussehen zu verstecken. Zu viel Schönheit war schlecht für die Karriere. Sie hatte schon vor Jahren erfahren müssen, dass Kollegen sie nicht für voll nahmen, weil sie so bildhübsch war. Und so steckte sie ihr Haar zu einem schlichten Nackenknoten zusammen, benutzte gerade so viel Make-up, um gepflegt zu wirken, und trug auch außerhalb der Arbeitszeit strenge Kostüme – elegant, aber schlicht.
Anne lief um das Museum herum zum Parkplatz und zog fröstelnd ihre Jacke enger um die Schultern. Es war Mitte Mai in Hamburg, was zweierlei bedeuten konnte – eine erste Ahnung von Sommer oder der direkte Übergang von einem verregneten Frühjahr in einen nassen Herbst. Eher Letzteres, dachte sie und sah kurz zum Himmel. Von der Elbe fegten grauen Wolkenschiffe herüber, um die Stadt zu ertränken, und ein starker Wind pfiff sein kaltes Frühlingslied um die Häuserecken.
Eine Kanne Tee, einen Teller Kekse und einen alten Liebesfilm im Fernsehen – das war alles, was Anne sich an diesem Abend noch wünschte. Keine Gedanken mehr an Johann, keine Enttäuschung über die verpasste Reise nach Kreta, keine Grübelei mehr über etruskische Bronzefiguren, die nicht so schwer waren, wie sie sein sollten.
Abrupt blieb sie stehen. Das war es! Johanns Bemerkung, sie nehme immer alles so schwer, hatte sie darauf gebracht. Die Schimäre war zu leicht! Als wäre sie innen hohl. Und das, da war sich Anne ganz sicher, bedeutete, dass sie es mit einer Fälschung zu tun hatte.
Die Etrusker hatten ihre Figuren mit einer ganz bestimmten Technik aus einem Stück gegossen. Ein Wachsmodell wurde mit feuerfester Erde umhüllt, oben blieb eine Öffnung frei, und dort hinein goss der Handwerker die stark erhitzte flüssige Bronze. Die Wachsfigur schmolz, der so entstandene Hohlraum wurde mit Bronze ausgefüllt, und nach dem Erkalten konnte die fertige Statuette entnommen werden. Eine hohle Figur war mit dieser Technik unmöglich herzustellen.
Schon wollte Anne kehrtmachen, zurück ins Museum laufen und mit Johann darüber reden, aber dann zögerte sie. Ihr Instinkt riet ihr, abzuwarten. Sie musste erst ganz sicher sein. Sie würde die Statuette überprüfen und auch die anderen bereits erfassten Ausstellungsstücke noch einmal gründlich untersuchen, sonst riskierte sie nur, dass Johann sie erneut so abkanzelte wie vorhin.
Es gab noch einen weiteren Grund für ihr Zögern, und der hatte etwas damit zu tun, dass Johann Wedekind sich so offensichtlich verändert hatte und nicht mehr der Mann war, den sie liebte. Aber darüber wollte Anne im Augenblick nicht weiter nachdenken.
Sie ging zu ihrem Wagen, einem knallroten BMW der Dreierreihe, und schloss ihn auf.
***
Eine halbe Stunde später erreichte Anne Eppendorf, bog in die Edgar-Ross-Straße, bremste ab und schaute bestürzt durch die Windschutzscheibe.
Bitte nicht!, flehte sie lautlos und rieb sich die Augen. Nicht ausgerechnet heute!
Kapitel 2
Die beiden Männer stiegen hintereinander den Trampelpfad hinauf, kletterten über loses Gestein und achteten darauf, keinen falschen Tritt zu machen. Die Wege der Collina Alta, der höchsten Erhebung auf dem Landgut Villa Monteverde, waren nicht für Sonntagsspaziergänger geeignet. Ohne feste Wanderschuhe und ein erfahrenes Auge für Stolperfallen konnte ein unkundiger Fußgänger leicht stürzen und eine unangenehme Rutschpartie in die Tiefe erleben.
Vor den Männern jagten zwei Maremmaner Hirtenhunde den Hügel hinauf. Kira und Daco waren unwegsames Gelände gewohnt. Die mächtigen weißen Tiere verbrachten ihr Leben im Freien als Beschützer einer Schafherde, und sie, kannten keine Furcht. Oben angekommen, blieben sie hechelnd stehen.
Patrizio und Lamberto Casagrande erreichten die Kuppe nacheinander mit den letzten Strahlen der untergehenden Sonne. Um sie herum breitete sich die hügelige Landschaft Umbriens aus wie die weichen Wellen eines seit langem erstarrten Meeres. Nur zum Tiber hin liefen die Wellen aus und glichen bald einer flachen Ebene. An diesem Maiabend leuchtete das Land in allen erdenkbaren Schattierungen ein und derselben Farbe. Die Palette reichte vom dunklen Grün der Steineichenwälder über den silbrigen Ton der Olivenbäume und dem satten Glanz der Weinranken bis zum hellen, frischen Grün der Schafweiden.
Von hier oben war der Tiber gut zu sehen, schon ein kräftiger stolzer Fluss, der aber noch einen weiten Weg nach Süden vor sich hatte, bevor er als mächtiger Strom die Ewige Stadt erreichte und schließlich bei Ostia ins Mittelmeer mündete.
Patrizio schaute auf die blauen Stromschnellen und verglich sie mit dem trägen schlammigen und braungelben Wasser, das unter den Brücken Roms hindurchfloss. Dann ließ er seinen Blick noch einmal über das weite Land schweifen.
Es sind die Farben, dachte er. Die sauberen Farben fehlen mir am meisten. In Rom herrschten das Marmorweiß und Schlammbraun der Monumente und das verwaschen wirkende Gelb der Palazzi vor. Hier jedoch, im grünen Tal des Tibers, hatten alle Farben noch ihre natürliche Kraft.
Tief sog er die würzige Luft in seine Lungen ein und atmete nur zögernd wieder aus.
Das Heimweh streckte seine Arme nach ihm aus wie eine ungeduldige Geliebte. Patrizio wehrte sich nicht, obwohl er wusste, wie schwer es sein würde, sich aus dieser Umarmung wieder zu befreien, wenn er nach Rom zurückmusste, wo es nach Abgasen roch und nicht nach Wiesenkräutern.
»Alles in Ordnung, mein Sohn?« Lamberto Casagrande sah ihn nachdenklich von der Seite an und kniff im Gegenlicht der untergehenden Sonne die Augen zusammen. Unzählige Falten verwandelten sein Gesicht in eine Landkarte des Lebens und ließen ihn älter erscheinen, als er war. Die vielen Jahre, die er bei der Bewirtschaftung des familieneigenen Gutes im Freien verbracht hatte, zeigten sich in jeder tiefen Linie und im dunklen Braunton der ledrigen Haut. Seine breiten Schultern waren leicht gebeugt, die Gelenke an seinen Fingern trugen die Spuren fortschreitender Arthrose. Dennoch strahlte der Vater mit seinen fünfundsechzig Jahren mehr Vitalität und Energie aus als der Sohn, der ein Vierteljahrhundert jünger war. Patrizios Gesichtsfarbe war blass, beinahe wächsern, unter seinen Augen lag ein bläulicher ungesunder Schimmer, und die Falten auf seiner Stirn erzählten von einem ehrgeizigen Mann, der jede Aufgabe mit voller Konzentration anging, manchmal zornig wurde und nur selten lachte. Fröhlichkeit und Lebenslust hatten um Augen und Mund keine Spuren hinterlassen.
Er überragte seinen Vater um Haupteslänge, besaß aber dieselbe schlaksige Figur. Auch die schwarzen Haare und die scharf geschnittenen Gesichtszüge hatte er von ihm. Die nachtblauen Augen dagegen waren ein Erbe seiner Mutter und setzten einen überraschenden Farbtupfer in seine ansonsten so mediterrane Erscheinung.
»Tutto a posto?«, wiederholte Lamberto Casagrande seine Frage.
»Sí, Babbo.« Ganz unbewusst hatte Patrizio den Kosenamen für Vater gewählt. Er erinnerte ihn an früher, als er mit nackten, zerschrammten Beinen über die Felder von Villa Monteverde gelaufen war, bis der Babbo ihn fand, ihm die Ohren langzog und zurück zu den Hausaufgaben schickte. Heimweh, dachte er jetzt, war viel mehr als ein bestimmtes Panorama, mehr als ein Duft und eine Erinnerung. Oder weniger. Manchmal genügte ein einziges Wort, um dieses schmerzhafte Ziehen im Herzen auszulösen. Babbo.
»Du siehst müde aus, Junge.«
»Ich bin bloß überarbeitet. Ein paar Tage Ruhe und viel frische Luft, das ist alles, was ich brauche, um wieder fit zu werden. Deshalb bin ich ja da.«
Lamberto kniff die Augen noch fester zusammen, als ob er seinem Sohn bis in die Seele schauen wollte. Was ihm auch gelang. »Du bist nicht zur Erholung hier. Die Wahrheit ist, du hast genug von Rom und deinem Leben dort.«
Patrizio löste den Blick von der Landschaft und sah seinen Vater überrascht an. »Wie kommst du darauf?«
Lamberto grinste jetzt und sah für einen Moment aus wie einer der alten Männer im Dorf Monteverde, die ihre Tage auf der Piazza verbrachten oder auf der Bocciabahn, hübschen Frauen nachschauten und sich an bessere, an jüngere Zeiten erinnerten, während sie ihren Espresso schlürften oder an einem Aperitivo nippten.
»Ich schätze, das Dolce Vita ist auf Dauer nichts für einen echten Casagrande. Wir sind immer eine hart arbeitende Familie gewesen, auf unserem eigenen Land, mit unseren eigenen Händen.«
»Dolce Vita! Ha!«, schnaubte Patrizio. »Du hast ja keine Ahnung. Von wegen süßes Leben!«
Auf einmal verlor Lamberto jede Ähnlichkeit mit den alten Müßiggängern von der Piazza und war wieder der strenge Vater, der sich nichts vormachen ließ.
»So schwer kann es ja nicht sein, den reichen Damen der römischen Gesellschaft ein bisschen im Gesicht herumzuschnippeln und die Hüften in Form zu bringen. Oder willst du mir etwas anderes erzählen? Hast du vergessen, wie hart die Arbeit hier auf dem Gut ist?«
Patrizio wollte schon protestieren, wollte ihm von seinen anstrengenden Tagen in der Schönheitsklinik La Bella erzählen, die um sechs Uhr früh begannen und selten vor neun Uhr abends zu Ende gingen. Seit die betuchten Römerinnen Patrizio Casagrande zum neuen Gott unter den plastischen Chirurgen erkoren hatten, kam er kaum noch zum Atemholen. Und es wurde täglich schlimmer. Inzwischen reisten Patientinnen aus Mailand und Genua, aus Neapel und Palermo an. Selbst aus St. Tropez und Paris gab es bereits Anfragen für eine Gesichtsstraffung, eine Nasenkorrektur oder eine Fettabsaugung. Patrizio kam sich mittlerweile vor wie in einem Film. Und er war der neue Star in einer ebenso tragischen wie heldenhaften Rolle. Ein Mann, der von aller Welt bewundert wurde, sich selbst aber schon seit langem im Glanz seines Ruhmes verloren hatte. Der nicht mehr wusste, wer er war und was er eigentlich in seinem Leben erreichen wollte.
Doch er schwieg, wandte sich ab und schaute wieder hinunter ins Tal. Noch nie war es ihm gelungen, mit seinem Vater über die Dinge zu reden, die ihn wirklich bewegten. Lamberto Casagrande war kein Mensch, dem man sein Herz ausschütten konnte. Er duldete keine Schwäche, weder bei sich selbst noch bei anderen.
Manchmal fragte sich Patrizio, welche Gefühle sein Vater hinter seiner energischen Maske versteckte. Gab es auch für ihn Momente des Zweifels und der Einsamkeit? Sehnte er sich nie danach, noch einmal Liebe zu empfinden, oder hatte er für immer damit abgeschlossen? Vielleicht war Lamberto Casagrande der Meinung, er verdiene es nicht, zu lieben und geliebt zu werden. Es war ihm nicht gelungen, die eine Frau glücklich zu machen, die er einst geliebt hatte. Vermisste er in solchen Momenten Marie, von der er seit vielen Jahren geschieden war? Oder ging seine Sehnsucht in eine ganz andere Richtung? Marie Dressier hatte Villa Monteverde verlassen und war zurück nach Wien gezogen, als Patrizio gerade eingeschult wurde.
»Deine Mutter ist durch und durch Großstädterin«, hatte sein Vater ihm erklärt. »Sie kommt mit dem Leben auf dem Land nicht zurecht.«
Schon der kleine Junge hatte gespürt, dass hinter dieser Erklärung noch eine andere steckte, die nicht ausgesprochen wurde. Warum, wollte er fragen, hat Mama mich nicht mitgenommen? Sie fehlte ihm doch so schrecklich. Jeden Abend weinte er in sein Kopfkissen, aber erst, nachdem sein Vater das Licht gelöscht hatte. Keine Schwäche zeigen, das hatte Patrizio schon mit sechs begriffen. Wie sehr sein Vater damals selbst litt, bekam er nicht mit. Die Gründe hätte er auch nicht verstanden.
Erst im Laufe der Jahre erfuhr er, dass Marie versucht hatte ihn nachkommen zu lassen, aber an Lamberto gescheitert war. Einem Casagrande, Großgrundbesitzer und Nachfahre eines uralten umbrischen Geschlechts, nahm man nicht den einzigen Sohn weg, das musste die Wienerin schmerzhaft erfahren.
Sie erzählte Patrizio davon, als er alt genug war, um sie in Österreich zu besuchen, doch auch sie sprach nicht über mögliche weitere Gründe für ihre Flucht.
»Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es war an der Zeit zu gehen«, sagte sie nur und verbot ihm jede weitere Frage.
Patrizio löste seine Gedanken aus der Vergangenheit, beugte sich hinunter und kraulte seinen Hunden das dichte lange Fell. Seinem Vater blieb er eine Antwort schuldig. Wozu ihm Widerworte geben, wenn er im Grunde doch recht hatte? Das Leben in Rom, zu dem er einst mit so viel Ehrgeiz und Hoffnung aufgebrochen war – er verabscheute es.
»Du verwöhnst die Viecher«, sagte Lamberto streng. »Sie hängen viel zu sehr an dir. Bald taugen sie nicht mehr für die Herde.«
Patrizio schmunzelte. »Bist du eifersüchtig?«
»Unsinn. Aber das sind Arbeitstiere und keine Schoßhündchen.«
Kira und Daco senkten die Köpfe, als wüssten sie genau, dass es um sie ging. Sie waren Mutter und Sohn, reinrassige Vertreter des Maremmano Abruzzese, knapp siebzig Zentimeter groß und gut vierzig Kilo schwer. Dieser Ausflug heute war für beide eine Abwechslung im harten Arbeitsalltag, und sie kosteten ihn aus.
Daran gewöhnt, selbständig die Herde zu hüten, besaßen sie einen eigenwilligen Charakter. Niemals zeigten sie sich unterwürfig, und hundertprozentiger Gehorsam war nicht ihre Sache. Einzig bei Patrizio machten sie eine Ausnahme. Ihm wichen sie nicht einen Moment von der Seite, wenn er zu Besuch auf Villa Monteverde war. Reiste er wieder ab, streunten sie tagelang durch die Gegend, in der Hoffnung, seine Witterung noch einmal aufzunehmen.
»Schon gut.« Patrizio richtete sich auf und entließ die Hunde mit einem knappen Handzeichen. Kira und Daco stoben davon, auf der Suche nach Kaninchen, die sie jagen konnten.
»Ich meine es ernst.« Lamberto setzte sich auf einen Felsblock und holte seine Pfeife heraus, um sie langsam zu stopfen. »Du verdirbst die Tiere.«
Einen Moment lang beobachtete Patrizio seinen Vater ratlos. Wenn Lamberto seine Pfeife zur Hand nahm, war das stets ein untrügliches Zeichen für ein ernstes Gespräch.
Über die Hunde? War sein Vater deshalb überraschend mitgekommen, als er vor zwei Stunden zu seiner Wanderung aufgebrochen war? Nein, entschied er. Lambertos Bemerkungen über Rom und seinen Umgang mit Kira und Daco waren nur eine Einleitung gewesen. Wie typisch für ihn, dachte Patrizio. Er sagt nicht geradeheraus, was er will, sondern redet drum herum, bis ich selbst darauf komme. Und das nur, um sich ja keine Blöße zu geben.
Schlagartig wurde ihm klar, worauf das alles hinauslief, und er wusste nicht, ob er darüber erschrocken oder erleichtert sein sollte. War es die Lösung, die er insgeheim suchte? Kam er deshalb in letzter Zeit immer öfter nach Villa Monteverde, weil er nur auf ein Wort seines Vaters wartete?
Patrizio suchte sich ein Stück entfernt einen Sitzplatz auf dem Stumpf eines Maulbeerbaums, hielt nach den Hunden Ausschau und schwieg.
Die Stille zwischen Vater und Sohn zog sich in die Länge, wurde schwer in der warmen Abendluft, beinahe drückend. Nur das Bellen von Kira und Daco drang zu ihnen herüber, und jeder wartete darauf; dass der andere sprach. Patrizio dachte gar nicht daran, es seinem Vater so leicht zu machen. Dieser wunderte sich wohl, warum sein Sohn ihm nicht wie sonst entgegenkam.
Endlich brach Lamberto das Schweigen. »Mit Massimiliano wird es jeden Tag schlimmer.«
Fast hätte Patrizio gelacht. Von allen Möglichkeiten, die sich seinem Vater boten, hatte er die abwegigste gewählt, um ihm die Botschaft zu vermitteln: Komm nach Hause, ich brauche dich auf Villa Monteverde.
Ausgerechnet der Koch musste nun als weitere Andeutung herhalten. Massimiliano della Torre war allerdings, das musste Patrizio zugeben, ein bemerkenswerter Mensch. Er bezeichnete sich selbst als Abkömmling einer etruskischen Dynastie und hätte mit seinem klassischen Profil eine imposante Erscheinung abgeben können, wenn sein Körper nicht bei knapp einem Meter fünfundfünfzig mit dem Wachstum in die Höhe aufgehört hätte, um sich dafür in die Breite zu entwickeln.
Er beherrschte meisterhaft sämtliche Spezialitäten aus Umbrien, entwickelte neuerdings jedoch ein immer stärkeres Faible für eher ausgefallene Speisen, angeblich, um seine eigenen Wurzeln zu finden.
»Der Agriturismo war deine Idee«, erwiderte Patrizio vorsichtig. Diese italienische Form des Urlaubs auf dem Bauernhof erfreute sich bei Touristen großer Beliebtheit und sicherte dem Landgut der Casagrandes seit einem Jahr bessere Einkünfte.
»Dazu stehe ich auch. Aber ein Koch, der den Gästen zum Frühstück Gerstenbrei mit Pinienkernen vorsetzt, ist nicht mehr tragbar. Und gestern Abend hat er meinen besten alten Rotwein mit Wasser gepanscht und mit Honig gesüßt. Dazu hat er behauptet, dass ein Getränk, das sogar die verwöhnten alten Griechen zu schätzen wussten, für einen Kegelclub aus Berlin gerade gut genug ist.«
Nun lachte Patrizio laut heraus. »Du hast doch gewusst, dass er sehr kreativ ist.«
Lamberto zog an seiner Pfeife und runzelte die Stirn. »Jemand muss mit ihm reden. Er vergrault mir sonst die Gäste. Auf mich hört er nicht. Vielleicht kannst du ... Ihr seid doch ungefähr im gleichen Alter.«
Patrizio hob die Augenbrauen. Dass sein Vater eine Bitte offen aussprach, war für ihn eine riesige Grenzüberschreitung. »Wenn du meinst ...«, erwiderte er langsam.
»Und morgen könntest du mit Beppe zu den Nordweiden rausfahren und mit ihm den Ankauf neuer Mutterschafe besprechen. Die Preise für Wolle stehen in diesem Jahr wieder gut. Die Ware aus Australien ist derzeit nicht sehr gefragt. Möglicherweise sollten wir die Herde wieder vergrößern.« Patrizio stand auf. So war das also. Mit einer Bitte nach der anderen zog ihn sein Vater auf das Landgut zurück. Moment mal! Waren es wirklich Bitten oder nicht doch Befehle? Eher Letzteres, dachte er. Der Tag, an dem mein Vater mich um Rat und Hilfe bittet, liegt noch in weiter Zukunft. Sofern er überhaupt jemals anbrechen wird.
Beppe Pellegrini leitete die Schafzucht von Villa Monteverde, seit Patrizio ein kleiner Junge gewesen war. In erster Linie wurden die Tiere ihrer Milch wegen gehalten, die Wolle war nur ein Nebengeschäft. Aus der Vollmilch wurde der umbrische Pecorino gewonnen, ein Schafskäse, der je nach Reifung mild bis scharf schmeckte und auf keiner Tafel zwischen Città di Castello im Norden und Terni im Süden, zwischen Gubbio im Osten und Orvieto im Westen fehlen durfte.
»Soweit ich informiert bin«, entgegnete Patrizio, »besitzen wir nicht genügend Weideland für eine größere Herde. Hast du nicht immer gesagt, bei tausend Stück Vieh muss Schluss sein?«
»Richtig«, antwortete sein Vater und zog an seiner Pfeife. »Ich denke darüber nach, weiteres Land zu pachten oder zu kaufen. Vielleicht könntest du mir bei den Verhandlungen helfen. Der Besitzer ist ein verdammter Sturkopf. Der denkt, er kann mir das Geld gleich bündelweise aus der Tasche ziehen, weil ich auf seinen verdorrten Wiesen nach Kunstschätzen des Altertums graben will.«
Patrizio grinste, wurde aber sofort wieder ernst. »Und was ist mit dem brachliegenden Land neben dem Kastanienwald? Für den Weinanbau taugt es nicht, aber als Schafsweide wäre es ideal, obwohl ein Hektar nicht sehr viel ist.«
»Nein«, sagte Lamberto, »das ist unmöglich.«
»Warum? Was ist an diesem Land so Besonderes, dass es ungenutzt bleiben soll?«
Der lange Blick, den Lamberto seinem Sohn zuwarf, war ärgerlich und bittend zugleich. »Darüber will ich nicht reden.«
Die Sonne ging nun hinter den westlichen Hängen des Apennins unter, im Tal krochen die Schatten heran und breiteten sich lautlos und rasch aus. Unaufhaltsam.
»Lass uns zurückgehen«, sagte Patrizio zu seinem Vater. Er war noch nicht willens, ihm seine Zustimmung zu geben. Vor allem nicht, wenn Lamberto keinerlei Bereitschaft zeigte, offen und ehrlich mit ihm zu sein. Daher pfiff er nur nach den Hunden und marschierte los, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Kapitel 3
Anne ließ den Motor laufen, schaute genauer hin und betete um eine Sinnestäuschung. Aber sie wusste es schon besser. Am Straßenrand, direkt vor ihrem Hauseingang, stand ein bunt bemalter VW-Bus, der aussah, als wäre er schon mindestens zweimal bis nach Poona in Indien und zurück gefahren, was durchaus möglich war. Und das konnte nur eines bedeuten – ihre Mutter feierte eine Party.
Schon wieder!
Anne stieß einen tiefen Seufzer aus. Dies war nicht ihr Tag, so viel stand fest. Sie versuchte sich innerlich gegen das Chaos zu wappnen, das ihr bevorstand. Wie schon so oft fragte sie sich, warum sie nicht endlich von zu Hause auszog und sich eine eigene Wohnung nahm. Aber im selben Atemzug nannte sie stumm die Gründe, die noch bis vor einer Stunde dagegen gesprochen hatten: Eigene vier Wände lohnten sich nicht, wenn sie ohnehin bald verreisen würde, um an Ausgrabungen teilzunehmen. Wozu ihr Leben mit Möbeln, Mietvertrag und Telefonanschluss beschweren, wenn doch schon bald, morgen vielleicht, die Zukunft leicht und frei wurde? Und dann Johann. Es war doch möglich, dass er sie eines Tages bitten würde, bei ihm einzuziehen.
Eher nicht, dachte sie jetzt bedrückt. Vielleicht hat er längst ganz andere Pläne, nur ich weiß noch nichts davon. Vielleicht ... Sie zögerte, den Gedanken zu Ende zu führen, zwang sich dann aber dazu. Vielleicht hat er längst eine andere Frau. Kälte breitete sich in ihrem Inneren aus, und sie zitterte plötzlich.
Mit einem Ruck fuhr sie wieder an, fand eine Parklücke am anderen Ende der Straße, stieg aus und lief zum Haus zurück
Schon im Treppenhaus säuselte ihr Leonhard Cohen sein herzergreifendes »Suzanne« entgegen, und als sie die Wohnungstür aufschloss, fiel die Stimme ihrer Mutter in den Refrain ein. »And you want to travel with her, and you want to travel blind ...«
Genau, dachte Anne, ich will auch verreisen. Auf der Stelle. Sekundenlang hatte sie das Bild einer grünen, von weichen Hügeln durchzogenen italienischen Landschaft vor Augen. Das Bild verschwamm, als ihre Mutter selig lächelnd vor ihr auftauchte.
»Schätzchen, da bist du ja. Du siehst müde aus. Komm, trink ein Glas Tequila mit uns. Oder willst du was essen? Wir haben heute einen mexikanischen Abend. Fred hat Chili con Carne gekocht, und Nora hat auch was mitgebracht. Ich glaube, Tortillas. Oder Enchiladas? Na, egal. Hauptsache, du bekommst was in den Bauch. He, Leander, Fred, dreht die Musik leiser, und macht ein paar Fenster auf. Meine Tochter ist zu Hause.«
Dieser Redeschwall allein schon hätte genügt, um Anne in die Flucht zu schlagen, aber es gab kein Entrinnen. Jemand schloss die Wohnungstür hinter ihr, und innerhalb von Sekunden war sie von den Freunden ihrer Mutter umringt.
Ein Blick in diese überaus originelle Runde kam einem Zeitsprung zurück in die späten sechziger Jahre gleich. Die Frauen trugen Batikgewänder oder Jeans und Fransenhemden, die Männer mehr oder weniger das Gleiche. Manche hatten wie ihre Mutter Blumen im Haar, andere klimperten mit ihren unzähligen silbernen Armreifen. Hier und da gab es Buttons mit dem Friedenszeichen und Schriftzüge auf Halstüchern: Make peace, no war. Die Augen einiger Frauen waren mit schwarzem Kajal umrandet, die einiger Männer auch. Stirnbänder hielten langes Haar zurück, und der eine oder andere Atem, der Anne entgegenschlug, roch verdächtig nach süßem, beschwingt machendem Rauch. Einzig die Fältchen in den Augenwinkeln und die grauen Fäden in den Vollbärten ließen erkennen, dass diese Blumenkinder die fünfzig seit einer ganzen Weile überschritten hatten. Manche von ihnen auch schon die sechzig.
»Die arme Anne schaut ja ganz erschöpft aus. Seht nur, wie blass sie ist.«
»Und solche Augenränder! Die hatte ich ja nicht mal, als wir in Woodstock durchgemacht haben.«
»Gib nicht so an, du warst doch bloß auf dem Open-Air-Festival in Uelzen.«
»Nun lasst das Kind doch erst mal was trinken. Wer hat schon wieder den Schnaps ausgesoffen?«
Das Kind zitterte inzwischen vor unterdrücktem Zorn.
»Ich bin dreiunddreißig Jahre alt und keine dreizehn, und ich will nur meine Ruhe haben.«
Niemand schien sie zu hören, das Geplapper ging munter weiter.
»Esmeralda, du solltest deiner Tochter sagen, dass sie zu viel arbeitet.«
»Tue ich ja, aber sie hört nicht auf mich.«
»Oh, die süße Kleine ist viel zu ehrgeizig.«
»Spießig trifft es wohl eher. Hockt sie immer noch in dieser grauenhaften Katakombe fest?«
»Ich fürchte, ja.«
»Aber warum genießt sie nicht ein bisschen ihr Leben? Man ist nur einmal jung. Sie sollte endlich mal raus in die Welt und ihren Horizont erweitern. Wie lange will sie noch warten?«
Anne richtete sich zu ihrer vollen Größe auf, womit sie die meisten anderen überragte, und sagte laut: »Ich bin keine süße Kleine! Und es geht niemanden was an, wie ich mein Leben führe! Ist das klar?« Sie mochten tausendmal recht haben, aber keiner dieser Alt-Hippies sollte einfach über sie urteilen.
In Esmeraldas Augen funkelte es belustigt. »Da hört ihr's, Leute. Mein großes Mädchen kann richtig fuchsig werden, wenn man es kritisiert. Ich würde sagen, da kommt sie ganz nach ihren Großeltern.«
Zustimmendes Gemurmel folgte. Alle wussten, wie sehr Esmeralda ihre eigenen Eltern bedauerte, weil diese niemals aus ihrem kleinbürgerlichen Leben ausgebrochen waren.
Anne schloss kurz die Augen und fragte sich, womit sie das bloß verdient hatte. Welche Sünden hatte sie begangen, um mit einer Mutter wie Esmeralda Martin gestraft zu sein? Einer Frau Mitte fünfzig, die noch immer lebte wie ein zwanzigjähriges Hippie-Mädchen, die ihren alternativen Frauenbuchladen selten vor elf Uhr öffnete, die ein großes Haus für alle Freunde führte und allen Ernstes noch an den Weltfrieden glaubte. An den Weltfrieden und den Niedergang des Establishments, um genau zu sein. Sie ging leidenschaftlich gern zu Demos, wo zwar nicht mehr gegen den Vietnamkrieg, sondern gegen die Amis im Irak protestiert wurde, nicht mehr für das Recht auf Abtreibung, sondern für mehr Frauen in Führungspositionen, aber das waren ihrer Meinung nach nur minimale Unterschiede.
Als kleines Kind hatte Anne gedacht, alle Leute würden so leben, ohne festen Tagesablauf und ohne Regeln, dafür mit viel Gitarrenmusik, Gesang und Gelächter, billigem Wein aus der Tüte und dem Duft von unzähligen Räucherstäbchen.
Erst in der Schule stellte sie überrascht fest, dass es auch anders ging. Ihre neuen Freundinnen aßen liebevoll geschmierte Pausenbrote und nahmen sie manchmal mit nach Hause, wo eine adrett gekleidete Mutter Annes langes schwarzes Haar zu Zöpfen flocht, wo der Vater am späten Nachmittag von der Arbeit heimkam und in einem abgewetzten Ohrensessel das Hamburger Abendblatt las. Um punkt sechs aß die Familie am Ecktisch in der Küche gemeinsam zu Abend. Es gab Hagebuttentee, dunkles Brot, Käse, Aufschnitt und Tomaten. Der Vater sprach ein kurzes Dankgebet, und alle reichten sich die Hände, um einander einen guten Appetit zu wünschen.
Nach solchen Besuchen hatte sie manchmal ihre Mutter gefragt, wo ihr eigener Papa war, wer überhaupt ihr Papa war. Jedes Mal hatte Esmeralda nur fröhlich gelacht und gesagt: »Schätzchen, du hast doch Fred, Leander, Tom und Piet. Reicht das nicht?«
Nein, wollte sie dann antworten, das reicht nicht. Oder: Nein, das sind mir zu viele. Aber sie wusste nicht, wie sie das ihrer Mutter erklären sollte.
Als sie älter wurde, gewöhnte sie sich die Fragen ab, auf die es nie eine Antwort gab.
»Ich finde, wir sollten Anne jetzt in Ruhe lassen.«
Sie öffnete die Augen und sah direkt in Freds freundliches Gesicht. Ihn hätte sie gern als Vater gehabt. Zu ihm hatte sie schon als Kind mit all ihren Kümmernissen gehen können, und bis heute war er ihr ein lieber Freund. Allerdings verschwand er ein wenig zu oft mit seinem VW-Bus in die weite Welt und kam dann erst nach Wochen, manchmal nach Monaten wieder.
»Danke«, murmelte sie. »Mama, kommst du bitte kurz mit in die Küche?«
»Klar doch. Ich zeige dir, was noch zu futtern da ist. Hoffentlich hat die Meute dir eine ordentliche Portion Chili übriggelassen.«
»Ich habe keinen Hunger«, sagte Anne und erinnerte sich an das indonesische Kokoshuhn von der letzten Party, das ihr nicht so gut bekommen war.
Sie schloss die Küchentür und baute sich mit vor der Brust verschränkten Armen kampfbereit auf. Aber ihre Mutter lächelte bloß friedlich, raffte ihr blumenbedrucktes langes Kleid hoch und hockte sich im Schneidersitz auf den Küchentisch, nachdem sie ein paar halbleere Schüsseln beiseitegestellt hatte.
»Du hättest deinen Johann mitbringen können. Der ist ein bisschen schlaff neuerdings, findest du nicht? Ein Teller extrascharfes Essen würde ihm ordentlich Feuer unter dem Hintern machen.«
»Mein Freund ist jetzt nicht das Thema!«, rief Anne böse aus.
»Schade.« Esmeralda schüttelte ihre hennarot gefärbten Locken. Manchmal kam sich Anne neben ihrer Mutter farblos und durchschnittlich vor. »Im Großen und Ganzen finde ich deinen Schatz nämlich reizend.«
Esmeralda wollte nur ablenken, klar, aber Anne fiel wie immer darauf rein. »Quatsch. Du findest ihn mittelmäßig und sterbenslangweilig, und das ist noch nett ausgedrückt, stimmt's?«
»Keep cool, Schätzchen. Wer um Gottes willen sagt denn so was?«
»Du, Mama. Zuletzt heute Morgen beim Frühstück, als ich dir verraten habe, dass ich ihn eines Tages heiraten werde.«
»Ach ja, eine Hochzeit.« So wie Esmeralda das Wort aussprach, hätte es auch Gefängnis oder gar Todesstrafe lauten können.
Dieses Gespräch ist vollkommen verrückt, schoss es Anne durch den Kopf. Es gibt vielleicht gar keine Zukunft mehr für Johann und mich. Aber sie hatte schon so oft mit ihrer Mutter über diesen Mann gestritten, dass sie nun wie in einem Rollenspiel gar nicht anders konnte.
»Was ist so schlimm daran, wenn ich mir eine eigene Familie wünsche?«
»Nichts. Gar nichts. Falls es wirklich und wahrhaftig dein Wunsch ist.«
»Selbstverständlich ist es das!«
Hörte Esmeralda den falschen Ton heraus? Sie hatte manchmal die unheimliche Fähigkeit, Annes Gedanken zu lesen.