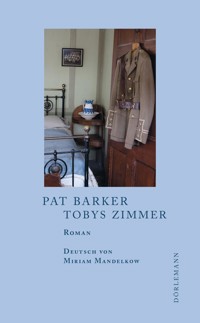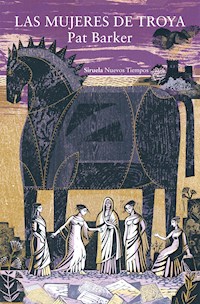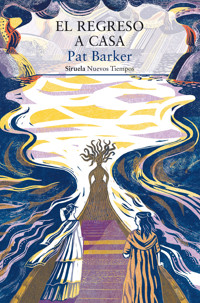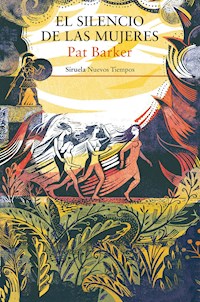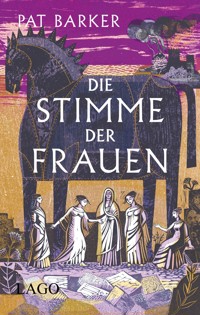
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lago
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Troja ist gefallen. Die Griechen haben ihren bitteren Krieg gewonnen und könnten als Sieger nach Hause zurückkehren. Alles, was sie brauchen, ist ein guter Wind, um ihre Segel zu setzen. Aber der Wind kommt nicht. Die Götter sind erzürnt und so kampieren sie im Schatten der Stadt, die sie zerstört haben. In diesen unruhigen Tagen beginnen die Hierarchien zu zerfallen und alte Fehden werden erneut entfacht. Weitgehend unbemerkt von ihren zankenden Entführern bleibt Briseis im griechischen Lager. Sie verbündet sich, wo sie kann, denn Briseis hat zwar den Krieg überlebt, aber die Friedenszeit könnte sich als noch gefährlicher erweisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
PAT BARKER
DIE STIMME DER FRAUEN
PAT BARKER
DIE STIMME DER FRAUEN
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2022
© 2022 by Lago, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Die englische Originalausgabe erschien 2021 bei Doubleday unter dem Titel The Women of Troy. © 2021 by Pat Barker. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Larissa Rabe
Redaktion: Carina Heer
Umschlaggestaltung: Manuela Amode, dem Original nachempfunden
Umschlagabbildung: Sarah Young
Satz: Christiane Schuster | www.kapazunder.de
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95761-218-2
ISBN E-Book (PDF) 978-3-95762-324-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95762-325-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.lago-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für Jack, Maggie und Mr Hobbes; und in liebevoller Erinnerung an Ben.
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
Im Bauch des Pferdes herrscht Hitze, Dunkelheit, Schweiß, Angst. Die Männer sind hineingestopft wie Oliven in einen Krug, es ist eng und überfüllt. Er verabscheut die Berührung anderer Leiber, das ist immer schon so gewesen. Selbst bei sauberen, wohlriechenden Leibern wird ihm fast übel – und diese Männer hier stinken. Es wäre vielleicht nicht so schlimm, wenn sie sich nicht bewegen würden, aber das tun sie. Jeder regt sich, verlagert sein Gewicht von hier nach da und versucht, die Schultern so auszurichten, dass er ein klein wenig mehr Platz bekommt. Alle sind ineinander verschlungen und winden sich wie die Würmer in der Pferdescheiße.
Rotwurm.
Das Wort schleudert ihn in eine Spirale der Erinnerung, immer weiter herab, hinunter, in die Vergangenheit, zurück ins Haus seines Großvaters. Als Junge – einige der Männer hier scheinen zu glauben, er wäre noch immer einer – ist er jeden Morgen zu den Ställen hinuntergelaufen. Er rannte den Weg zwischen den großen Hecken entlang, sein Atem bildete Wölkchen in der kalten Luft, die nackten Zweige schimmerten im rötlichen Morgenlicht. Sobald er die Biegung hinter sich hatte, sah er den armen alten Rufus am Gatter des ersten Sattelplatzes stehen – oder vielmehr lehnen. Er hatte auf Rufus reiten gelernt. Das hatten sie fast alle, denn Rufus war ein außergewöhnlich zuverlässiges Pferd. Kein Witz: Wenn man ins Rutschen kam, streckte er den Huf aus und schob einen wieder hinauf. Er hatte nur glückliche Erinnerungen an das Reitenlernen. Also kraulte er Rufus ausgiebig an allen Stellen, die er selbst nicht erreichen konnte, dann blies er ihm sanft in die Nüstern, und ihr Atem vermischte sich in einem schnaubenden, warmen Laut. Der Klang von Sicherheit.
Wie sehr er dieses Pferd geliebt hat! Mehr als seine Mutter, mehr sogar als seine Amme, die man ihm ohnehin genommen hatte, als er sieben war. Rufus. Selbst der Name hatte ein Band zwischen ihnen geschaffen: Rufus – Pyrrhos. Beide Namen bedeuten »rot« – und sie waren beide ungewöhnlich rothaarig. Zugegeben, das Fell von Rufus war eher kastanienbraun als rötlich. Als junges Pferd hatte sein Fell geschimmert wie die ersten Rosskastanien im Herbst, aber er wurde natürlich älter. Und krank. Schon im letzten Winter hatte ein Pferdeknecht gesagt: »Er ist ein bisschen mager, man sieht seine Rippen.« Seitdem war Rufus von Monat zu Monat dünner geworden; Schulter- und Beckenknochen drangen scharf und spitz durchs Fell, und er begann, ausgemergelt auszusehen. Nicht einmal das saftige Sommergras hatte ihn Fett ansetzen lassen. Eines Tages beobachtete Pyrrhos, wie ein Stallknecht einen Haufen lockerer Pferdeäpfel zusammenschaufelte, und er fragte: »Warum sieht das so aus?«
»Rotwurm«, antwortete der Mann. »Der arme alte Kerl ist voll davon.«
Rotwurm.
Und dieses Wort versetzt ihn zurück in die Hölle.
Zuerst gestattet man ihnen Wachslichter, mit der strengen Mahnung, sie augenblicklich zu löschen, sobald sich das Pferd zu bewegen beginnt. Schwache, flackernde Lichter, doch ohne sie hätte ein Pelz von Dunkelheit und Angst ihn erstickt. Jawohl, Angst. Er würde es abstreiten, wenn ihn jemand fragen würde, aber die Angst ist da, unverkennbar, in seinem trockenen Mund und in der Unruhe in seinen Gedärmen. Er versucht zu beten, aber kein Gott hört ihn, und so schließt er die Augen und denkt: Vater. Das Wort fühlt sich unbeholfen an, wie ein neues Schwert, wenn sich die Finger noch nicht an den Griff gewöhnt haben. Hat er seinen Vater je gesehen? Falls dem so ist, dann ist er damals ein Baby gewesen, zu jung, um sich an die wichtigste Begegnung seines Lebens zu erinnern. Er versucht es stattdessen mit: Achill – und tatsächlich ist es leichter, den Namen zu verwenden, den das ganze Heer benutzen kann.
Er blickt die Männer an, die sich eng an eng neben und vor ihm auf den Bänken drängen. Jedes Gesicht ist von unten her beleuchtet, winzige Flammen tanzen in ihren Augen. Diese Männer haben Seite an Seite mit seinem Vater gekämpft. Da ist Odysseus: dunkel, schlank, frettchenhaft, der diese ganze Unternehmung erdacht hat. Er hat das Pferd entworfen, seinen Bau überwacht, einen trojanischen Prinzen gefangen genommen und gefoltert, um Einzelheiten über die Verteidigungsmaßnahmen der Stadt zu erfahren – und zum Schluss hat er sich die Geschichte ausgedacht, mit deren Hilfe sie durch die Stadttore kommen sollen. Wenn dieser Plan fehlschlägt, werden alle wichtigen Krieger des griechischen Heeres in einer einzigen Nacht umkommen. Wie kann man eine solche Verantwortung nur aushalten? Und doch scheint Odysseus nicht im Mindesten beunruhigt. Ohne es zu wollen begegnet Pyrrhos seinem Blick, und Odysseus lächelt. Oh ja, er lächelt, er ist scheinbar freundlich, aber was denkt er wirklich? Wünscht er sich, Achill wäre hier, und nicht sein Sohn, dieser unnütze kleine Kümmerling? Nun, falls er es sich wünscht, hat er recht, Achill sollte eigentlich hier sitzen. Er hätte keine Angst gehabt.
Als er seinen Blick weiterwandern lässt, sieht er Alkimos und Automedon nebeneinander. Früher sind sie die maßgeblichen Berater von Achill gewesen, nun sind sie seine. Nur ist »Berater« nicht ganz das richtige Wort. Sie sind die Herren der Lage. Vom Moment seiner Ankunft an unterstützen sie einen Anführer, der über keinerlei Erfahrung verfügt, sie sorgen dafür, dass seine Fehler in Vergessenheit geraten, sie sind stets darum bemüht, dass er in den Augen der Männer gut dasteht. Nun, das alles wird sich am heutigen Tag, oder vielmehr in der heutigen Nacht, ändern. Nach dieser Nacht wird er den Männern, die an Achills Seite gekämpft haben, in die Augen schauen und nichts erblicken als Respekt – Respekt vor dem, was er in Troja erreicht hat. Natürlich wird er nicht damit prahlen, wahrscheinlich wird er es nicht einmal erwähnen, das wird nicht notwendig sein, denn jeder wird Bescheid wissen. Das ist immer so. Er merkt, wie die Männer ihn manchmal anblicken und an ihm zweifeln. Aber nach dieser Nacht nicht mehr. Heute Nacht wird er …
Du liebe Zeit, er muss scheißen. Er setzt sich aufrechter hin und versucht, die Schmerzen im Darm zu ignorieren. Als sie in das Pferd geklettert waren, hatte es eine Menge Witze darüber gegeben, wohin man die Latrineneimer stellen sollte. »Ans Ende, wo der Arsch ist«, sagte Odysseus, »wohin sonst!« Es hatte großes Gelächter auf Kosten derer gegeben, die hinten im Pferd saßen.
Niemand hat die Eimer bisher benutzt, und er will auf keinen Fall der Erste sein. Alle werden sich die Nase zuhalten und sich mit den Händen Luft zufächeln. Es ist nicht fair, es ist einfach nicht fair. Er sollte lieber an wichtige Dinge denken, daran, dass der Krieg für ihn heute Nacht ruhmreich zu Ende gehen wird. Jahrelang hat er sich darauf vorbereitet; seit er alt genug gewesen ist, um ein Schwert zu heben. Sogar früher schon, als er fünf oder sechs war, hat er mit angespitzten Stöcken gekämpft. Es gab keinen Augenblick, in dem er nicht gekämpft hätte, und er schlug mit den Fäusten auf seine Amme ein, wenn sie ihn zu beruhigen versuchte. Und nun geschieht es tatsächlich, es passiert endlich alles wirklich – und alles, woran er denken kann, ist: Und wenn ich mir in die Hosen scheiße?
Der Druck scheint ein wenig abzuklingen. Vielleicht geht ja alles gut.
Draußen ist es sehr still geworden. Seit Tagen hat Lärm geherrscht: Die Schiffe wurden beladen, die Männer sangen, es wurden Trommeln geschlagen, Schwirrhölzer sirrten, die Priester stimmten Sprechchöre an – und das alles so laut wie möglich, denn die Trojaner sollten es hören. Sie mussten glauben, die Griechen würden tatsächlich abziehen. Es durfte nichts in den Hütten zurückbleiben, denn als Erstes würden sie Späher zum Strand aussenden, um zu überprüfen, ob die Griechen das Feldlager tatsächlich aufgegeben hatten. Es reichte nicht, nur die Männer und die Waffen abzuziehen. Frauen, Pferde, Möbel, Vieh – alles musste fort sein.
Im Pferd wird nun ein unbehagliches Murmeln laut. Die Stille gefällt ihnen nicht. Es fühlt sich an, als hätte man sie verraten und aufgegeben. Pyrrhos verdreht sich auf der Bank und späht durch einen Spalt zwischen zwei Holzplanken, aber er kann nichts erkennen. »Was zum Henker ist da los?«, fragt jemand. »Keine Sorge«, antwortet Odysseus, »die kommen wieder.« Und tatsächlich hören sie nur Minuten später Schritte vom Strand herauf auf sie zukommen, gefolgt von einem Ruf: »Alles klar da drinnen?« Ein Knurren als Antwort. Dann, es scheint, als wären Stunden vergangen, obwohl es wahrscheinlich nur Minuten sind, bewegt sich das Pferd mit einem Ruck. Sofort hebt Odysseus die Hand, und eines nach dem anderen erlöschen die Wachslichter.
Pyrrhos schließt die Augen und stellt sich die verschwitzten Rücken der Männer da draußen vor, wie sie sich vornübergebeugt abmühen, dieses Monster von einem Pferd über den zerfurchten Boden nach Troja zu ziehen. Sie haben Gleitrollen als Hilfsmittel, aber trotzdem dauert es lange – das Land ist vernarbt und gezeichnet von zehn langen Jahren des Krieges. Die Männer im Pferd wissen, dass sie sich der Stadt nähern, als die Priester einen Lobgesang auf Athene anstimmen, die Schutzgöttin der Städte. Die Schutzgöttin der Städte? Soll das ein Witz sein? Man kann verdammt noch mal nur hoffen, dass sie diese Stadt nicht beschützt! Endlich hat das Schlingern ein Ende. Die Männer im Bauch des Pferdes wenden sich einander zu und schauen sich an, ihre Gesichter sind im schwachen Licht nur als helle Flecken erkennbar. Ist es so weit? Sind sie da? Eine weitere Lobeshymne auf Athene, und dann, nach drei abschließenden Rufen zur Ehre der Göttin, wenden die Männer, die das Pferd vor die Tore von Troja gezogen haben, sich zum Gehen.
Ihre Stimmen, die noch immer Gesänge und Gebete anstimmen, verklingen in der Ferne, und es wird still. Jemand flüstert: »Und nun?« Und Odysseus sagt: »Wir warten.«
Ein Trinkschlauch aus Ziegenleder mit verdünntem Wein darin wird von einer Hand zur anderen gereicht, doch sie wagen es höchstens, die Lippen zu benetzen. Die Eimer sind bereits zu mehr als zwei Drittel voll, und wie Odysseus spöttisch angemerkt hatte: Ein hölzernes Pferd, das anfängt zu pissen, könnte Verdacht erregen. Es ist heiß hier drin; es riecht nach dem Harz frisch gefällter Kiefernstämme – und nach und nach geschieht etwas sehr Merkwürdiges, denn er schmeckt das Harz und riecht die Hitze. Das Innere seiner Nasenlöcher scheint versengt. Und er ist nicht der Einzige, der leidet. Machaon ist schweißüberströmt – er wiegt sehr viel mehr als die jüngeren Männer, die so mager sind wie die verwilderten Hunde, die jetzt sicher an den Türen der leeren Hütten herumschnüffeln und sich fragen, wohin die Menschen wohl verschwunden sein mögen. Pyrrhos versucht, sich das Lager verlassen vorzustellen. Zehn Tage nach dem Tod seines Vaters ist er zum ersten Mal in die Halle gekommen, er hat sich auf den Stuhl des Achill gesetzt, die Hände auf die geschnitzten Köpfe der Berglöwen gelegt und die Fingerspitzen gegen ihre knurrenden Mäuler gedrückt, wie Achill es jeden Abend getan haben muss – und die ganze Zeit kam er sich vor wie ein Hochstapler oder wie ein kleiner Junge, dem man gestattet hat, lange aufzubleiben. Hätte er nach unten geschaut, würden seine Füße sicher ein ganzes Stück über dem Boden gebaumelt haben.
Morgen früh ist er vielleicht schon tot, aber es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken. Der Schicksalstag eines Mannes kommt, wann immer er kommt, und man kann nichts tun, um den Moment hinauszuzögern. Er schaut die Reihe der Gesichter entlang und sieht seine eigene Anspannung in jedem einzelnen von ihnen gespiegelt. Selbst Odysseus knabbert jetzt an seinem Daumennagel. Die Trojaner müssen mittlerweile wissen, dass die Schiffe davongesegelt sind, dass das Lager der Griechen tatsächlich verlassen ist – aber möglicherweise misstrauen sie der Sache ja? Priamos ist ein alter Fuchs, er herrscht seit fünfzig Jahren über Troja und fällt auf eine solche List nicht herein. Das Pferd ist eine Falle, eine geniale Falle – ja, aber wer täuscht hier wen?
Odysseus hebt den Kopf und lauscht, und einen Augenblick später hören sie es alle: das Gemurmel trojanischer Stimmen, neugierig und nervös. Was ist das? Warum steht es hier? Haben die Griechen tatsächlich aufgegeben, die Heimfahrt angetreten und den Trojanern dieses komische Geschenk dagelassen? »Merkwürdig nutzlos«, sagt jemand. »Wie kannst du sagen, es sei nutzlos, wenn du nicht weißt, wozu es dient?!«, ruft ein anderer. »Wir wissen vielleicht nicht, wozu es dient, aber eines wissen wir: Den verdammten Griechen kann man nicht trauen!« Zustimmende Rufe. »Und überhaupt, woher wissen wir denn, ob es leer ist? Woher wissen wir, dass da niemand drin ist?« Die Stimmen ändern sich – jetzt hört man keinen Argwohn mehr, sondern Angst. »Zündet es an!« – »Ja, los, legt Feuer an das Scheißding und brennt es nieder. Dann merken wir ganz schnell, ob jemand drin sitzt!« Der Plan findet Anklang. Bald rufen sie alle im Chor: »Feuer dran! Feuer dran! Feuer dran!« Pyrrhos blickt sich um und sieht Furcht in den Gesichtern. Nein, mehr als Furcht – Todesangst. Das hier sind tapfere Männer, die besten des gesamten griechischen Heeres, aber wer behauptet, er hätte keine Angst vor Feuer, ist entweder ein Lügner oder ein Dummkopf.
FEUER DRAN! FEUER DRAN! FEUER DRAN!
Ein hölzernes Gehäuse, vollgestopft mit Männern, wird in Flammen aufgehen wie ein Scheiterhaufen, der mit Schweine - schwarten gespickt ist. Und was werden die Trojaner tun, wenn sie Schreie hören? Losrennen und Wassereimer ranschleppen? Den Teufel werden sie tun: Sie werden dabeistehen und lachen. Wenn das restliche Griechenheer zurückkehrt, wird es nur noch verkohltes Holz und die Überreste verbrannter Männer vorfinden, die erhobenen Fäuste geballt wie Faustkämpfer, in der üblichen Haltung von Menschen, die im Feuer umkommen. Und über ihnen auf den Mauern die Trojaner. Er ist kein Feigling, wirklich nicht, er ist in dieses verdammte Pferd gestiegen und ist auf den Tod vorbereitet, aber er wird auf gar keinen Fall sterben wie ein Schwein, das am Spieß gebraten wird. Besser jetzt heraussteigen und kämpfen …
Er hat sich schon halb erhoben, als zwischen den Köpfen zweier Männer die Spitze eines Speers erscheint. Ihre Gesichter sind ausdruckslos vor Schreck. Sofort beginnen alle, sich tiefer in den Pferdeleib zu drücken, lautlos, und doch so weit weg von den Außenseiten, wie sie nur können. Draußen schreit eine Frau mit lauter Stimme: »Das ist eine Falle, begreift ihr denn nicht, dass es eine Falle ist?« Dann ertönt eine andere Stimme, die eines Mannes, alt, aber nicht schwach, und von großer Autorität. Das kann nur Priamos sein. »Kassandra«, sagt er. »Geh zurück nach Hause, komm schon, geh heim.«
Die Männer im Pferd wenden sich Odysseus zu und starren ihn anklagend an. Es ist sein Plan, aber er zuckt nur mit den Achseln und hebt die Hände. Hilflos? Beruhigend?
Wieder laute Rufe. Die Wachen haben jemanden aufgegriffen. Sie zerren ihn vor Priamos und zwingen ihn auf die Knie. Und dann schließlich – endlich! – beginnt Sinon zu sprechen. Erst zittert ihm die Stimme, aber sie wird kräftiger, als er sich in seine Erzählung stürzt. Pyrrhos schaut zu Odysseus hinüber und stellt fest, dass dessen Lippen sich im Gleichtakt mit Sinons Worten bewegen. Er hat ihn in den letzten drei Wochen auf diesen Moment vorbereitet, die beiden sind Stunde um Stunde ohne Pause auf dem Sandplatz auf und ab gelaufen, haben alles geprobt und versucht, jede Frage vorwegzunehmen, die die Trojaner nur stellen könnten.
Jede kleine Einzelheit ist so überzeugend wie nur irgend möglich: Die Griechen glauben, die Götter hätten ihnen ihre Gunst entzogen – insbesondere Athene, die sie schwer erzürnt haben. Das Pferd ist eine Weihegabe und muss sofort zum Tempel der Athene gebracht werden. Aber nicht die Einzelheiten sind von Belang. Alles hängt davon ab, ob Odysseus den Charakter des Priamos richtig gedeutet hat. Als kleiner Junge, mit nicht einmal sieben Jahren, ist Priamos in einem Krieg gefangen genommen und als Geisel festgehalten worden. Ganz allein, ohne Freunde, gezwungen, sein Leben in einem fremden Land zu verbringen, hat er sich an die Götter gewandt, damit sie ihm Trost spendeten – insbesondere an Zeus, an Zeus Xenios, der Freundlichkeit gegenüber Fremden gebietet. Unter der Herrschaft des Priamos ist Troja stets bereit gewesen, Menschen aufzunehmen, deren Landsleute sich gegen sie gewandt hatten. Die von Odysseus erdachte Geschichte zielt darauf ab, Eindruck auf Priamos zu machen, jede Nebensächlichkeit ist so entworfen, dass sie sich sein Vertrauen zunutze macht und es in Schwäche ummünzt. Und wenn dieser Plan nicht aufgeht, ist es auf keinen Fall die Schuld von Sinon, denn der bietet sein gesamtes schauspielerisches Können auf. Sein großes Wehklagen über sein Elend klingt zum Himmel hinauf. »Bitte«, wiederholt er stets aufs Neue, »bitte, bitte, habt Erbarmen mit mir, ich wage es nicht, in die Heimat zurückzukehren, sie werden mich umbringen, wenn ich nach Hause zurückgehe, weil ich geflohen bin, als sie mich der Göttin opfern wollten.«
»Lasst ihn los«, sagt Priamos. Und dann wendet er sich wahrscheinlich direkt an Sinon: »Willkommen in Troja.«
Kurze Zeit später hört man das Poltern von Seilen, die als Lassos um den Hals des Pferdes geworfen werden, und es setzt sich in Bewegung. Nach wenigen Schritten kommt es mit einem Ruck wieder zum Stehen, bleibt einige quälende Minuten lang festgefahren, schlingert dann weiter voran. Pyrrhos späht durch eine Lücke zwischen den Planken, und die Nachtluft trifft unerwartet kalt auf seine Augenlider – aber er sieht nur eine steinerne Mauer. Doch das reicht. Er weiß nun, dass sie das Skäische Tor passieren, hinein nach Troja. Sie blicken einander mit aufgerissenen Augen an. Es herrscht Schweigen. Draußen singen die Trojaner, Männer, Frauen und Kinder, Lobeshymnen auf Athene, die Schutzgöttin der Städte, während sie das Pferd durch die Stadttore ziehen. Sie hören das aufgeregte Gerede der kleinen Jungen, die ihren Vätern »helfen«, mit aller Kraft an den Seilen zu ziehen.
Unterdessen widerfährt Pyrrhos etwas Seltsames. Vielleicht ist es nur der Durst oder die Hitze, die inzwischen schlimmer sind als je zuvor, aber er scheint das Pferd von außen betrachten zu können. Er sieht, wie der Pferdekopf auf gleicher Höhe mit den Dächern des Palastes und der Tempel ist, er sieht das Pferd, wie es langsam durch die Straßen gezogen wird. Ein merkwürdiges Gefühl, im Dunklen eingepfercht zu sein und doch die breiten Straßen und offenen Plätze sehen zu können, die Menge der aufgeregten Trojaner, die sich um die Beine des Pferdes drängen. Der Boden ist schwarz von Menschen. Sie sind wie Ameisen, die eine Insektenpuppe gefunden haben, groß genug, um ihre Nachkommenschaft wochenlang zu ernähren, und sie im Triumph zurück in den Ameisenhügel schleppen, ohne zu ahnen, dass die harte, glänzende Puppe, wenn sie erst aufplatzt, ihnen allen den Tod bringen wird.
Endlich nimmt das Torkeln und Schwanken ein Ende. Allen im Pferd ist es übel. Weitere Gebete und Lobgesänge; die Trojaner drängen sich in den Tempel der Athene, um der Göttin für den Sieg zu danken. Und dann beginnen die Feierlichkeiten: mit Gesang, Tanz und immer mehr berauschenden Getränken. Die griechischen Krieger lauschen und warten. Pyrrhos versucht, seine Beine auszustrecken. Er hat einen Krampf in der rechten Wade, weil er Durst hat und vom ewigen Sitzen in der gleichen verkrampften Haltung. Bald herrscht noch tieferes Dunkel, kein Lichtstrahl dringt durch die Ritzen des Pferdes, denn sie haben für den Angriff eine mondlose Nacht ausgewählt. Ab und zu wankt eine Gruppe betrunkener Zecher vorbei, und ihre lodernden Fackeln werfen Tigerstreifen auf die Gesichter der Männer, die drinnen warten. Das Licht funkelt auf Helmen und Brustpanzern und auf den Klingen ihrer gezückten Schwerter. Und noch immer warten sie. Draußen in der Dunkelheit, weit entfernt, pflügen die griechischen Schiffe, schwarz und mit schnabelförmigem Bug, eines am anderen, weiße Furchen in das graue wogende Meer. Die griechische Flotte kehrt zurück. Er stellt sich vor, wie die Schiffe in die Bucht einfahren, die Segel einholen, wie die Ruderer übernehmen, dann das Kratzen der Kiele auf dem Kiesstrand, als sie sicher am Strand anlanden.
Gesang und Geschrei sind erstorben. Die letzten Betrunkenen sind nach Hause gekrochen oder liegen bewusstlos in der Gosse. Und die Wachen des Priamos? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie nüchtern geblieben sind, nun, da der Krieg vorüber ist? Nun, da sie zu wissen glauben, dass sie gesiegt haben? Nun, da niemand mehr da ist, gegen den sie kämpfen müssten?
Endlich, auf ein Kopfnicken des Odysseus hin, öffnen vier Krieger am hinteren Ende die Riegel und entfernen zwei Teile der Seitenwand. Kühle Nachtluft dringt herein. Pyrrhos spürt ein Kribbeln auf der Haut, als der Schweiß verdampft. Und dann beginnen die Männer, einer nach dem anderen, in einem gleichmäßigen Strom, die Strickleitern hinabzuklettern. Zunächst gibt es Gedränge, weil jeder die Ehre haben möchte, das Pferd als Erster zu verlassen. Pyrrhos ist das gleich. Er ist unter den Ersten, das reicht ihm. Als seine Füße hart auf dem Boden landen, spürt er den Stoß die ganze Wirbelsäule hinauf. Die Männer stampfen mit den Füßen und versuchen, ihre Durchblutung wieder in Gang zu bringen, denn es kann sein, dass sie nun jeden Moment losrennen müssen. Er greift sich eine Fackel von einem Leuchter an der Tempelwand. Im grellen roten Licht dreht er sich zurück zum Pferd und sieht, wie die letzten Krieger sich schwer zu Boden fallen lassen. Das Pferd scheißt Männer. Als alle draußen sind, wenden sie sich einander zu und blicken sich an. Auf allen Gesichtern liegt der gleiche halb wache Ausdruck. Sie sindin der Stadt. Langsam wird ihm dieser Gedanke bewusst, in einer unaufhaltsamen Woge durchströmt er ihn. In diesem Augenblick steht er dort, wo sein Vater nie gestanden hat: innerhalb des Mauerrings von Troja. Jetzt kennt er keine Furcht mehr. Alles ist leicht und eindeutig. Dort drüben in der Dunkelheit sind die Stadttore, die sie öffnen müssen, um das griechische Heer einzulassen. Pyrrhos packt den Griff seines Schwertes fester und rennt los.
2
Eine Stunde später steht er mitten im Kampfgewühl auf den Stufen zum Palast. Er reißt einem Sterbenden die Streitaxt aus der Hand und beginnt, auf das Tor einzuschlagen. Der Druck der Kämpfenden, die hinter ihm die Stufen hinaufdrängen, macht es schwierig, vernünftig auszuholen. Er schreit sie an, sie sollen ihm Platz machen, sie sollen zurückgehen, und bald hat er ein Loch ins Tor des Palastes geschlagen, gerade breit genug, um hindurchzuschlüpfen. Und danach geht es leicht, es ist alles ganz einfach. Während er die Flure entlangrennt, spürt er, wie das Blut seines Vaters in seinen Adern pocht, und er stößt einen Triumphschrei aus.
Am Eingang zum Thronsaal stehen die trojanischen Wachen dicht gedrängt, die ersten griechischen Krieger stürzen sich auf sie, doch er wendet sich nach rechts und hält Ausschau nach dem geheimen Durchgang, der von Hektors Flügel, wo seine Witwe Andromache nun allein mit ihrem Sohn lebt, zu den Privatgemächern des Priamos führt. Dieses Wissen hat Odysseus dem gefangenen Prinzen unter der Folter abgepresst. Und da ist sie; eine Tür, halb verborgen hinter einem Wandschirm, führt ihn in einen schwach beleuchteten Durchgang, der steil nach unten abfällt. Hier ist es kühl, es riecht muffig, der Geruch von Räumen, die nicht genutzt werden. Dann führt eine Treppe hinauf in das helle Licht des Saals, wo Priamos auf den Stufen eines Altars steht, unbeweglich, voller Erwartung, als hätte er sich sein ganzes Leben lang auf diesen Moment vorbereitet. Sie sind allein. Der Lärm der kämpfenden Griechen und Trojaner auf der anderen Seite der Mauer dringt kaum zu ihnen durch.
Schweigend starren sie einander an. Priamos ist alt, furchtbar alt, und so gebrechlich, dass seine Rüstung ihn niederdrückt. Pyrrhos räuspert sich, ein merkwürdiger, entschuldigender Laut in der gewaltigen Stille. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein, und er weiß nicht, was er tun soll, damit sie wieder anläuft. Er tritt näher zu den Stufen des Altars und verkündet seinen Namen, wie es sich gehört, bevor man kämpft: »Ich bin Pyrrhos, der Sohn des Achill.« Unglaublich und unverzeihlich: Priamos lächelt und schüttelt den Kopf. Pyrrhos, nun voller Zorn, betritt die unterste Stufe und sieht, wie Priamos sich wappnet, doch als der alte Mann endlich seinen Speer wirft, durchschlägt er den Schild nicht, hängt nur einen Augenblick zitternd daran, dann fällt er zu Boden. Pyrrhos bricht in Gelächter aus, und der Klang seines Lachens wirkt befreiend. Er springt die Stufen empor, packt Priamos bei den Haaren, biegt seinen Kopf nach hinten, um die dürre Kehle freizulegen, und …
Und nichts …
Die ganze letzte Stunde hat er in einem geradezu rauschhaften Zustand erlebt, seine Füße haben den Boden kaum berührt, die Kraft ist vom Himmel in ihn hineingeströmt – aber jetzt, wo er diese Kraft am dringendsten brauchte, spürt er, wie sie aus seinen Gliedern weicht. Er hebt den Arm, doch sein Schwert ist schwer, sehr schwer. Priamos erfasst die Schwäche, er entwindet sich seinem Griff und versucht zu fliehen, doch er strauchelt und stürzt kopfüber die Stufen hinunter. Sofort ist Pyrrhos über ihm, packt die Mähne des silbernen Haares, und nun ist es so weit, jetzt, jetzt, aber das Haar ist unerwartet weich, fast wie Frauenhaar, und diese winzige, unbedeutende Nebensächlichkeit reicht aus, um ihn aus der Fassung zu bringen. Er zielt auf die Kehle des alten Mannes und verfehlt sie – dumm, wie dumm –, er ist wie ein Junge von zehn Jahren, der versucht, sein erstes Schwein abzustechen. Er hackt wild drauflos, Schnitt um Schnitt, Stoß um Stoß, keiner ist tief genug, um zu töten. Mit seinem weißen Haar und der blassen Haut sieht Priamos aus, als hätte er nicht einen Tropfen Blut in sich. Doch das hat er, sogar Unmengen von Blut, er glitscht und schlittert über den Boden. Endlich bekommt Pyrrhos den alten Mistkerl zu fassen, kniet sich auf seine knochige Brust – und selbst jetzt bringt er es nicht fertig und stöhnt verzweifelt auf: »Achill! Vater!« Und unfassbar: Priamos blickt ihn an und lächelt erneut. »Der Sohn des Achill?«, sagt er. »Du? Du bist kein bisschen wie er.«
Ein Schleier roter Wut verleiht Pyrrhos die Kraft, erneut zuzustoßen, diesmal mitten hinein in den Hals. Heißes Blut schießt in pulsierenden Strömen über seine geballte Faust. Das war’s. Es ist vorbei. Er lässt den Leichnam zu Boden gleiten. Irgendwo, ziemlich nahe, schreit eine Frau. Verblüfft schaut er sich um und sieht eine Gruppe Frauen, einige mit Babys im Arm, hinter dem Altar kauern. Trunken vor Triumph und Erleichterung rennt er mit ausgebreiteten Armen auf sie zu, schreit »Buh!« – und lacht, als sie sich verängstigt noch enger aneinanderdrängen.
Doch ein Mädchen erhebt sich und starrt ihn an. Sie hat vorstehende Augen, ein Froschgesicht. Wie kann sie es wagen, ihn anzuschauen! Einen Augenblick lang ist er versucht, auf sie einzuschlagen, doch er nimmt sich rechtzeitig zurück. Man erringt keinen Ruhm, wenn man eine Frau tötet, außerdem ist er müde; müder, als er je im Leben gewesen ist. Sein rechter Arm hängt von der Schulter herab, leblos wie ein Spaten. Das Blut des Priamos trocknet bereits auf seiner Haut und zieht sie zusammen. Es stinkt, der Geruch von Eisen, der an Fisch erinnert. Einen Augenblick steht er da und schaut auf den Leichnam hinab, und aus einem Impuls heraus tritt er dagegen. Kein Begräbnis für Priamos, beschließt er. Keine Ehren, keine Bestattungsriten, keine Würde im Tod. Er wird genau das tun, was sein Vater mit Hektor gemacht hat: die dürren Fußknöchel des alten Mannes an die Radachse seines Streitwagens binden und ihn ins griechische Lager zurückschleifen. Doch zuerst muss er das Geschrei und Schluchzen hinter sich lassen, und so stolpert er blindlings durch eine Tür zu seiner Rechten.
Dunkel ist es hier, kühl und ruhig. Die Schreie der Frauen sind schwächer zu hören. Als sich seine Augen an das Dunkel gewöhnen, sieht er eine Ablage für zeremonielle Kleidung, daneben einen Lehnstuhl, Gewänder über die Rückenlehne drapiert. Hier hat sich Priamos offenbar für die Zeremonien zu Ehren des Zeus umgekleidet.
Er steht unter der Tür und lauscht, er spürt, wie das Zimmer vor ihm zurückweicht, genau wie die Frauen. Alles ist still und leer. Aber dann fällt ihm plötzlich in der hinteren Ecke eine Bewegung auf. Jemand versteckt sich dort drüben im Schatten, er kann gerade eben die Umrisse einer Gestalt ausmachen. Eine Frau? Nein, von dem flüchtigen Eindruck her, den er gewonnen hat, ist er beinahe sicher: Es ist ein Mann. Er schiebt die Kleiderablage beiseite und tastet sich langsam voran – und dann lacht er beinahe laut auf vor Freude und Erleichterung, denn dort, direkt vor ihm, steht Achill. Es kann niemand anders sein: die funkelnde Rüstung, das wallende Haar – das ist ein Zeichen, das Zeichen, dass er endlich anerkannt ist. Selbstbewusst tritt er vor, späht in die Dunkelheit und sieht Achill auf sich zukommen, blutbedeckt; alles ist rot, von seinem federbesetzten Helm bis zu den Füßen, die in Sandalen stecken. Auch das Haar ist rot, nicht orange oder karottenfarben, nein, es ist rot wie Blut oder Feuer. Im letzten Augenblick, als sie sich Auge in Auge gegenüberstehen, streckt er die Hand aus, und seine blutverklebten Finger treffen auf etwas Hartes, Kaltes.
Ganz nah ist er jetzt, fast nahe genug, dass sie einander küssen könnten. »Vater«, sagt er und durch seinen Atem beschlägt die glänzende Bronzeoberfläche des Spiegels. »Vater.« Und noch einmal, weniger selbstbewusst diesmal: »Vater?«
3
Wir fahren,
wir fahren,
wir fahren endlich heim!
Ich zählte schon nicht mehr mit, wie oft ich dieses Lied in den letzten paar Tagen gehört hatte – falls man es überhaupt ein Lied nennen kann. Männer taumelten in kleinen Gruppen durch das Lager, betrunken, mit schlaffen Mündern und ausdruckslosem Blick, und brüllten die einfachen, sich stets wiederholenden Worte heraus, bis sie heiser waren. Die Disziplin war beinahe vollkommen dahin. Im ganzen Lager kämpften die Könige darum, ihre Männer wieder unter Kontrolle zu bekommen.
Als ich eines Morgens über den Versammlungsplatz ging, hörte ich Odysseus rufen: »Wenn ihr dieses verdammte Schiff nicht beladet, fahrt ihr nirgendwohin!« Er stand vor seiner Halle auf den Stufen der Veranda und trat einer Gruppe von vielleicht zwanzig oder dreißig Männern gegenüber. Es war bezeichnend für die allgemeine Stimmung, dass er selbst hier, auf seinem eigenen Gelände, einen Speer dabeihatte. Die meisten Sänger schlichen davon, aber dann drang eine Stimme aus der Menge: »Und was ist mit dir, du verdammter Mistkerl? Dich seh ich ja nicht grad viel schleppen.«
Thersites natürlich, wer sonst? Er war nicht vorgetreten, die anderen waren vielmehr zurückgetreten. Odysseus ging sofort auf ihn los. Er benutzte das stumpfe Ende seines Speeres als Schlagstock und versetzte Thersites mehrere Hiebe auf Arme und Schultern. Als er gekrümmt und stöhnend am Boden lag, gab er ihm noch ein paar Schläge in die Rippen und trat ihn zum Schluss in den Unterleib.
Thersites hielt sich die Eier und warf sich von einer Seite auf die andere, während sich die Männer um ihn versammelten und vor Lachen brüllten. Er war ein Großmaul und bekannt dafür, dass er Ärger machte. Wenn es Arbeit zu verteilen gab, fand man Thersites immer weit hinten in der Schlange. Es mochte für die Männer eine willkommene Unterhaltung bedeuten, wenn er die Autoritäten herausforderte, aber beliebt und respektiert war dieser Mann nicht. Also ließen sie ihn liegen und gingen weg, vielleicht, um das Schiff zu beladen, aber wahrscheinlich eher, um Nachschub an Alkohol zu suchen, denn die Trinkschläuche aus Ziegenleder, die sie über die Schultern geschlungen hatten, schienen leer zu sein. Schon nach wenigen Schritten fingen sie wieder an zu singen, doch mit jeder weiteren Wiederholung wirkte das Lied eher wie ein Trauergesang.
Wir fahren,
wir fahren,
wir fahren endlich heim!
In Wahrheit fuhr niemand heim. Niemand fuhr irgendwohin. Noch vier Tage zuvor hatte die Abreise bloß eine Stunde bevorgestanden – ein paar Könige, darunter auch Odysseus, waren bereits an Bord ihrer Schiffe gewesen –, doch dann hatte der Wind sich plötzlich gedreht und blies seitdem vom Meer her, beinahe so stark wie ein Sturm. Nur ein Wahnsinniger hätte bei diesem Wind den Schutz der Bucht verlassen. »Keine Sorge«, sagten alle, »das legt sich bald.« Aber der Wind legte sich nicht. Tag für Tag, Stunde für Stunde wehte dieser ungewöhnliche Wind, und so saßen sie alle hier fest: die siegreichen griechischen Krieger und mit ihnen natürlich die gefangenen trojanischen Frauen.
Ich beugte mich über Thersites und bemühte mich, nicht vor dem Gestank zurückzuschrecken, der aus seinem offenen Mund drang. Es tat mir leid, dass ich schlecht von einem Mann dachte, der Odysseus gerade einen verdammten Mistkerl genannt und ihm das mitten ins Gesicht gesagt hatte, aber an Thersites gab es wirklich nicht viel zu mögen. Doch er lag verletzt da, und ich war unterwegs zum Krankenzelt, also schob ich die Hand unter seinen Arm und half ihm beim Aufstehen. Einen Augenblick stand er zusammengekrümmt vor Schmerzen da, die Hände auf den Knien, dann hob er langsam den Kopf. »Ich kenn dich doch«, sagte er. »Briseis, oder?« Er wischte sich mit dem Handrücken über die blutige Nase. »Die Hure von Achill.«
»Die Gattin von Herrn Alkimos.«
»Ja gut, aber was ist mit dem Balg, das du kriegst? Was hält Herr Alkimos wohl davon? Den Bastard von ’nem anderen Mann großziehen?«
Ich wandte mich ab, und während ich fortging, war mir die ganze Zeit bewusst, dass Amina hinter mir war und mir folgte. Kannte sie die Vorgeschichte meiner Hochzeit? Nun, wenn sie sie zuvor nicht gekannt hatte, kannte sie sie spätestens jetzt.
Ein paar Tage vor seinem Tod hatte Achill mich mit Alkimos vermählt und mir erklärt, Alkimos habe geschworen, sich um das Kind zu kümmern, das ich erwartete. Bis zum Morgen der Hochzeit hatte ich nichts von diesen Plänen gewusst. Ich wurde aus Achills Bett gezerrt – ein mit Samen beschmiertes Laken um die Schultern, Brotkrümel im Haar, mir war übel, ich roch nach Sex – und mit Alkimos vermählt. Eine merkwürdige Hochzeit, aber vollkommen rechtskräftig, mit einem Priester, der die Gebete sprach und unsere Hände mit dem scharlachroten Band umschloss. Und Ehre, wem Ehre gebührt – Alkimos hatte sein Wort gehalten. Erst heute Morgen hatte er darauf bestanden, ich müsse eine Frau zur Begleitung mitnehmen, wenn ich das Gelände von Pyrrhos verließ. »Es ist hier im Lager nicht mehr sicher«, hatte er gesagt. »Du musst jemanden dabeihaben.«
Das Ergebnis war dieses Mädchen, Amina.
Wir gaben eine lächerliche kleine Prozession ab, ich als achtbare, verheiratete Frau, stark verschleiert, und Amina, die ein paar Schritte hinter mir hertrottete. Natürlich war das alles Unsinn. Was mich vor den betrunkenen Banden schützte, die im Lager herumzogen, war nicht die Anwesenheit eines halbwüchsigen Mädchens, sondern der Schwertarm des Alkimos. Genau wie es einst, vor nicht einmal fünf Monaten, der Schwertarm des Achill gewesen war. Das Einzige, was in diesem Heerlager zählte, wirklich das Einzige, war Macht – und zwar die Macht, jemanden zu töten.
Normalerweise fand ich Gefallen an einem Spaziergang an der Küste, aber nicht heute. Der Wind schien zu einer heißen, feuchten Hand geworden zu sein, die einen vom Meer wegschob und sagte: Nein, da kannst du nicht hingehen. Die Luft war schwer – aber bisher hatte es noch nicht geregnet, obwohl eine ambossförmige Wolke hoch aufgetürmt in den Himmel über der Bucht ragte. Nachts konnte man tief in ihrer Mitte Blitze zucken sehen, alles deutete darauf hin, dass in Kürze ein Sturm losbrechen würde, und doch kam er nicht. Das Licht, ein merkwürdiges Rotbraun, verlieh der Haut einen Bronzeton, bis Gesichter und Hände der Männer aus dem gleichen harten, unnachgiebigem Material zu sein schienen wie ihre Schwerter.
Hinter den Feierlichkeiten – Besäufnisse, Festessen, Tanz – spürte ich Besorgnis und Unsicherheit. Der Wind begann an den Nerven zu zerren, wie ein quengelndes Baby, das einfach nicht schlafen will. Selbst nachts, wenn alle Türen geschlossen und verriegelt waren, konnte man dem Wind nicht entgehen. Die Böen drangen durch jede Ritze, hoben Teppiche an, bliesen Kerzen aus und verfolgten einen auf dem Weg ins Schlafzimmer und selbst noch bis in den Schlaf. Mitten in der Nacht lag man wach und starrte an die Decke. Alle Fragen, denen man tagsüber hatte ausweichen können, versammelten sich nun hier.
Was hält Herr Alkimos wohl davon? Den Bastard von ’nem anderen Mann großziehen?
Über meine Schwangerschaft wusste mittlerweile jeder Bescheid. Die Veränderung schien unmerklich vor sich gegangen zu sein, ganz so, wie die Nächte länger werden. Kein Abend scheint anders zu sein als der vorherige, bis plötzlich das Gefühl von Kälte in der Luft liegt und man weiß: Es ist Herbst. Das Verhalten der Männer mir gegenüber hatte sich verändert, während mein Bauch dicker wurde, und das erschwerte es mir, mit meinen Gefühlen für das ungeborene Kind umzugehen. Das Kind des Achill. Der Sohn des Achill, wenn man den Myrmidonen Glauben schenken wollte, die anscheinend in meinen Schoß blicken konnten. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich trüge gar kein Baby in mir, sondern eine verkleinerte Ausgabe von Achill selbst, einen Homunkulus, doch immer noch unverkennbar Achill, und in voller Rüstung.
Als wir uns dem Tor von Agamemnons Gelände näherten, schaute ich zu Boden und betrachtete die Bewegung meiner Füße unter dem Saum meiner Tunika, wie sie verschwanden und wieder erschienen: herein, heraus; herein, heraus. An diesem Ort war ich so unglücklich gewesen; ich fürchtete mich immer, hierher zurückzukehren, rief mir aber in Erinnerung, dass die Schande, eine Sklavin in den Hütten des Agamemnon, im Bett des Agamemnon gewesen zu sein, der Vergangenheit angehörte. Ich war jetzt frei; und so hob ich, nachdem wir das Tor durchschritten hatten, den Kopf und blickte mich um.
Wir standen auf dem Hauptplatz des Geländes. Als ich hier gelebt hatte, war dies der Übungsplatz gewesen, wo die Männer Aufstellung nahmen, bevor sie in den Krieg zogen. Nun stand hier ein Krankenzelt. Man hatte es von seiner ursprünglichen, ungeschützten Lage am Strand hierher versetzt. In seiner neuen Umgebung sah das Zelt noch schäbiger aus als zuvor. Die Leinwand war mit grünen Flecken übersät und roch faulig von der langen Einlagerung im Laderaum eines Schiffes. Es war eines der Zelte, in denen die Griechen in den ersten Monaten des Krieges gelebt hatten, als sie noch hochmütig genug gewesen waren zu glauben, Troja würde leicht zu besiegen sein. Nach dem ersten erbärmlichen Winter in ihren Zelten hatten sie einen ganzen Wald gefällt, um sich Hütten zu bauen.
Ich ging geduckt unter der offenen Zeltklappe hindurch und blieb einen Augenblick stehen, während meine Augen sich an das grüne Zwielicht gewöhnten. Ich dachte, ich hätte mittlerweile jedes Geräusch gehört, das der Wind hervorbringen konnte, doch das Brüllen der Leinwand war neu. Die Gerüche jedoch waren die gleichen – aus einem Korb voller gebrauchter Verbände roch es nach geronnenem Blut, und es duftete intensiv nach frischen Kräutern: Thymian, Rosmarin, Lavendel und Lorbeer. Als ich die Männer noch gepflegt hatte, hatte es so viele Patienten gegeben, dass man über den einen hatte hinwegsteigen müssen, um zum nächsten zu gelangen. Jetzt war das Zelt fast leer, es standen nur zwei Reihen von fünf oder sechs Pritschen aus Rindsleder da. Die Männer, die darin lagen, schliefen größtenteils, außer zweien am hinteren Ende, die in ein Würfelspiel vertieft waren. Diese Männer waren beim letzten Angriff auf Troja verwundet worden. Keiner von ihnen schien schwer verletzt, nur einer am Ende der vordersten Reihe wirkte so, als sei sein Zustand ernst. Ich fragte mich, warum ich mir überhaupt die Mühe machte, das alles einzuschätzen; denn es hatte nichts mehr mit mir zu tun.
Ritsa stand an dem langen Tisch am hinteren Ende des Zeltes und wischte sich die Hände an der rauen Schürze aus Sackleinen ab, die sie um die Hüften gebunden hatte. Sie lächelte, als ich näher kam. Aber mir fiel auf, dass sie nicht auf mich zukam, um mich zu begrüßen, wie sie es früher getan hatte.
»Na«, sagte sie, als ich zu ihr trat, »wie kommst du denn daher!«
Ich fragte mich, was sie damit meinte. Meine Schwangerschaft, die allmählich sichtbar wurde, oder die prächtige Stickerei an meinem Kleid? Aber nichts davon war wirklich neu. Dann begriff ich: Sie bezog sich offenbar auf Amina, die mir ins Zelt gefolgt war und ein paar Schritte hinter mir stehen geblieben war.
»Wer ist denn das? Deine Zofe?«
»Nein.« Es war mir wichtig, das klarzustellen. »Alkimos will nicht, dass ich allein im Lager unterwegs bin.«
»Da hat er recht. Ich habe noch nie so viele Betrunkene gesehen. Komm, setz dich …«
Sie griff nach einem Krug Wein und goss drei Becher voll. Nachdem sie einen Moment gezögert und einen Blick in meine Richtung geworfen hatte, nahm Amina sich einen davon. Ärgerlicherweise benahm sie sich genau wie eine Zofe.
Ich setzte mich an den langen Tisch und wandte mich an Ritsa. »Wie geht es dir?«
»Ich bin müde.«
Sie wirkte auch müde und sah tatsächlich verhärmt aus. Ich begriff nicht, wieso, denn die Männer, von der Kopfverletzung in der vordersten Reihe einmal abgesehen, waren alle Leichtverwundete.
»Ich schlafe in Kassandras Hütte.«
Das war eine einleuchtende Erklärung. Ich erinnerte mich, in welche Raserei Kassandra an jenem Tag ausgebrochen war, als die trojanischen Frauen darauf warteten, den griechischen Königen zugeteilt zu werden – wie sie Fackeln ergriffen und sie hoch über dem Kopf herumgewirbelt hatte, wie sie mit den Füßen aufgestampft und nach allen geschrien hatte, sie sollten kommen und auf ihrer Hochzeit tanzen … Sie hatte sogar versucht, ihre Mutter hochzuzerren, und wollte sie dazu zwingen, ebenfalls zu tanzen.
»Geht es ihr etwas besser?«
Ritsa verzog das Gesicht. »Unterschiedlich. Morgens ist es ganz gut, aber die Nächte sind eine Qual … Sie ist verrückt nach Feuer, es ist wirklich erstaunlich, wie sie es immer wieder fertigbringt, an welches heranzukommen, aber sie schafft es. Und jedes Mal bekomme ich den Ärger, immer ist es meine Schuld. Es wundert mich wirklich, dass sie noch nicht das ganze verdammte Lager in Brand gesteckt hat. Ich wage es nicht, mich schlafen zu legen – und dann muss ich den ganzen Tag hier arbeiten. Das ist kein Leben.«
»Du brauchst jemanden, der dir hilft.«
»Nun ja, ein Mädchen habe ich – aber sie ist ziemlich nutzlos. Ich kann Kassandra nicht mit ihr allein lassen.«
»Ich könnte bei ihr wachen, dann bekommst du ein bisschen Schlaf.«
»Ich weiß nicht, was Machaon dazu sagen würde.«
»Wir könnten ihn fragen. Ich könnte ihn fragen.«
Sie schüttelte den Kopf. Machaon war der oberste Arzt des griechischen Heeres. Er war auch – wichtiger noch – Ritsas Eigentümer. Ich merkte, wie es ihr widerstrebte, dass ich mich an ihn wandte, also ließ ich es dabei bewenden.
»Der Wein ist gut«, sagte ich, um das Schweigen zu brechen.
»Ja, oder? Nicht schlecht.«
Sie goss uns gerade einen weiteren Becher ein, als ein heftiger Windstoß die Leinwand über unseren Köpfen blähte. Beunruhigt blickte ich nach oben. »Machst du dir keine Sorgen? Ich hätte Angst, dass hier alles zusammenstürzt.«
»Ich wünschte, das würde es.«
Ich schaute sie an, aber sie zuckte nur wieder mit den Achseln und fuhr fort, Kräuter zu zerreiben. Ihr mögt es vielleicht seltsam finden, aber ich beneidete sie um das Gefühl, den kalten Stößel in der Handfläche zu spüren. Es war lange her, dass ich neben ihr an diesem Tisch gearbeitet hatte, aber es waren meine glücklichsten Stunden hier im Lager gewesen. Ich kannte noch immer jede einzelne der Zutaten, die vor ihr aufgereiht lagen, ganz genau – sie alle besaßen eine beruhigende Wirkung. Mit starkem Wein vermischt, würden sie eine Arznei ergeben, die selbst einen Stier außer Gefecht setzen würde. »Ist das für Kassandra?«
Sie warf einen Blick auf Amina und hauchte dann fast unhörbar: »Für Agamemnon. Er kommt offenbar nicht zur Ruhe.«
»Ach, der Ärmste!«
Wir lächelten uns an, dann wies sie mit dem Kopf auf Amina. »Sie ist ganz schön schweigsam.«
»Stille Wasser.«
»Wirklich?«
»Nein, ich weiß es nicht. Aber du hast recht: Sie spricht nicht viel.«
»Ist sie nun deine Zofe?«
»Nein, sie ist eines der Mädchen von Pyrrhos. Es passt für uns beide gut, glaube ich: Ich brauche jemanden, der mich auf meinen Gängen begleitet, und sie muss ab und zu aus der Hütte heraus.«
Die ganze Situation war ziemlich verkrampft. Ich kannte Ritsa, seit ich ein Kind gewesen war. Damals war sie eine Frau mit einigem Ansehen, eine geachtete Heilerin und Hebamme. Sie war die beste Freundin meiner Mutter gewesen – und nach deren Tod hatte Ritsa ihr Bestes getan, um sich um mich zu kümmern. Zehn Jahre später, als Achill unsere Stadt Lyrnessos geplündert und in Brand gesteckt hatte, waren wir als Sklavinnen hierher ins Lager gebracht worden. Ritsa war mir damals eine große Hilfe gewesen, und vielen anderen Frauen auch. Aber nun war ich frei und die Gattin von Alkimos, während Ritsa noch immer eine Sklavin war. Es sagt sich leicht, dass Veränderungen, die den sozialen Stand oder das Vermögen betreffen, eine Freundschaft nicht belasten sollten – doch wir wissen alle: Sie tun es sehr wohl. Aber diese würde sie nicht zerstören! Ich hatte so viele Menschen verloren, die ich geliebt hatte. Ich war entschlossen, Ritsa nicht zu verlieren.
Unwillkürlich begann ich in Erinnerungen über unser Leben in Lyrnessos zu schwelgen und mich Ritsa durch unsere gemeinsamen Erinnerungen an eine glücklichere Vergangenheit zu nähern, an damals, bevor Achill alles zerstört hatte, bevor wir zum ersten Mal seinen schrecklichen Schlachtruf gehört hatten, der um die Mauern hallte. Aber trotzdem gestaltete sich die Unterhaltung schwierig und flackerte wie eine Kerze am Ende ihres Lebens – und die ganze Zeit über war ich mir bewusst, dass Amina begierig lauschte. Nach einer weiteren Pause sagte ich: »Nun, ich glaube, ich sollte mich auf den Weg machen.«
Sofort nickte Ritsa und schob ihren Mörser zur Seite. Wir zögerten mit dem Abschied, küssten uns flüchtig und halbherzig auf die Wangen und waren so ungeschickt, dass wir schließlich mit den Nasen zusammenstießen. Amina sah uns zu. Als wir uns auf den Weg machten, blieb sie von Neuem absichtlich hinter mir. Ich ließ mich zurückfallen und wollte neben ihr gehen, aber sobald ich langsamer ging, tat sie das Gleiche, sodass der Abstand zwischen uns bestehen blieb. Seufzend kämpfte ich gegen den Wind an. Dieses Mädchen machte mir ein schlechtes Gewissen, und das ärgerte mich, denn ich tat, was ich konnte. Ich erinnerte mich noch gut an meine ersten Tage im Lager und daran, wie sehr andere Frauen mir damals geholfen hatten. Deswegen hatte ich schon zuvor bei meinen Besuchen in der Hütte der Frauen versucht, Kontakt zu Amina zu bekommen, aber bisher hatte sie jede freundschaftliche Annäherung zurückgewiesen. Natürlich versuchte ich auch die anderen Mädchen zu unterstützen, aber Amina besonders, wahrscheinlich, weil sie mich so sehr an mich selbst erinnerte – wie ich damals zugeschaut und zugehört und abgewartet hatte. Freundschaft gründet sich häufig auf Gleichartigkeit, man entdeckt gemeinsame Standpunkte und Leidenschaften, aber die Ähnlichkeiten zwischen Amina und mir hatten diese Wirkung nicht. Wenn überhaupt, verstärkten sie meine Selbstzweifel. Und doch wollte ich noch immer zu ihr durchdringen. Immer wieder blickte ich zu ihr zurück, aber sie hielt den Kopf gesenkt und wich meinen Blicken geschickt aus.
Auf dem großen sandigen Platz hatte sich eine Gruppe Männer versammelt, die eine Schweinsblase herumstießen – zumindest hoffte ich, dass es eine Schweinsblase war. Am Tag nach dem Fall von Troja hatte ich einige Krieger gesehen, die mit einem menschlichen Kopf Fußball gespielt hatten. Dieser Haufen hier schien harmlos, doch ich ließ es nicht darauf ankommen. Ich drehte mich um, legte Amina die Hand auf den Arm und wies mit dem Kopf zum Strand. Allmählich glaubte ich, dass Alkimos die ganze Zeit recht gehabt hatte und dass es einfach zu gefährlich war, die Unterkunft zu verlassen.
Der Strand war leer bis auf zwei Priester, die die scharlachroten Bänder Apolls trugen und Schwirrhölzer über dem Kopf schwangen. Vielleicht dachten sie, wenn sie nur genug Lärm machten, könnten sie den Wind dazu bringen, sich ihnen zu unterwerfen. Während ich hinschaute, brachte eine besonders starke Windböe den einen von ihnen aus dem Gleichgewicht und warf ihn unsanft auf dem feuchten Sand nieder. Danach gaben sie auf und trotteten niedergeschlagen in die Richtung von Agamemnons Unterkunft davon. Überall im Lager unternahmen Priester wie diese hier alles, was in ihrer Macht stand, um das Wetter zu beeinflussen: Sie lasen aus den Eingeweiden von Opfertieren, sie beobachteten den Flug der Vögel, sie deuteten Träume … Und der Wind blies noch immer.
Nachdem die Priester verschwunden waren, hatten wir den ganzen weiten Strand für uns allein. Doch wir mussten unsere Schleier über dem Gesicht festhalten, damit wir überhaupt atmen konnten; es war unmöglich, miteinander zu sprechen. Keine von uns wäre allein gegen den Wind angekommen, also waren wir gezwungen, uns aneinanderzuklammern – und diese paar Minuten gemeinsamen Kampfes bewirkten mehr, als meine Freundschaftsangebote es je vermocht hatten, um die Schranken zwischen uns zu überwinden. Wir taumelten voran, lachten und kicherten. Amina hatte gerötete Wangen, ich glaube, sie war erstaunt, als sie merkte, dass es immer noch möglich war, zu lachen.
Zunächst hielten wir uns am Rand des Strandes, wo die von Gerüsten gestützten Schiffe uns etwas Schutz boten, aber der Anziehung des Meeres kann ich nie widerstehen – außerdem sagte ich mir, dass der feuchte Sand direkt am Wasser fester sein würde, sodass wir dort besser laufen könnten. Also gingen wir über Sand und Kies hinunter und fanden uns am gelblich-grauen Wasser wieder, das die Absicht zu haben schien, das Land zu verschlingen. Am Rande des Wassers lagen stinkende Haufen Blasentang, übersät mit Tausenden toter Lebewesen; mehr, als ich je zuvor gesehen hatte: winzige graugrüne Krabben, Seesterne, verschiedene riesige Quallen mit roter Mitte, beinahe so, als wäre etwas in ihrem Inneren geborsten, und anderes Getier, das ich nicht benennen konnte – alles tot. Das Meer tötete seine Kinder.
Amina wandte sich um und blickte zu den noch immer vor sich hin schwelenden Türmen von Troja. Ihr Gesichtsausdruck war plötzlich angespannt und unglücklich. Ich spürte, dass ich nicht zu ihr durchdrang und dass jemand anders, der älter und erfahrener war – Ritsa vielleicht –, besser in der Lage gewesen wäre, sie zu erreichen. Schweigend gingen wir weiter, bis wir auf Höhe des Geländes von Pyrrhos waren. Wenn wir erst das Tor durchschritten hätten, wären wir in Sicherheit, das wusste ich, aber noch waren wir nicht da. Ich hörte, wie brüllendes Gelächter ausbrach, und schlich mich vorsichtig im Schutz des Strandhafers näher an die Quelle des Lärms. Ich hielt mich im Schatten und versuchte zu ergründen, was sich vor uns abspielte. Es war eigentlich noch nicht dunkel, aber in jenen Tagen war der Himmel häufig derart verhangen, dass es sogar um die Mittagszeit kaum richtig hell war.
Direkt vor dem Tor lag ein weiter, offener Platz. Hier war eine weitere Gruppe Soldaten versammelt, und mitten in diesem Gedränge befand sich ein Mädchen. Sie hatten ihr die Augen verbunden und stießen sie im Kreis herum. Sie schrie nicht und rief auch nicht um Hilfe; wahrscheinlich wusste sie mittlerweile, dass niemand kommen würde. Das durfte Amina, die mir nachgefolgt war, nicht länger mit anschauen. Ich packte sie am Arm und deutete zurück auf den Weg, den wir gekommen waren, aber sie stand einfach da, ganz starr vor Entsetzen, und so musste ich sie schließlich davonzerren. Stolpernd folgte sie mir entlang der Umzäunung, blickte aber immer noch über die Schulter zurück zu dem umhergeschleuderten Mädchen und dem Kreis grölender Männer.
In meinen ersten Wochen im Lager, als das Meer sowohl Trost als auch Versuchung gewesen war – Versuchung deshalb, weil ich so oft in die Wellen hatte gehen und nicht wieder umkehren wollen –, hatte ich jeden Fußbreit Strand erkundet, und das kam mir jetzt zugute. Ich wusste, dass es einen Pfad durch die Dünen gab, der zu einem anderen Eingang bei den Stallungen führte, also hielt ich geradewegs darauf zu. Als wir außer Sichtweite waren, ließ ich mich in den Sand fallen, um zur Besinnung zu kommen, und nachdem sie einen Moment gezögert hatte, setzte Amina sich neben mich nieder, legte sich auf dem Rücken und starrte hinauf zum Himmel.
Wie wir so dalagen, entgingen wir der vollen Kraft des Windes, obwohl die scharfen Halme des Strandhafers wie wild über unseren Köpfen schwankten. Ich schloss die Augen und legte mir die Arme übers Gesicht. Ich fürchtete, Amina würde über den Vorfall sprechen wollen, dessen Zeugen wir geworden waren, und ich wusste nicht, was ich ihr sagen sollte. Die Wahrheit vermutlich – aber es war eine schwierige Wahrheit, die ich ihr würde erzählen müssen.
Meine zweite Nacht im Lager hatte ich im Bett des Achill verbracht. Keine zwei Tage zuvor hatte ich mit angesehen, wie er meinen Mann und meine Brüder getötet hatte. Ich hatte unter Achill gelegen und gedacht, etwas Schlimmeres würde mir niemals zustoßen können – und auch keiner anderen Frau. Ich hielt es für den absoluten Tiefpunkt. Doch als ich später im Lager umherlief, fielen mir die einfachen Frauen auf, die rund um die Kochfeuer nach Abfällen suchten. Frauen, die nichts hatten, um ihre Kinder satt zu bekommen, und die nachts zum Schlafen unter die Hütten krochen. Ich hatte nicht lange gebraucht, um zu begreifen, dass es viele Schicksale gab, die schlimmer waren als das meine. Das musste Amina wissen, sie musste erfahren, wie das Leben in diesem Lager wirklich war, aber ich hatte nicht die Kraft, um ihr diese grausame Wahrheit klarzumachen. Und überhaupt, sagte ich mir, sie würde es früh genug lernen.
Als ich die Augen öffnete, sah ich, dass Amina ein paar Krähen beobachtete, die etwa hundert Schritt entfernt kreisten. Sie sah verwirrt aus, und nach einer Weile stand sie auf und beschattete die Augen mit der Hand, damit sie besser sehen konnte. Mit dem schwarzen Kleid, das sie umflatterte, sah sie selbst wie eine Krähe aus. Unwillig stand ich auf und fragte mich, wie ich sie an diesem Ort vorbeibekommen sollte, denn ich wusste (oder vielmehr vermutete ich), was dort war. Als Pyrrhos im vollen Triumph über seine Heldentat aus Troja zurückgekehrt war, hatte er einen Klumpen aus Blut und gebrochenen Knochen hinter den Rädern seines Streitwagens hergeschleift: Priamos. Das war sowohl entsetzlich als auch auf trostlose und öde Art und Weise vorhersehbar gewesen. Achill hatte den Leichnam Hektors entehrt, indem er ihn hinter seinem Streitwagen hergezogen hatte, also musste Pyrrhos offensichtlich Priamos das Gleiche antun. Ich erinnerte mich, wie Achill an jenem Tag ins Lager zurückgekehrt und mit großen Schritten die Halle betreten hatte, wie er Kopf und Schultern in einen Bottich mit sauberem Wasser getaucht hatte, lange Zeit, und triefend nass und mit zusammengekniffenen Augen wieder aufgetaucht war. Auch an diesem Tag hatten die Krähen gekreist.
»Komm«, versuchte ich ein bisschen Kraft in meine Stimme zu legen, »gehen wir weiter.«
Ich schlang mir den Schleier eng um den Kopf und machte mich auf. In der Luft lag der Geruch von Verwesung, und ich hoffte, er würde Amina nicht auffallen, obwohl sie allem gegenüber aufmerksam schien. Wir rutschten einen Hang mit lockerem Sand hinunter und standen auf einer offenen Fläche – und da lag es. Er. Ob man diesen Ort absichtlich ausgewählt hatte oder Priamos’ Leichnam einfach dort hatte liegen lassen, wo die wilde Fahrt von Pyrrhos geendet hatte – wer weiß das schon … Aber Zufall oder Absicht, der Leichnam lag an einer kleinen Böschung, sodass er sich halb zu erheben schien, um uns zu begrüßen. Irgendwie machte das alles schlimmer. Von seinem Gesicht war nicht mehr viel übrig, die Augen und die Nase waren verschwunden. Die Krähen machen sich immer als Erstes über die Augen her, denn die machen nicht viel Arbeit. Sie müssen rasch zu Werke gehen, schon so manche hungrige Krähe hat einen Augenblick zu lange gezögert und ihr Leben im Maul eines Fuchses beendet.
Es gab keine Möglichkeit, den Leichnam zu umgehen. In seiner Nähe wurde der Gestank zu einem geradezu körperlichen Hindernis, gegen das man ankämpfen musste. Ich atmete durch den Mund und hielt den Blick gesenkt, damit ich so wenig wie möglich sah. Was ich allerdings nicht erwartet hatte, war das Summen der Fliegen. Tausende von ihnen bedeckten den Leichnam; sie sahen aus wie schwarze Haarstoppeln. Als mein Schatten auf sie fiel, stiegen die Fliegen auf, nur um sich wieder niederzulassen, sobald ich vorübergegangen war. Das summende Geräusch füllte meinen Kopf, bis ich dachte, er müsste platzen. Manchmal werde ich mir selbst heute noch, so viele Jahre später, wenn ich draußen sitze und einen warmen Sommerabend genieße, der summenden Bienen an den Blumen bewusst und der zahllosen anderen Insekten, die im grünen Schatten herumwimmeln – und es ist mir unerträglich. »Wo gehst du hin?«, fragen die Leute. Und ich sage überzeugend beiläufig, denn darin habe ich Übung, sehr viel Übung: »Es ist hier draußen zu heiß, findet ihr nicht? Wollen wir nicht lieber hineingehen?«
An jenem Tag gab es kein Entkommen. Ich versuchte, mich auf ganz einfache Fragen zu konzentrieren – was es zum Abendessen geben würde und ob die Frauen daran gedacht hatten, ein heißes Bad für Alkimos bereitzuhalten, wenn er zurückkehrte (obwohl ich keine Ahnung hatte, wann oder ob er überhaupt nach Hause zurückkehren würde). Ich dachte an alles Mögliche, nur nicht an das, was da vor mir lag – die traurigen Überreste eines großen Herrschers.
Amina war ein Stück hinter mir. Ich drehte mich um und wollte sie zur Eile antreiben, aber ich stellte fest, dass ich kein Wort herausbrachte. Der Gestank machte ihr zu schaffen, sie presste den Schleier fest gegen die Nase und starrte den Leichnam an. Viel mehr als die blutverklebte silberne Mähne konnte man nicht erkennen, aber es war doch genug, dass sie fragte: »Priamos?«