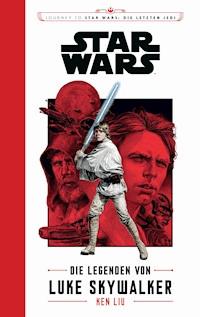9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Serie: Die Legenden von Dara
- Sprache: Deutsch
Preisgekrönte asiatische Fantasy: Von der TIME zu den 100 besten Fantasy-Büchern aller Zeiten gewählt Rachsüchtige Feinde, hinterlistige Götter und ein übermächtiger Gegner – der Kampf um den Thron von Dara entbrennt mit neuer Wucht in Ken Lius preisgekrönter asiatischer High Fantasy-Saga. Kuni Garu, der seit zehn Jahren als Kaiser Ragi über das Inselreich Dara herrscht, sieht sich einem neuen, mächtigen Feind gegenüber, den er allein nicht besiegen kann. Kunis Feinde planen ihre Rache sorgfältig, und die Götter sind ihm keine Stütze. Als eine gewaltige Armee aus dem Lyucu-Reich im fernen Westen die Sturmwälle überwindet, die seit Menschengedenken Daras Grenzen schützen, muss Kuni auf seine vier Kinder vertrauen – und besonders auf die geheimnisvollen Fähigkeiten seiner Tochter Thera. »Lius Charaktere begeistern, die Weltenschöpfung ist ungewöhnlich und überzeugend, seine Sprache entwickelt eine eingängige Strahlkraft. Diese Saga bezaubert jeden Fan epischer Fantasy mit genau der richtigen Menge Spannung und magischen Einfällen.« Publishers Weekly »Die Stürme von Dara« ist der dritte Teil der Seidenkrieger-Reihe. Die epische High-Fantasy-Serie ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Die Schwerter von Dara - Seidenkrieger Band 1 - Die Götter von Dara - Seidenkrieger Band 2 - Die Stürme von Dara - Seidenkrieger Band 3
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 727
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ken Liu
Die Stürme von Dara
Seidenkrieger Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Christiane Steen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kuni Garu, der seit zehn Jahren als Kaiser Ragi über das Inselreich Dara herrscht, sieht sich einem neuen, mächtigen Feind gegenüber, den er allein nicht besiegen kann. Kunis Feinde planen ihre Rache sorgfältig, und die Götter sind ihm keine Stütze. Als eine gewaltige Armee aus dem Lyucu-Reich im fernen Westen die Sturmwälle überwindet, die seit Menschengedenken Daras Grenzen schützen, muss Kuni auf seine vier Kinder vertrauen – und besonders auf die geheimnisvollen Fähigkeiten seiner Tochter Théra.
Inhaltsübersicht
Karten
STURM AUS DEM NORDEN
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
DER KAMPF DER TAIFUNE
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Glossar
Nachbemerkung
STURM AUS DEM NORDEN
Kapitel 1
DIE ANKUNFT DER STADTSCHIFFE
Am nördlichsten Strand von Dara spielten ein paar Kinder in der anhaltend drückenden Hitze eines Herbstnachmittags. Sie sammelten hübsche Muscheln und hielten Ausschau nach Wrackteilen, die hin und wieder ans Ufer gespült wurden – jedoch nicht, ohne dabei die Krebse oder Austern in die Tasche zu stecken, die ihnen dabei ins Auge fielen, denn ans Essen dachten die Kinder der Armen immerzu.
»Piraten!«, rief einer der Jungen.
Seine Spielkameraden blieben stehen und blickten aufs Meer hinaus. Eine Flottille von Schiffen unterschiedlichster Größe war am Horizont aufgetaucht: schlanke Fischerboote in der Bauweise des alten Xana; breite, flach liegende Frachter, die den Händlern von Wolfstatze abgenommen worden waren; schlanke Wellenreiter aus Arulugi und sogar ein paar alte Kriegsschiffe, die die Piraten schon vor Jahren von den Tiro-Königen gekapert hatten. Ruder ragten aus allen Decks, und die bunt zusammengewürfelten Segel flatterten im Wind. Die farbenfrohe Flotte hüpfte auf den Wellen und wirkte dabei wie ein Haufen Blätter, die man über einen Teich gestreut hatte.
»Wie viele es sind«, murmelte ein Mädchen. »So viele habe ich noch nie gesehen.«
»Das ist ein Überfall!«
Einige Erwachsene auf den terrassenförmig angelegten Feldern am Hang des Hügels hielten in ihrer Arbeit inne und starrten die sich nähernde Flottille entsetzt an. Wie viele Schiffe waren es? Dutzende? Nein, Hunderte. Es schien, als hätten sich alle Piraten der nördlichen Inseln nach Dara aufgemacht. Dies musste der größte Piratenüberfall sein, an den man sich erinnern konnte – noch nicht mal an Geschichten über einen solchen Überfall konnte man sich erinnern.
Sobald sich die Nachricht von den ankommenden Schiffen verbreitet hatte, strömte alles von den Hügeln herab. Menschen liefen aus ihren Hütten und Häusern, ließen ihre Feldwerkzeuge und Fischernetze fallen und eilten, so schnell sie ihre Beine tragen konnten – Alte und Junge, Männer und Frauen, Reiche und Arme … nichts davon war mehr von Bedeutung, wenn es um Piraten ging. Ein paar Dorfbewohner besaßen die Geistesgegenwart, zu den Garnisonskommandanten zu laufen und von dem bevorstehenden Überfall zu berichten. Hoffentlich konnte die Nachricht noch rechtzeitig an Prinz Timu weitergeleitet werden, um eine Art Rettungsoperation zu organisieren, sobald die Piraten ihren Hunger nach Zerstörung gestillt und Dasu wieder verlassen hatten.
Als die Piratenschiffe schließlich landeten, waren Strand und Felder verlassen. Die Piraten schwärmten aus den Schiffen auf den Strand und dann weiter landeinwärts, wie ein Schwarm Termiten über ein neues Haus. Sie sprangen über die Zäune der Gemüsegärten und trampelten durch Taro-Felder, wobei ihre Beine und Arme wie rasend gegen alles traten und stießen, was ihnen im Weg stand.
Prinz Timu mochte nicht viel von Militärangelegenheiten verstehen, aber er wusste, wann er Menschen mit mehr Kenntnissen nachgeben sollte. Die Kaiserlichen Garnisonen von Dasu waren gut ausgebildet und verstanden sich darauf, wie man Gelände und Engpässe zu seinem Vorteil nutzte.
Eine Gesandtschaft von Kaiserlichen Soldaten erschien oben auf dem Hügelkamm. In enger Formation richteten die Bogenschützen ihre Pfeile auf die nahende Piratenflut. Der kommandierende Offizier hob den Arm, bereit, den Schießbefehl zu erteilen.
Die Piraten schrien etwas.
»… Gnade …«
»Lauft um euer Leben! …«
»… meine Augen … Grauen …«
Der Offizier zögerte. Irgendetwas stimmte hier nicht. Doch die Piraten wurden nicht langsamer, obwohl die Pfeile auf sie zielten.
»Feuer frei!«
Pfeilschwärme flogen den Piraten entgegen, und Dutzende gingen zu Boden.
Normalerweise zogen sich Piraten im Angesicht solch disziplinierter Wehrhaftigkeit zurück – es waren Seebanditen, mehr an Plünderungen und Gefangenen interessiert als an so theoretischen Konzepten wie Ehre und Sieg. Doch dieses Mal nicht. Die Piraten hasteten über die Leichen ihrer gefallenen Kameraden und setzten ihren Überfall fort. Sie liefen schneller und entschlossener als jedes Überfallkommando, das der Offizier je gesehen hatte; sie wirkten beinahe wie Berserker.
Der kommandierende Offizier traute seinen Augen nicht. In der hereinbrechenden Menschenflut erkannte er nun Männer und Frauen, von denen einige Babys und Kinder schleppten. Die meisten von ihnen trugen keine Rüstung, und in ihren Händen lagen keine Waffen. Statt einer Piratenmannschaft, die von Kampfeslust angetrieben wurde, war dies ein Mob verzweifelter Flüchtlinge, der vor unaussprechlichem Grauen floh.
»Gnade! Gnade! Gnade!«, riefen die Flüchtenden.
Selbst die abgehärtetsten Veteranen konnten beim Anblick Tausender Männer und Frauen, die um Gnade bettelten, nicht ungerührt bleiben. Die Arme der Bogenschützen sanken herab, und die meisten hörten auf zu schießen und sahen sich stattdessen hilfesuchend nach ihrem kommandierenden Offizier um.
Doch dieser achtete nicht länger auf die Piraten. Jenseits der Menge der Flüchtenden, jenseits ihrer verlassenen Schiffe, erhob sich eine hölzerne Wand, gekrönt von immensen Segeln, sauber und weiß wie Meeresschaum.
Zwanzig riesige Schiffe, ein jedes so hoch wie die Wachtürme von Pan und so groß wie ein ganzes Dorf, kamen über die Wellen heran.
Prinz Timu versammelte seine Ratgeber in Daye, um über die Fremden zu sprechen, die an der Nordküste von Dasu gelandet waren und dort ihr Lager aufgeschlagen hatten. Für den Augenblick schienen sie mit ihrer Zeltstadt am Strand zufrieden zu sein.
»Die Piraten fallen jedes Jahr an den Küsten von Dasu und Rui ein«, sagte Ra Olu, König Kados ehemaliger Regent in Daye und jetzt Prinz Timus Erster Staatsminister. Er trug sein glattes Haar zu einem ordentlichen dreifach geschlungenen Knoten gebunden, und seine teure gelbe Seidenrobe passte perfekt zu seinem dunklen Teint. »Es sind verzweifelte, rücksichtslose Männer, jedoch nicht ohne Mut. Aber nun haben diese Fremden sie derartig erschreckt und jeden Widerstand in ihnen gebrochen, dass sie sich freiwillig der Gnade des Kaisers unterwerfen. Was für Monster müssen das sein? Wir sollten sie umgehend angreifen.«
»Im Gegenteil«, sagte Zato Ruthi, der alte Lehrer des Prinzen und sein Ratgeber. »Man kann nicht behaupten, die Piraten würden Mut besitzen, denn sie sind ohne jede Moral. Und die Geschichten, die man von diesen Fremden hört, sind verwirrend, widersprechen einander und verdienen keinen Glauben. Feuer spuckende Schlangen? Tod, der vom Himmel regnet? Das klingt nach dem fiebrigen Gestammel von Verrückten. Selbst wenn sie die Piraten angegriffen haben, ist es sehr gut möglich, dass die Piraten diese Fremden zuerst provoziert haben, und alle zivilisierten Männer, die die Meere befahren, haben einen natürlichen Widerwillen gegen Piraterie. Diese Schiffe passen zu den Beschreibungen der Stadtschiffe aus der legendären Flotte unter Kaiser Mapidéré. Könnten es Gesandte der Unsterblichen von hinter dem Meer sein? Wir sollten hier nicht die Rolle des Aggressors einnehmen.«
»Wenn es tatsächlich unsterbliche Gäste sind, die von Mapidérés Flotte hergebracht wurden«, sagte Ra Olu, »glaubt Ihr nicht, dass wir dann inzwischen einen Höfling aus Mapidérés Zeiten aus den Zelten hätten kommen sehen?«
»Es ist möglich, dass Mapidérés Männer und die Unsterblichen von uns erwarten, dass wir uns wie anständige Gastgeber verhalten und uns für den schäbigen Anblick dieser Piraten entschuldigen, die wohl kaum das rechte Begrüßungskomitee vor Daras Toren sind.«
»Wenn Ihr die Worte der Piraten nicht glauben wollt – die trotz allem immerhin Männer Daras sind –, warum nehmt Ihr dann an, dass die Absichten der Fremden freundlich sind?«, gab Ra Olu entnervt zurück.
»Weil die Piraten sich bereits als gesetzlose Kriminelle bewiesen haben, die nur von Gier getrieben werden, doch von diesen Fremden wissen wir nichts. Wie Kon Fiji sagt: ›Umarme den Fremden, der über das Meer kommt, und der Fremde wird dich umarmen.‹«
»Kon Fiji dachte dabei wohl kaum an Fremde, die rücksichtslose Piraten dazu bringen, wie Herbstlaub zu zittern. Wir sollten umgehend um Hilfe aus Rui und vom Kaiser selbst bitten.«
»Der Kaiser ist zu sehr damit beschäftigt, einen Aufstand niederzuschlagen, und sollte nicht ohne weitere Beweise von der Gefahr abgelenkt werden«, sagte Ruthi. »Wenn Prinz Timu jetzt zu seinem Vater läuft, um seine Hilfe zu erbitten, wird er wirken wie ein Kind, das immer noch nicht erwachsen geworden ist.«
Das letzte Argument überzeugte Timu. »Wir sollten erst mehr über sie herausfinden, bevor wir überreagieren. Meister Ruthi, werdet Ihr bei den Fremden unser Gesandter sein?« Als er sah, dass Ra Olu etwas erwidern wollte, fügte Timu schnell hinzu: »Doch es ist natürlich auch gut, vernünftige Vorkehrungen zu treffen. Ich werde um eine Flotte von Luftschiffen vom Kaiserlichen Flughafen in Rui bitten, um Euch zu eskortieren. Falls die Fremden uns freundlich gesinnt sind, werden sie die Schiffe als Zeichen unserer Wertschätzung für Ihren Besuch verstehen. Und falls sie uns feindlich gesinnt sind, sind wir vorbereitet.«
Zwanzig große Luftschiffe schwebten in einer Reihe über dem Hügel, der den Strand überblickte. Jedes von ihnen war etwa einhundertachtzig Fuß lang und dabei schlank wie ein Delfin. Es waren nicht die größten Schiffe der Flotte – diese wurden wie zur Zeit von Kaiser Mapidéré gebaut und waren dreihundert Fuß lang –, doch sie waren neuer und schneller und zudem angenehmer für die Kaiserliche Schatzkammer.
Unter ihnen versammelte sich eine zweitausend Mann starke Ehrengarde auf dem Hang. Die Besten aus Daras Heer standen dort vollkommen still und schweigend; ihre Rüstungen glänzten in der Sonne, und ihre polierten Speere standen aufrecht wie ein Bambuswald. Das einzige Geräusch stammte von den purpurnen Kriegsumhängen der Offiziere, die in der Brise flatterten.
Hinter den Reihen der Gardisten hatte man Hunderte von teuren Wagen kreuz und quer auf dem Hügelkamm abgestellt. Behelfsmäßige Unterstände und Aussichtsplattformen aus Bambus und Seide standen in den Zwischenräumen der Gefährte. Viele der adligen und wohlhabenden Familien von Daye waren gekommen, um Zeuge dieses historischen Augenblicks zu werden: Prinz Timus Gesandter würde mit Unsterblichen von jenseits des Meeres sprechen.
»Glaubst du, die Unsterblichen suchen hier nach Ehefrauen?«
»Ha! Denkst du vielleicht daran, einen Kuppler für dich zu engagieren?«
»Oh, ich bin ganz zufrieden mit meinen Aussichten, vielen Dank. Aber da dir kein Junge aus Dasu gut genug zu sein scheint, kann dich vielleicht nur ein Unsterblicher zufriedenstellen, und zwar außerhalb und innerhalb des Schlafzimmers – au! Hör auf, mich zu kneifen!«
»Vielleicht will ich ja gar nicht heiraten … aber es würde sicher Spaß machen, mit einem Unsterblichen zu schlafen. Vielleicht kann ich auch ihr Geheimnis lüften und selbst unsterblich werden! Wäre das nicht etwas?«
»Meinst du, Unsterbliche haben morgens Mundgeruch?«
Die verwöhnten Männer und Frauen betrachteten das ganze Spektakel wie einen Feiertag. Die Aufregung wuchs, während sie sich auf ihren bequemen Kissen unter den verschwenderischen Seidendächern niederließen, Kleinigkeiten aßen und Tee schlürften, wobei sie sich über die konischen weißen Zelte unterhielten, die den Strand wie eine Ansammlung von Meeresschnecken bedeckten und gegen die riesigen Schiffe dahinter geradezu winzig wirkten.
Der gelegentliche Anblick eines Fremden, der zwischen den Zelten herumging, löste jedes Mal lautes Rufen und Kichern aus. Adlige niedrigeren Ranges stellten sich vor, wie sie sich mit den Unsterblichen anfreundeten und sie dazu nutzen konnten, ihre eigene Position zu verbessern. Wohlhabende Gutsherren flüsterten sich gegenseitig Pläne zu, den Unsterblichen kleine Parzellen Land zu überteuerten Preisen zu verkaufen, damit sie ihre Zelte gegen luxuriöse Häuser eintauschen konnten. Kaufleute betrachteten die fernen großen Schiffe, die sich auf den Wellen hoben und senkten, spekulierten auf die Fracht, die sie mit sich führten, oder wetteten darauf, welche Güter die Unsterblichen wohl am meisten interessierten.
Immerhin war dies das Jahr des Cruben – eine Zeit, in der das Meer besonders freigebig mit Schätzen und Möglichkeiten zu sein versprach.
Hinter ihnen beobachteten die armen Dorfbewohner, die die Ankunft der Fremden aus ihren Häusern vertrieben hatte, die Szene weitaus nüchterner und besorgter. Sie waren nur daran interessiert, wann sie wieder auf die Felder zurückkehren und ihr Leben würden fortführen können. Sie wagten nicht, sich hoffnungsvollen Vorstellungen einer Zukunft hinzugeben, die von der Ankunft der Unsterblichen abhing – wenn es denn überhaupt Unsterbliche waren. Jede Veränderung in Dara schien doch nur dazu zu führen, dass die Wohlhabenden und Mächtigen sich die Vorteile sicherten und den Armen die Abfälle überließen.
Gelassen machte sich Zato Ruthi auf einem schneeweißen Pferd auf den Weg zum Lager der Fremden. Er wurde von einem Dutzend Soldaten eskortiert, ebenfalls auf Pferden, die Geschenke von Prinz Timu bei sich trugen. Eine riesige Fahne von Dasu, die die blaue Figur eines springenden Cruben auf rotem Hintergrund zeigte, flatterte am Kopf der kleinen Prozession.
Ruthi und seine Wachen verschwanden im fernen Zeltlager. Die Blicke aller Zuschauer folgten der Fahne, die wie eine winzige Flamme über einem Schneefeld dahintanzte. Welcher Wunder würde Ruthi wohl angesichtig werden?
Kapitel 2
DIE FREMDEN
Die Zelte – untersetzte Zylinder von der Größe eines Mannes mit abgeflachten konischen Spitzen – waren sämtlich aus Tierfellen hergestellt, wie Zato Ruthi beim Näherkommen feststellte. Das Lager der Fremden war von einem niedrigen Zaun aus Knochen umgeben, die mit Sehnen zusammengebunden waren, und jeden Zaunpfahl krönte ein Schädel mit scharfen Kiefern. Von den Spitzen scharfer weißer Stangen – waren das die Rippen eines Monsters? –, die vor den Zelten in den Boden getrieben worden waren, flatterten die Schwänze verschiedener Tiere wie Fahnen. Hinter den Zelten schwankten die riesigen Stadtschiffe auf den Wellen wie ruhende Wale vor dem Strand.
Die Unsterblichen haben offenbar einen seltsamen Sinn für Architektur, dachte Ruthi. Er hatte sich die Unsterblichen immer als ätherische Wesen vorgestellt, die mit hauchdünnen seidenen Stoffen bauten, mit Blüten und Blättern voll Tau. Er hatte sie sich als gebildete Poeten und Philosophen vorgestellt, die mit den Göttern sprachen und keine materiellen Bedürfnisse hatten. Dass sie Knochen und Häute zum Bau nutzten – also Tiere dafür töteten, passte damit nicht zusammen.
Im Zaun gab es eine Öffnung, eine Art Tor, das aus den riesigen Kiefern eines Hais bestand. Das gesamte Bild drückte eine Art rohe Kraft und Disziplin aus, eine schlichte, funktionale Eleganz.
Als Ruthi sich dem Durchgang näherte, traten Männer aus den Zelten. Etwa fünfzig von ihnen stellten sich vor das Tor und hinderten ihn daran, hindurchzureiten. Ruthi parierte sein Pferd und betrachtete sie genau.
Sie hatten helle Haut, obwohl diese inzwischen von der Sonne stark gebräunt war –, und die Farben ihrer Haare und Bärte reichten von Weiß bis Hellbraun. Sie trugen Häute und Felle und Kriegskeulen aus Knochen oder Treibholz, an deren Spitzen Muscheln und Steine befestigt waren. Einige hatten sich die Schädel kahl rasiert, während andere ordentliche Zöpfe trugen, die ihnen den Rücken herunterhingen; ein paar trugen Helme aus Tierschädeln. Ruthi entdeckte nur wenige Metallwaffen oder Rüstungen und keine Bekleidung aus Hanf oder Seide. Viele der Männer wirkten ausgemergelt und klein, und die Felle an ihren Körpern waren zerrissen und zerlumpt, als hätten sie eine lange Reise hinter sich, bei der sie keine Gelegenheit gehabt hatten, sich mit frischen Waren zu versorgen.
Der dürftige Zustand ihrer Bekleidung führte Ruthi recht unerwartet vor Augen, dass einige dieser »Männer« in Wirklichkeit Frauen waren. Er errötete. Welche Unsterblichen würden ihre Frauen dazu zwingen, mit Knüppeln zu kämpfen? Und so unanständig!
Sie sehen aus wie Figuren aus einer alten Ano-Legende, dachte Ruthi weiter. So müssen die barbarischen Ureinwohner dieser Inseln unseren Vorfahren erschienen sein, als sie zum ersten Mal als Flüchtlinge aus ihrer zerstörten Heimat im Westen an den Küsten Daras landeten.
Obwohl Ruthi enttäuscht war, dass die Fremden nun also doch keine Unsterblichen zu sein schienen, hielt er seine respektvolle Miene aufrecht, während er sich vom Pferderücken gleiten ließ. Seine Wachen folgten seinem Beispiel.
»Ich komme in Frieden«, erklärte er den Fremden. »Der Kaiser von Dara heißt euch an diesen Ufern willkommen. Wenn ihr in irgendeiner Form Hilfe benötigt, steht mein Herr, Prinz Timu, bereit, euch mit allem zu versorgen, was ihr braucht.«
Einer der Barbaren – ein großer Mann von etwa vierzig oder fünfzig Jahren – trat vor. Er sagte etwas zu Ruthi, doch dieser konnte sich keinen Reim aus der Aneinanderreihung von Silben machen.
Unverzagt bedeutete Ruthi den Wachen, die Geschenke zu holen, die sie mitgebracht hatten, und sie etwa in der Mitte zwischen den beiden Fronten auf den Boden zu legen: eine Platte mit geröstetem Schwein; ein Holzteller mit rohem Fisch, der so geschnitten und arrangiert war, dass er die Schriftzeichen Anos für Frieden bildete; ein Ballen Seide; eine Schriftrolle, auf die Prinz Timu in kalligrafischen Zeichen die Worte ›In den Weiten der Vier Meere sind alle Menschen Brüder‹ geschrieben hatte, ein Zitat von Kon Fiji. Ruthi hatte diese Geschenke sorgfältig ausgewählt, um den Fremden Daras Großzügigkeit zu demonstrieren und gleichzeitig die Würde des Kaisers und Prinz Timus zu demonstrieren, des Kaiserlichen Stellvertreters in Dasu.
Nachdem Ruthis Wachen die Geschenke auf den Boden gelegt hatten, traten sie zurück. Der große Barbar hielt den Blick auf Ruthi geheftet, bedeutete aber gleichzeitig einigen seiner Begleiter, sich den Geschenken zu nähern. Sie stocherten im Schwein und im Fisch herum, probierten davon und riefen dann aufgeregt nach ihren Gefährten. Sie aßen wie Verhungerte, drängten und schubsten sich, um an das Essen heranzukommen, und schon bald waren das Schwein und der Fisch verschwunden. Zwei Männer mit fettigen Fingern trugen die Seide zurück ins Lager, die Schriftrolle hingegen untersuchten sie nur kurz und ließen sie dann achtlos fallen.
Der Gesichtsausdruck des großen Barbaren blieb die ganze Zeit über ungerührt.
Ruthi runzelte die Stirn. Das ist kein vielversprechender Anfang.
Der große Fremde lächelte und deutete auf sich selbst. »Pékyu Tenryo«, sprach er langsam. Dann machte er eine Geste mit ausgestrecktem Arm zum Lager. »Lyucu.«
Das ist schon besser, dachte Ruthi. Er versuchte, so gut er konnte, die unbekannten Silben zu wiederholen.
Pékyu Tenryo – was wohl die Bezeichnung für einen barbarischen Häuptling sein musste, entschied Ruthy – nickte zufrieden.
Ruthi deutete auf sich und sagte langsam »Zato Ruthi.« Und in Anlehnung an Pékyu Tenryos Geste deutete er auf die ferne Armee und Luftschiffe von Dara. »Dara.«
Pékyu Tenryo grinste und entblößte dabei zwei Reihen unebener Zähne. Irgendwie wirkte sein Lächeln eher animalisch und bedrohlich als freundlich. Doch Ruthi wollte die Barbaren nicht beleidigen und grinste zurück.
Diese Menschen, die sich selbst Lyucu nennen, sind zwar keine Unsterblichen, doch es scheint nicht unmöglich, sich mit ihnen zu verständigen.
Pékyu Tenryo deutete jetzt auf Ruthis Wachen und machte einige Gesten, die auf Ruthi wirkten, als entledige er sich seiner Kleidung. Ruthi errötete ebenso wie die restlichen Männer von Dara. Sind diese Barbaren denn ohne jede Scham?
Der Häuptling runzelte die Stirn, als er sah, dass Ruthi und seine Wachen zögerten.
Ein paar der Barbaren kamen ihrem König zu Hilfe. Sie legten ihre Waffen neben ihren Füßen auf den Boden und nahmen die zerlumpten Felle und Häute ab, die sie am Körper trugen – sowohl Männer als auch Frauen! –, bis sie nur noch in groben Lendenschurzen dastanden, die aus einer Art Grasfaser gewebt schienen.
Ruthi errötete noch heftiger und wollte seinen Männern schon befehlen, die Augen abzuwenden, um die Ehre dieser entblößten Barbaren zu bewahren, als diese auf ihre Waffen deuteten, dann auf sich selbst und mit ihren Händen ihre Körper abklopften.
»Oh, sie wollen, dass wir unsere Waffen niederlegen! Es ist eine Sicherheitsvorkehrung.« Ruthi nickte heftig, um anzudeuten, dass er endlich verstanden hatte. Dann drehte er sich zu seinen Wachen um. »Tut, worum sie uns bitten.«
»Meister Ruthi, ist das klug?«, fragte Jima, der Hauptmann der Palastwache, der außerdem die Standarte Daras trug. »Wir kennen ihre Absichten nicht und sollten ihr Lager nicht schutzlos betreten.«
»Das kommt dabei heraus, wenn man sein Leben mit Kämpfen verbringt, anstatt die Bücher der Weisen zu studieren«, tadelte Zato Ruthi. »Wo ist Eure Empathie geblieben? Ihr müsst versuchen, die Lage aus ihrer Perspektive zu betrachten. Seht doch, wie primitiv ihre Ausrüstung und Behausungen sind! Keine einzige Waffe aus Metall ist zu sehen. Seht, wie schnell sie das Essen verschlungen haben, das wir ihnen mitgebracht haben! Stellt Euch vor, Ihr wärt in einem fremden Land weit weg von zu Hause, hungrig, verängstigt und umgeben von einer mächtigen Armee mit Waffen und Rüstungen, die den Euren weit voraus sind. Wenn eine Gruppe dieser Leute Euer Lager betreten wollte, würdet Ihr nicht auch ein Zeichen des Vertrauens erwarten?«
»Ich bin mein Leben lang Soldat gewesen, Meister Ruthi. Glaubt mir, auch wenn wir die besseren Waffen haben – diese Leute haben keine Angst vor uns, das sehe ich.«
»Dara ist das Land der Zivilisation«, sagte Ruthi streng. »Unsere Vorfahren kamen hierher, um die Wilden zu befrieden, und ich nehme an, dass die Götter unseren Ruhm weit über unsere Ufer hinaus verbreitet haben. Diese Barbaren haben den gefährlichen Weg des Wals gemeistert, um zu uns zu kommen, angezogen vom Glanz unserer Lebensart. Wir müssen ihnen unsere überragende Haltung zeigen. Ein gerechter Mann hat keinen Grund, Verrat zu fürchten, und selbst wenn sie etwas gegen uns im Schilde führten, dann werden sie unsere Rechtschaffenheit und unser Vertrauen sicher beschämen und sie erkennen lassen, wie falsch sie liegen. Entwaffnet Euch nun, sonst beflecken wir die Ehre unserer Herren, dem Kaiser von Dara und seinem Erstgeborenen.«
Zögernd legten Hauptmann Jima und die anderen Wachen ihre Waffen und Rüstungen auf einen Haufen neben die leeren Teller, auf denen zuvor die Geschenke gelegen hatten.
Pékyu Tenryo grinste noch breiter, dann wedelte er mit den Händen. Sein Gefolge wich zu den Seiten des Hai-Tores zurück und gab den Weg ins Lager frei.
Oben auf dem Hügel jubelten die Zuschauer von Dara.
»Sie gehen hinein!«
»Du hast scharfe Augen, Dümo. Kannst du sehen, was passiert?«
»Sie sind zu weit weg. Aber ich glaube, die Fremden haben sich soeben verbeugt. Vielleicht hat Meister Ruthi sie mit seiner Bildung beeindruckt? Und jetzt verbeugen sie sich wieder!«
»Aber sie tun es, nachdem Meister Ruthi und seine Männer schon hineingegangen sind. Warum sollten sie sich verbeugen, wenn er es gar nicht sehen kann?«
»Nun … daran sieht man, wie mangelhaft deine Bildung ist. Ich erinnere mich, einmal etwas über die Gebräuche der Eingeborenen auf der Halbmondinsel gelesen zu haben, als die Ano dort eintrafen. Sich hinter jemandem zum verbeugen ist ein Zeichen noch größeren Respekts, als sich vor ihm zu verbeugen.«
»Ich hatte ja keine Ahnung, dass du Experte für Heldensagen bist, Yehun! Stand das in der Sage über Er-dessen-Name-ein-Mundvoll-ist? Die habe ich auch gelesen!«
»Ähm … ja, das ist sie! Merkwürdig – es überrascht mich, dass du sie kennst. Nun, wie ich schon sagte, es war ein alter Brauch, der auf den Inseln gepflegt wurde, bevor die Ano sich dort niederließen, aber es macht natürlich absolut Sinn, wie du dich erinnern wirst – warte, warum lacht ihr drei denn wie die Hyänen hinter meinem Rücken?«
»Oh, Yehun, du armer, eingebildeter Esel! Es gibt gar keine Sagen von Er-dessen-Name-ein-Mundvoll-ist! Nur weil du der einzige toko dawiji unter uns bist, heißt das nicht, dass du immer auf alles eine Antwort haben musst.«
»… Ein überlegener Geist soll sich nicht mit den Albernheiten herumärgern, die ...«
»Willst du, dass wir dir weiterhin den einzigen ›Respekt‹ zollen, den du verdienst: uns vor Lachen zu krümmen?«
Zato Ruthi kniete sich im förmlichen mipa rari in der Mitte des Zeltes hin, das so hoch war wie drei übereinanderstehende Männer und etwa zwanzig Yards breit. Der Fußboden war mit den weichen Fellen eines unbekannten Tieres bedeckt. Ruthi betrachtete interessiert die Wände des Zeltes: Der Stoff war lichtdurchlässig und erinnerte ihn an die dünnen, pelzigen Membranen von Fledermausschwingen. Trotz seiner Belesenheit und seines Wissens konnte er nicht sagen, von welchem Tier die Häute stammten.
Der Häuptling der Barbaren schlenderte zum vorderen Teil des Zeltes und ließ sich in gekreuztem géüpa nieder. Andere Barbaren – Adlige und Häuptlinge, nach ihren schweren Kriegskeulen und dem kunstvoll gefertigten Schmuck aus Knochen und Muscheln zu urteilen – setzten sich wie sie gerade am Rand des Zeltes hin, einige im géüpa, andere sogar im thakrido, mit gespreizten und ausgestreckten Beinen, darunter auch die Frauen.
Hauptmann Jima, der neben Ruthi kniete, runzelte die Stirn. Ruthi war der Stellvertreter des Kaisers, und dass Pékyu Tenryo und seine Häuptlinge Ruthi mit solcher Respektlosigkeit behandelten, war inakzeptabel. Doch bevor er etwas sagen konnte, unterbrach ihn Zato Ruthi mit erhobener Hand.
»Vielleicht haben sie nicht dasselbe Verständnis von unseren Sitzhaltungen«, flüsterte Ruthi. »Was zivilisierte Menschen auszeichnet, ist Toleranz, und dass man Unwissenheit nicht mit Provokation verwechselt. Wir sollten diesen Pékyu Tenryo als den König seiner Leute ehren.«
Der Hauptmann biss die Zähne aufeinander und schwieg. Etwas an der Art, wie die barbarischen Häuptlinge und Edlen lachten und miteinander flüsterten, bereitete ihm Sorgen. All das wirkte nicht wie ein König, der den Abgesandten eines anderen Landes empfing, auch nicht wie eine Willkommensfeier für Fremde. Er konnte es nicht genau sagen, aber … warum sah Pékyu Tenryoso zufrieden aus?
Ein paar junge Barbaren brachten die Waffen und Rüstungen, die Ruthis Wachen am Eingang des Lagers deponiert hatten, und legten sie vor den König. Pékyu Tenryo sagte etwas zu den jungen Leuten, und sie nickten und verschwanden.
»Seht Ihr«, sagte Ruthi zu Jima, »es gibt nichts, worum Ihr Euch Sorgen machen müsst. Sie haben sogar Eure Waffen hereingebracht. Ich bin sicher, dass sie sie Euch bald zurückgeben werden, nachdem wir ihr Vertrauen gewonnen haben.«
Pékyu Tenryo betrachtete Zato Ruthi und dessen Männer, die unbehaglich in der Mitte des Zeltes saßen, und grinste noch breiter. Ruthi nickte und erwiderte das alberne Grinsen. Dann fingen die Adligen der Lyucu an, eine große, grobe Keramikschale herumzureichen und nacheinander einen Schluck daraus zu trinken, und kurz darauf füllten ihre lautstarken Gespräche das Zelt.
Nachdem Pékyu Tenryo selbst einen Schluck aus der Schale genommen hatte, bedeutete er einem seiner Männer, Ruthi die Schale zu bringen. Ruthi nahm sie respektvoll entgegen und inspizierte den Inhalt: etwas, das nach Alkohol und Milch roch und dessen Schaum sich am Rand der Schüssel abgelagert hatte.
»Kyoffir!«, sagte Pékyu Tenryo und deutete auf die Schale. Dann machte er eine Gebärde, als würde er einen herzhaften Schluck nehmen.
Ruthi hob die Schale an den Mund. Das Getränk roch nicht nach Kuhmilch oder Ziegenmilch, auch nicht nach Stutenmilch, sondern eher nach Kräutern. Vorsichtig nahm er einen Schluck. Es schmeckte kräftig, ein wenig medizinisch und brannte in der Kehle. Die Konsistenz des Getränks war dickflüssig, ähnlich einem alkoholischen Joghurt. Es war außerdem ziemlich stark, und Ruthi, der normalerweise nur selten trank, hustete und keuchte, während ihm die Tränen in die Augen traten.
Die adligen Lyucu brachen in lautes Gelächter aus, und selbst Pékyu Tenryo kicherte. Ruthi wischte sich die Augen und stellte die Schale beschämt grinsend zu Boden.
Glücklicherweise kehrten in diesem Moment die Wachen, die kurz zuvor weggeschickt worden waren, mit mehr Waffen und Rüstungen zurück. Diese legten sie auf einen zweiten Stapel neben den ersten, und Pékyu Tenryo stand auf, ging hinüber und nahm von jedem Stapel einen Helm, die er miteinander verglich, ohne Ruthi weiter Beachtung zu schenken.
»Die Waffen aus diesem anderen Haufen sehen auch so aus, als stammten sie aus Dara«, sagte Hauptmann Jima. Er gab sich nicht mehr die Mühe, zu flüstern, da die Barbaren ganz offensichtlich die Unterhaltung zwischen ihm und Ruthi nicht besser verstehen konnten als sie ihre. »Woher haben sie sie? Von den Piraten?«
»Dieses Schwert …« – Ruthi kniff die Augen zusammen –»scheint aus Xana zu stammen. Wenn ich mich nicht irre, ist das ein Helm aus der Zeit von Mapidéré, also über zwei Dekaden alt.«
»Kaiser Mapidérés Expedition?«
Ruthi nickte. »So muss es sein.«
Pékyu Tenryo nahm noch andere Gegenstände von dem einen Stapel – ein Schwert, einen Handschuh, einen Helm, einen Schild, einen Bogen – und suchte im anderen Stapel nach den Gegenstücken, die er untersuchte und verglich. Von Zeit zu Zeit rief er ein paar seiner Edlen zu sich, und die kleine Gruppe untersuchte dann die Waffen, wobei sie laut miteinander sprachen und stritten.
Ruthi und Jima verfolgten verwirrt dieses mysteriöse Vorgehen.
»Vielleicht vergleichen sie die Kunstfertigkeit der Gegenstände, um sicherzugehen, dass wir tatsächlich die Urheber dieser wunderbaren Artefakte sind, die sie von Kaiser Mapidéré bekommen haben«, sagte Ruthi hoffnungsvoll.
Schließlich schien Pékyu Tenryo zufrieden zu sein und befahl seinen Wachen, all die Waffen und Rüstungen wegzubringen. Dann trugen die Wachen ein großes, flaches, rundes Tablett herein, das aus einer dünnen Schicht Haut zu bestehen schien, das über gebogenem Knochen gespannt war, und legten es vor Ruthi hin. Das Tablett war mit Sand gefüllt.
Pékyu Tenryo erhob sich und setzte sich Ruthi gegenüber – natürlich im thakrido –, sodass das Tablett mit Sand zwischen ihnen lag. Dann nahm er einen Stock und begann im Sand zu malen.
Ruthi sah zu, wie Pékyu Tenryo eine Linie durch den Sand zog und dann einen kleinen Kreis darüber. Der König der Barbaren warf Ruthi einen Blick zu und deutete dann zur Zeltdecke.
Er will mir sagen, dass der Kreis die Sonne darstellt und die Linie das Land, dachte Ruthi.
Pékyu Tenryo zeichnete ein paar Ovale in den Himmel, aus denen geflügelte Ruder ragten. Die Zeichnungen mochten grob sein, doch es war deutlich, dass diese die Kaiserlichen Luftschiffe darstellen sollten. Daraufhin malte er einige pilzförmige Objekte am anderen Ende des Landes, die offenbar das barbarische Lager darstellen sollten.
Pékyu Tenryo tat nun so, als ducke er sich ängstlich, während er gleichzeitig zur Decke des Zeltes blickte. Dann grinste er wieder und reichte Ruthi den Stock, doch dem war nicht klar, was er damit sollte.
Pékyu Tenryo nahm den Stock zurück und zeichnete ein paar Pfeile, die aus den Luftschiffen gegen das Lager flogen, dann reichte er Ruthi den Stock zurück. Er sah Ruthi fragend an und tat wieder so, als würde er sich fürchten.
Ruthi lachte. »Nein, nein! Die Schiffe sind nur hier, um euch willkommen zu heißen; nicht, um euch anzugreifen.«
Pékyu Tenryo sah ihn fragend an.
Ruthi versuchte es noch einmal. Er löschte die Pfeile aus dem Sand und versuchte, Blumen zu zeichnen, die aus den Luftschiffen auf das Lager regneten – doch die Blumen sahen eher aus wie Schneeflocken.
»Frieden!«, rief er, als ob der Barbar ihn besser verstehen würde, wenn er lauter sprach. »Nicht Krieg!« Dann grinste er wieder und machte eine umarmende Gebärde, tat so, als trinke er aus der großen Schale und schmatzte laut.
Pékyu Tenryo sah noch verwirrter aus. Dann schien ihm etwas Neues einzufallen. Er zeichnete ein paar Strichmänner auf Pferden unter die Luftschiffe – die Kaiserlichen Abgesandten – und zeichnete die Barbaren, wie sie aus dem Lager liefen – mit hocherhobenen Keulen rannten sie auf die Armee Daras zu.
Grinsend reichte er den Stock wieder an Ruthi zurück.
Ruthi sah ihn angespannt an und breitete fragend die Arme aus.
Pékyu Tenryo tat so, als lachte er – er hielt sich den Bauch, als müsse er sich über einen Witz förmlich ausschütten. Dann deutete er wieder auf die Zeichnung im Sand.
»Ah, er meint es nur hypothetisch«, sagte der erleichterte Ruthi. »Es ist ein Scherz.«
»Das glaube ich nicht«, sagte Jima. »Dies ist kein Thema für Scherze; er will unsere Verteidigungsfähigkeit erfahren. Meister Ruthi, wir sollten sofort gehen.«
»Unsinn«, sagte Ruthi. »Hier geht es um zwei Köpfe, die zu kommunizieren versuchen. Setzt Eure verkümmerte Empathie ein, Hauptmann Jima! Wenn er so gern erfahren möchte, wie wir reagieren würden, ist es dann nicht besser, ihm die Macht von Daras Armeen in einer Sandkiste zu zeigen, als dass er sie im wirklichen Kampf herausfindet? Der Kaiser hat immer gewollt, dass so wenig Leben wie möglich verschwendet werden.«
Also malte Ruthi in den Sand. Als ehemaliger König von Rima hatte er einige Kenntnis von klassischer militärischer Kriegsführung. Er verwendete eine Reihe von Diagrammen, um Pékyu Tenryo zu zeigen, wie sich die Kaiserlichen Reihen formieren würden, wie sie im Zentrum zurückfallen und die Barbaren gleichzeitig mit beiden Flügeln flankieren würden, bis die Angreifer umringt wären. Dann illustrierte er, wie die entwaffneten Barbaren niedergemetzelt oder geköpft würden.
Der Ausdruck von Bewunderung und Entsetzen auf Pékyu Tenryos Gesicht wirkte absolut echt.
»Aber Ihr braucht Euch keine Sorgen zu machen!«, beeilte Ruthi sich, seinem Gastgeber zu versichern. »Das ist bloß hypothetisch. Hy-po-the-tisch! Angenommen!« Er hielt sich gespielt den Bauch und lachte.
Pékyu Tenryo nickte heftig und grinste den Kaiserlichen Gesandten liebenswürdig an.
Zato Ruthi war beschwingt. Mochte er auch in den Wäldern von Rima einst eine schmähliche Niederlage von der Hand von Gin Mazoti erlitten haben – heute war es ihm gelungen, einen Barbarenkönig einzuschüchtern und zu beeindrucken, indem er bloße Bilder in den Sand malte!
Pékyu Tenryo wischte das Tablett mit Sand wieder glatt und zeichnete erneut die Kaiserlichen Luftschiffe über dem Lyucu-Lager. Wieder tat er so, als ducke er sich ängstlich, und schaute dabei nach oben; dann hielt er sich wieder den Bauch und tat, als ob er lachte.
Rein hypothetisch: Wie würde der Kaiser von Dara mich aus der Luft angreifen?
Alle anderen barbarischen Häuptlinge versammelten sich um das Sandtablett. Pékyu Tenryo reichte Ruthi den Stock und bedeutete ihm, fortzufahren.
»Meister Ruthi«, bat Hauptmann Jima. »Das fühlt sich wirklich nicht richtig an. Ihr solltet ihnen nicht unsere Fähigkeiten oder unsere Luft-Boden-Strategien erklären. Wir selbst wissen beinahe nichts darüber, wie sie kämpfen!«
»Pst! Ihr benehmt euch wie ein paranoider, dummer Bauer anstatt wie ein selbstbewusster Offizier der Kaiserlichen Armee. Was ist falsch daran, ihnen zu zeigen, was unsere Luftschiffe ausrichten können? Unsere Macht wird sie mit Ehrfurcht erfüllen und sie dazu bringen, uns den angemessenen Respekt zu zollen. So beeindruckt eine große Zivilisation eine geringere.«
Und so zeichnete Ruthi weiter im Sand und zeigte den Barbaren, wie die Luftschiffe von Dara mit Feuerbomben angriffen.
Pékyu Tenryo hielt fünf Finger hoch, ballte dann die Hand zur Faust und hielt dann wieder fünf Finger hoch. Er deutete auf die Luftschiffe, breitete dann die Hände aus und sah Ruthi fragend an.
Ruthi grübelte eine Weile, dann verstand er, worauf Pékyu Tenryo hinauswollte. Er zeichnete ein Luftschiff und füllte es mit kleinen Kreisen, zeichnete dann ein paar Kreise, wie sie aus dem Luftschiff auf das Lager fielen – eine Salve von Feuerbomben. Er hielt Pékyu Tenryo alle zehn Finger hin, ballte sie zu Fäusten und zeigte erneut zehn Finger … diesen Vorgang wiederholte er fünf Mal, um zu zeigen, dass jedes Luftschiff fünfzig Feuerbomben mit sich führte. Mehr als genug, um dem Lager massiven Schaden zuzufügen. Dann löschte er die kleinen Kreise im Luftschiff, um zu zeigen, dass es jetzt leer war.
Pékyu Tenryo grinste und sagte etwas zu seinen Adligen, die daraufhin alle lachten. Dann nahm Pékyu Tenryo die Schale mit alkoholischem Joghurt – dem Kyoffir – und reichte sie Ruthi. Ruthi trank nur zu gern daraus. Das starke Getränk hatte eine positive Wirkung auf seine Stimmung.
»Danke für die Information«, sagte Pékyu Tenryo. Sein Akzent war stark, doch die Worte waren deutlich zu verstehen.
Ruthi sah verwirrt über den Rand der Kyoffir-Schale. Hinter ihm sprangen Jima und die restlichen von Ruthis Männern alarmiert auf. Doch es war zu spät. Pékyu Tenryos Keule war bereits auf Ruthis Schädel niedergegangen, und die anderen Edlen der Lyucu machten mit dem Rest der Delegation von Dara kurzen Prozess.
»Jetzt passiert etwas! Sie kommen aus dem großen Zelt!«
»Aber wo ist Meister Ruthi?«
»Warum liegt die Kaiserliche Standarte auf dem Boden?«
»Stellen sie sich auf, um sich zu ergeben?«
Das Geplapper der Menge erstarb, als die Barbaren aus dem Lager strömten, sich zu langen Reihen formierten und dann mit geschwungenen Keulen auf die Kaiserlichen Reihen zumarschierten. Die Meeresbrise trug ihre Rufe zur Menge hinüber: Es waren eindeutig Kriegsschreie.
Obwohl das Heer aus Lyucu, das etwa eine Meile entfernt heranmarschierte, den Kaiserlichen Truppen zahlenmäßig überlegen war, machte Ra Olu sich keine Sorgen. Er befahl seinen Schlachtreihen, vorzurücken, um sich dem Angriff der Barbaren entgegenzustellen. Man gab den Luftschiffen Fahnensignale, dass sie sich der barbarischen Horde nähern und sie bombardieren sollten.
»Diese Clowns wagen es, den mächtigen Prinz Timu anzugreifen!«
»Sie werden sterben, bevor sie überhaupt wissen, wie ihnen geschieht!«
»Drängt sie zurück ins Meer!«
Die Barbaren kamen näher. Wer scharfe Augen hatte, konnte den beklagenswerten Zustand ihrer Waffen und Kleider erkennen; selbst die Piraten waren besser ausgerüstet gewesen. Die Zuschauer aus Dasu verspürten daher keineswegs Angst, sondern warteten gespannt darauf, Zeuge eines ungleichen Gemetzels zu werden.
»Dies wird ein Tag, der in Liedern und Geschichten besungen werden wird.«
»Sehen sie denn nicht, wie hoffnungslos unterlegen sie sind?«
»Ich kann nicht glauben, wie dumm diese Wilden sind!«
»Sind darunter etwa auch Frauen? Wie grausam müssen ihre Ehemänner und Väter sein!«
Der Vormarsch der Lyucu blieb gerade außerhalb der Schussweite der Bogenschützen unter Ra Olus Befehl stehen.
Haben sie plötzlich erkannt, wie sinnlos ein Angriff wäre?, dachte Ra Olu. Er gab den Luftschiffen den Befehl, zu sinken und das Bombardement zu beginnen.
Wie Tänzer in einer Choreografie strafften die Gasmänner in den Luftschiffen die Bänder um die Gasbeutel, um den Auftrieb zu verringern, und die Ruderer zogen fest an den gefederten Rudern. Wie riesige Mingén-Falken, die sich auf ihre Beute stürzten, sanken die Luftschiffe aus Bambus und Seide herab. Die Soldaten in den Gondeln bereiteten die Eimer mit brennendem Teer vor und öffneten die Bombenluken, während die Schiffe über die Formation der Barbaren hinwegflogen.
Die Kommandanten der Lyucu pfiffen, und die Horde teilte sich in kleine Gruppen von je etwa fünfzig Personen. Die meisten der Männer und Frauen duckten sich, während die, die am Rand der Formation positioniert waren, ihre Kriegskeulen hoben und sie zwischen ihren Füßen aufrecht in den Boden rammten wie Speere. Die Kauernden halfen, Laken aus hautartigem Material zwischen den Spitzen der Keulen aufzuspannen – offensichtlich dasselbe Material, aus dem auch ihre Zelte gefertigt waren. Tatsächlich sah es so aus, als wären in Windeseile kleine Zelte über den Köpfen der barbarischen Krieger gewachsen.
Es schien ein aussichtloses Unterfangen – das Material sah so dünn und leicht aus, dass es beinahe durchsichtig war; sicherlich würden die Feuerbomben kurzen Prozess damit machen.
Die Teerbomben trafen die Schutzstände und explodierten. Ein paar der Bomben trafen neben den Zelten auf den Boden und spritzten brennenden Teer gegen die bloßen Beine und Körper der Lyucu-Krieger am Rand der Formationen. Sie schrien, heulten, ließen ihre Keulen fallen und rollten sich auf dem Boden herum, doch die Krieger, die ihnen am nächsten saßen, übernahmen sofort die Aufgabe, die Keulen zu halten, damit die Zelte nicht in sich zusammenfielen.
Der brodelnde Teer brannte sich in ihre Haut und in ihr Fleisch, ihre mitleiderregenden Schreie wurden erst lauter, dann immer schwächer, die zappelnden Glieder und sich krümmenden Körper wurden langsamer und blieben schließlich reglos liegen.
Die Soldaten und Zuschauer von Dara jubelten. Dieses Gemetzel war noch aufregender, als sie gedacht hatten.
Doch schon bald verwandelte sich ihr Jubel in verblüffte Schreie.
Die explodierten Teerbomben hatten die behelfsmäßigen Zelte über den Köpfen der Barbaren in Seen aus flammender Lava verwandelt, doch irgendwie hielt das dünne Material. Der siedende rauchende Teer brannte hell auf den Membranen, ohne sie jedoch zu entflammen.
Die Lyucu-Krieger, die sich unter dem Schutz duckten, begannen ihre Keulen rhythmisch in die Höhe zu stoßen, sodass der Stoff wogte wie die Oberfläche des Meeres. Ein Großteil des brennenden Teeres wurde schon bald von den Wellen hinuntergeschoben und fiel harmlos zu Boden.
Die Luftschiffe wendeten und setzten zu einem zweiten Bombardement an. Die Kapitäne, die nun begriffen, dass die Zelte weitaus feuerabweisender waren, als sie ursprünglich angenommen hatten, änderten rasch ihre Taktik und befahlen den Bombern, ihre Ladung neben die Zelte zu werfen statt direkt darauf. Damit hofften sie, ausreichend viele der Krieger am Rand zu treffen, sodass die Zelte in sich zusammenfallen würden.
Doch auch darauf waren die Lyucu-Krieger vorbereitet. Als die Flugschiffe auf die Unterstände zusteuerten, bewegten sich die Krieger darunter wie ein Mann: Hunderte von Beinen marschierten im Gleichschritt und trugen die Unterstände auf die herabsinkenden Luftschiffe zu, sodass die Bomben erneut wirkungslos auf den schützenden Stoffen über ihren Köpfen landeten.
Ein paar Formationen gab es, denen es nicht gelungen war, ihre Geschwindigkeit rechtzeitig anzupassen. Sie gerieten in die Pfützen brennenden Teeres zwischen den Unterständen, und die verletzten Krieger mussten sich auf dem Boden wälzen, um die Feuer zu löschen, während die anderen ihnen hektisch auswichen. Doch die meisten der marschierenden Unterstände entkamen dem zweiten Bombardement ebenso unverletzt wie dem ersten.
Ra Olu begriff, dass er die Barbaren unterschätzt hatte. Sie schienen überraschend gut auf Luftangriffe vorbereitet zu sein. Doch zu Zeiten des Chrysanthemen-Löwenzahn-Krieges war er ein erfahrener Kommandant bei den Tiefflugangriffen gewesen, und er war geübt darin, sich schnell ändernden Bedingungen anzupassen. Augenblicklich gab er zusätzliche Befehle, die die Fahnentruppen in Windeseile an die Luftschiffe signalisierten.
Die Luftschiffe wendeten ein weiteres Mal und näherten sich nun dem Lager der Barbaren. Als sie die Reihen der vielbeinigen beweglichen Zelte überflogen, die wie Quallen über eine ruhige See schwammen, ließen sie eine weitere Salve von Feuerbomben fallen. Die Schiffe flogen nun sehr tief und synchronisierten ihre Bewegungen, sodass alle Bomben ungefähr in einer Linie zwischen den barbarischen Angreifern und ihrem Lager landeten. Als die Bomben explodierten, bildete der brennende Teer eine flammende Barriere, die die barbarische Horde von ihrer Basis trennte. Die zusammengedrängten Kämpfer konnten nur zusehen, wie ihnen der Rückweg abgeschnitten wurde.
Ra Olu grinste und gab den Kaiserlichen Truppen den Befehl, vorzurücken. Sobald sie in Reichweite waren, würde Ra Olu den Bogenschützen den Befehl zum Schießen geben: Die Barbaren würden zwischen der Feuerwand hinter ihnen und der Wand aus Pfeilen vor ihnen gefangen sein. Währenddessen würden die Luftschiffe weiterfliegen und die Schiffe der Barbaren bombardieren. Die gesamte Invasionsmacht der Lyucu würde hier und heute am Strand von Dasu sterben.
Die Luftschiffe näherten sich der Lyucu-Flotte, wie die großen Mingén-Falken sich frischem Fischgrund näherten. Die Stadtschiffe waren wie fette, saftige Fische, die im seichten Gewässer feststeckten und nur darauf warteten, aufgepickt zu werden.
Ra Olus Schlachtreihen rückten stetig vor. Mit jedem Schritt waren die Eindringlinge ihrem Tod ein Stück näher.
»Feuer!«, befahl Ra Olu.
Tausende von Pfeilen überbrückten in Sekundenschnelle die Entfernung zwischen den Kaiserlichen Linien und denen der Barbaren.
Doch auch die Lyucu-Krieger hatten ihre Position verändert. Die Laken aus dem fremden, hautartigen Material, an dem noch Reste brennenden Teeres klebten, spannten sich nun wie breite Schilde vor der vordersten Reihe auf. Die Krieger ganz vorn traten dabei auf den unteren Rand der Häute und lehnten sich vor, die Kriegskeulen fest in den Boden und gegen die Membran gestemmt, während die Krieger hinter ihnen den oberen Rand der Häute zurückzogen, sodass sie alle in dieser gewölbten »Tasche« Schutz fanden.
Die Pfeile prallten gegen die Häute und fielen nutzlos zu Boden, auch wenn einige der Krieger, die sich vorn gegen die Häute stemmten, bei der Wucht des Aufpralls vor Schmerz aufstöhnten. Manche brachen sich sogar ein paar Rippen oder Armknochen.
Was ist das nur für ein außerordentliches Material?, grübelte Ra Olu. Ich habe noch nie von so einer festen Haut gehört. Von welcher Kreatur stammt sie?
Doch er hatte nicht die Zeit, lang über dieses Rätsel nachzudenken. Schreckensschreie erhoben sich von seinen Soldaten und auch von den Zuschauern. Ra Olu sah auf, und die Trompete in seiner Hand fiel zu Boden.
In der Ferne krochen riesige, albtraumhafte Monster aus den großen Stadtschiffen und erhoben sich in die Lüfte.
Diese Kreaturen widersprachen allem, was Ra Olu je gesehen hatte – es waren unmögliche Verschmelzungen von Merkmalen der unterschiedlichsten Tierarten: ein fassförmiger Körper, der die Größe von drei oder vier Elefanten haben musste, wenn man die in der Nähe schwebenden Luftschiffe als Maß nahm; ein schlangenförmiger Schwanz, der sich hinter ihnen durch die Luft wand; zwei mit Klauen besetzte Füße, ähnlichen denen eines Falken, die unter dem Bauch hervorwuchsen; ein Paar große, ledrige Flügel, die sich über hundertzwanzig Fuß oder mehr ausbreiteten; und ein langer, schlanker Hals, auf dem ein hirschartiger Kopf mit Geweih saß.
Zehn, zwanzig, dreißig und mehr von ihnen erhoben sich in die Luft. Mit ihren langen Flügeln und Hälsen schien jede der Kreaturen etwa zwei Drittel eines Luftschiffs auszumachen, obwohl ihre Körper viel schmaler waren. Die Monster setzten zum Sturzflug an und schossen auf die Luftschiffe zu, mit einer Geschwindigkeit, die angesichts ihrer massigen Gestalt unvorstellbar schien.
Der Kapitän des ersten Luftschiffs war vor Entsetzen wie gelähmt und hatte keine Chance, einen Befehl zu geben, ehe sich zwei der Monster bereits auf das Schiff stürzten. Sie schlugen mit ihren Krallen zu und schnappten mit den Kiefern, verbissen sich und rissen die langen Hälse wild hin und her. Die seidene Hülle und die Bambusrahmen zerbrachen unter den Klauen und Zähnen wie Zahnstocher, und die Gasbeutel waren innerhalb von Sekunden durchlöchert. Die Besatzung schrie und sprang aus den Gondeln, Hunderte von Metern hinab in den Tod.
Die Kapitäne der übrigen Luftschiffe erwachten aus ihrer Betäubung und befahlen den Abschuss von Feuerpfeilen, während die Ruderer mit aller Macht ruderten, um die Luftschiffe zum Rückzug anzutreiben. Doch die Pfeile prallten harmlos von den Flügeln und Körpern der Monster ab, wie Mücken auf Elefantenhaut. Einige von ihnen trafen sogar andere Luftschiffe und setzten sie in Brand.
Und nun endlich verstand Ra Olu, aus welchem Material die Zelte und Schildplanen der Barbaren gemacht waren.
Die Monster senkten sich auf die Flotte der Kaiserlichen Luftschiffe herab, die noch vor Kurzem so anmutig und wendig gewirkt hatte, jetzt aber neben dem rasenden Flug dieser tödlichen Kreaturen viel zu unbeholfen und langsam schien. Keines der Luftschiffe hielt dem Angriff von zwei oder drei dieser Monster länger als eine Minute stand.
Brennende Wrackteile regneten vom Himmel und segelten im Wind wie Wolken bei Sonnenuntergang. Sterbende Männer sprangen aus den qualmenden Schiffsrümpfen und stürzten schreiend in den Tod. Viele der Zuschauer aus Dasu bedeckten ihre Augen vor diesem Anblick. Einige packten bereits ihre Wagen, um zu fliehen.
Bald war kein Luftschiff mehr am Himmel zu sehen. Die schrecklichen Monster sammelten sich zu einer lockeren Formation und steuerten auf die Kaiserlichen Linien zu.
Erst jetzt begriff Ra Olu, dass der erste Angriff der Lyucu bloß eine Falle gewesen war. Das Manöver hatte die Stärke der Kaiserlichen Armeen testen sollen, sie zum Angriff verleiten, um ihre Taktiken zu offenbaren, während die Barbaren sie lediglich in Schach hielten, bis die Luftmonster befreit waren.
Ra Olu wusste, dass er eine Entscheidung treffen musste und dass er nur eine einzige Chance hatte.
»Angriff!«, befahl er.
Die schockierten Kaiserlichen Soldaten besaßen noch genug Disziplin, um zu gehorchen. Bogenschützen traten vor und gaben eine weitere Salve von Pfeilen ab, dann ließen sie die Bogen sinken und zogen ihre kurzen Verteidigungsschwerter. Sie blieben zurück, während die Speerträger vortraten und mit gesenkten Speerspitzen auf die barbarische Horde zurannten.
Die Barbaren ließen ihre Schutzhaut fallen, stießen einen ohrenbetäubenden Kriegsschrei aus und stürzten sich mit ihren Keulen auf die Kaiserlichen Schlachtreihen.
Wie eine Flutwelle, die auf einen felsigen Strand bricht, prallten die beiden Seiten aufeinander. Knochen schlugen auf Schilde, Speere und Schwerter bohrten sich in Fleisch. Männer und Frauen heulten und brüllten, bluteten und starben.
Über ihnen glitten die Monster über den Mahlstrom der gegnerischen Truppen hinweg und auf die Zuschauer jenseits der Kaiserlichen Linien zu.
Die Zivilisten aus Dasu, die dem Schauspiel der ersten Begegnung mit den Fremden hatten beiwohnen wollen, schrien auf und sprengten auseinander. Wagen rumpelten gegeneinander; Pferde trampelten über Menschen hinweg; die Reichen brüllten nach ihren Dienern – doch alle Diener, die ihre Sinne halbwegs beisammenhatten, waren längst geflüchtet. Alles versank im Chaos.
Die Monster stießen herab und bremsten erst dreißig oder vierzig Fuß über dem Boden ab. Mit wild schlagenden Flügeln schwebten sie dicht über der Erde, und alle, die in den Luftstrom ihrer großen Schwingen gerieten, kauerten sich ängstlich zusammen.
Nur wenige Männer und Frauen waren mutig genug, hinaufzusehen, und was sie da sahen, ließ ihre Herzen erstarren: Die Oberkörper der Monster waren mit einem feinen Netz aus festen Fasern und Sehnen überzogen, und ein gutes Dutzend barbarischer Krieger hatte sich zu beiden Seiten der Kreaturen festgehakt wie Matrosen in die Takelage eines hohen Schiffes. In den Händen hielten sie Speere aus Knochen und Steinschleudern. Ein einzelner Reiter mit einem aus einem Tierschädel gefertigten Helm saß sicher festgegurtet in einem Sattel am Halsansatz jeder Kreatur.
Die Augen der Männer und Frauen, die die Monster ritten, waren ebenso dunkel und unerbittlich wie die reptilienartigen Augen ihrer Reittiere.
Die Monster richteten sich auf, öffneten und schlossen ihre massiven Kiefer mehrmals und präsentierten lange, scharfe Reißzähne, die aussahen wie gebogene Schwerter; dann stießen ihre Köpfe vor, und Feuerströme schossen aus ihren Mäulern.
Es war, als wäre der Mount Kiji endlich ausgebrochen. Dutzende feuriger Flammenzungen, jede einzelne fast einhundert Fuß lang, fuhren über die Menge hinweg und verwandelten den Boden in kochende Lava. Einige wurden sofort zu Asche verbrannt, andere rannten schreiend und brennend davon. Der Gestank von verkohltem Fleisch erfüllte die Luft, und der beißende Rauch verdunkelte alles. Es war wahrhaftig eine Szene aus der Hölle.
Die Kaiserlichen Soldaten, die noch immer in ihren Schlachtreihen verharrten, warfen einen Blick zurück und erstarrten. Die barbarischen Krieger brachen beim Anblick der Zerstörung, die ihre Unterstützer aus der Luft anrichteten, in Jubelgeheul aus und brüllten wie aus einer Kehle: »Garinafin, Garinafin! Pékyu Tenryo! Pékyu Tenryo!«
Die Armee von Dara verließ der Mut. Die Kaiserlichen Reihen fielen in sich zusammen, als die Soldaten erst wankten und dann aus Leibeskräften rannten. Die Barbaren stürmten vor und schlugen ihnen mit den Keulen die Schädel ein. Die fliegenden Monster nahmen die Verfolgung der Überlebenden auf, die ihre Reiter mit präzisen Schleudergeschossen niedergestreckt hatten …
In der Ferne peitschte Ra Olu sein Pferd zu noch schnellerem Galopp an. Er war geflohen, gleich nachdem er den Befehl zum Angriff gegeben hatte.
Sein Herz schmerzte bei dem Gedanken an die jungen Männer, die er in den Tod geschickt hatte, doch es war die einzige Möglichkeit gewesen, sich selbst die Flucht zu ermöglichen und die Nachrichten nach Daye zu bringen.
Alle Geschichten, die die Piraten erzählt hatten, waren wahr. Die Eindringlinge waren über alle Maßen stark, und Dasu war verloren.
Kapitel 3
DIE STANDHAFTIGKEIT DES PRINZEN
In Daye wurde ein schnelles Kaiserliches Botenschiff bereitgestellt, das die Nachricht von der Invasion zum Kaiser bringen sollte.
Damit es so schnell wie möglich segelte, war das Schiff, abgesehen von den Ruderern, ohne Mannschaft – und die meisten von ihnen waren Frauen, die man nach ihrem geringen Gewicht, ihrer Kraft und Ausdauer ausgewählt hatte. Statt sich auf das Trommeln eines Bootsführers zu verlassen, würden sie sich durch das Singen beliebter Volkslieder selbst im Takt halten. Man entledigte sich allen Ballasts, der nicht unbedingt notwendig war, entnahm dem Schiff inwendige Dammbalken, lud Waffen und Rüstungen ab – abgesehen davon, dass Pfeile oder Spieße oder Ankerhaken sowieso nicht viel gegen die fliegenden Monster der Barbaren würden ausrichten können, die offenbar Garinafin hießen. Außerdem würde das Schiff keinen Proviant oder Wasser mit sich führen – die Besatzung würde ihren Durst mit dem Wasser stillen, das an der seidenen Ballonhülle kondensierte, wenn das Schiff durch die Wolken fuhr.
Trotz Ra Olus unermüdlichen Drängens weigerte sich Prinz Timu, das Schiff zu besteigen und zu fliehen.
»Es wäre sinnlos, mich auf die Ruderbänke zu setzen«, sagte der Prinz. »Ich wäre nach nicht mal einer Viertelstunde erschöpft. Jetzt wünschte ich wirklich, ich hätte auf Théra und Phyro gehört und der körperlichen Ertüchtigung mehr Beachtung geschenkt.«
Ra Olu stampfte frustriert mit dem Fuß auf. »Niemand bittet Euch, zu rudern! Eure Sicherheit ist im Moment das Allerwichtigste.«
»Unsinn. Meister Ruthi hat mich immer gelehrt, dass die Menschen ohne Glauben und Loyalität kaum besser sind als Tiere. Der Kaiser hat mich hergeschickt, um das Leben der Menschen in Dasu zu verbessern. Jetzt, da sie in Gefahr sind, wäre es sowohl ein Verrat an ihnen wie auch an dem Vertrauen, das mein Kaiser in mich setzt, wenn ich sie im Stich ließe.«
Ra Olu dachte an seine eigene Flucht vom Schlachtfeld und errötete.
Timu, der Olus Schweigen für Niedergeschlagenheit hielt, versuchte, ihn zu trösten. »Seid nicht zu traurig über den Verlust von Meister Ruthi. Er wollte immer in Übereinstimmung mit den Prinzipien der Moralistischen Weisen leben. Und ich bin sicher, er ist ohne Reue gestorben.«
Etwa eine Stunde lang schluchzte Timu über den Tod von Zato Ruthi, seinem Lehrer und Bildner seines Geistes. Es würde in ganz Dara nie wieder einen Gelehrten geben, der so sanft und nachgiebig war.
Dann wischte er die Tränen fort. Er hatte seine Pflichten nicht vergessen.
Aufgrund von Ra Olus Beschreibungen war Timu darauf vorbereitet, dass die Garinafin-Reiter jeden Augenblick am Himmel auftauchen konnten, gefolgt von barbarischen Fußsoldaten, die über das Land marschierten. Doch der Himmel im Osten blieb leer.
Als Ra Olu die Geflüchteten befragte, die vom Land in die Stadt strömten, erfuhr er, dass die Garinafin keineswegs die heranrückende Armee der Barbaren nach Daye führten, sondern noch immer an dem Strand lagerten, an dem sie die zweitausend Mann starke Armee von Dasu vernichtet hatten.
»Haben sie etwa vor, die Leichen der gequälten Soldaten zu entweihen?«, fragte Prinz Timu mit zitternder Stimme.
Ra Olu schüttelte den Kopf. »Der barbarische König, dieser Pékyu Tenryo, ist schlau. Er hat eine lange Zeit mit Meister Ruthi gesprochen, bevor er angriff, und man kann annehmen, dass er versucht hat, dem Meister nützliche Informationen zu entlocken. Sein Angriff war sorgfältig geplant und schien darauf abgerichtet, uns den größtmöglichen Schaden zuzufügen. Ich glaube nicht, dass er sich die Gelegenheit entgehen lassen würde, einen Blitzangriff gegen uns zu führen und ganz Dasu einzunehmen, wenn diese Garinafin dazu in der Lage wären.«
»Was meint Ihr damit?«
Geduldig erklärte sich Ra Olu. »Nach großen Anstrengungen brauchen die meisten Tiere etwas Zeit, um sich zu erholen. Denkt an den langbeinigen Leoparden von Écofi, von dem es heißt, er sei das schnellste Tier auf dem Land: Er rennt so schnell wie der Blitz durch das Gras, um seine Beute zu jagen, doch dann muss er sich einen halben Tag lang ausruhen, bevor er auch nur wieder aufstehen und sich bewegen kann. Wenn man die feurigen Anstrengungen bedenkt, die ich bei den Garinafin gesehen habe, würde es mich nicht überraschen, wenn sie jetzt Zeit brauchen, um sich zu erholen.«
»Zeit zur Erholung …«, murmelte Timu. »Aber dann … dann sind sie doch nicht unverwundbar. Auch wenn sie Feuer atmen und eine Haut aus Stahl zu haben scheinen.«
»Nein. Ich bin sicher, auch sie sind sterblich, genau wie Ihr und ich. Sie können nicht ohne Pause über Dara fliegen und alles mit ihrem feurigen Tod überziehen.«
Prinz Timu rief nach Pinsel und Tinte und beeilte sich, dem Bericht an Kaiser Ragin noch einen Satz hinzuzufügen.
Das Botenluftschiff verließ die Stadt ohne Prinz Timu an Bord.
Als die Barbaren später am Tag die Stadt Daye erreichten, fanden sie die Stadttore weit offen. Die Garinafin – etwa dreißig an der Zahl – watschelten zwischen den Kriegern wie seltsame, übergroße Wale mit Hühnerfüßen, die sich mit der Fortbewegung an Land schwertaten. Ihre Flügel hatten sie eng um den Körper gefaltet.
Prinz Timu, der mit Ra Olu vor den Stadttoren stand, fühlte sich an die fantastischen Kreaturen erinnert, die ein Mann namens Kita Thu bei der Kaiserlichen Prüfung vor einigen Jahren präsentiert hatte, als er Kaiser Ragins Reich mit einem Cruben-Wolf verglich, der weder an Land noch im Wasser zu Hause war.
»Ich hörte, die Männer von Dara würden Ehrenhaftigkeit hoch schätzen«, erklärte Pékyu Tenryo, der auf dem Hals eines reinweißen Garinafin ritt, welcher sogar noch größer zu sein schien als seine grauen Artgenossen. »Doch sind sie in Wahrheit so feige, dass sie nicht einmal gegen mich kämpfen wollen, ehe sie um ihr Leben betteln.« Trotz seines Akzents war die Arroganz in seiner Stimme unüberhörbar.
Timu sah dem Barbarenkönig ins Gesicht und antwortete: »König Pékyu Tenryo, Ihr missversteht mich. Ich bin keineswegs hier, weil ich um mein Leben zu betteln gedenke. Ihr könnt es nehmen, wenn Ihr das wünscht.«
Pékyu Tenryo blickte amüsiert auf den jungen Prinzen herab. »Mein Name ist Tenryo Roatan. Pékyu ist ein Titel, ungefähr so wie Euer Kaiser. Und wer seid Ihr?«
»Ich bin Timu, Prinz von Dara und Lord von Dasu.«
Tenryo betrachtete Timu mit noch größerem Interesse. »Ihr könnt nicht kämpfen, oder? Seht Euch an, Eure glatte Haut, Eure dünnen Arme, Eure schwache Gestalt … Mit einem Prinzen wie Euch ist das Reich Eures Vaters bloß wie das Spielzelt eines Kindes.«
Timu war nicht so dumm, den Köder zu schlucken. »Ihr habt bereits Tausende getötet, doch das waren Soldaten, und es war ihre Pflicht, für die Verteidigung des Volkes zu sterben – eine Pflicht, an die ich ebenfalls gebunden bin. Um diese Pflicht zu erfüllen, habe ich dem Volk der Stadt Daye Anweisungen gegeben, und sogar der gesamten Insel von Dasu, keinerlei Widerstand zu leisten. Es liegt keine Ehre darin, eine hoffnungslose Schlacht zu schlagen. Das Leben ist wichtiger.«
Tenryo betrachtete Timu jetzt mit einer Art von Respekt. »Wenn Ihr nicht daran interessiert seid, Euch selbst zu retten, warum versperrt Ihr mir dann den Weg in die Stadt?«
»Ich bin gekommen, um Euch zu warnen. Wenn Ihr es wagt, den unbewaffneten Menschen von Dasu Schaden zuzufügen, dann werde ich sie in einen Krieg führen, der Euch zurück ins Meer treibt!«
Obwohl Timu kaum mehr war als ein halbwüchsiger Junge, der sich mit dem Schreibpinsel wohler fühlte als mit dem Schwert, sprach er seine Worte mit fester Stimme und ernster Miene.
Ra Olu erfüllte sein Anblick mit Freude. Prinz Timu mag nicht den Körper eines Kriegers besitzen, aber Fithowéo ist auch der Gott derer, die allein mit ihrem Stolz bewaffnet sind, welche streben und suchen und sich plagen und mühen, selbst wenn sie von Anfang an wissen, dass sie nicht gewinnen können.
Genauso muss König Jizu ausgesehen haben, als er die Zerstörung Na Thions durch Tanno Namen aufgehaltenhat.
Nach einer kurzen, verblüfften Pause fing Tenryo an zu lachen. »Prinz Timu, wenn Ihr glaubt, dass ich mich vor Geistern fürchte, irrt Ihr Euch gewaltig. Ich interessiere mich nicht für die belanglosen Träumereien Eurer Philosophen, und ich habe mehr Menschen getötet, als Ihr Euch vorstellen könnt.
»Ich bin in meinem Leben zahllose Male betrogen worden, und ich wiederum habe die betrogen, die glaubten, mich mit ihren Versprechungen binden zu können. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass selbst das Band zwischen Eltern und Kind keine Garantie für Vertrauen ist. Gehorsam kann allein durch Angst und Tod erzwungen werden, nicht indem man die Namen der Götter oder unsichtbarer Geister anruft. Ein Gemetzel bezwingt ein ungehorsames Volk schneller als alle schönen Reden der Welt.«
Timu starrte Tenryo an, und zum ersten Mal schien er die Realität zu erfassen, die vor ihm stand. »Das … ist eine Philosphie des Bösen.«
»Gut und Böse sind bloße Etiketten für Taten, die uns dienen oder schaden. Ich habe das Leben meiner Vasallen und Krieger auf die bloße Hoffnung gesetzt, in diesem uferlosen Meer eine Zuflucht zu finden. Ihnen schulde ich jede Pflicht, aber Euch und den Euren schulde ich nichts. Ein besseres Leben für meine Leute ist das einzig Gute, nach dem ich strebe. Ich beabsichtige, ganz Dara zu unterwerfen, und ich werde nicht ruhen, bis alle Männer dieser Inseln zu meinen Füßen liegen, tot oder lebendig, und das Klagen ihrer Frauen die Gezeiten übertönt.«
Timus Gesicht verzog sich in einer Mischung aus Angst und Trotz. Tenryo sah auf ihn herab, und die Stimme des Pékyu klang beinahe mitfühlend, als er weitersprach.
»Ihr müsst nicht um Euer eigenes Leben fürchten – Ihr seid mir nützlicher, wenn Ihr am Leben bleibt. Aber Ihr werdet zusehen, wie wir in Daye ein Exempel statuieren: Es ist vielleicht die wertvollste Lektion überhaupt.«
Das Gemetzel von Daye dauerte drei Tage lang.
Kapitel 4
DAS GESUCH DER KAISERIN
Schritte hallten durch die runde Halle. Gin Mazoti, immer noch die einzige Gefangene in diesen einsamen Zellen, sah auf.
Zwei Gestalten traten aus dem Schatten und blieben vor den Gitterstangen stehen. Einer von ihnen war ein Wärter, der einen großen Schlüsselbund in der Hand hielt. Hinter ihm stand Kaiserin Jia mit einem hölzernen Tablett, auf dem ein Porzellanflakon und eine einzelne Tasse standen, die im matten Licht blassweiß leuchteten. Der Wärter öffnete die Zellentür.