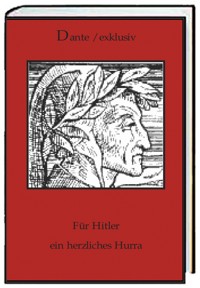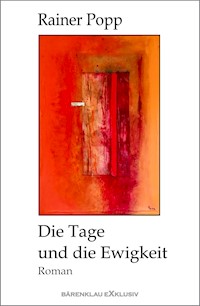
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman erzählt die Geschichte des Inhabers eines Werbeunternehmens, der im Unterholz eines Hochwaldes bei Göttingen als Einsiedler in einem Erdloch zu überleben versucht. Ein Albtraum hätte ihm nicht mehr an Leid und Entbehrungen aufbürden können. Der Grund: Er hat über Nacht alles verloren, was seins war – die Firma, das Haus, sein Eheweib, sein gesamtes Vermögen. Was ihm bleibt, ist die Kleidung, die er am Leib trägt, ein paar Euro Münzgeld in der Hosentasche und eine Windjacke, die man ihm vor die Tür wirft. Nach mehr als tausend Tagen ohne Kontakt zur Außenwelt begegnen ihm – rein zufällig – zwei Lebewesen, die ihm abermals zur dramatischen Schicksalswendung werden: Er nimmt eine ausgesetzte Hündin zu sich und er trifft, halb erfroren und halb tot, auf eine verheiratete Frau, die ihm das Leben rettet – zunächst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Rainer Popp
Die Tage und
die Ewigkeit
Roman
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Covergestaltung: © by Lothar Joerger, Gemälde: Rainer Popp, 2023
Lektorat/Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichte ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Tage und die Ewigkeit
ERSTER TEIL: DIE FLUCHT
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
ZWEITER TEIL: DIE RÜCKKEHR
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
DRITTER TEIL: DIE ENTSCHEIDUNG
1. Kapitel
Der Autor Rainer Popp
Weitere Werke des Autors sind erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung
Das Buch
Dieser Roman erzählt die Geschichte des Inhabers eines Werbeunternehmens, der im Unterholz eines Hochwaldes bei Göttingen als Einsiedler in einem Erdloch zu überleben versucht. Ein Albtraum hätte ihm nicht mehr an Leid und Entbehrungen aufbürden können. Der Grund: Er hat über Nacht alles verloren, was seins war – die Firma, das Haus, sein Eheweib, sein gesamtes Vermögen. Was ihm bleibt, ist die Kleidung, die er am Leib trägt, ein paar Euro Münzgeld in der Hosentasche und eine Windjacke, die man ihm vor die Tür wirft. Nach mehr als tausend Tagen ohne Kontakt zur Außenwelt begegnen ihm – rein zufällig – zwei Lebewesen, die ihm abermals zur dramatischen Schicksalswendung werden: Er nimmt eine ausgesetzte Hündin zu sich und er trifft, halb erfroren und halb tot, auf eine verheiratete Frau, die ihm das Leben rettet – zunächst.
***
Die Tage und die Ewigkeit
Roman von
Rainer Popp
ERSTER TEIL: DIE FLUCHT
Roland Fenn fühlte,
wie sein Mund zu zittern anfing.
Ihm war zumute,
als würde
seine eigene Hinrichtung angezählt.
1. Kapitel
Der Zugriff aus dem Hinterhalt, von den trällernden Rufen eines Rotkehlchens begleitet, war blitzschnell und überraschend erfolgt in der sommerlichen Schwüle des frühen Nachmittags. Die flache Scheibe der Sonne hing wie ein glühender Pfannkuchen hoch am Himmel, der sich zeigte im reinsten, von Wolken befreiten Blau.
Vier uniformierte Polizisten, die in der Deckung von Blättern und Ästen durch das Unterholz angeschlichen kamen, hatten sich, während er die prasselnden Flammen seiner Kochstelle bewachte, von hinten auf ihn gestürzt, hatten ihn umgeworfen, ihn auf die Erde gedrückt, ihn mit dem Kinn vorweg in die Tannennadeln gestoßen, hatten sich auf ihn gesetzt, hatten aus ihren Dienstwaffen zwei Kugeln in die Luft gefeuert, ihm seine Arme auf den Rücken gerissen, hatten ihm den Atem abgedrückt, ihn gefesselt und ihn, der sich aus Leibeskräften wehrte, der strampelte, der um sich biss, der um Hilfe schrie, über den Waldboden die Böschung hinunter bis zum Einsatzwagen geschleift, hatten ihn während der Fahrt vom Fuße des Steilhangs in die Kreisstadt im Schwitzkasten gehalten, hatten ihn mit Fußtritten, Ohrfeigen und Würgegriffen in die Zelle befördert, hatten ihn im Stakkato ihrer kreischenden Kehlen angebrüllt, um ihn einzuschüchtern, hatten anschließend mit Fäusten mehrmals gegen seinen Kopf geschlagen und ihn später, als der Zeitpunkt der Sprengung nur noch fünfzehn Minuten entfernt war, mit der Handschelle an das Heizungsrohr geklemmt.
Damit er, wie sie sagten, endgültig seine schmierige Fresse hielt und endlich aufhörte, wie ein Wahnsinniger in diesem Gewahrsam zu toben, war ihm von Oberwachtmeister Ernfried Kolb ein halbvoller Eimer Wasser ins Gesicht gekippt worden.
„Wenn dir das noch immer nicht reicht, du dumme Drecksau, dann können wir dir auch ’ne Spritze in den Arsch verpassen … die wirkt wie ’ne Keule und die legt dich flach aufs Maul, ohne dass du noch einen Mucks machst“, hatte der bullig gewachsene Zwei-Meter-Mann gedroht und dabei gekichert. „Wir wollen keinen Pieps mehr von dir hören … nicht einen einzigen kleinen Pieps … nichts mehr. Es soll hier so still werden wie in der Kirche … Also Schluss mit dem Herumgetobe … und keinen Ton mehr! Hast du mich verstanden, du verlauster Penner? Keinen Ton mehr! Schluss! Ende! Affe tot!“
Er hatte sich vor ihm aufgebaut und drohend seinen Gummiknüppel geschwungen. „Wehe dir, du gibst jetzt nicht sofort Ruhe. Du hast uns schon genug Scherereien gemacht … und ändern kannst du sowieso nichts mehr … Das … das Ding geht hoch, ob du ’s willst oder nicht … Wenn du still bist, kriegst du den Knall sogar mit … Ist ja nicht besonders weit weg von hier …“
Kolb grinste schadenfroh, machte – militärisch korrekt –auf dem rechten Hacken kehrt, warf die Tür hinter sich zu und schob den Riegel vor, der mit einem quietschenden Ruck einrastete.
Roland Fenn, der ausgestreckt auf dem Beton lag und dessen Oberkörper verdreht war wie ein Korkenzieher, zerrte an der Fessel und verzog seinen Mund vor Schmerzen, als ihm das chromblanke Stahlband über dem Puls in die Haut schnitt. Blut lief ihm über den Unterarm und rann in den karierten Stoff seines erdverkrusteten Hemdes, das er aufgekrempelt hatte bis zu den Ellenbogen. Seine an den Knien zerrissene Leinenhose, ursprünglich in postgelber Farbe vor langer Zeit in den Handel gekommen, war mit braunen, weißen und grünen Flecken übersät und eingenässt von den Spritzern des Wassers, das nach dem Guss zurückgeschwappt war und nun über Nacken und Stirn aus seinen damenhaft langen, zerzausten, ungewaschenen, schwarzen Haaren tropfte. Seine halb hohen Schuhe aus braunem Leder, von denen der linke ein faustgroßes Loch in der Sohle hatte und der rechte an der Innenseite eine aufgerissene Naht vorzeigte, waren mit Lehm beschmiert. Unter den gekreuzten Schnürbändern, so als hätte sie jemand geschmückt, steckten Tannennadeln, Grashalme und die Blütenblätter von Klee und Löwenzahn. Ein Marienkäfer, der irgendwie und irgendwann während des Kampfes vor der Hütte zwischen die Lasche und seinen Knöchel geraten war, krabbelte an Fenns nackter Wade hoch und bewegte sich im Lauf einer Serpentinstraße auf den dürren Oberschenkel des Einundvierzigjährigen zu.
Dieser durchgeprügelte, ein Meter fünfundachtzig große Mensch, dieser Haufen Elend mit ausdrucksvollen, hellgrauen Augen, der einen Anblick bot, als wäre er in einem Straßengraben aufgelesen worden, dieser Verwahrloste, der von Natur aus ein attraktives, fein geschnittenes Gesicht vorzuweisen hatte, dieser Verarmte, der nichts mehr besaß außer einem ausgefransten Taschentuch, dieser geschiedene Mann, der bei klarer Sicht von einem selbstgebauten Hochsitz den Bungalow sehen konnte, in dem seine ehemalige Ehefrau lebt, diesem Gefangenen glitzerte der Tropfen einer Träne zwischen den Wimpern. Roland Fenn knurrte wie ein Hund, er gurgelte, als käme Säure aus den Därmen hochgespült. Der Zorn, der ihm auf der Zunge lag, den schluckte er vorübergehend runter.
In diesem Augenblick, unrasiert, wie er war und abgemagert und verdreckt und lausig anzusehen und bis unter seine Schädeldecke angefüllt mit Wut, wirkte er älter, als sein Geburtsdatum auswies. In diesen Sekunden, zu Boden geworfen und hingeschubst, blaugeschlagen und verlacht, sah er gefährlicher aus, als sein Charakter sich grundsätzlich zu gebärden vermochte. In diesem Moment, hilflos und ausgeliefert, wie er sich fühlte, ausgehungert und durstig, wie er Magen und Zunge spürte, unterdrückt und genötigt, wie er sich empfand in seiner Lage, hätte ihn jeder für einen Schwerverbrecher gehalten, der auf seiner Spur des Schreckens nach wochenlanger Flucht geschnappt worden war. Er aber, der verzagt war, der das Gefühl hatte, sich übergeben zu müssen, dem die Seele wehtat, er sehnte sich zurück in seine Kindheit und nach dem Trost seiner Mama und nach ihren Küssen und ihren Liebkosungen.
Als Roland Fenn noch regelmäßig gebadet und frisiert war, als er Maßanzüge getragen und einen schwarzen Sportwagen gefahren hatte, ähnelte er, den Frauen als attraktiv bezeichneten, auf den ersten Blick dem Geschäftsführer einer Fluggesellschaft oder dem Direktor einer Werft für Segelschiffe. Von Beruf war er Texter gewesen und Inhaber einer Werbeagentur. Er hatte Kommunikationswissenschaften studiert und Psychologie und in beiden Fächern sein Examen mit einer befriedigenden Note bestanden. Das war mehr als sechzehn Jahre her. Und damals, als er seine Vorlesungen besuchte und ihm die Mädchen in Scharen hinterherliefen, hatte er nicht die geringste Vorstellung, dass er, dessen Vater Jurist war, einmal in Beugehaft genommen sowie geschlagen und verhöhnt werden würde bei seiner vorläufigen Festnahme.
Wie und warum das alles geschehen war, das, was sich zugetragen hatte, darüber machte er sich keine Gedanken, während er sich aufrichtete und sich mit der Schulter gegen die beigefarbenen Lamellen der Heizung lehnte. In weniger als dreizehn Minuten, so rechnete er sich mit einem Blick auf seine goldene Armbanduhr aus, würde die Detonation erfolgen. Die werden sich um nichts in der Welt verspäten, dachte Fenn. Die legen Wert auf Präzision. Die werden vor Geifer quieken und sich vergnügt die Finger reiben, wenn sie endlich auf den Knopf drücken dürfen und es in einem ohrenbetäubenden Knall bums und rums macht.
Er überlegte, was er noch unternehmen könnte, um die bevorstehende Explosion zu verhindern. Zu schreien aus Leibeskräften, würde nichts bewirken. Weiter toben und um sich schlagen, als wäre der Teufel in ihn gefahren, würde ihm vermutlich nur wieder eine Tracht Prügel der Uniformierten einbringen. Und beten zum Herrgott, dazu konnte er sich nicht entschließen. Selbst sein bester Wille war nicht imstande, ihn dazu zu ermutigen. Das Einzige, was ihm übrig blieb als Zeichen der Auflehnung gegen seine widerrechtliche Gefangennahme – er ruckelte ein paar Mal resigniert an der Handschelle.
Trotz der Nässe, die seine schäbige Kleidung durchzogen hatte, war ihm nicht kalt. Die heiße Augustsonne, die seit Tagen ihre Hitze aussendete über den mit Fichten bewachsenen Bergen, hatte die schmale, sechs Quadratmeter große Zelle auf angenehme zwanzig Grad angewärmt. Fenn sah erneut auf die Uhr. Es war sechzehn Uhr fünfunddreißig. Noch zehn Minuten, sagte er sich, bis es so weit ist.Dann ist ohnehin Feierabend für die Spezialisten des Sprengkommandos, die auch für die Absperrungen des Gebiets von der Größe eines Karibik-Atolls verantwortlich waren. Er ballte die Faust und presste die Lippen zusammen. Von Hass erfüllte Gefühle von Mord und Totschlag stiegen in ihm auf.
Wie lange sie ihn hier festhalten wollten in diesem weiß getünchten Raum, in dem eine mit einer grauen Decke gepolsterte Pritsche stand und ein Waschbecken in die Wand eingelassen war, das wusste er nicht. Niemand hatte ihm gesagt, wie viele Stunden er in Polizeihaft bleiben würde. Durch das vergitterte Fenster sah er ein taschentuchgroßes Stück des blauen Himmels. Er fühlte die Wärme der brennenden Sonne und er hörte einen Vogel zwitschern und später noch einen zweiten.
Seinen strengen Eigengeruch, der ihm anhaftete wie Klebstoff, diese Mischung aus trockener Erde und Müll, die von den Poren seiner Haut strömte, den nahm er nicht mehr wahr. Roland Fenn stank wie ein Iltis und eine angefaulte Ratte zusammen. Wäre der Mief eines Eremiten sichtbar in die Luft zu schreiben, er hätte einen Schweif hinter sich hergezogen wie ein Komet. Er hatte in den vergangenen Tagen den Duft angenommen von uraltem Schweiß, von schmutziger Wäsche, vom Qualm eines offenen Feuers, von Asche, von Hasenfell, von Rinde, von Moos und von Efeu, von Steinen und von den abgetropften Säften der Bäume über ihm, als er in Freiheit war.
Plötzlich spürte er, wie etwas in der Gegend seiner Leiste kribbelte. Fenn langte an die Stelle in seinem Schoß und kratzte sich. Aber das Kitzeln hörte nicht auf, sondern verlagerte sich in die Nähe der Bauchregion. Doch wohl kein Floh, dachte er und begann, sich mit einer Hand den Schlitz aufzuknöpfen und den Bundverschluss zu öffnen. Er schob seine Unterhose ein Stück nach unten bis über den Ansatz des Schamhaares. Dazwischen entdeckte er den Marienkäfer, der sich tot stellte, als er ihn vorsichtig aufnahm und auf sein angewinkeltes Knie legte. Sechs schwarze Punkte zählte Fenn ab auf den roten Flügeln. Bevor er den Käfer mit der Spitze seines Zeigefingers berühren konnte, um ihn dazu zu bewegen, sich ein paar Zentimeter in Marsch zu setzen auf dem Stoff seiner Hose, flog das Insekt plötzlich auf und, nachdem es vor dem offenen Fenster drei Sturzflüge vollführt und eine Runde gedreht hatte, zwischen den Gitterstäben davon.
Hoffentlich ist Lisa so klug gewesen und hat sich weit genug von dem Platz vor der Hütte entfernt, dachte Fenn. Nach den zwei Warnschüssen auf sie, die Kommissar Struwe mit seiner Pistole abgefeuert hatte, war sie im Dickicht verschwunden. Sie wird dort bleiben, bis ich zurück bin, überlegte er. Wenn sie genug Abstand vom Explosionsherd hat, wird ihr nichts passieren, beruhigte er sich. Aber wer weiß: Falls sie doch noch zu dicht dran ist, kann sie verletzt oder sogar getötet werden durch umherfliegende Gesteinsbrocken und zerberstende Balken.
Sein Blick auf die Uhr zeigte ihm die verbleibende Zeit bis zur Sprengung an: zwei Minuten und ein Dutzend Sekunden. Roland Fenns Gemütsverfassung näherte sich ihrem Tiefpunkt. Mehr konnte er nicht ertragen. Mehr hielt er nicht aus. Er versuchte sich zu beruhigen, indem er bewusst Atem holte und ihn langsam durch die Nase ausströmen ließ. Wo bin ich bloß angelangt?, ging es ihm durch den Kopf, während er sich die Rechnung seines unergiebigen Lebens aufmachte, das ihn anfauchte wie eine behäbig fortlaufende Tortur.
Noch weniger als eine Minute, sagte er sich und verfolgte den Sekundenzeiger, der das erste Viertel des Kreises passiert hatte und sich auf die Zahl dreißig zubewegte. Roland Fenn fühlte, wie sein Mund leicht zu zittern anfing. Ihm war zumute, als würde seine eigene Hinrichtung angezählt und sie unmittelbar erfolgen.
Jetzt drückt einer von diesen beamteten Vollstreckern den Knopf, dachte er. Jetzt erfolgt die Zündung. Jetzt, jetzt gleich, jetzt kommt der Knall. Und so, wie er es sich vorgestellt hatte, genau so passierte es. Nach einer kurzen Verzögerung hörte er einen dumpfen Schlag in der Ferne und dann ein tiefes, ein röhrendes Grollen, das sich zu einem im Widerhall verknoteten Donner auftürmte.
Neun Zuckungen später, die sein Herz ausführte, verbreitete sich nach dem ausrollenden Krachen eine lärmende Stille, als hätte der Tod bei ihm vorbeigeschaut und ihn umgebracht. Roland Fenn machte die Augen zu und fand in seiner Rückbesinnung frühere Bilder, auf denen er sich wiedererkannte …
Jetzt aber, da die Bruchkante
eines Schattens auf ihn fiel,
begann er zu frösteln.
Minuten später
klapperten seine Zähne aufeinander.
2. Kapitel
Die Festtafel, auf der die Speisen des Büfetts angeordnet waren, reichte über die Länge von sechs Räumen quer durch den gesamten Bürotrakt. Mehr als fünfzig verschiedene Gerichte, Kaviar ebenso wie Sellerie-Salat und Thunfischfilet, hatte der Delikatessen-Laden auf Geheiß der Geschäftsführung zubereitet und zu einem Kunstwerk aufgestellt: Jede Schüssel, jede Schale, jeder Bottich ruhte auf unterschiedlich geformten Felssteinen. Zwischen den Meeresfrüchten waren Berge von weißem und schwarzem Kies ausgestreut und Treibhölzer in verschiedenen Größen und Formen hingelegt, als wären sie, mitten hinein in die angebotenen Kostbarkeiten eines Picknicks, zufällig mit der Gischt der Wellen angespült worden an den Strand, an dem sich mehr als hundert geladene Gäste versammelt hatten.
Roland Fenn, gekleidet in einen schwarzen Anzug mit schwarzem T-Shirt, stand an der Stirnseite des Tisches. Er war der Hausherr: ledig, erfolgreich, wohlhabend, schlank, gut aussehend, gefühlvoll, kreativ. Er, der charmante Bohemian, das Sonntagskind, dem alles gelang, was es anpackte, hatte zu diesem Empfang gebeten. Es war sein Unternehmen, das an diesem Abend eingeweiht werden sollte. Es war der offizielle Gründungstag seiner Werbeagentur BrainMedia und zugleich der Erstbezug des unter Denkmalschutz stehenden Firmen-Domizils in der Fußgängerzone der Göttinger Innenstadt. Das Gebäude – ein aus Granitquadern errichtetes ehemaliges Patrizierhaus – stammte aus der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts. Das rechteckige Foyer, über dem sich ein gefächertes Deckengewölbe erstreckte, war mit abstrakten Gemälden zeitgenössischer Künstler geschmückt. Die Mitte der Halle füllte die sechsgezackte, wie ein Granatsplitter aussehende Bronze-Skulptur eines Turiner Bildhauers aus. In den oberen drei Stockwerken hingen großflächige Aquarelle und mobile Objekte von Akanasi und dem US-Amerikaner Jonathan Jim Poll.
Bevor er seine Begrüßungsrede hielt, lächelte Fenn in die Runde und nickte, wenn er zufällig dabei ihre Blicke streifte, den Umstehenden zu, die sich miteinander unterhielten und an den alkoholischen Getränken nippten, die ihnen von den Kellnern gereicht worden waren.
„Ich glaube, du kannst jetzt etwas sagen. Es sind alle da“, hörte er die Stimme von Vera, die neben ihm stand und seine Hand ergriffen hatte. „Die sind hungrig und die wollen was essen … und bevor du nicht deine Ansprache hältst, trauen die sich nicht.“
Vera Mahn, langhaarig blond, vollschlank, ausgestattet mit schwerem Busen, war die Geliebte Fenns und nach ihm die wichtigste Mitarbeiterin in der Agentur. Sie überwachte die Buchhaltung und den gesamten Zahlungsverkehr. Fenn vertraute ihr blind, und er schätzte ihren Sachverstand und ihre Fähigkeiten, Widersachern immer einen Schritt voraus zu sein.
Ohne sich zu räuspern, aber mit einem vierfachen Fingerschnipsen gegen sein leeres Glas, aus dem er Portwein getrunken hatte, setzte Roland Fenn in konzentrierter Lautstärke zu seiner Rede an, die kurz war und nicht mehr Inhalt bot, als bei solchen Anlässen üblich. Er beschrieb mit wenigen, aber genauen Worten die Schwerpunkte der Dienstleistung seiner Agentur und wünschte zum Schluss seiner Ausführungen angenehme Stunden.
„Eine Polizeistunde gibt es bei uns nicht. Sie sind herzlich willkommen, solange Sie wollen … und wenn es bis morgen früh ist … Ich bitte Sie … langen Sie jetzt tüchtig zu. Es ist genügend da, und ich hoffe, das Angebot wird Ihren Geschmack treffen … Guten Appetit, meine sehr verehrten Damen und meine sehr geehrten Herren“, sagte er und nahm den höflichen Beifall mit einer leichten Verbeugung entgegen.
Gut gemacht, pflichtete er sich bei und klopfte sich als Eigenlob für seinen perfekten Auftritt in Gedanken auf die Schulter.
„Gut gemacht“, lobte ihn Vera. Sie trug ein halblanges, dunkelrotes Leinenkleid mit tiefem Ausschnitt. Sie lächelte ihn an. Er küsste ihr auf die Wange.
„Danke für die Blumen … Lass uns ab sofort ins Gewühl stürzen … auf getrennten Wegen. Wir haben viele Leute zu beackern … Du weißt schon … neue Kunden ins Haus lotsen … Akquisa nennt man das“, sagte er. „Falls wir uns in diesem Gewimmel aus den Augen verlieren … unser ultimativer Treffpunkt ist das Bett bei mir … irgendwann. Wer zuletzt drin liegt, macht nach dem Aufwachen das Frühstück.“
Er ließ Vera stehen und wandte sich zwei Schritte entfernt einem Möbelfabrikanten zu, der einen Monolog in Gang setzte über moderne Kunst und die daraus entstehenden Rückwirkung auf den Zeitgeist. Wie viele Kurzgespräche Roland Fenn an diesem Abend führte, wie viele Male er „interessant“ und „tatsächlich“ und „Ach was“ von sich gegeben, wie oft er „Ich freue mich sehr“ und „Sie haben absolut recht“ gesagt hatte, daran konnte er sich nicht mehr erinnern, als er, nachdem die letzten Gäste gegangen waren, gegen vier Uhr seinen Wagen startete und zu sich nach Hause fuhr. Der Alkoholpegel in seinem Blut betrug nicht mehr als 0,01 Promille, die von vier kleinen Schlucken stammten.
Vera ruhte bereits im Tiefschlaf: nackt, halb zugedeckt, zusammengekrümmt, parfümiert und leblos. Wie schön ihr Körper ist, dachte Roland Fenn, der sich im Schein seiner Nachtischlampe auszog und sich hinter sie rollte. Er spürte ihre Wärme. Er streichelte ihre Schulter. Er drückte seine Wange gegen ihren Rücken. Fenn fühlte keine Müdigkeit. Im Gegenteil: Die Ereignisse dieses Tages hatten seine Aufnahmefähigkeit überstrapaziert und seine Nerven in einen Rausch versetzt, der noch nicht abgeklungen war. Seit heute gibt es kein Zurück mehr, sagte er sich. Die Firma ist etabliert und dazu ein Bankkredit in Höhe von eineinhalb Millionen Euro. Wenn die Geschäfte weiterhin so laufen wie bisher, dann werde ich es schaffen, dachte Fenn. Falls es jedoch bei den Umsätzen zu einem Einbruch kommen sollte, dann bin ich auch mein gesamtes Privatvermögen los, mit dem ich das Darlehen verbürgt habe.
Er lag noch mehr als eine halbe Stunde wach; und erst allmählich beschäftigten sich seine Gedanken nicht mehr mit der ungewissen Zukunft seines Unternehmens. Von der Frage, ob es notwendig sei, neues Personal einzustellen, kam er ab, als er bemerkte, dass sich Vera neben ihm rekelte. Sie war seit vier Monaten bei ihm beschäftigt und seit dreiundsiebzig Tagen seine Geliebte. An ihrer Tüchtigkeit und ihrer Effizienz als seine rechte Hand gab es keinen Zweifel.
Vera Mahn, die sich auf ein Stellenangebot bei ihm beworben hatte, achtundzwanzig Jahre alt, studierte Betriebswirtin, war eine wandelnde Rechenmaschine. Sie multiplizierte dreistellige Ziffernfolgen und addierte ganze Zahlenkolonnen im Kopf. Sie merkte sich jede Telefonnummer, die sie einmal gehört hatte. Sie kannte jeden Steuertrick und sie war eine hervorragende Buchhalterin, die auf jeden Cent achtete.
„Ich bin so froh, dass du bei mir bist … beruflich und privat“, hatte er ihr vorgestern gestanden. Und sie hatte ihm geantwortet: „Wir beide, du und ich, wir sind ein glänzendes Duo … in jeder Beziehung. Das Schicksal hat uns zueinander geführt … zu einem guten Zweck. Ich spüre das tief in mir … ganz tief … ganz, ganz tief.“
Fenn, der erste Schlafreize herannahen fühlte, klammerte sich fester an sie, streckte seinen Arm aus und schob ihn unter ihren Nacken. Vera schnalzte mit ihren Lippen und murmelte ein paar Wortgeräusche vor sich hin, die er nicht verstand. Mit einer Drehung, die von einem Ruck eingeleitet wurde, als würde sie aufschrecken und die flirrenden Aufführungen ihres Traums verlieren, drückte sie ihre Wange gegen seine Achsel und seufzte.
Ehe er schwerelos in die Dunkelheit des Unterbewusstseins absackte, ging er noch einmal gedanklich seinen Terminkalender durch, in dem die wichtigsten Vorhaben der vor ihm liegenden Woche notiert waren: Am Montag hatte er ein zweitägiges Arbeitstreffen mit dem Bundesverband der Gebäudereiniger in München. BrainMedia hatte den Zuschlag erhalten für die Prospekt-Erstellung und für die Verteilung einer millionenfachen Postwurfsendung. Am Mittwoch war um neun Uhr die notarielle Erteilung der Prokura für Vera Mahn verabredet, und am Freitagabend stand ihr Einzug in sein Haus bevor. Da sie bislang in einem möblierten Apartment gewohnt hatte, waren nur ihre Koffer abzuholen und ein paar Kartons mit Büchern.
Fenn war es gewesen, der den Wunsch geäußert hatte, mit ihr zusammenzuziehen. „Wir arbeiten fast jeden Tag bis in den späten Abend und wir verbringen die Nächte miteinander … dann kannst du auch für immer zu mir kommen“, hatte er seinen Vorschlag begründet. „Das spart Zeit und Geld … Und außerdem bin ich dann nicht mehr allein. Ich hasse das … ein großes Haus, und außer mir ist niemand drin.“
Sie war ihm gicksend um den Hals gefallen und hatte ihm einen ekstatischen, fächernden Zungenkuss versetzt.
„Ich bin sehr glücklich darüber“, hatte sie ihm zugeflüstert und dabei mit ihrem Lippen an seinem Ohrläppchen gezupft. „Ich werde dich versorgen nach all meinen Kräften … und ich werde dich pflegen, wenn du krank bist. Ich werde mit dir lachen und mit dir weinen. Ich will deine Frau sein, die dir zur Seite steht … in guten und in weniger guten Tagen … und in ganz furchtbaren.“
Die neun Stunden Schlaf, die vor ihm lagen, verbrachte Fenn in der Haltung eines Zinnsoldaten – stramm liegend wie rückwärts in Grundstellung mit den Händen an der Hosennaht aus einem Wachhäuschen gekippt. Nur einmal wälzte er sich herum in einer schnellen Drehung an die äußerste Kante des Bettes.
Und er erwachte erst, als Vera nach ihm schaute, weil sie befürchtete, ihm wäre das Herz stehengeblieben und er nicht mehr am Leben.
„Raus aus den Federn, du Langschläfer“, rief sie ihm zu mit einem Lachen in der Stimme. „Der Nachmittag, der ist gleich vorbei.“ Sie zog die Gardinen zurück. „Sieh nur, herrliches Frühlingswetter … und wie hell die Sonne scheint.“
Fenn gab ein träge herausgestöhntes Murren von sich und zog sich die Zudecke weiter über den Kopf.
„Ich mache Kaffee und Toast und Eier … und was du willst, und wir frühstücken zusammen im Bett … und dann lass uns rausfahren in den Wald und spazieren gehen“, schlug sie ihm vor.
Während Vera Mahn in der Küche hantierte, ging Fenn ins Badezimmer, duschte sich und putzte sich die Zähne. Es war ihm zuwider, mit zerwühlten Haaren und ungewaschen den Tag zu beginnen und dabei Nahrung und ein Getränk zu sich zu nehmen. Er saß bereits wieder zwischen den Kissen, als Vera mit dem Tablett zurückkam. Sie schlüpfte neben ihn unter die Decke, schmiegte sich an ihn und begann, ihn mit Weintrauben zu füttern. Sie trug nicht mehr ihren Hosenanzug, sondern ein weit geschnittenes, seidenes Hauskleid, aus dem ihr süßlicher Duft in seine Nase strömte.
„Du riechst gut“, sagte er. „Du riechst wahnsinnig gut.“ Seine Hand schnellte in ihren Nacken, kraulte sie dort und fuhr ihr durch das Haar. Ohne, dass er sie in seine Richtung zog, kam sie, die ihre Arme um ihn schlang, mit ihrem roten, gelackten, mit ihrem aufgeworfenem, mit ihrem gewulsten Mund seinen Lippen entgegen, küsste ihn und saugte sich an seiner Zunge fest.
Ebenso schnell, wie ein Blitz über den Horizont zuckt, fielen sie übereinander her, rollten ihre Körper parallel zueinander, betasteten sich mit ihren Händen, langten hinein in ihr Fleisch, packten zu, rieben, drückten und kneteten sich, griffen sich synchron an die Stellen, die ihnen Lust verschafften und sie immer häufiger stöhnen ließen. Weder Roland Fenn noch Vera hatten bemerkt, dass die Schüssel mit dem Obstsalat umgekippt war und sie sich auf der Höhe ihrer Hüften in Rosinen, in Stücken von Ananas, in Apfelscheiben, Kirschen und einer Zuckermelange wälzten. Durch die Wellenbewegungen der Matratze und die Stöße, die von seinen Knien und ihren Ellenbogen verursacht wurden, hatte sich auch der Inhalt des Milchkännchens ins Laken ergossen und sich mit dem verlaufenden Gelb der beiden Eier vermischt, das sich in einer dickflüssigen Spur vor einer Falte des Leinenstoffs wie in einer Talsperre aufstaute. Wenige Zentimeter davon entfernt war ein dicker Klecks von Marmelade verschmiert, die Vera in ein Schälchen gefüllt hatte. Als Fenn sich zwischen Veras Oberschenkel grätschte und seine Waden abspreizte, stieß er mit dem großen Zeh gegen die Kanne, die zur Seite fiel und glucksend austropfte.
Aber weder das Geräusch des auslaufenden Kaffees noch die anderen kochend heißen, die klebrigen und die glitschigen Flüssigkeiten, auf denen sie herumrutschten, bemerkte das Paar, das sich mit ihren Gefühlen in ihren Häuten eingenäht hatte, das verwoben war in ihrer Leidenschaft, das sich gebärdete, als wollte es sich aufessen, das Töne von sich gab, die sich anhörten wie das Brummen eines Bären, wie Miauen, wie das Wimmern von Welpen. Fenn keuchte, und Vera stimmte mit ein. Sie stöhnte, und er schloss sich ihr an. Sie schrie, und er stieß Laute aus, die dem Lärmpegel eines galoppierenden Pferdes entsprachen.
Nach mehr als einer Stunde, in der sich ihre Atemfrequenz verdoppelte und sich ihr Puls verdreifachte, in der sich ihre Lust von allen Seiten befingerte, in der sie sich kratzten und bissen, sich verschlangen und sich abtasteten, am Ende dieser Zeit, in der sie sich abgeleckt hatten und in sich verwachsen waren, als ihr Appetit aufeinander gestillt war, brach er plötzlich über ihr zusammen und blieb, nass vor Schweiß, auf ihrem hingeworfenen Leib liegen. Sie stammelte eine Eruption von Wörtern heraus aus ihrem abgeknabberten Mund, und er, der sich in ihr verspritzt hatte, rang nach Luft – eingepflockt in ihren spuckenden, gefletschten Schoß und nicht im Geringsten darauf vorbereitet, dass sein Schicksal ein Hund war, der mit ihm zu spielen wünschte. Und für Vera, die nur auf ihren Vorteil bedacht war, sollte der Tag kommen, an dem sie von einer Sekunde zur anderen ihre Chance witterte und ihre Interessen durchsetzte – zu ihrem Nutzen und zu seinem Schaden.
Während Roland Fenn sich dabei zusah, wie er sich auf Vera ausruhte, der sich erinnerte, wie er jedes Partikel des Geruchs dieser Frau aufgenommen hatte, als wehte er gerade vor seinem Gesicht, in dieser einen Sequenz von Zeitsprung und von einer Rückbesinnung, aus der er mit einem gelüfteten Augenaufschlag auftauchte, spürte er nicht mehr die Feuchtigkeit ihrer erhitzten Haut sondern in einem fließenden Übergang seiner Gedanken und seiner Empfindungen die Kälte der Handschelle, mit der er am Heizungsrohr hing.
Die Stille, die sich nach den dumpfen Hieben des Explosionsdonners wie der Verlauf eines abnehmenden Prasselregens aufgetürmt hatte, dröhnte Fenn als schrilles Konzert von Glockenschlägen und Blecheimer-Musik im Kopf. Er schnitt, weil ihn das Hämmern hinter seiner Stirn quälte, eine Fratze mit seinen Lippen und dem Fleisch seiner hochgeschobenen Wangen.
Wäre er nicht gefesselt gewesen, er hätte sich mit beiden Händen die Ohren zugehalten und die Stille weggedrückt, die von draußen kam und den Raum bis in jeden Winkel ausfüllte. Sie war das endgültige Ergebnis, das die Zerstörung besiegelte. Sie hielt ihn dazu an, dass er vor Zorneswut überkochte. Sie erschütterte ihn. Sie brachte ihn beinahe um. Sie sagte ihm, dass es unwiderruflich geschehen war. Sie vernichtete jedes Bekenntnis zu irgendeiner Hoffnung, die er solange nicht aufgegeben hatte, bis das ferne Grollen mit der Geschwindigkeit des Schalls in seine Zelle eingedrungen war.
Im Winkel der Sonne, die ihn, flach gelegt auf dem Beton, in einem Lichtstreifen angeleuchtet hatte, war Roland Fenn nicht kalt gewesen. Jetzt aber, da die Bruchkante eines Schattens auf ihn fiel, begann er zu frösteln. Minuten später klapperten seine Zähne aufeinander. Er wäre gerne aufgestanden und hätte sich bewegt; die Fessel hinderte ihn jedoch daran, auf die Beine zu kommen und sein Blut zirkulieren zu lassen. Sein Versuch, die Wolldecke von der Pritsche zu ziehen und sie sich überzulegen, scheiterte daran, dass er, angebunden wie er war, mit den Fingerspitzen nicht heranreichte, so sehr er sich auch über die Länge seiner beiden Arme ausstreckte.