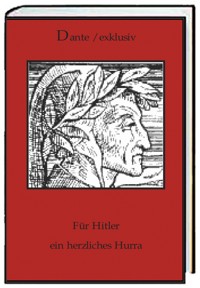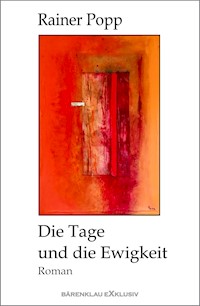Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Zwei Männer und deren Lebensläufe, wie sie unterschiedlicher nicht sein können, durchziehen den ersten Band dieses dramatischen und erotisch aufreizenden Romans – der eine wird, erst wenige Stunden alt, als Frühgeburt weggeworfen wie ein Sack Müll zwischen die vereisten Schienenstränge eines Kleinstadt-Bahnhofs in Süddeutschland; der andere wächst als einziger Sohn in der Obhut einer wohlhabenden Berliner Familie auf: geliebt, verwöhnt und umsorgt von einem Kindermädchen aus Kenia. Der Findeljunge jedoch, der verbringt seine Jahre bis zur Pubertät in verschiedenen Waisenhäusern, in denen er mal von evangelischen Erziehern, mal von katholischen Nonnen geschlagen, mit Essensentzug bestraft, in Dunkelkammern gesperrt, tagtäglich in seiner Würde erniedrigt und sexuell ausgebeutet wird. Eine zufällige Begegnung jedoch besiegelt ihr beider Schicksal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Popp
Plötzlich kehrt Stille ein
Band 1
Roman
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv, 2024
Cover: © Gemälde von Rainer Popp, 2020, Covergestaltung: Lothar Joerger, Wesseling
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau (OT), Gemeinde Oberkrämer. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren, es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv, 13.07.2023.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Plötzlich kehrt Stille ein
Erster Teil: Die Entdeckung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Zweiter Teil: Die Hinwendung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Dritter Teil: Die Vorsehung
1. Kapitel
2. Kapitel
Vierter Teil: Die Offenbarung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Fünfter Teil: Die Vollstreckung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Sechster Teil: Die Auferstehung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Siebenter Teil: Die Heimsuchung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Epilog
Der Autor Rainer Popp
Weitere Werke des Autors sind erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung
Das Buch
Zwei Männer und deren Lebensläufe, wie sie unterschiedlicher nicht sein können, durchziehen den ersten Band dieses dramatischen und erotisch aufreizenden Romans – der eine wird, erst wenige Stunden alt, als Frühgeburt weggeworfen wie ein Sack Müll zwischen die vereisten Schienenstränge eines Kleinstadt-Bahnhofs in Süddeutschland; der andere wächst als einziger Sohn in der Obhut einer wohlhabenden Berliner Familie auf: geliebt, verwöhnt und umsorgt von einem Kindermädchen aus Kenia.
Der Findeljunge jedoch, der verbringt seine Jahre bis zur Pubertät in verschiedenen Waisenhäusern, in denen er mal von evangelischen Erziehern, mal von katholischen Nonnen geschlagen, mit Essensentzug bestraft, in Dunkelkammern gesperrt, tagtäglich in seiner Würde erniedrigt und sexuell ausgebeutet wird. Eine zufällige Begegnung jedoch besiegelt ihr beider Schicksal.
***
Für Ingrid, meine Frau.
Plötzlich kehrt Stille ein
Band 1
Erster Teil: Die Entdeckung
1. Kapitel
Ohne das Wimmern, das aus der Tiefe kommt, hätte es auch ein Laib Brot sein können oder der Kadaver einer Katze oder ein Klumpen Aas. Aber es ist ein Säugling; eingewickelt in eine Mülltüte und eingerollt in Zeitungspapier zu einem Bündel und verschnürt mit dem Stück blauer Plastik-Schnur einer Wäscheleine. Er liegt, erst wenige Stunden alt und nicht einmal 2000 Gramm schwer, im verschneiten Schotterbett des Bahnhofs der Gemarkung Karlsburg - fast zwei Meter unterhalb der Bahnsteigkante und nur eine Handbreite neben dem vereisten Eisenstrang der Schienen.
Das Gesicht des Babys ist bis zum Mund freigelegt, und auch die Nasenspitze, die lugt hervor. Im gelben Schein der Dachlampen sind seine Augen zu erkennen; sie sind geöffnet und sie schließen sich wieder und sie blinzeln und sie ziehen sich zusammen und sie weiten sich und sie flimmern und sie flackern und sie zucken immerfort und sie bleiben für Sekunden zu vor panischer Angst.
Ein sehr später Abend im Dezember. Die Uhr zeigt auf wenige Minuten nach Mitternacht. Der 25. Tag des Monats hat gerade begonnen. Es ist kalt; minus sechs Grad unter Null. Ein Wind, wie aus vereisten Kieselsteinen gefertigt, fegt und heult über den Bahnsteig. Schneefahnen wirbeln auf und schrauben sich hoch zu gedrehten Schwüngen.
Drei Fahrgäste, zwei Männer und eine Frau, warten auf ihren Zug; einer, der auf Gleis 3, der rast heran mit hoher Geschwindigkeit, fährt aber durch. Es sind mehrere Dutzend Kesselwagen von einem halben Kilometer Länge. Funken sprühen auf. Es dröhnt und es rasselt und es röhrt und es quietscht und es hört sich an wie der Gefangenen-Chor des Teufels aus Sterbensgebrüll und Schmerzensschreien und es mutet an wie bewusst in kauf genommenes Gottesurteil über Leben und Tod.
Der Lärm ist ohrenbetäubend, der Geruch übel; eine Mischung aus Chlorwasserstoff und Kohle. So mag es zugehen zur Begrüßung der für alle Ewigkeit verdammten Logiergäste am Eingangstor des Fegefeuers.
Der starke Luftzug, den die Radreifen der Lokomotive und der Waggons erzeugen, der verfängt sich in dem runden Packen Papier, dreht ihn mehrmals um, rollt ihn hin und her und schüttelt ihn immer wieder durch. Jeden Moment droht das Neugeborene unter die Räder zu geraten und von den tonnenschweren Gewichten zerquetscht zu werden. Zwei weitere Eisenbahnen, die dicht nacheinander heranbrausen, halten ebenfalls nicht an; die dritte jedoch, die stoppt auf der Höhe des Prellbocks auf einem Nebengleis.
Niemand steigt aus, zwei Fahrgäste steigen ein und nehmen Platz im Abteil und fahren nur ein paar Dutzend Sekunden später davon; die dritte Person bleibt stehen, schaut nach links und blickt nach rechts, schlägt die Füße mehrfach aneinander, schiebt den Mantelkragen höher, klatscht in die Hände. Es ist ein Mann. Er setzt ein paar Schritte nach links und dann wieder nach rechts. Er geht zwei Meter geradeaus. Er bleibt stehen.
Auf einmal, so als hätte ein Dirigent sein Handzeichen gesetzt für den brachialen Schlussakkord des Konzerts, verebbt der Sturm. Und es hört für eine kurze Weile zu schneien auf. Und plötzlich und unerwartet und nicht vorhersehbar kehrt Stille ein. Für einige Sekunden ist kein Laut, kein Geräusch ist zu hören. Die Mäuse verharren unter der Schneedecke in ihrem Lauf, und der Lärm der Kfz-Motoren verstummt in Echo der Böen. Es ist so still, als hielte die Welt den Atem an. Das Licht des Halbmonds hellt sich auf für wenige Momente. Und die paar Sterne, die zu sehen sind am schwarzen Himmel, die scheinen magisch zu blinken.
Der Mann verharrt, beugt sich nach vorn. Er zögert, sieht sich um. Er geht in die Knie. Er lauscht und senkt seinen Kopf. Er dreht seinen Körper und lässt sich, in dem er sich abstützt an der Kante des Bahnsteigs, mit der Brust und dem Bauch langsam ins Gleisbett herabsinken. Er bückt sich, greift nach dem Bündel zu seinen Füßen, hebt es auf, reckt seine Arme hoch, legt das Neugeborene ab über sich auf den Steinplatten. Er hangelt sich hoch, nimmt das Knäuel mit dem Baby an sich, öffnet seinen Mantel, schiebt es darunter, um es zu wärmen und läuft dem Ausgang zu. Er strauchelt, rutscht aus, fällt hin. Er steht wieder auf und rennt zu seinem Auto, das neben dem Bahnhofsgebäude geparkt ist. Er steigt ein, legt keinen Sicherheitsgurt um.
Der einen Tag alte Säugling liegt auf seiner Brust. Er steuert das Lenkrad nur mit einer Hand; mit der anderen hält er ihn fest an sich gepresst. Und in diesem Moment fallen ihm die ersten Textzeilen des Goethe-Gedichts vom Erlkönig ein, die er sich zuflüstert: »Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hält den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm …«
Er haucht dem Baby von oben herab mehrmals seinen Atem zu. Es hat die Augen wieder geöffnet. Seine Sicht ist geradeaus gerichtet durch die beschlagene Windschutzscheibe, und es sieht, ohne sich dessen gewahr zu werden, mit getrübter Sicht wie verschwommen Schwärme weißer Flocken herumwirbeln im Licht der Scheinwerfer. Es wimmert nicht mehr. Es friert entsetzlich. Es ist nass. Es ist zum Sterben hungrig. Und es hat schmerzhaften Durst. Es ist bereits halbtot. Niemand hätte für sein Leben jetzt noch einen Cent auf den Tisch geworfen.
Das Baby, das keinen Laut mehr von sich gibt, es weiß nicht, was mit ihm gerade geschieht. Es weiß nicht, wer seine Mutter ist, die ihn am Vortag geboren hat und wer sein Vater. Es weiß nicht, wo es hingehört. Es weiß nicht, was aus ihm werden wird und was das Schicksal noch vorgesehen hat für die Zukunft. Es ist hineingeschleudert in seine Existenz wie ein Stein, der irgendwo aufschlägt in den Schneefeldern eines zugefrorenen Sees. Und es weiß nicht, wer der Fahrer ist, der das Gaspedal des Wagens bedient, in dem es durch die Nacht fährt.
Der Mercedes fährt mit hohem Tempo; trotz der glatten Straße. Der Mann, der die betagte Limousine steuert, will, so schnell wie es möglich ist bei dieser bedrohlichen Witterung, zurück fahren in das Dorf, in dem er wohnt. Er hat die Heizung ganz aufgedreht und das Gebläse ebenso. Ihm ist bewusst, dass jetzt jede halbe Minute zählt, soll der Tod noch abgewendet werden von diesem Kind in seinem Arm. Einen Arzt, den gibt es nicht in der Einöd-Gemeinde, auch keinen Pfarrer und keine Kirche und keine Polizeistation. Es stehen nur ein paar Bauernhäuser in der Ebene, drei Schober für Heu und zwei Ställe für das Vieh.
Vor dem Eingangstor seines Hauses bremst er das Auto so stark ab, dass die Räder blockieren und das Fahrzeug zu rutschen beginnt. Es stellt sich quer und bleibt dann stehen. Der Mann springt heraus und trägt das Papierknäuel mit dem Baby ins Haus und dort die Treppe hoch ins Badezimmer. Er dreht das Licht an und einen Glühfaden-Ventilator, legt das Neugeborene auf einer Kommode ab, nimmt eine Plastikschüssel und füllt sie mit warmem Wasser. Danach schneidet er die Plastiktüte auf und die Schnur des Pakets durch, wickelt die Schichten der Zeitungen ab, die mehrere hundert Kilometer entfernt in München gedruckt wurden und befreit den Säugling aus seinem durchnässten Packen Papier.
Es ist ein Junge. Seine Haut fasst sich so eisig an wie ein Ball aus gefrorenem Schnee. Er ist nass und er hat volle Windeln, die aus einem Frotteehandtuch bestehen. Sein Atem ist nur noch ein Hauch. Er beginnt wieder ganz leise zu wimmern, als er abgespült wird. Er macht die Augen auf und erkennt ein Gesicht, das sich über ihn beugt und ihn anlächelt.
»Na du … du … du Sohn von irgendjemandem … von einer unbekannten Mutter und von einem Vater, den keiner kennt … Du … du … du bist aber klein, siehst ja aus wie ein Frühchen. Sei mir herzlich willkommen in der Welt«, vernimmt er eine Stimme flüstern. »Gott sei Dank, dass ich dich Winzling gehört habe … da unten neben den Gleisen … bei dieser furchtbaren Kälte. Wer dort abgelegt wird wie Abfall und dann doch gerettet in letzter Minute, der ist auserwählt von seinem Schicksal … ja auserwählt, so kann man sagen. Du bist ein Wunder … ein großes Wunder. Dein Leben, das ist ein Wunder.«
Er fühlt das warme Wasser auf seinem Leib und er fühlt die Kälte entweichen aus ihm und er fühlt die behutsamen Berührungen einer Hand und er hört den Lauten dieser Worte zu, die an ihn gerichtet sind. »Deine Bestimmung, die hat es sehr, sehr … sehr gut gemeint mir dir. Und das hat bestimmt einen Sinn … einen wichtigen Grund. Wer weiß schon, was aus dir noch werden wird. Vielleicht musst du einen Opfergang gehen, einen mit Leid und Elend. Und du musst all das ertragen. Oder du bist ein neuer Messias … ein Heiland … eine neue Hoffnung für unsere Welt … ein wahrer Erlöser, der endlich zu uns gekommen ist …«
Und er denkt in diesem Moment nur so für sich ganz leise im Stillen und er glaubt fest daran und er wünscht es sich so sehr, dass dieses wundersame Ereignis, an dem er gerade teilnimmt und das er bezeugen kann, einen historischen Wert hat und es eines jenes vom Schicksal bestimmten Ereignisses ist, wie es in tausend Jahren nur ein- oder nur zweimal geschieht.
Der Mann, der den winzigen Buben gerade wäscht und der auf ihn einredet, ist 41 Jahre alt, unverheiratet; von Beruf Vertreter für erlesene Frucht-Konfitüren. Er ist stämmig von Statur, schwarzhaarig. Sein Gesicht ist grob geschnitten. Sein Name: Hubertus Holl.
»Du hast doch … du kleiner Spatz … hast doch stimmt einen Riesenkohldampf … und großen Durst, den hast du ganz sicher auch«, setzt er seine Ansprache fort. »Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Dich stillen mit der Brust, das geht nicht. Ich hab’ keine, die Milch gibt. Und eine Babyflasche, die hab’ ich auch nicht … Und Marmelade, von der ich reichlich besitze, die darf ich dir nicht geben … und ein Käsebrot, das magst du sicher auch nicht … und ohne Zähne im Mund ist ein Kotelett schon gar nichts für dich.«
Er hebt den Säugling, der kaum noch ein Lebenszeichen von sich gibt, aus dem Wasser, lässt es kurz abtropfen, hüllt ihn in ein Badetuch und wickelt ihn zusätzlich in eine Decke ein.
»Frieren, das ist nun vorbei für dich … und einsam, das bist du auch nicht mehr.«
Er trägt den Jungen, der nicht mehr wehklagt und der sich nicht mehr bewegt, ins Schlafzimmer, bettet ihn auf einem großen Kopfkissen und legt sich neben ihn.
»Was soll ich bloß mit dir machen?«, fragt er mit lauten Worten in den Raum hinein. Und er hat diesen Satz gerade beendet, da kommt ihm wenige Sekunden später ein Entschluss in seine Gedanken.
Er greift zum Mobil-Telefon und ruft den Notarzt an. Er schildert, dass er das Kind neben den Gleisen gefunden und zu sich genommen hat und dass der Säugling wegen Unterkühlung und der Gefahr der Austrocknung dringend in ein Krankenhaus gefahren werden muss.
»Hören Sie … das Leben … das des Babys, das steht auf dem Spiel«, sagt er und teilt seine Anschrift mit. »Beeilen Sie sich … bitte … machen Sie schnell. Schnell! Schnell! Ich weiß gar nicht mehr, ob es nicht schon gestorben ist.«
Und während der Rettungswagen, dem ein Polizeiauto folgt, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in hohem Tempo aus der Toreinfahrt des Hospitals Sankt Blasius in Richtung der angegebenen Adresse fährt, beugt sich im Berliner Bezirk Charlottenburg eine Kinderfrau über das aus der Zeit des Empire stammende vergoldete Bett eines einen Tag alten Jungen und zieht an der Schnur einer Spieluhr. Die Melodie Ihr Kinderlein kommet … oh kommet doch … ertönt; lieblich vorgetragen auf dem Xylophon. Die dunkelhäutige Afrikanerin streicht die seidene Zudecke glatt und verlässt auf Zehenspitzen den bis zur Hälfte der hohen Wände mit Lindenholz getäfelten Raum; der ist mehr als zwanzig Quadratmeter groß. Auf dem Parkettboden liegt ein prachtvoller rot-gelber Kelim, und auf dem Nachttisch steht ein Weihnachtsbaum aus Plastik, an dem Girlanden und Glühlämpchen blinken.
Der Knabe, dessen Gesicht im Halbdunkel des Zimmers nicht zu erkennen ist, schläft mit ruhigen Atemzügen. Sein Vorname: Ruben. Er ist das einzige Kind des wohlhabenden Berliner Immobilienmaklers Gunter Door und seiner Frau Barbara. Das religionslose Paar ist seit 16 Jahren verheiratet. Ihre Ehe gilt als erkaltet.
Firmensitz der GmbH und zugleich das luxuriöse Wohndomizil der Familie: eine mächtige, aus ockerfarbenem Sandstein gebaute Jugendstilvilla mit sechzehn Zimmern; umgeben von einem eingeschneiten zwei Hektar umfassenden Park im englischen Stil. Dort lebt ein Pfau, und dort sind mehrere Skulpturen aufgestellt – aus Stahl und aus Granit. Hinter dem Anwesen liegt ein kleiner See; Lebensraum für Karpfen, Frösche, Enten und ein Paar von Schwänen. An einem Steg aus Holz ist ein Ruderboot im Eis festgefroren.
Barbara Door, die ihren Sohn und einziges Kind als Spätgebärende im Alter von 42 Jahren um 12.03 Uhr am Heiligen Abend bei einer komplizierten und lang andauernden Hausgeburt zur Welt gebracht hat, ruht geschwächt in einem Dämmerschlaf im Südflügel des Gebäudes; ihr Mann, vierzig Jahre alt, hält sich im obersten Stock unter dem Dach in einer Mansarde auf.
Er hört Musik: Brahms. Er blickt aus dem Fenster auf die Wiesen voll Tau und in die ersten glimmenden Lichtspuren des heraufziehenden Morgens. Er trinkt das dritte Glas Calvados. Er ist attraktiv. Er kleidet sich elegant. Er ist wohlhabend. Er ist gebildet. Er ist klug. Er ist schlank. Und er ist der klassische arrogante Typ, zu dem die Menschen, wenn sie es könnten, schneller auf Wiedersehen sagen, bevor er überhaupt guten Tag gewünscht hat. Er lebt mit sich in einer trügerischen Harmonie aus Eigenliebe, Selbstgerechtigkeit und herrischem Stolz. Seine Körpergröße: ein Meter 83. Die Geburt seines Sohns erfüllt ihn mit kontrollierter Freude.
Als Barbara ihm den wenige Minuten alten Jungen präsentierte, hatte er gesagt: »Ich danke dir … ich danke dir sehr.« Und er hatte, ohne sie dabei direkt anzusehen, mit einem Lächeln hinzugefügt: »Ich bin glücklich, dass es Ruben gibt … jetzt hier bei uns.«
Dann hatte er sich über sie gebeugt und ihr einen flüchtigen Kuss auf die Stirn gegeben. Sie hatte ihn ebenfalls angelächelt und diesen kurzen Satz gesprochen: »Ich danke dir ebenso von ganzem Herzen für dieses bildschöne Baby …«
Fast vierhundert Kilometer entfernt vom herrschaftlichen Anwesen der Doors, dessen Hausherr an diesem späten Vormittag des 1. Weihnachtsfeiertags unter der Dusche steht und sich belebt von der durchwachten Nacht, sitzt Hubertus Holl genau um diese Sekunden von Zeit übermüdet und seelisch mitgenommen in seiner Küche und löffelt kalte Mich mit Haferflocken. Er ist noch nicht wieder bei sich, ist sich nicht klar in seinen Gedanken über den emotionalen Befund seines Gemütszustands, ist verwirrt, ist in Mitleidenschaft gezogen. In seinem Inneren rollt eine Welle von Schwermut heran, die ihn niederdrückt. Dabei kann er sich, als wäre es ein Film, der abrollt, haarklein daran erinnern, was sich zugetragen hat mit dem Baby in der vorausgegangenen Nacht: der Notarzt, ein Sanitäter und zwei Polizeibeamte waren mehr als zwanzig Minuten nach seinem Notruf bei ihm eingetroffen. Sie waren ins Haus gestürmt und hatten gerufen: »Schnell! Schnell! Wo ist er? Wo ist der Junge? Wo ist er?«
Und dann, so kommen die Bilder des Geschehens immer wieder zurück zu ihm, war das Baby, das man ihm so schnell weggenommen hat wie der Blitz, in eine beheizte Tragewanne gelegt und mit Decken und einer goldfarbenen Folie eingewickelt worden. Und wenige Sekunden später war es schon nicht mehr zu sehen. Eine Wagentür schlug zu, ein Motor heulte auf, und dann herrschte Stille für einen Augenblick. Die beiden Polizeibeamten, ein Mann und eine Frau, die hatten ihn ausführlich zu dem Geschehen befragt, und sie hatten die Mülltüte und die Zeitungen mitgenommen, in die der Säugling eingewickelt gewesen war, und das durchnässte und beschmutze Frotteehandtuch, das hatten sie in eine durchsichtige Plastiktüte gesteckt.
»Darauf suchen wir nach DNA-Spuren«, hatte die Polizistin gesagt. »Die könnten ja von der Täterin stammen.« Und dann fügte sie hinzu: »Es handelt sich hier ja um versuchten Totschlag … und wenn das Kind stirbt … dann ist es sogar Mord.«
Danach waren die Beamten mit Hubertus Holl zu der Stelle unterhalb des Bahnsteigs gefahren, an der er das Baby wimmern gehört, es von dort aufgehoben und es dann zu sich auf den Arm genommen hatte. Und er hatte berichtet, was genau vorgefallen und warum er auf dem Bahnhof gewesen und welches sein Reiseziel gewesen war. Außerdem war er für den nächsten Tag auf die Wache bestellt worden. Dort musste er seine Aussagen nochmals zu Protokoll geben und mit seiner Unterschrift bestätigen.
Der Polizist hatte mit einer Taschenlampe das Schotterbett ausgeleuchtet und den Abschnitt minutenlang nach Spuren gesucht. Aber abgesehen von einer Bierdose, Zigarettenkippen, von einem halb verwesten Vogel und einem Arztroman-Heft hatte er keine für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen relevanten Gegenstände gefunden.
»Hier neben dem Gleis«, hatte der Polizist gesagt, »hier ist ab jetzt sein offizieller Geburtsort, wenn es uns nicht gelingt, die Mutter zu ermitteln und … und wo sie es tatsächlich konkret geboren hat … das Kind … ihr Kind.« Und er hatte noch diese Worte hinzugefügt: »Es kann ja sein, dass es von weit her kommt … ist vielleicht angereist mit der Mama in einem Zug, und sie hat es heimlich auf der Toilette zur Welt gebracht hat und es dann hier in der Eiseskälte abgelegt … ihr eigenes Fleisch und Blut … und das bei lebendigem Leib.«
Die Polizistin hatte tief eingeatmet und dann bemerkt: »Aber warum ist es gerade am Heiligen Abend geschehen und warum gerade hier … genau hier, wo das Neugeborene hätte leicht überfahren und getötet werden können. Himmel und Kruzitürk! Wer ist fähig zu so was … welche Mutter tut so etwas unvorstellbar Grausames und nimmt in Kauf, dass ihr eigen Fleisch und Blut … ihr eigenes Baby von den Rädern eines Eisenbahnzuges zerquetscht wird.«
Der Säugling war sofort nach seiner Ankunft im Krankenhaus in einen Brutkasten gelegt und ärztlich untersucht und versorgt worden. Er wird seither künstlich ernährt und erhält die Zufuhr von Flüssigkeit. Eine Gewissheit des Überlebens besteht nicht. Das Körpergewicht des drei Tage alten Jungen beträgt aktuell nur 2003 Gramm.
»Wir müssen weiterhin von Stunde zu Stunde in Sorge sein«, sagt der behandelnde Arzt. »Erst nach zwei Wochen etwa, und wenn bis dahin keine Verschlechterung des Gesundheitszustands eintritt, können wir mit aller großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Junge alsbald genesen wird. Er ist von Geburt an ein Leichtgewicht und er ist sehr … sehr stark unterkühlt gewesen … Und einen Schock, den hat es ganz bestimmt auch davongetragen.«
Während der Neugeborene weiter auf Messers Schneide gegen seinen Tod ankämpft, denkt sein Retter Hubertus Holl immer wieder darüber nach, was aus seinem Baby geworden ist. Wer behütet es? Wer sorgt für den Jungen? Ist er noch am Leben? Über seinen nächtlichen Fund am Weihnachtsabend hatten die Medien ausgiebig berichtet, und ein Zeitungsausschnitt, der an der Tür seines Kühlschrankes klebt, der trägt diese Überschriften in roten Großbuchstaben: Das Wunder am Heiligen Abend – Frühchen drohte der Erfrierungstod - Neugeborenes in letzter Sekunde gerettet vor herannahendem Zug.
Und immer, wenn er in die Küche geht oder eine Mahlzeit zu sich nimmt, fällt sein Blick auf den Artikel und auf ein Foto von sich, in dem er als Held gefeiert wird, der ein gerade geborenen Säugling in eisiger Kälte gerettet hat. Holl ist unendlich traurig darüber, dass er seinen Jungen, wie er es besitzergreifend fühlt, nie mehr wieder zu Gesicht bekommen wird, so glaubt er zu wissen, sicher zu sein.
Aber so, wie er es sich denkt, dass es geschieht, wird es nicht sein: mehr als dreißig Jahre später wird er in den Tagesthemen der ARD um 22 Uhr und 34 Minuten mehrere Minuten lang Bilder sehen und dazu den Text der Nachricht hören, die von dem Mann handelt, zu dem das Baby herangewachsen ist, das er einst wimmern hörte unter sich im Schottergleis des Bahnhofs von Karlsburg. Hubertus Holl jedoch wird nicht einmal ahnen, was er von wem da in Groß- und in Nahaufnahme auf dem Bildschirm sieht, und dass er es gewesen ist, den er gerettet hat vor dem fast sicheren Sterben.
Doch dessen Biografie, die hat ja gerade erst begonnen. Noch ist er sich seines Ichs nicht bewusst, noch ist er hilflos und abhängig, noch seinem Schicksal willenlos überantwortet, das jeden Tag einen neuen Anfang nimmt und das zu einem Ende findet und das über Leben und Tod sein Urteil fällt.
Fünf Wochen später, als seine Gesundung nahezu abgeschlossen ist, wird der namenlose Knabe, der nicht größer ist als der Unterarm eines Mannes, vorübergehend in die Säuglingsstation eines Waisenhauses verlegt, das sich jetzt um ihn kümmert. Dort bekommt er aus der Flasche zu essen und zu trinken; er wird gewickelt und gewaschen, er wird gepudert und eingecremt und von den Schwestern liebevoll behandelt.
Und er erhält, wie üblich bei allen Findelkindern nach den in Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen, eine eigene staatsbürgerliche Identität zugeteilt, die amtlich beglaubigt wird; mit Stempel und Unterschrift.
Das Datum, an dem er geboren wurde, wird gemäß einem ärztlichen Befund auf den 24. Dezember festgelegt. Und die Zeit, zu der er auf die Welt gekommen war: 12.03 Uhr. Als sein Geburtsort ist der Name der Gemeinde benannt, in der er, nur noch halb lebendig an Leib und Seele, gefunden wurde: Karlsburg.
Den Vornamen des Jungen haben sich alle elf Pflegerinnen der Abteilung in einer gemeinsamen Abstimmung ausgewählt - in tiefer Zuneigung für einen von ihnen sehr verehrten, inzwischen aber verstorbenen US-Sänger und Songschreiber und in Anbetracht ihrer Vorliebe für das Aussehen und für den Charakter und für die erkennbare Intelligenz ihres zwei Monate alten Schützlings. Und sein Nachname, den hat eine aus Indien stammende Schwester ihm gegeben; in Würdigung eines in ihrem Heimatland immer wiederkehrenden Naturereignisses, das mal ein Fluch ist und mal ein Segen.
In den Frauen ist der esoterische Wunsch angelegt, dass ihr Baby von besonderer Geburt ist und von besonderen Eltern abstammt, die im gleichen Stande sind wie Fürsten oder Könige. Der Vater könnte auch ein Häuptling der Indianer sein und die Mutter die Tochter des Medizinmannes.
»Weil unser kleiner Bub wirklich ein besonders hübsches … ein besonders süßes, ein sehr, sehr süßes, ein besonders niedliches … und ein besonders waches und besonders zauberhaftes und besonders wundervolles Baby-Bürschlein ist«, lautete die einstimmig gefasste Begründung, die mit Beifall besiegelt wurde.
»Der kleine goldige Schlingel der … der wird vielleicht eines Tages genau der Erlöser sein, auf den die ganze Welt schon lange wartet … seit mehr als zweitausend Jahren.«
Auf einem schmalen Band, das ihm um das Handgelenk gelegt ist und ebenso auf seiner Geburtsurkunde, wenige Tage vor seiner Überstellung in ein Kinderheim ausgefertigt, steht - Schwarz auf Weiß - folgender Vor- und folgender Familienname geschrieben: Johnny Monsun.
2. Kapitel
Er schluchzt und er ringt nach Atem. Seine Oberlippe ist geschwollen, seine linke Wange rot angelaufen. Tränenwasser läuft ihm in den Mund. Er kniet und er hat die Hände, wie befohlen, hinter seinem Rücken verschränkt. Sein Blick, der ist zu Boden gerichtet, sein Nacken gebeugt. Er zittert vor Angst. Er spricht ein stilles Gebet und bittet den Heiland und seinen lieben Gott um sofortige Hilfe aus höchster Not.
»Jetzt weg mit dir aus meinem Blickfeld! … und ab mit dir ins Loch, du … du unerzogener Bengel … du böse, böse … du sehr, sehr böse Brut der Sünde!«, schreit Schwester Gunilla ihn an und haut ihm, locker geschlagen aus dem Handgelenk, schnell noch weitere Ohrfeigen ins Gesicht. Jedes ihrer Worte klingt wie das Kläffen eines Hundes.
»Wer nicht gehorchen kann, der muss eben fühlen … du … du Miststück von einem Jungen«, setzt die Ordensfrau nach.
Sie trägt ein weißes Gewand und eine schwarze Kopftuch-Haube. Ihr Gesicht ist bleich und flach wie eine Scheibe Käse. Ihre Lippen, die sind ganz dünn, die sieht man nicht. Sie ist 52 Jahre alt und seit ihrem Ewigkeitsgelübde, das sie als Jungfrau ablegte, die vermählte Braut von Jesus Christus dem Sohn des Herrn.
Sie zerrt ihn an der Schulter, packt seinen Arm, schleift ihn in die Mitte des Raumes, hebt eine im Boden eingelassene Falltürklappe hoch und stößt den Jungen hinein in die Öffnung. Darunter erstreckt sich ein fensterloser rechteckiger Raum von der Größe eines doppelten Kleiderschranks. Die Höhe ist so gering, dass ein Pony darin nicht stehen kann.
»Und wehe dir, ich höre nur einen einzigen auch noch so leisen Mucks«, schreit sie ihm nach. »Dann … ja dann gnade dir Gott … Keinen Ton, verstanden!«
Mit lautem Krach, der wie ein Schuss klingt aus einem Revolver, schlägt das Gewicht der Bohlen-Bretter zurück, und es rastet wieder ein im Scharnier. Staub wirbelt auf.
In seinem Verlies, in dem die Dunkelheit so dicht und so schwarz ist, als wäre es ein Klumpen Teer, krümmt sich ein Junge vor Angst und vor Schmerzen. Es hat sich blutig geschlagen beim Aufprall in seinem Kerker, in dem er zur Strafe einen halben Tag bis nach dem Abendbrot ausharren muss. Das heißt für ihn: hungrig ins Bett.
Sein Vergehen: er hat seinen Napf, der bis zum Rand gefüllt war mit kaltem und stark versalzenem Hirsebrei, nicht ganz aufgegessen, und das Erbrochene, das ihm danach in einem Schwall hochgekommen war vor Ekel und wie eine Fontäne aus dem Mund gespritzt, das hat er danach ebenfalls nur zu Teilen verspeisen können. Die anderen Kinder im Saal, die Mädchen und die Jungen, die schauten nicht hin und die sagten kein Wort; sie hatte der Anblick des Grauens gelähmt.
Als er hört, wie sich die Schritte der Nonne über ihm entfernen, wendet seinen Kopf nach allen Seiten, aber er sieht nichts. Er kann seine Hände berühren, aber er erkennt ihre Umrisse nicht. Er riecht das Entsetzen, das ihn befällt und er riecht den Gestank eines Abortkübels und wohl auch tropfenweise Blut. Er versteinert zunächst und stellt sich tot für einige Momente, kann aber einen Weinkrampf nicht unterdrücken, der ihn schüttelt. Er hustet, und die Panik, die ihn erfasst, würgt ihm den Hals zu. In seiner Not würde er gerne um Hilfe rufen und um Beistand schreien, die Furcht jedoch, die Nonne könnte ihn hören und wieder und wieder auf ihn einschlagen, lässt ihn schweigen.
Aber an wen hätte er sich auch wenden und wessen Namen hätte er auch nennen können? Eine Mutter, die hat er nie gekannt, und einen Vater, den hat es nie gegeben. Und Geschwister, einen großen Bruder etwa, den kann er ebenso wenig anflehen, ihn zu befreien aus dieser unfassbaren Qual, der er ausgesetzt ist. Und auf Hilfe von der Polizei, die konnte er nicht erwarten.
Der Junge, der dort in dem kalten und dunklen und stickigen Loch liegt, das ist Johnny … ist Johnny Monsun, das Frühchen vom Bahnhof Karlsburg. Er ist jetzt acht Jahre alt, von Statur mager und für sein Alter zu klein gewachsen. Er hat schwarze Haare und leuchtend hellgraue Augen. Er ist hübsch anzusehen. Und er ist freundlich in seinem Wesen.
Dieses von der katholischen Kirche betriebene Haus, in dem er seit elf Monaten lebt, ist die vierte Heimstatt für Waisenkinder, die ihm von amtlicher Trägerschaft zugewiesen worden ist. Mal waren es Ordensleute, mal protestantische Erzieher, dann wieder Betschwestern, die ihn und seine noch nicht schulpflichtigen Leidensgenossen wie Vieh behandelten und sie folterten und sie nötigten und ihnen die Freiheit und die Selbstbestimmung raubten und ihr Lachen und ihre Fröhlichkeit
Sie schlugen sie grün und blau und blutig und sie erniedrigten sie. Sie verbrannten sie mit Bügeleisen und Kerzenwachs. Sie spuckten sie an, und manche urinierten auf sie bei nächtlichen Doktorspielen in der Sakristei. Und sie ließen sich, ob Pastor oder Nonne, schon vor dem Morgengebet ihre Ärsche lecken und saugen an ihren Geschlechtsteilen von den Buben und den Mädchen. Und der harzige Geruch von Weihrauch, der waberte dabei über dem Kruzifix und über dem Weihwasserbecken und zwischen den Beichtstühlen und an den Heiligenbildern entlang von Nepomuk und Petrus und der Jungfrau Maria und dem gemarterten Sohn von Gott.
Sie taten ihnen Gewalt an. Sie sperrten sie ein, sie ließen sie hungern und sie verweigerten ihnen einen ganzen Tag lang zu trinken. Sie ließen die Kinder in ihrem Urin liegen und sie zwangen sie immer wieder bei Tag und bei Nacht zu oralen Handlungen an männlichen und weiblichen Geschlechtsteilen. Das hieß: an den Mönchen saugen und an den Nonnen lecken, bis es denen auf die eine und die andere Art gekommen war. Und manche der Aufseher, die vergewaltigten ihre Schutzbefohlenen anal.
Johnny hat auch davon erfahren, dass der Leiter eines der Heime sich jede Nacht ein anderes Mädchen griff, es aus seinem Bett riss und an den Haaren auf sein Zimmer zerrte und es dort zu sexuellen Handlungen zwang, die er bestimmte. Dazu gehört es, dass es sein Wunsch war, ihm die entblößten Spitze von seinem erigierten Penis zu küssen, die Hoden zu streicheln und danach das Ende des äußeren Schließmuskels mit der Zunge zu liebkosen.
Das Erziehungsheim Martinsgrotte, in dem Johnny jetzt untergebracht ist, das liegt, weitab von einer anderen menschlichen Ansiedlung, in einer idyllischen Landschaf auf einem der vielen Höhenzüge des Schwarzwalds. Es mutet an wie eine kalte Insel, ist ein ein düsterer Schauplatz des Verbrechens, ist eine niedergerungene Welt ohne Menschlichkeit. Hier hat die Unterwelt ihre Tore geöffnet und die schlimmsten der Sorten von Aufpasserinnen an diesen Ort verschlagen.
Senkrecht aufsteigende Felswände begrenzen den Nordteil des mannshohen Drahtzauns, mit dem das Areal umgeben ist. Die Gebäude, in denen 136 Jungen und Mädchen im Alter von drei bis siebzehn Jahren untergebracht sind, von dicken Steinmauern erbaut und mit kleinen Fenstern versehen, stammt aus der Zeit des Empire.
Die Unterkünfte, in denen Johnny zuvor Verpflegung und ein Dach über dem Kopf bekommen hatte, die waren, seit er alt genug war, die Schikanen und Entwürdigungen zu erkennen, nicht ganz so furchtbar gewesen: geschlagen wurden die Schutzbefohlenen aber auch; egal, ob Junge oder Mädchen. Und es gab Nahrungsentzug. Bettnässer erhielten fünf hart geschlagene Kopfnüsse und fünf Hiebe mit einem Weidenstock auf die Finger beider Hände, und sie bekamen an fünf Tagen keinen Nachtisch.
Und sie wurden angehalten, sich über die ausgebreiteten Arme mit dem nassen Laken solange aufrecht hinzustellen, bis es wieder getrocknet war. Wer während des Essens versehentlich ein paar Tropfen Tee verschüttete oder sich aufstützte mit dem Ellenbogen oder wer mit Soße kleckerte, der musste sofort aufstehen und sich während der Mahlzeit mit dem Gesicht zur Wand in die Ecke stellen. Der Kommentar der im Speisesaal Aufsicht führenden Schwester Gunilla: »Schäm dich … du olles Drecksferkel … Da essen ja die schlimmsten Schweine besser als du.«
Diese Stimme von ihr, die mal schrill tönt und auch wieder blechern, sobald sich auch Zorn und Verachtung darin mischen, wirkt auf Johnny wie eine Trillerpfeife, die ihn auf einen Folterblock zu rufen scheint. Er erschaudert jedes Mal, wenn er den Schall ihres Gebrülls schon von weitem sich ihm nähern hört. Einen Stoß vor die Brust oder einen heftigen Klaps in die Wange, damit muss jedes Kind rechnen, das ihr begegnet. An den Haaren ziehen und dabei lächeln, das macht ihr ebenfalls Freude. Und kneifen, kneifen, kneifen überall hin, das mag sie, das beherrscht sie virtuos, das kann sie – in die Ohren, in den Hals und in die Brustwarzen. Treten gegen das Schienenbein, diese Handhabung gehört ebenso zum Repertoire der Bestrafung.
In seinem Kerker sind erst zehn Minuten vergangen, ihm aber mutet es an wie die ewige Ewigkeit, die ewig dauert. Was wird aus mir, wenn man mich vergisst, und niemand kommt, um mich aus dieser Finsternis zu befreien, ängstigt sich Johnny. Ich werde verdursten und ich werde verhungern, ist er sich sicher. Und später, wenn die Erde untergegangen ist, findet man hier mein Gerippe.
Er faltet seine Hände und beginnt im Flüsterton zu beten: »Lieber, lieber … du mein lieber … lieber, lieber … allerliebster Gott, komm doch bitte, bitte schnell … herunter aus dem Himmel zu mir und … und hilf mir hier raus aus diesem dunklen Loch … jetzt gleich. Lieber, lieber … lieber Gott, ich bitte dich darum sehr, sehr … Mach so schnell, wie du kannst und rette mich.«
Zeitgleich bis auf die Sekunde, als Johnny in tiefer Furcht vor dem Alleinsein in seinem Kerker, der keinen Funken Licht durchlässt, in seinem Gemüt zerbrochen seelisch zu verenden droht, stößt der gleichaltrige Ruben Door, durchflutet von ergiebigen und druckvollen Glücksfontänen, laute Freudenschreie aus. Er juchzt und er lacht und er wackelt mit seinen Beinen, und der Wind erfasst seine blonden Haare, die ihm wie ausgefranste Wimpel um die Ohren fliegen.
Er umarmt sein Kindermädchen Alika. Der Name bedeutet auf Kisuaheli: Die Frau, die durch ihre Schönheit alle anderen Frauen übertrifft. Sie sitzt neben ihm in einem Doppelsitz eines Ketten-Karussells. Sie hält seine Hand und küsst sie zart. Der Fliegende Regenschirm, der immer schneller an Fahrt aufnimmt, ist für Jungen und Mädchen die Hauptattraktion im Erlebnisdorf Elstal westlich von Berlin.
Es ist Rubens Namenstag. Es ist der achte für ihn, den er feiert, seit er denken kann. Und er feiert ihn immer auf diesem Rummelplatz. Und es ist immer Alika, die ihn begleitet und darauf achtet, dass ihm nichts passiert. Mit ihr teilt er seine kindlichen Freuden. Mit ihr ist er in tiefer Harmonie verbunden.
Es ist warm an diesem 14. September. Die Sonne scheint. Am Himmel über ihnen sind keine Wolken zu sehen. Es duftet nach gebackenen Waffeln und Zuckerwatte und Türkischem Honig und es riecht nach Ziegen und Ponys und einem Dutzend Erdmännchen, die im Streichelzoo ihr auf Futter warten.
Als nach dem Ende der Fahrt im Kreis alle Personen aussteigen, bleiben Alika und Ruben sitzen. Sie haben sich die Fahrkarten gleich für sechs Runden hintereinander gekauft.
»Ich könnte hier immer bleiben, so schön ist es«, sagt Ruben. »Fliegen, fliegen … fliegen. Ich will wieder fliegen.«
Er ist ungeduldig und zerrt an den Ketten, an denen er sich festhält.
»Wunderbar, wunderbar … huuiii«, ruft er aus, als sich das Karussell zu drehen beginnt und immer schneller und schneller wird.
»Mir ist schon ganz schwindlig im Kopf«, bemerkt Alika. Sie wendet sich ihm zu und lacht hell auf. Ihre weißen Zähle leuchten auf zwischen ihren rot geschminkten Lippen.
Sie ist attraktiv, groß gewachsen, schlank, sechsundzwanzig Jahre alt und seit Rubens Geburt im Hause angestellt. Sie stammt aus der mehr als eine Millionen Einwohner zählenden kenianischen Küstenstadt Mombasa. Ihr Vater ist Arzt, ihre Mutter Lehrerin. Sie ist das einzige Kind.
Am Abend des Ehrentages von Ruben haben seine Eltern ihn in ein Schnellrestaurant eingeladen. Er darf essen, was sich wünscht. Und er wünscht sich zwei Hamburger und eine Tüte Pommes Frites und zwei doppelte Becher Schokoladeneis. Und er wünscht sich noch einen Schokoriegel und zu trinken Orangenlimonade.
»Das ist jetzt aber genug«, sagt seine Mama Barbara. »Du verdirbst dir noch den Magen. Und dir wird ganz schlecht.«
Und Vater Gunter Door, der ermahnt ihn: »Viel klüger ist es, jeweils nur eine Portion zu essen. … du willst doch wohl nicht etwa dick und fett werden, oder?
Ruben erwidert: »Es ist ja nur einmal im Jahr … mein Namenstag … und dann kann man essen, bis man platzt.«
Johnny Monsun hingegen, der seit vier Stunden in seinem stockdunklen Kerker eingesperrt ist, der hat jedes Zeitgefühl verloren. Ihm frisst die erdrückende Angst beinahe den gesamten Verstand auf und Stücke seines Bewusstseins dazu. Ihm ist zumute, als wäre er niedergeschmettert aus großer Höhe. Er bemerkt nicht, dass er sich gerade zum zweiten Mal in die Hose macht; der Urin bildet eine Pfütze zwischen seinen Beinen.
Kein Geräusch ist zu hören; nicht neben ihm, nicht über ihm. Es ist so still, wie es der Tod ist, wenn er sich von hinten nähert. Nur sein Herz, das hört Johnny schlagen in seiner schmalen, knochigen Brust. Er weiß nicht, wie spät es ist. Er weiß nicht, wie lange er noch in der Dunkelheit ausharren muss. Und er weiß nicht, wann sie ihn holen kommen und ob sie ihn jemals wieder in der Gemeinschaft der anderen Zöglinge leben lassen.
Was er aber genau weiß, und fühlt das ist die Qual des Hungers. Sie kneift ihn und sie beißt ihn und sie brennt. Sein Bauch ist vollkommen leer, und er ist sich sicher, dass die Wände seines Magens schon aufeinander liegen, sich reiben in einem Saft von Säure und Spucke und sich gegenseitig blutig scheuern. Es winselt in seinen Eingeweiden, wie es Hundewelpen tun, wenn sie sich vor Prügel fürchten und es gluckst dort in hellen und in tiefen Tönen. Und Durst, großer Durst, der quält ihn ebenfalls. Seine Zunge, die ist so trocken wie Kreidemehl. Kein Tropfen Flüssigkeit benetzt mehr in seinem Mund.
Oh mein Gott, meine lieber Gott, denkt er. Lieber Vater im Himmel, hol mich doch hier raus, bevor ich sterbe … bitte, bitte … bitte. Hol mich hier raus. Komm doch gleich runter zu mir von deinem Thron im Himmel. Ich bin doch erst acht Jahre alt, bin ein Kind nur, ein kleiner Junge … mehr nicht.
Er beginnt wieder zu weinen. Er schluchzt. Er schluckt. Sein Atem rast, als wäre er einen steilen Berg hinaufgelaufen. Er ist ein einziger Haufen Elend, ist verlassen von allen guten Geistern, ist geschunden, ist lebensmüde. Der einzige Wunsch des Achtjährigen, den er in diesem Moment um Erfüllung fleht: tot umfallen und nichts mehr spüren von seinem Elend.
Aufgeschreckt aus seinem Halbschlaf hört Johnny Schritte über sich und dann das Geräusch, wie ein Riegel zur Seite geschoben wird. Eine Wand aus gleißend hellem Licht schlägt auf ihn ein. Er schließt die Augen, reibt sie sich und kneift sie wieder zu. Er hört Gunillas Stimme im schneidenden Befehlston: »Raus da! Hoch mit dir! Die Zeit ist um!«
Sie zieht ihn an seinen ausgestreckten Armen aus dem Loch.
»Na … wie war’s da drin? Hattest ja Zeit genug, ohne abgelenkt zu werden, in Ruhe darüber nachzudenken, ab jetzt immer aufzuessen, was auf dem Tisch steht, wie?«, fügt sie hinzu und treibt ihn aus dem Zimmer über den Flur vor sich her; in jedem ihrer Atemzüge lodert enthemmte Verachtung für dieses Kind.
»Du gehst jetzt sofort schlafen. Es ist Zeit für dich. Essen, das gib’s nicht mehr … Wasch dich aber noch anständig … vor allem unten rum … und am … und … und besonders unter dem Pullermännchen. Da muss es immer blitzblank sein«, weist sie ihn an. »Ich komme in einer halben Stunde … zum Gute-Nacht-Gebet.«
Auf die Sekunde um Punkt zwanzig Uhr reißt Schwester Gunilla mit einem heftigen Ruck die Tür zum hell erleuchteten Schlafsaal auf und stellt sich in die Mitte des Ganges, von dem zur linken und zur rechten Seite jeweils zehn Betten aufgestellt sind, in denen die Jungen liegen. Sie sind zwischen sechs und zwölf Jahre alt. Es herrscht absolute Stille. Keines der Heimkinder bewegt sich; jedes von ihnen weiß bis in jede Einzelheit ihres Vorgehens, was jetzt als Ritual erfolgt. Alle Augenpaare sind auf die Nonne gerichtet.
Sie schreitet gemächlich auf das erste Bett zu, in dem Carlo liegt. Er ist zehn Jahre alt; ein Findelkind wie Johnny. Er wurde in einer Babyklappe abgegeben.
»Hast du dich anständig gewaschen?«, fragt sie.
Carlo nickt. Es ist den Jungen verboten, auf ihre Fragen mit Worten zu antworten
»Überall?«
Carlo nickt ein zweites Mal.
»Auch dort?«, will sie wissen.
Carlo nickt wieder.
»Schwindest du mich auch nicht an?«
Carlo schüttelt den Kopf.
»Das muss ich überprüfen … Vielleicht sagst du ja doch nicht die Wahrheit«, fügt sie hinzu und setzt sich auf die Bettkante.
Carlo weiß, was er jetzt zu tun hat. Er deckt sich ab und zieht sich langsam die blau-weiß gestreifte Hose seines Schlafanzugs runter bis zu den Knien. Seine Augen hält er geschlossen. Auf diese Weise läuft es jeden Abend ab, wenn Schwester Gunilla die Jungen mit einem anschließenden Gebet in den Schlaf entlässt. Über ihnen schaut der ans Kreuz genagelte Jesus, blutüberströmt mit hängendem Hals und schon fast gestorben, von einem verblassten Deckenfresko auf sie herab; dazu sind Lorbeerkränze gemalt, ein Regenbogen und ein halbes Dutzend nackte Engel; die spielen Harfe und die blasen in Posaunen. Eine zweite Abbildung zeigt die Auferstehung des Gottessohnes, der zur rechten Seite seines Vaters thront und stoisch das missbräuchliche Geschehen betrachtet unter ihm im ungeheizten Raum.
Dort fasst Gunilla, die keusche Nonne, mit innerem Wohlgefallen den kleinen Penis des Jungen an, hebt ihn mit zwei Fingern in die Höhe, zieht die Vorhaut zurück und schiebt sie wieder hoch. Das macht sie mehrere Male, wobei sie sich weit nach vorne beugt und genau hinsieht, ob die Eichel auch wirklich blank gewaschen ist. Kein Krümel darf dran sein und kein Stäubchen. Wenn sie doch irgendeine Unreinheit entdeckt, bekommt derjenige am nächsten Morgen nichts zum Frühstück zu essen.
»Na ja, meinetwegen«, sagt sie und geht zum nächsten Bett. Abermals ihren Hals weit nach unten gestreckt, vollzieht sie die gleichen Handhabungen, und es entwickelt sich der gleiche Monolog, der mit Kopfnicken oder mit einem Kopfschütteln beantwortet wird. Ben, bereits entblößt, die Hände an der Hosennaht, macht sich gefasst auf die Prozedur, die ihn erwartet. Er ist dreizehn Jahre alt. Sein Penis ist gemäß seinem Alter schon länger und dicker und von beachtenswerter Statur; und er schwillt leicht an, als sie ihn betastet und sanft rubbelt.
»Na, na … was ist das denn?«, fragt sie. »Was sehe ich denn da, wie? Was tut der? Was macht der? Was fällt dem denn ein? Darf der das … dick werden?«
Ihr Urteil, als sie ihre Begutachtung der Reinlichkeit beendet hat: »Makellos in jeder Hinsicht«, stellt sie fest. Und Ben glaubt, eine vibrierende Erregung in ihrer Stimme zu hören und ein geiles Glitzern in ihren Pupillen zu sehen. Er selbst hat ebenfalls ein warmes Gefühl zwischen seinen Beinen.
Johnny kommt als siebter an die Reihe. Er liegt flach ausgestreckt in seinem Bett und er ist so hungrig, dass ihm schwindelig ist. Er atmet schwer. Er macht seine Augen zu, wie jedem der Zöglinge befohlen, wenn sie ihre Untersuchung der hygienischen Beschaffenheit von kleinen Pullermännchen durchführt, die allesamt ihrer selbsternannten Befehlsgewalt unterliegen.
»Ich hoffe sehr für dich«, beginnt sie ihre Ansprache, »dass du so reinlich bist da unten wie ein Engel. Und wehe dir, wenn nicht …«
Sie macht eine kurze Pause und sieht ihm dabei zu, wie er seinen Unterleib ihrer Ansicht nackt präsentiert.
»Noch weiter«, fordert sie ihn auf. »Zieh die Hose noch weiter runter. Ich kann ja gar nicht alles sehen … von deinem … deinem …«
Sie langt auch sein Glied an und sie tut so, als sei diese Geste, die sie augenscheinlich gelassen vollzieht, nicht mehr als die selbstverständliche Praktik einer handwerklich erfahrenen Urologin, die ohne jegliches erotische Empfinden einen Phallus inspiziert; und sei er auch noch so klein. Oder noch so groß. In Wirklichkeit jedoch, so ist es ihr bewusst und so fühlt sie es, spürt sie ein berauschendes Prickeln in ihren Brustwarzen, das ihr wie eine Kette von Zündfunken direkt zwischen die Beine fährt. Und die Ordensfrau, die nach abgestandenem Wasser riecht und nach Vaseline, sie ist zugleich entzündet von dem Gedanken und zugleich abermals voll von Scham über ihr chronisches Gelüste, ihm ihren linken Zeigefinger dabei tief in den Po zu stecken; nicht als Tortur gedacht, sondern als Gebärde einer intimen Zweisamkeit, nach der sie gelüstet.
Für den Jungen hingegen ist die Prozedur das Gegenteil eines wie auch immer gearteten Vergnügens. Johnny Monsun, der ist von Furcht überschwemmt, die Nonne könnte ihn in wenigen Momenten wieder in den Kerker stecken, weil sie mit dem Ergebnis der Reinigung nicht zufrieden ist. Doch es gibt keinen Tadel und keine Schimpfe. Nachdem sie die Penisspitze mehrfach freigelegt und wieder mit der Vorhaut bedeckt hat, sagt sie: »In Ordnung. Das kann sich sehen lassen … vor aller Welt und vor dem geheiligten Erlöser.«
Und dann geht sie weiter von einem Bett zum anderen und inspiziert, wie sie es jeden Abend macht, mit eigener Hand bei jedem Jungen, ob unter dem Präputium klar Schiff herrscht. Den lateinischen Ausdruck für Vorhaut, den erwähnt sie immer wieder mal und den übersetzt sie mit erhobenem Zeigefinger ins Deutsche, um sich und ihren Zöglingen den Anschein zu geben, bei ihrer Penis-Visite gehe alles pädagogisch wertvoll und selbstverständlich streng wissenschaftlich vor sich.
Als sie den letzten Jungen in Augenschein und auch dessen nicht erigiertes Geschlechtsteil und auch den seidenweichen Hodensack in die Brennweite ihrer Pupillen genommen hat, als sie an die Jungen die Aufforderung gesprochen hat, ihre Hände gefaltet auf den Bauch zu legen, da kniet sie nieder am Kopfende des Saals und spricht folgenden heiligen Text.
»Oh Herr, wir danken Dir für diesen wunderbaren Tag, den wir erfahren durften. Und wir danken Dir für das Leben, das du uns geschenkt hast. Und wir danken Dir, dass Du mit Wohlgefallen herabsieht auf uns und uns behütest bei allem, was wir tun … Geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme …«
Schwester Gunilla legt eine Pause und sieht die Jungen, die alle ihre Augen geschlossen halten und die alle entblößt sind, einen nach dem anderen an, wartet einige Momente, bevor sie weiterspricht und beendet dann den Text ihres Gebets mit diesem Satz: »Ich bin Deine Dienerin auf ewig … und ich will im Geiste singen und jubilieren und Dir … oh Du gütiger Herr … ein Lob für immer sagen … Amen.«
Sie verharrt eine Sekunde und sie schaut so geistesabwesend, als blicke sie genau in diesem Moment mit einer Frage ohne Antwort in den unentdeckten Kern ihres Wesens. Dann dreht sie sich um, geht mit erhobenen Schultern zum Ausgang des Schlafraums, knipst das Deckenlicht aus und schließt die Tür – nahezu geräuschlos, so wie immer. Die Jungen, die rühren sich nicht, die sagen minutenlang kein Wort. Erst als sie sicher sind, dass die Nonne Gunilla weder zurückkommt noch sie heimlich am Schlüsselloch belauscht, beginnen sie untereinander zu flüstern von Bett zu Bett. Und einen von ihnen, den hört man mit seiner hellen Kinderstimme in die Dunkelheit rufen, so dass es alle verstehen: »Wie bin ich doch froh … der Satan, der ist weg.«
Und Johnny Monsun, der denkt im Stillen vor sich hin: Was ist das bloß für ein widerliches und sehr, sehr hässliches Frauenzimmer … Der liebe Gott, der muss doch die Schnauze gestrichen voll haben von einer wie der, die er selbst gemacht hat aus Lehm. Die ist doch der Teufel aus der Finsternis.
Während der Waise vom Hunger geplagt und von den Schreckensstunden im schwarzen Loch schwer verletzt an seinem Gemüt noch lange wach liegt und in seinen Gedanken mit den furchtbaren Bildern von Angst und von Verlassenheit kämpft, liegt Ruben Door ebenfalls in seinem Bett. Es ist Schlafenszeit für den Sohn aus wohlhabendem Hause. Er hat ein Omelett-Toast zum Abendbrot gegessen und ein Glas Milch getrunken. Er hat sich die Zähne geputzt und er ist von Alika geduscht worden, die sich zu ihm an seine Seite gelegt, ihn umarmt und die angefangen hat, ihm aus ihrer Heimat Kenia zu erzählen.
»Eure Märchen hier in Deutschland, die fangen meistens so an … Es war einmal … In unserer Sprache heißt das … Hapo zamani zakalee. Und die Kinder dort, die wollen in den Geschichten immer wieder diese Fragen beantwortet haben, die ich auch dir stelle und über die du nachdenken kannst. Und morgen Abend sagst du mir, was du herausgefunden hast. Gib deiner Fantasie keine Grenzen. Also, hör’ genau zu … Wie sind die Zebras zu den Streifen in ihrem Fell gekommen? Warum kann der Löwe so laut brüllen? Und … Warum sind im Gesicht des Gepards schwarze Spuren von Tränen zu erkennen?«
Sie streicht Ruben über die Haare und drückt ihn an sich. Er atmet in vollen Zügen ihren berauschenden Duft ein, der in erregt und ihn schwindlig macht. Er schließt die Augen, weil er will, dass alles dunkel ist um ihn. Er schmiegt sich noch fester an sie, weil er will, dass er mit seinem Leib zusammenwächst mit dieser jungen Frau und er sucht in seiner Vorstellung den Anfang eines wunderschönen Traums, in den er jetzt sofort eintauchen möchte wie in ein warmes Wannenbad.
In diesem Intervall, den er auskostet, bis ihm schwindelig wird, kann er sich nicht vorstellen, dass es jemals noch etwas Schöneres geben wird in seinem Leben, das ihm auf Erden bis zu seinem Tod widerfahren kann, als Alika so nahe zu sein.
3. Kapitel
Im sechsten Jahr seit seiner Einweisung in die christliche Fürsorgeeinrichtung, wie die offizielle Bezeichnung des Waisenhauses Martinsgrotte lautet, ist Johnny Monsun mit besten Zensuren versetzt worden. Seine schulischen Leistungen sind mit gut oder sehr gut bewertet, die gehässigen Entwürdigungen aber, die Beschimpfungen und die drakonischen Strafen, die bei kleinsten Verfehlungen gegen die Regeln an der Tagesordnung sind, werden immer unerträglicher für den Jugendlichen. Die schwarze Pädagogik, wie Prügel und Folter und Erniedrigungen und Züchtigungen aller Art genannt werden, ist in jedem Raum des Anwesens und zu jeder Zeit und auf den Feldern und auf den Wiesen und in den nahen Wäldern zu spüren.
Selbst das Kirchenschiff ist nicht ausgenommen. Wer dort von den Jungen und Mädchen während des Gottesdienstes seine Lippen zu einem Lächeln verzieht, wer mit dem Nachbarn flüstert, wer mit den Füßen scharrt, wer zu laut hustet oder gar ein Niesen nicht unterdrücken kann und wer seine Hände nicht vorschriftsmäßig faltet, der wird es nachher büßen.
Wer sich zum wiederholten Male schmutzig macht an seiner Kleidung, der muss, weil es der Orden so entschieden hat, Nahrungsentzug bis zu vierundzwanzig Stunden ertragen. Schläge mit einem Weidenzweig werden verabreicht, als wäre es ein heilendes Medikament, wenn sich Mädchen heimlich schminken, und drei Stöße mit der Faust setzt es, sobald man die Nonnen nicht höflich genug grüßt und vor ihnen den Diener in der Verbeugung nicht weitreichend tief oder den Knicks in seiner Geste der Huldigung nicht demütig genug macht. Mit stundenlangem Ausharren im schwarzen Loch ohne Wasser und Brot wird bestraft, wer bei Tisch ohne Erlaubnis redet und wer seine Mahlzeit nicht vollständig verzehrt. Oftmals wird einem Jungen noch ein zweiter und besonders großer Nachschlag ungebeten aufgetischt, damit er es garantiert nicht schafft, diese Extra-Portion ganz aufzuessen, ohne zu würgen und sich zu übergeben.
Und wenn es vor Ekel und Überdruss geschieht, dass Haferbrei, gewässertes Hartbrot, ungesüßter Tee und Magensäure und Reste von Spucke aus dem Mund spritzen und den Fußboden beschmutzen, dann wird er obendrein zu einer Strafarbeit angehalten: mit dem Messer aus alten Zeitungen Klopapier schneiden im Blatt-Format penibel nach Maß zwölf mal zwölf Zentimeter Kantenlänge. Und das in zweihundertfacher Ausfertigung.
Bettnässer, auch wenn sie erst drei Jahre alt sind, bekommen vor allen Anwesenden fünf Ohrfeigen geschlagen, die so heftig sind, dass die Haut noch Stunden danach rot gefärbt bleibt. Als Zeichen vermeintlicher Güte und Nächstenliebe darf es sich der Delinquent aussuchen, auf welche Wange er gehauen werden will. Und dann fällt stets dieses Schimpfwort: »Du Lumpenpack, du.«
Und so geschieht es wie von selbst, an diesem einen Abend, der eigentlich so ist wie jeder andere im Monat Oktober, dass Johnny, nachdem Schwester Gunilla die tägliche Inspektion der Unterleiber der Jungen beendet hat, einen Entschluss fasst, der nicht auf seiner eigenen Entscheidung beruht. Ihm kommt es vor, während er sich, an Leib und Seele auch an diesem Tag gepeinigt, in der Dunkelheit des Schlafsaals auf der Matratze zusammenrollt, als vernehme er eine Stimme, von der er nicht zu erkennen vermag, zu welchem Lebewesen sie gehört. Ein Kobold? Weiblich? Männlich? Ist es ein Engel, der zu ihm spricht? Ein guter Geist? Der Fürst der Unterwelt? Könnte es sein Vater sein oder seine Mutter? Johnny weiß, seit er eingeschult wurde, dass er ein Waisenkind ist und er seinen Namen bekommen hat von fremden Leuten. Und er weiß, dass er am gleichen Tag geboren wurde wie der Messias Jesus Christus.
Die Wörter, ausgesprochen in nur einem Satz, die in diesen Sekunden an ihn gerichtet werden im Echoklang aus weiter Ferne her, die sagen voraus, dass er dieses kirchliche Zuchthaus, über dessen Eingang der gekreuzigte Heiland wacht, dass er diese Stätte des Grauens schon bald verlassen wird – von heute an in drei Wochen. Bis dahin aber, bis es wirklich soweit ist, dass er sich am Morgen in aller Frühe aufmacht zu seiner Flucht, wird er von all den im Wohnbereich der Mädchen geschehenen hartherzigen, den grässlichen, den gemeinen, den abscheulichen, den verheerenden, den grausamen, den hinterhältigen, den entsetzlichen, den widerwärtigen, den boshaften, den heimtückischen, den herablassenden und den ungeheuerlichen verbrecherischen Vorkommnissen erst zwei Dekaden später erfahren. Denn er, dieser Johnny Monsun, dieser neunmalkluge Waisenjunge, dessen Vorfahren von sonst woher stammen mögen, dieser schmucke junge Herr, wie er in seinem Alter von sechzehn Jahren in seinem Angesicht erstrahlt, der ist auserwählt, sein Wissen vor aller Öffentlichkeit mitzuteilen und es, sollte sein Karma tatsächlich so sein, an Eides Statt zu bekunden und es zu bekräftigen mit dem Ansehen seiner Person – eines noch sehr fernen Tages.
Und nur deshalb und nur aus diesem einzigen Grund hat sein Schicksal, in dessen Beobachtung er steht ohne Unterlass, den wie ein Sack voll Abfall in das Schotterbett eines Bahngleises weggeworfenen Säugling in der eiskalten Winternacht des Heiligen Abends überleben lassen. Und nur deshalb wird er, der Geschundene sicher geleitet; aber seine Vorsehung wird ihn zur Rechenschaft ziehen und ihn zu Fall bringen, weicht er ab von seinem Weg und kommt er dieser Verpflichtung nicht voll umfänglich nach.
Was er zu tun hat in Zukunft in dieser Welt und was er anfangen soll mit seinem Leben, davon hat er noch keine Kenntnis. Und er hat in diesen kurzen Minuten keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Die Müdigkeit, die ihn einnebelt, drängt ihn mit Macht in den Schlaf. Morgen früh um 5 Uhr ist die Nacht beendet.
Die schrillen Töne einer Trillerpfeife reißen die Kinder aus ihren Träumen und ihren Ängsten in den Beginn eines neuen Tages voll von Entbehrungen, Schikanen und Beleidigungen. Die Jungen springen aus ihren Betten und stellen sich in Reihe auf; die Mädchen, denen ebenfalls das Sprechen verboten ist, fassen sich im Schlaftrakt des Nebengebäudes zu zweit an den Händen und werden, bekleidet mit grauen Nachthemden, von einer Nonne in den Waschraum geführt. Die Zeit, die ihnen gewährt wird zur Körperreinigung und Zahnpflege, beträgt exakt fünf Minuten.
Wer dann noch nicht fertig ist, der bekommt es mit Regel Nummer elf zu tun, die Verspätungen unter anderem so ahndet: nackt duschen mit kaltem Wasser. Und alle sehen dabei zu und sagen kein Wort. Ein Kruzifix halten mit ausgestrecktem Arm über eine halbe Stunde lang, damit wird gebüßt, wer einen Bibelvers nicht fehlerfrei aufsagen kann. Damit der Kopf versehentlich vor Entkräftung nicht nach vorne sackt, wird der Bestraften ein Besenstiel als Stütze in den Mund gesteckt. Es gibt auch Zwangsjacken im Heim, in die ein Kind einen halben Tag lang geschnürt wird, wenn es sich gegen Übergriffe von Gewalt zu wehren versucht. Und wer schreit oder weint, der wird geknebelt. Wer in die Hosen macht, ob es klein ist oder groß, der muss den ganzen Tag damit herumlaufen. Sich reinigen und sich waschen, ist verboten. All diesen Kindern, ausgezehrt und zerlumpt, wurde das Lachen gestohlen und die Würde für mehrere Jahrzehnte.
Es ist noch dunkel draußen; der Mond bleibt verdeckt hinter einem schwarz-grauen Wolkenfeld. Wind kommt auf und zeigt sich mit heftigen Böen. Erste Regentropfen fallen. Der Herbst ist jetzt auch auf den Höhen der Berge eingetroffen; mit den Ausdünstungen seiner modrigen Düfte, mit seinem Farbenspiel in den Blättern der Buchen, mit seinen rot und gelb gefärbten Lichtern der Sonne, die gerade einen Spalt breit aufgestiegen ist am Horizont. Und seine Tonleiter, die spielt auf mit dem Brausen und dem Rauschen der ersten Stürme, die an den Zweigen der Baumkronen zerren.
An diesem Morgen werden die Jungen, die älter sind als sieben Jahre, nach dem Frühstück auf die nahen Felder geführt zur Kürbisernte. Die Mädchen der Anstalt müssen ebenfalls mithelfen; zum ersten Mal seit Bestehen der Einrichtung und als einmalige Ausnahme von der Mutter Oberin beschlossen. Der Grund: Die Anbaufläche des Fruchtgemüses ist um ein Hektar erweitert worden ist. Und deshalb sind mehr Arbeitskräfte erforderlich als sonst.
Die rigorose Trennung nach Geschlechtern, die sogar den Blickkontakt untereinander verbietet, ist ein erzieherisches Grundprinzip dieses Waisenhauses. Jede Sympathiebekundung, jedes Nicken als Zeichen eines Grußes, jedes Lächeln, jede Annäherung, und sei sie auch noch so flüchtig, jede Hinwendung über den Zaun, wie auch immer geartet, ist tabu und wird als Schwerverbrechen eingestuft. Und wer als Junge bei den Unterkünften der Mädchen ertappt wird, wer sie berührt an der Schulter, wer ihnen zuwinkt, auf den warten drei Tage im schwarzen Loch und ein Dutzend Hiebe mit dem Rosenkranz.
Vor allem die Mädchen sind es, die von ihren Geschlechtsgenossinnen, den Ordensschwestern besonders brutal und besonders herzlos drangsaliert werden. Befehlen, bewachen, bestrafen und immer wieder beten, beten und nochmals beten. Und ihnen das Böse aus dem Körper treiben, und es heraus prügeln aus ihnen und sie schinden, wann immer sich eine Gelegenheit dazu bietet. Und die sexuellen Triebe ausmerzen, und sie ihnen zur Qual werden lassen. Und die Versuchungen des Satans eindämmen, und sie ihnen zu Schmerzen werden lassen. Und das Weibliche verdammen, das aus der Betrachtung der Ordensfrauen nur Gelüste schürt und sich lasterhaft gebärdet; es sei denn, man ist die Ehebraut des Gottessohnes.
Und so ist es Pflicht und so wird es eisern durchgesetzt zur Schlafenszeit: Die Hände, die gehören sichtbar auf die Bettdecke gelegt – als Vorsichtsmaßnahme gegen irgendeine Art von Selbstbefriedigung. Damit auch wirklich nichts geschieht, was Erregung und Lust verschafft, werden bei einigen Mädchen, die in Verdacht geraten sind, sich unten anzufassen im Schritt, die Fingerspitzen mit Tinte eingepinselt und in der Frühe ihre Scheiden außen und innen nach Farbspuren untersucht. Und wehe derjenigen, blaue Flecken oder andere Farbspuren werden auf der Vulva entdeckt. Dann wird eine vaginale Bohrung befohlen – mit dem Mittelfinger oder dem Stil einer Haarbürste.