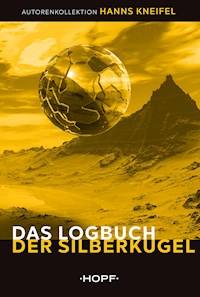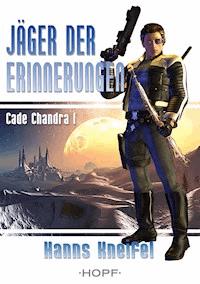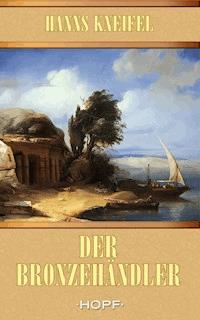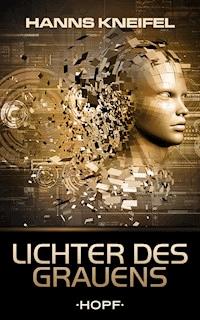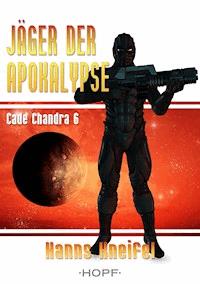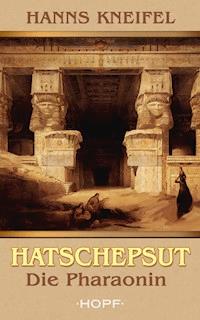4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Ihr seid Hoffnungsträger für den Frieden. Aber zugleich stellt ihr auch eine Gefahr dar.“ – „Die Tempelritter-Saga“ jetzt als eBook bei dotbooks. Im prächtigen Jerusalem gibt es auch Schattenseiten: Die Gefährten Henri, Uthman und Joshua werden von zwielichtigen Gestalten verfolgt und erhalten rätselhafte Botschaften. Stecken sie bereits in großer Gefahr, ohne es zu wissen? Ihre Lage wird immer bedrohlicher, und schließlich rottet sich auf Geheiß eines mächtigen Feindes eine wütende Menschenmenge zusammen, die ihnen jeden Fluchtweg abschneiden. Doch als alles aussichtslos erscheint, erhalten die Freunde Hilfe von ganz unerwarteter Stelle … Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch:
Im prächtigen Jerusalem gibt es auch Schattenseiten: Die Gefährten Henri, Uthman und Joshua werden von zwielichtigen Gestalten verfolgt und erhalten rätselhafte Botschaften. Stecken sie bereits in großer Gefahr, ohne es zu wissen? Ihre Lage wird immer bedrohlicher, und schließlich rottet sich auf Geheiß eines mächtigen Feindes eine wütende Menschenmenge zusammen, die ihnen jeden Fluchtweg abschneiden. Doch als alles aussichtslos erscheint, erhalten die Freunde Hilfe von ganz unerwarteter Stelle …
Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Über den Autor:
Hanns Kneifel (1936–2012) studierte Pädagogik. Er war einige Jahre als Berufsschullehrer tätig, bis er den Entschluss fasste, als freier Schriftsteller zu arbeiten. Er wurde zu einem der erfolgreichsten deutschen Autoren im Fantastik-Bereich und veröffentlichte zahlreiche Science-Fiction-, Horror- und Fantasyromane. Außerdem schrieb er als einer der Hauptautoren für die Perry-Rhodan-Serie. Hanns Kneifel lebte in München und zeitweise auf Sardinien.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Hanns Kneifel auch folgenden Band:
»Die Tempelritter-Saga – Band 22: Der Kaiser des Westens«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2016
Dieses Buch erschien bereits 2007 unter dem Titel »Die geheimnisvollen Pergamente« im Pabel-Moewig Verlag
Copyright © der Originalausgabe 2007 by Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt
Copyright © der Neuausgabe 2014 bei dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/artforce und Kiselev Andrey Valerevich
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-832-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Geheimnis der Schriften« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Hanns Kneifel
Das Geheimnis der Schriften
Die Tempelritter-Saga
Band 21
dotbooks.
Kapitel 1
Anno Domini 1324: Auf der Straße nach Jerusalem
Schon seit dem Augenblick, als er seinen Rappen über die breite Planke vom Schiff geführt hatte, war Sean of Ardchatten sicher, von zahlreichen Augenpaaren beobachtet zu werden. Akkons Hafen, der einstmals prächtig und vom regen Treiben der Händler erfüllt war, erstreckte sich entlang einer Reihe von verfallenen, ruinengleichen Häusern. Vor den Häusern standen die Tische weniger Händler unter zerschlissenen Sonnensegeln. Sean führte sein Pferd zum Brunnen, ließ es saufen, sattelte es und band Satteltaschen und den Sack fest, in dem einige seiner Waffen versteckt waren.
Sean trug einen Turban, der sein helles Haar verbarg, und einen Burnus. Seine Haut war sonnengebräunt, trotzdem wirkte er nur auf den ersten Blick wie ein reisender Muslim. Es waren seine blauen Augen, die ihn als Fremden verrieten. Er wusch den Ziegenbalg und füllte ihn mit frischem Wasser. Von einem fliegenumschwirrten Händler kaufte er getrocknete Feigen, scharf gebratene Hühnerkeulen, Datteln, Käse und einen Beutel Nüsse.
Er stieg in den Sattel und ritt langsam an. Einige Fischerboote und zwei Schiffe hatten längsseits an der langen Hafenmole angelegt. Auch der Mole waren noch immer die Spuren der Zerstörung deutlich anzusehen. Die Mamelucken hatten die alte Kreuzritterstadt gründlich zerstört. Montmusards Mauern waren niedergerissen worden. Montmusard – so hatte die tiefer gelegene Vorstadt einst geheißen, und Sean wusste von Henri, dass es in der Stadt damals 60 Kirchen gegeben hatte. Aber nun sah er keinen einzigen Kirchturm inmitten der Stadt, in deren Trümmern Büsche und Bäume wild wucherten. Er ritt weiter und hoffte, unbehelligt aus der Stadt zu kommen. In leichtem Trab wich er den wenigen Händlern und deren hochbeladenen Eseln aus.
Am Ende eines Wellenbrechers stand ein halb zerfallener Leuchtturm. Im Gewirr der Trümmer, links von Sean, hatte einst die Kathedrale zum Heiligen Kreuz gestanden. Wer heute in den Ruinen dieses mächtigen Gotteshauses lebte, wollte sich Sean lieber nicht vorstellen. Unter dem Rand des Turbans hervor beobachtete er aufmerksam die Umgebung, aber er sah nichts außer Zerfall und Elend. Ein Windstoß wehte den Geruch von Brackwasser und faulendem Fisch über die Hafenstraße.
Sean wurde das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Der uralte Turm, dem er sich näherte, bildete gewissermaßen den Endpunkt der inneren Mauer, und eine schmale Straße führte durch kleine Felder, zwischen denen einzelne Dattelpalmen wuchsen, auf einen Torturm der äußeren Mauer zu. Auch dieser Teil der Mauer war vor langer Zeit niedergerissen worden.
Zu seiner Linken, hinter den Ruinen und den zwischen den Trümmern wild wuchernden Pflanzen, lag auf dem Felsplateau die Oberstadt. Aus Henris Erzählungen wusste Sean, dass die Johanniter einst ein riesiges Hauptquartier in der Unterstadt erbaut hatten. Jetzt wurden die Stadt und das Land von den Mamelucken regiert, und alles lag in Trümmern. Vor über drei Jahrzehnten, im Mai 1291, hatte Sultan Qualawuns Sohn, el-Aschraf Khalil, mit ungefähr 100 000 Kämpfern Akkon erobert und verwüstet. Zu dieser Zeit, dachte Sean erstaunt, war Henri de Roslin ungefähr so alt gewesen wie ich selbst jetzt.
Er trabte durch die Felder, auf denen trotz der unbarmherzigen Hitze gearbeitet wurde. Die Bauern wirkten ärmlich und ausgemergelt.
Die Außenmauer zog sich bis weit ins Meer hinaus. Vor dem Tordurchgang zügelte er seinen Rappen und ritt im Schritt weiter. Zwei lanzentragende Wächter standen im kühlen Halbdunkel.
Einer von ihnen fragte ihn mit rauer Stimme auf Arabisch: »Wohin willst du, in Allahs Namen?«
Sean legt die rechte Hand auf die Brust. Er sprach Arabisch leidlich gut, aber noch immer fehlerhaft und antwortete wahrheitsgetreu: »Auf die Straße nach Nazareth und nach Jerusalem.«
»Was willst du in Jerusalem?«
»Die heiligen Stätten sehen, zu Gott beten und Freunde besuchen.«
»Inshallah. Reite zu, die Straße ist frei von Gefahren. Wir haben nichts von Räubern und Strauchdieben gehört.«
»Salaam.« Sean hob grüßend die Hand und duckte sich, als er durch das halb geöffnete Tor ritt. Er blinzelte wegen der grellen Sonnenstrahlen und ließ das Pferd galoppieren. Nach einigen Momenten sah er sich um. Er war erleichtert, die überwucherte Stadtmauer und die stark beschädigten Türme hinter sich zu lassen und kleiner werden zu sehen.
Sean erinnerte sich, während er ritt, an Henris Erzählungen vom letzten Gefecht der Tempelritter in Akkon. Henri hatte einen Angreifer, einen Sarazenen, unter Trümmern hervorgezogen und dessen Leben gerettet. Der Araber war Henris Freund geworden und hatte ihm einen Talisman geschenkt. Henris Leben war mehrere Male dank dieser Münze gerettet worden. Er würde sie auch jetzt bei sich haben, in Jerusalem, wo er mit Uthman und Joshua auf ihn wartete.
Vor Sean erstreckten sich lange Baumreihen, magere Weiden und Felder. Er ritt in den Schatten hinein und wusste, dass er auf dem langen Ritt weder der Hitze noch dem Durst entrinnen konnte, denn jenseits von Nazareth gab es, den Erzählungen Henris zufolge, weder schattenspendende Bäume noch reichlich sprudelnde Quellen.
Als der Rappe wieder in Trab fiel, schlugen der Bogen und der Köcher nicht mehr so hart gegen Seans Schulter. Die Straße war leer, trotzdem wusste Sean, dass sein Ritt für ihn gefährlich werden konnte, wenn er sich nicht vorsah. In einer Lederschlaufe am Sattel steckte griffbereit seine Axt, und in einem Lederbeutel klirrte die Kette des Morgensterns. Den großen Reitermantel, der ihm nachts als Unterlage und Decke diente, hatte er über den Satteltaschen zusammengerollt und mit Lederriemen befestigt.
Ich hätte mich besser einer Karawane angeschlossen, dachte er und folgte der Straße. Sie schlängelte sich von der Höhe des Strandes in weiten Halbkreisen leicht aufwärts, noch immer durch Felder und kleine Haine mit Obstbäumen. Große Wolken kamen vom Meer her und warfen ihre wandernden Schatten über das Land. Sean dachte an Henri und Joshua.
Dann hatte Sean plötzlich wieder ein merkwürdiges Gefühl, und er spähte nach links und rechts, aber er sah niemanden. Sein Verdacht, beobachtet zu werden, blieb jedoch.
Als die Schatten länger geworden waren und es nicht mehr ganz so heiß war, verließ er die Straße und ritt auf einige niedrige Hütten zu, die sich im Schutz von Palmen und Ölbäumen wie eine Insel in den Feldern und Weiden zusammendrängten. Ziegen und Schafe grasten dort, und kleine Hühner pickten im Staub. Als Sean neben einem Ziehbrunnen das Pferd anhielt, rief er: »Salaam!«
Ein barfüßiger Junge sprang aus der Tür eines Hauses und sagte: »Salaam. Was willst du, Fremder?«
Sean zeigte auf den Brunnentrog und antwortete: »Wasser für mich und mein Pferd und ein wenig Ruhe.«
Er erwartete nicht, dass sich plötzlich ein Dutzend Bewaffneter auf ihn stürzen und ihn ausrauben würde, aber er war auf alles vorbereitet. Ohne Henri neben sich fühlte er sich allein. Nicht schutzlos, doch ein wenig gefährdeter, Tag und Nacht. Jetzt rechnete er mit der Gastfreundschaft der Muslime, auf die man sich in der Regel trotz aller Armut verlassen konnte.
Der Junge, der einen schmutzigen Turban und ein löchriges Hemd trug, tauchte in die Dunkelheit des Hauses ein und kam kurz darauf wieder daraus hervor. Er zog einen zahnlosen Greis hinter sich her.
Der Alte rief mit fistelnder Stimme: »Allah schützt den Wanderer! Nimm dir Wasser, Fremder.«
»Schukran«, sagte Sean und stieg aus dem Sattel. »Danke.«
Er holte den gefüllten ledernen Wassersack mit dem Zieharm herauf, kippte ihn in den Trog und löste die Trense aus dem Maul des Rappen. Mit drei weiteren triefenden Säcken füllte er den Trog und seinen Wassersack aus Ziegenhaut. Er wusch sein Gesicht und seine Hände und trank gierig. Der Greis und der Junge sahen ihm schweigend zu. Sean setzte sich an den Rand des Trogs, wickelte seinen Proviant aus und aß etwas Brot, einige Datteln und eine Hühnerkeule. Er packte die Reste wieder ins Tuch, verstaute das Bündel in der Satteltasche und erleichterte sich hinter einem dicken Ölbaumstamm.
Er zwängte die Trense ins Maul des Pferdes, verbeugte sich vor dem Alten und wiederholte seinen Dank. Dann zog Sean sich in den Sattel, winkte und wendete den Rappen. Wenige Augenblicke später war er wieder auf der Straße und ritt seinem eigenen Schatten hinterher, in der Hoffnung, ein brauchbares Nachtlager zu finden.
*
In der Dunkelheit hörte man zwar die Laute der Lasttiere und der Pferde, aber nur dann, wenn die Flammen höher aufloderten, traten die Körper hinter den gestapelten Packlasten als bewegte Halbschatten hervor. Die Männer saßen in einem Kreis um das Feuer, über dem ein Kräutersud im Kessel summte. Die Flüssigkeit roch nach fremdartigen Kräutern, Honig und Gewürzen, die Sean nicht kannte. Die Sitzenden redeten leise miteinander, aber hin und wieder ertönte ein kehliges Lachen. Sean versuchte zu verstehen, worüber sie sich unterhielten.
Er hatte sich außerhalb der niedrigen Stadtmauer von Samaria einer kleinen Karawane angeschlossen, die Salz, Datteln und Korn nach Sichem brachte. Jetzt hockte er zusammen mit elf Turbanträgern am Feuer, kaute Datteln und sah den Funken zu, die aus der Glut in die Höhe schwirrten. Zwischen seinen Stiefeln hatte er den leeren Becher in den Sand gebohrt.
Sean hatte mitbekommen, dass die Karawane in Sichem umkehren und viele Tonkrüge nach Samaria bringen würde. Abdul, der Karawanenführer, winkte ihm und deutete auf den Holzbecher. Sean ging zum Feuer, ließ sich den Becher füllen und kehrte an seinen Platz zurück, der nicht mehr war als eine Vertiefung im Sand. Er wartete, bis der Sud abgekühlt war, und trank mit vorsichtigen Schlucken.
Eine lange Reise lag hinter ihm. Von Roslin in Schottland über Land nach London, von wo aus er einen Segler nach Zypern nahm. Dort fand er ein Schiff, das ihn nach Akkon brachte. Stadt und Hafen wurden von den Mamelucken beherrscht, aber man hatte ihm keine Schwierigkeiten dabei gemacht, hier an Land zu gehen.
Er war braun gebrannt und ausgeruht, und im Schutz der Karawane hatte sich seine Beklemmung gelegt. Während er den zweiten Becher leerte, dachte Sean an Henri de Roslin, seinen Meister, seinen großen Freund, der ihn an Sohnes Statt angenommen hatte. Alles, was er wusste und konnte, hatte er von Henri gelernt. Nun ja – fast alles. Ein Gefühl großer Dankbarkeit stieg in Sean hoch. Er stand auf, hob einen Speer auf und sagte: »Ich übernehme die nächste Wache!«
Sein Arabisch war nicht besonders gut, aber die wichtigsten Redewendungen hatte er inzwischen gelernt. Er wünschte eine gute Nacht, und die Männer am Feuer murmelten. Sean entfernte sich vom Feuer, seine Schritte knirschten im Sand. Nach zwei Dutzend Schritten hob er den Kopf. Von den Flammen und der Glut nicht mehr geblendet, sah er die Sternbilder des Nachthimmels über dem Heiligen Land. Sie schienen anders zu sein als die über Schottland, und auch heller.
*
Im Gebirge, ein gutes Stück jenseits von Sichem, begann sich die Sonne hinter den baumlosen Bergen, hinter Felsen und jenseits der Felsstürze des ausgetrockneten Flussbetts zu verstecken. Sean ritt wieder allein und dachte an die vielen Abenteuer, die Wölfe und die französischen Soldaten in Roslin, an seinen ehemaligen Herrn Henri und die schöne, tote Jeanie, an die geheimnisvollen Höhlen, König Roberts Kampf gegen die Engländer und an die Räuber, die Joshua gefangen genommen hatten und fast getötet hätten. Zweimal war es ihm gelungen, sich kleinen Karawanen anzuschließen, zu denen auch bewaffnete Wächter gehörten.
Die Straße folgte den schroffen Windungen einer Schlucht. Tiefe Schatten wechselten sich mit dem rötlichen Sonnenlicht ab, das von zerklüfteten Wänden widerstrahlte. Immer wieder schallte das Echo der Hufschläge vom Gestein zurück. Es klang wie Schwertschläge auf splitterndem Granit. Sean war vor kurzem erst abgestiegen und hatte den Bogen gespannt und den Köcherriemen festgezurrt. Eine Hand hatte er auf dem Griff seines Dolchs liegen.
Es roch nach dem warmen Gestein, und bisweilen fuhr ein heißer Windstoß zwischen den Felsspalten hindurch und wirbelte eine Sandhose auf. Vielleicht konnte Sean die Händler noch einholen, die schon nachts in Sichem aufgebrochen waren, wie ihm die Torwächter berichtet hatten. Aber er sah hier nicht einmal Spuren der Karawane.
Sean trabte weiter, durch Schatten und Licht. Die kaum sichtbare Straße, die aus festgebackenem Sand bestand, führte eine leichte Anhöhe hinauf. Die Felswände strebten auseinander, die Schlucht weitete sich. Zuerst waren es nur große und kleine Geröllbrocken, die neben dem Weg lagen, aber zunehmend wurden die Trümmer größer und kantiger. Als endlich ein flaches Tal vor Sean lag, war der Weg von haushohen Felsen gesäumt, die aus dem Boden herausgewachsen zu sein schienen.
»Hier kann sich ein kleines Heer verstecken«, flüsterte er mit trockenen Lippen. Die Ohren des Rappen, dessen Fell ebenso staubbedeckt war wie Seans Kleidung, bewegten sich aufgeregt. Beruhigend klopfte er den Hals des Tieres und kitzelte es mit den Sporen. Der Wallach fiel in Trab, die Echos der Hufschläge verloren sich in der steinigen Umgebung.
Seans Unruhe nahm zu. Er war in seinem Leben schon wegen weit weniger als einem guten Pferd überfallen worden. Er setzte sich im Sattel zurecht und versuchte, hinter die Felsen zu spähen. Aber er sah nichts als Sandwirbel und Splitter, die sich vom Gestein lösten und zu Boden fielen. Die Schatten waren länger geworden; es begann zu dunkeln.
Weit vor sich sah er Palmwedel zwischen Sandhügeln. Ein Anblick, der ihm ein ruhiges Nachtlager zu versprechen schien. Doch an dieser Aussicht konnte er sich nicht lange erfreuen. Als er sich umdrehte, nahm er zwischen den Felsen eine undeutliche Bewegung wahr. Er blinzelte den Staub aus den Augen und blickte schärfer hin. Aber nun schien sich nichts zu bewegen.
Er ritt weiter, aber plötzlich schienen sich jeder Schatten, jeder Umriss in etwas Bedrohliches zu verwandeln. Alle Dinge wirkten auf einmal gefährlich. Sean wandte den Kopf nach rechts und links. Da war jetzt tatsächlich etwas. Hinter ihm preschten zwei Reiter heran, die sich offensichtlich hinter Felsen versteckt hatten. Er rammte die Stiefel in die Steigbügel, spornte den Rappen und zog einen Pfeil aus dem Köcher. Mit einem Ruck riss er den Bogen von der Schulter, legte den Pfeil auf die Sehne und spannte die Waffe.
Als er den Kopf hob, erkannte er, dass ungefähr einen Bogenschuss weit vor ihm zwei Reiter und zwei andere Gestalten aus ihren Verstecken heraus auf ihn zukamen. Er zielte und schoss den Pfeil auf den rechten seiner Verfolger ab. Ein Schmerzensschrei sagte ihm, dass er getroffen hatte.
Sean stieß einen Fluch aus, warf sich den Bogen auf die Schulter und galoppierte weiter. Die Entfernung war zu gering für einen zweiten Schuss.
Er zog den Morgenstern aus dem Beutel, packte entschlossen den Griff und ritt mit der gleichen Geschwindigkeit weiter. Seine Verfolger schrien Unverständliches. Die Räuber, die zu Fuß näher rannten, hielten kurze Lanzen in den Händen, die Reiter schwangen Krummschwerter. Sean wollte zwischen ihnen hindurchreiten, aber sie wichen nicht auseinander. Die Spitzen ihrer Waffen zielten auf ihn. Er schwenkte langsam die Stachelkugel an der unterarmlangen Kette. Die Verfolger hatten augenscheinlich ausgeruhte Pferde, denn sie kamen schnell näher. Sean hob die Waffe, ritt auf einen der Lanzenträger zu und führte einen waagrechten Schlag aus. Der Morgenstern traf das Holz, die Lanze zerbrach, ihre Spitze wirbelte durch die Luft.
Als er sich kurz umwandte, sah er, dass sein Pfeil in der Schulter eines Verfolgers steckte, der nun einige Pferdelängen zurückgefallen war. Von beiden Seiten drangen jetzt die Räuber mit den Schwertern auf ihn ein, und gerade, als er ein Schwert mit der Kette klirrend zur Seite schlug, packte der Waffenlose rechts von ihm seinen Fuß, um ihn aus dem Sattel zu zerren.
»So einfach bekommt ihr mich nicht!«, schrie er, ließ das Pferd hochsteigen und auf der Stelle drehen. Seine Waffe beschrieb wilde Kreise und Halbkreise. Er traf die Handgelenke dessen, der an ihm zog. Der Räuber heulte auf und ließ los. Ein Schwert fiel klirrend zu Boden. Jetzt umringten ihn vier Männer und versuchten, ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen. Das Pferd drehte sich und wieherte schrill, die Räuber verständigten sich mit kurzen Rufen.
Sean ahnte, dass der Kampf hart werden würde und dass die Übermacht zu groß war. Aber er kämpfte mit aller Kraft weiter, duckte sich zwischen den Hieben, wich ihnen aus und schmetterte die Stachelkugel in einen Pferdeschädel. Das Tier brach auf der Stelle zusammen und schleuderte den Reiter aus dem Sattel. Er überschlug sich in der Luft und fiel schwer auf den Rücken. Seans Rappe setzte über das gestürzte Tier hinweg. Überall wurden Staub, Geröll und Sand aufgewirbelt. Die Dunkelheit nahm zu.
Ein Hieb traf Seans Handgelenk. Seine tauben Finger konnten den Morgenstern nicht mehr halten. Er versuchte, den Stiel in die Linke zu nehmen, aber mit dem anderen Arm hatte er weder genügend Kraft noch genügend Übung. Er rammte den Griff der Waffe hinter seinen Gürtel und zog mit der Linken den Dolch aus der Scheide.
Der zweite Räuber, der zu Fuß kämpfte, sprang an Sean hoch und umklammerte seine Arme. Ein Hieb mit der flachen Klinge traf den linken Oberarm des Angreifers, der wie gelähmt von ihm abließ. Sean zog den Fuß aus dem Steigbügel und trat zu. Es gelang ihm, einen Reiter links von ihm so schwer zu treffen, dass er aus dem Sattel rutschte. Aber dann packten mehrere Männer seine Arme, und einer fiel dem Pferd in den Zügel. Der Kampf schien für Sean erfolglos und schmerzhaft zu enden.
Kapitel 2
Abu Lahabs Schwertschmiede bei Al Quds
Zwei Meilen südlich der Stadtmauer von Al Quds, das die Juden Yerushalayim und die Christen Jerusalem nannten, stiegen Tag und Nacht Rauch und Dampf in den Himmel. In den Ruinen, von denen manche sagten, dass sie älter als tausend Jahre waren, unterhielt Abu Lahab ben Taimiya eine Eisenschmelze und einige Schmieden. Aus allen Orten rund um die Stadt kamen fast täglich Karawanen mit schwer beladenen Kamelen zu den offenen Feuerstellen und den überdachten Schmieden und brachten Holz und Roheisen, Holzkohle, eisenhaltiges Gestein und zerbrochene Eisenwerkzeuge aller Art.
Die Schmelzöfen, angefacht und betrieben von großen Blasebälgen, loderten ohne Pause. Im weiten Umkreis der Gebäude rieselte ununterbrochen schwarzer Staub vom Himmel und färbte die kümmerlichen Pflanzen, die Dächer und selbst die Haut der Sklaven und Arbeiter. Der Geruch nach nassem Leder von den Gerbern aus der Nachbarschaft, kaltem Rauch und Aschestaub wehte bei Südwind bis zu den gelben Mauern der Stadt.
Abu Lahabs Lager der fertigen Waffen war in einem niedrigen Steinhaus untergebracht, das mitten in einem Viereck aus blattlosen Ölbäumen mit schrundigen, aufgequollenen Stämmen auf römischen Fundamenten stand. Unter dem lang gestreckten Gebäude, das mit schwärzlichen Steinplatten gedeckt war, dehnten sich große Kellergewölbe. Der Besitzer hatte sie vom Schutt befreien und die Wände dick mit Kalkbrei tünchen lassen. Im Sommer herrschte angenehme Kühle, im Winter blieb es wohlig warm. Hier unten war das ständige Geräusch der Schmelzen und Schmiedehämmer nur schwach zu hören.
Abu Lahab, ein gedrungener, schwarzbärtiger Araber aus Antiochia, hob prüfend eine Klinge in das Licht, das Dutzende Kerzen und Öllampen verbreiteten. Die Flammen schienen auf der silberglatt geschliffenen Doppelschneide zu tanzen.
»Bei Allah. Schwerter und Dolche – man wird sie immer brauchen. Also kann ich sie auch immer schmieden lassen.«
Seine Stimme klang satt und zufrieden. An seinen Fingern, auf denen sich schwarze Haare kringelten, funkelten schwere Ringe. Er lenkte das gespiegelte Licht der Klinge in Nadschib ben Sawaqs Gesicht. Lahabs enger Vertrauter zuckte nicht zurück. Zwischen den Männern standen Trinkschalen auf einem kniehohen Tisch.
»Nun ja«, antwortete Nadschib nachdenklich, »einerseits hast du Recht. Auch das Buch spricht vom Schwert des Propheten, vom Schwert des Islam.« Er lachte kurz. »Aber der Prophet hat wahrscheinlich nicht die Schwertschmiede gemeint.«
»Wahrscheinlich nicht. Vielleicht lass ich Töpfe, Messer, Pfannen und Nägel schmieden, wenn uns Allah ein paar Jahre Frieden gönnt. Irgendwann wird der Kaiser des Abendlandes wieder seine Krieger ausschicken.«
Die Männer saßen in rostigen Stühlen aus Eisenstäben, Leder und schmutzigen Schafspelzen. Das Hämmern aus der Schmiede drang als schwaches Dauergeräusch bis in die kühle Höhle aus uralten Ziegeln. Sie unterhielten sich darüber, dass erst vor einigen Tagen die Mamelucken und die Mongolen Frieden geschlossen hatten. Dies würde der Stadt und dem Land Ruhe bringen und den Bewohnern ein besseres Leben ermöglichen.
Nach dem Fall und der Eroberung Akkons im Mai des Jahres 1291 nach dem Kalender der Ungläubigen hatten die Mamelucken unter al-Ashraf Khalils Führung die Hafenstadt erobert und danach ihre Herrschaft auf einen Küstenstreifen ausgedehnt, der von Caesarea im Süden bis nach Antiochia reichte.
Von Osten her hatten die Heere der mongolischen Khane die islamische Welt bedroht. Und nun war es gelungen, mit dem Enkel des gefürchteten Eroberers Dschinghis Khan, Hülägü Khan, Frieden zu schließen. Er herrschte über das Reich der Ilkhnane südlich und östlich von Bagdad. Nadschib seufzte, hob seine Schale und trank einen großen Schluck.
»Friede!«, sagte er und breitete, nachdem er die Schale abgesetzt hatte, die Arme aus. »Endlich, nach so vielen Jahrhunderten der Kämpfe gegen die Christen! Die Christen, die nur Salah ed-Din Yusuf – den sie in ihrer Sprache Saladin nannten – aufhalten und zurückdrängen konnte.«
Der Sultan hatte Jerusalem zurückerobert, und seither war es in der Hand der Muslime. Trotz der geänderten Lage hatte Abu Lahab darauf bestanden, hauptsächlich Schwerter und Dolche schmieden zu lassen.
»Sieh dich um«, sagte Nadschib und deutete auf die Wände. »Du kannst mit deinen Schwertern ein kleines Heer ausrüsten.«
Eisenstangen waren in die Wände getrieben und mit hölzernen Brettern belegt worden. In diesen Vorrichtungen lagen, einzeln oder zu mehreren in ölgetränkte Tücher eingewickelt, kurze und lange Schwerter, gerade Waffen und solche mit geschwungenen Klingen. Abu Lahab grinste und zeigte in seinem Bart schneeweiße Zähne. Neben dem linken Schneidezahn war eine Lücke zu sehen, was Abu Lahabs Lächeln etwas Verschlagenes verlieh.
»Ich werde deinen Rat bedenken. Schließlich weißt du genau, wie viele es sind.«
»Es sind nie genug«, entgegnete Nadschib und nickte. Er lächelte wissend. »Mit den Schwertern ist es genauso wie mit deinem Reichtum.«
»Allah hat die Reichen nicht verdammt.«
Abu Lahab wischte die öligen Finger an seinem Burnus ab, nahm den Krug und füllte die Schalen.
»Einige letzte Schlucke, mein Freund. Bald beginnt der Ramadan. Und dann gibt es nur Schweiß, Schwerter und Durst. Und nach Sonnenuntergang keinen Wein, nur Wasser.«
Nadschib zuckte mit den Schultern und roch an dem Getränk, das der Prophet angeblich verboten hatte, wie manche Gelehrten versicherten. Andere aber, und an deren Auslegung hielten sich Nadschaf und Abu Lahab, sagten, der Koran ließe es zu.
»Im Ernst, Freund und Gebieter der scharfen Schneiden«, begann Nadschib erneut, »es sind mehr als 500 verschiedene Schwerter, die du hier hortest. Sie bringen viel ein, wenn du sie verkaufst.«
»Ich weiß.« Abu Lahab nickte zufrieden.
»Verkaufe die Waffen, und dein Vermögen wird noch viel größer werden.«
Abu Lahabs Nicken wurde stärker.
»Und dann lass nützliche Dinge schmieden, und wenn es nur Nägel sind. Denn wenn Friede herrscht, wird man allerorten Häuser bauen, und wer dann keine Nägel zu verkaufen hat, wird sich voll Wut den Bart raufen.«
»Diese Entwicklung ist mir durchaus nicht entgangen.«
»Also …?«
Abu Lahab stand auf und trug ein Bündel aus grauem Wolltuch, das nach Ruß, Schweiß und altem Olivenöl stank, zu einem der Wandbretter und legte es zu anderen Schwertern. Dann blies er zwei Kerzen aus.
»Allah ist mit den Sparsamen«, sagte er. Sein Grinsen wurde breiter.
»Also, während du hier mit deinem gottlosen und geizigen Herrn und Schmiedebesitzer den süßen Wein der Sünde genießt, hat eben dieser Herr deine Ratschläge schon vorweggenommen und einen Teil des täglich zu verarbeitenden Eisens zu allerlei nützlichem Gerät schmieden lassen.« Er stieß ein dröhnendes Lachen aus, beugte sich herunter und leerte den Krug gerecht in beide Schalen. »Aber kein Schwert weniger! Vielleicht verkaufe ich sie sogar an die Ungläubigen! Wenn du wieder ans Licht des Tages hinaufsteigst, wirst du es mit eigenen Augen sehen können.«
Jetzt musste auch Nadschib grinsen. Er rückte sein Stirntuch zurecht und lehnte sich zurück. Bedächtig tranken er und sein Dienstherr die Schalen leer, dann löschten sie weitere Flammen und gingen zur Treppe. Sie stiegen Stufe um Stufe höher; jedes Mal wurde es ein wenig heller und lauter. Aber Nadschib ben Sawaq wusste auch, dass im Herzen seines Dienstherrn mehr als ein Stachel saß: Es gab ein Haus in der Stadt, kaum kleiner, aber weniger reich eingerichtet als sein eigenes, dessen Bewohner sich seltsam aufführten, obwohl einer der Hausbewohner ein Hebräer unbekannter Herkunft war, ein gläubiger alter Jude, der niemandem etwas zuleide tat. Dennoch: Abu Lahabs Freundschaft gehörte weder den Christen noch den Juden. Abu Lahabs einziger wirklicher Freund war er selbst, der Herr der Schwerter. Er hatte einen großen Traum. Er träumte von Reichtum, Macht und Einfluss.
Sein Geschäft verstand er wie kein Zweiter, das hatte er schon oft bewiesen. Sein Reichtum war immens, aber niemand konnte sagen, wie viel Abu Lahab wirklich besaß. Ein Sklavenschinder war er nicht, aber wenn seine Befehle nicht befolgt wurden, konnte er gnadenlos sein. Er war äußerst gerissen, und nur Allah kannte seine Träume und seine Pläne. Abu Lahab war rachsüchtig, aber er konnte geduldig und lange warten, bis er den richtigen Augenblick für seine Rache gekommen sah.
Nadschib hatte es nicht schlecht bei ihm. Er rechnete wie kein Zweiter, unterschlug keine einzige Drachme, machte keine Fehler und hütete sich davor, Abu Lahab, den sie oft Effendi nannten, zu betrügen. Er dachte nicht einmal daran. Aber bisweilen dachte er an einen weiteren Stachel in Abu Lahabs Herz, nämlich an dessen Sohn Süleiman.
Der Effendi liebte den einzigen männlichen Spross seiner Lenden. Er wünschte sich, dass er sein Nachfolger würde, und blickte scheel auf dessen Leidenschaft für Schriften und Bücher. Immerhin hatte Abdullah ibn Aziz den Jungen in allen Kampfarten ausgebildet und war mit dem Resultat zufrieden. Süleiman war 19 Sommer jung und alles andere als ein Stubenhocker. Abu Lahab tröstete sich damit, dass der Junge viele Freunde in der Stadt hatte und in den Nächten, in denen er nicht im Harem schlief, sich wahrscheinlich mit den jungen Sklavinnen anderer reicher Händler vergnügte.
Aber Abu Lahabs Auge ruhte mit äußerstem Missfallen auf jenen Muslimen, die mit Ungläubigen verkehrten – zumindest mehr, als für gute Geschäfte notwendig war.
Besonders missfielen ihm Glaubensbrüder, die ihre Häuser an Ungläubige vermieteten oder, was noch verwerflicher war, ihnen sogar den Mietzins erlassen hatten.
Kapitel 3
Vor der Ruhe des Sabbats in Yerushalayim
Mit sicheren Fingern, trotz der Dämmerung, legte Joshua ben Shimon den schwarzen Faden neben den weißen. Er saß an seinem Arbeitstisch auf dem Dach des Hauses. Tisch und Sessel waren umgeben von blühenden, duftenden Ziersträuchern in großen Tongefäßen und standen unter einem Viereck aus geflochtenen Binsen, das ihn tagsüber vor der Sonne schützte. Jenseits der Stadtmauer hatte sich der zunehmende Mond über die Berge erhoben.
»Bald, in wenigen Atemzügen, fängt die Sabbatruhe an«, sagte er mehr zu sich selbst als zu seinem Freund Henri, der den Greis bisher schweigend beobachtet hatte. »Ich sehe es dir an, Henri, dass du die Ruhe und den Frieden ebenso genießt wie Uthman und ich.«
»So ist es.«
Das Haus, das Joshua bewohnte, gehörte Uthmans Vater und war uralt, ebenso alt wie die meisten Häuser nahe des Jüdischen Viertels. Vielleicht hatten die Häuser schon gestanden, als die christlichen Heere vor mehr als zwei Jahrhunderten die Heilige Stadt erobert und die Stadtviertel in Seen aus Blut und Grausamkeit verwandelt hatten. Sicherlich war es in Teilen umgebaut und, wo nötig, erneuert worden, aber die Fassade und die rückwärtigen Mauern trugen die unverkennbaren Spuren hohen Alters.
Joshua hob beide Fäden hoch und sagte lächelnd: »Jetzt ist es so weit. Ich kann den weißen nicht mehr vom schwarzen Faden unterscheiden.« Der letzte Widerschein der Sonne war hinter den Wolken am westlichen Horizont verschwunden. »Hilfst du mir, die Sabbatkerze anzuzünden, Henri?«
Henri de Roslin nickte, stieg die Steintreppe hinunter und kam kurz darauf mit einem brennenden Öllicht zurück. Joshua entzündete den Docht der dicken, nach Bienenwachs duftenden Kerze und sprach die segnenden Worte. Dann begann er mit dünner Stimme zu singen. Henri summte die Melodie an den Stellen mit, an denen er sie wiedererkannte.
Die Nacht senkte sich über die Stadt mit den drei Namen. Die Haushälterin Mara kam herauf. Sie trug ein großes Tablett, über das ein weißes Tuch gebreitet war, und stellte es auf den Tisch. Joshua sang und betete, bis die alte Mara eine Schüssel Wasser, das nach Rosen roch, in die Mitte des Tisches rückte. Die drei wuschen sich die Hände, trockneten sie feierlich ab, und Joshua sprach den Segen über den Wein.
»Zur Erinnerung an den Exodus«, sagte Joshua. In den Gläsern der Brille brach sich das Licht der Kerzenflamme. Das schmale Gesicht des Gelehrten wirkte, als ob er träumte, aber die dunklen Augen hinter den Gläsern blitzten aufmerksam. Joshua verteilte Brote und Salz, und Mara füllte die Weinbecher.
»Es tut gut, nicht kämpfen zu müssen und nicht von Feinden und Häschern umgeben zu sein.« Henris Stimme war weich, als er nach dem Becher griff. »Bald wird auch Sean bei uns sein.«
Die ersten Sterne erschienen am Firmament. Der Mond stieg höher und übergoss die Stadt mit bleichem Licht. Das Murmeln und die vielfältigen Laute aus den Häusern und Gassen erfüllten die Nacht mit einem beruhigenden, fast einschläfernden Summen. In Fenstern und auf unzähligen Dächern erschienen Lichter. Andere Lichtpunkte, wahrscheinlich waren es Fackelflammen, bewegten sich durch die Gassen. Hinter Umar ibn al-Mustansirs Haus, im Jüdischen Viertel, das der Turm von Sankt Maria Magdalena überragte, breitete sich die Ruhe des Sabbat aus.
»Er ist uns ebenso willkommen wie Uthman«, antwortete Joshua und setzte den Becher ab. »Die Tür knarrt. Ich höre ihn kommen.«
Uthman war am späten Nachmittag in die Moschee gegangen, um am Freitagsgebet teilzunehmen. Henri hörte einen leisen Wortwechsel, dann wurde die Tür geschlossen und verriegelt.
»Seid ihr alle auf dem Dach?«, rief Uthman aus dem Erdgeschoss.
»Ja. Komm herauf!«, gab Henri laut zurück. »Bring ein paar Kerzen mit. Und noch einen Krug Wein.«
Uthman lachte. »Ich eile und gehorche, Henri.«
Henri de Roslin lehnte sich zurück und streckte genussvoll die Beine aus. Er trug nur einen langen Rock aus dünnem Stoff und aus Stroh geflochtene Sandalen. Die ruhigen Tage als Joshuas Gast und besonders die Nächte, in denen er tief und lange schlief, hatten viele schlimme Erinnerungen vertrieben und ihn, der nun schon 52 Jahre zählte, in der Gewissheit bestärkt, dass die Jahre des Kampfes hinter ihm lagen. Er war müde und schlaff, sein Körper und sein Herz trugen die frischen und alten Narben vieler Kämpfe. Henri ahnte, dass der Aufenthalt in Jerusalem auch nur ein langes Atemholen vor neuen Abenteuern sein konnte, aber er würde jede Stunde auskosten.
Uthman kam aufs Dach und setzte sich, nachdem er den schweren Krug abgestellt und die Kerzen verteilt hatte, zu den Freunden. Der Vierzigjährige nahm den Turban ab und blickte in den schwarzen Himmel.
»Das Essen ist bald fertig«, sagte Mara und fragte: »Warst du in der Moschee?«
»Ja, in der Omar-Moschee«, antwortete Uthman ibn Umar leichthin. »Gebet ist besser als Schlaf. Zumindest manchmal. Die Predigt war gut; es ging um den Frieden, den kommenden Ramadan und um die Almosen für die Armen.«
Im Kalender des Islam, der nach dem Mondmonat berechnet wurde, war Ramadan der neunte Monat. Er begann und endete im Jahr der Christen stets an unterschiedlichen Tagen und wanderte sozusagen durch das Jahr des christlichen Kalenders.
»Aber was vielleicht wichtiger ist – es scheint, dass man uns beobachtet«, fuhr der Sohn Umar ibn al-Mustansirs fort.
Henri richtete sich auf und suchte den Blick von Uthmans schwarzen Augen. »Beobachtet? Wer sollte das tun?«
»Zuerst habe ich nicht bemerkt, dass mir ein junger Araber gefolgt ist. Im Gedränge an der Moschee konnte er auch nicht auffallen. Aber auf dem Weg hierher habe ich ihn immer wieder hinter mir gesehen. Schließlich war er verschwunden.« Uthman zuckte mit den Schultern. Henri und Joshua sahen ihn gespannt an. »In den Gassen hier war es ziemlich finster, aber ich hab den Araber gesehen, als sich ein Fenster öffnete, aus dem Licht fiel. Es war ein dunkel gekleideter junger Mann mit schwarzen Locken. Er hat zu dem Haus hier herübergestarrt, Joshua. Er wirkte aufgeregt. Dann hat sich das Fenster wieder geschlossen, und ich konnte nichts mehr erkennen.«
Die meisten Häuser, dachte Henri, hatten abweisende Fassaden. Wenige kleine Fenster mit Holzläden und vielleicht einen kleinen Erker, der aus Schnitzwerk bestand, sodass man leichter hinaus- als hineinsehen konnte. Und eine schwere Eingangstür. Die Häuser öffneten sich zu den Höfen, mit Wandelgängen, Pfeilern, Fenstern und Treppen. Joshua wandte sich an Mara.
»Hast du in den vergangenen Tagen hier einen jungen Araber herumlungern sehen?«
Die alte Hausbesorgerin schüttelte den Kopf.
»Kleine Jungen rennen oft durch die Gassen. Aber ich habe so einen Mann, wie Uthman ihn beschrieben hat, hier nicht bemerkt.«
Völlig sorglos konnte Joshua hier nicht leben, seine Gefährten wussten von seinen Vorkehrungen. Mindestens einmal pro Woche klopfte ein hünenhafter Mann, offensichtlich auch ein Jude, an die Haustür. Er wurde eingelassen, und Joshua zog sich um. Der Leibwächter, der den als Muslim getarnten Joshua dann zu Rabbi Judah ben Cohen begleitete, brachte ihn spätnachts oder erst am nächsten Morgen zurück. Joshua und der Rabbi verbrachten die Stunden mit langen Gesprächen über Glauben und Wissenschaft.
Das Zusammenleben mit den Muslimen in Jerusalem war für Juden und Christen vor einigen Jahren noch wesentlich einfacher. Doch es gab Formen des Miteinander, freilich war die Hierarchie klar, denn die Muslime hielten alle Andersgläubigen für Ungläubige. Joshua hatte Henri und Uthman schon vor einiger Zeit berichtet, dass die Muslime jüdische Ärzte beschäftigten und dass viele Juden erfolgreich mit edlen Metallen handelten, mit Arzneien und Stoffen. Sie standen entweder im Dienst einflussreicher Muslime oder zahlten eine Kopfsteuer.
Trotzdem misstraute Henri der Ruhe. Er sagte sich zwar, dass Joshua hier nahe dem alten Viertel bekannt war und dass er sich nicht in Gefahr befand. Für ihn selbst aber und später auch für Sean galt das nicht. Die Erinnerung an die Gräueltaten der christlichen Ritter war trotz der lange zurückliegenden Kämpfe lebendig geblieben. Aber auch er verließ das Haus nur als Muslim verkleidet. Es wäre für ihn lebensgefährlich gewesen, wenn man ihn als einen ehemaligen Tempelritter erkannt hätte.
Henri wechselte mit Joshua und Uthman lange Blicke.
»Was sollen wir tun?«, erkundigte sich Joshua leise. Er nahm die Brille ab und reinigte die Gläser mit seinem Hemdärmel. Plötzlich wirkte er unsicher und bedrückt.
»Auf Sean warten«, antwortete Henri. »Oder hast du einen besseren Vorschlag, Uthman?«
Uthman blinzelte in die Flamme der Sabbatkerze und murmelte etwas Unverständliches. Dann sagte er leise: »Wir müssen auf ihn warten, sonst sucht er uns viele Tage lang in Al Quds, Yerushalayim, Jerusalem oder wie immer er die Stadt nennt. Wenn er hier herumirrte würde er sich in große Gefahr begeben, das können wir nicht verantworten.«
»Ich sehe das genauso«, pflichtete ihm Henri bei. »Was könnte dieser schwarz gelockte Araber von uns wollen?«
»Er will herausfinden, wer ihr seid«, sagte Joshua und bedeutete Mara, nach unten zu gehen und das Essen aufzutragen.