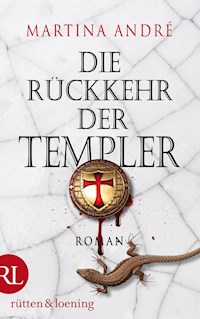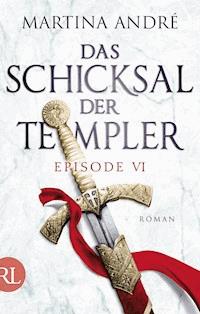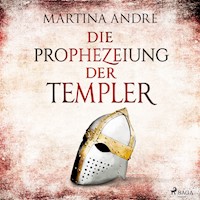8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schottland 1647. Der Highlander John Cameron hat Krieg und Pest überlebt, als er auf Madlen MacDonald trifft, von der es heißt, sie sei die Mätresse eines zwielichtigen Lords und mit dem Teufel im Bunde. Nach einer gemeinsamen Liebesnacht wird John wegen falscher Anschuldigungen ihres Gönners zum Tode verurteilt. Im Verlies erfährt er, dass der Lord Häftlinge kauft, um an Ihnen Experimente durchzuführen ... Edinburgh 2009. Die Biologin Lilian versucht, den Erinnerungscode in menschlichen Genen zu entschlüsseln. Bei einem Selbstversuch sieht sie einen Mann in altertümlicher Kleidung. Auf der Suche nach den Hintergründen dieses Mysteriums, gerät sie in ein Herrenhaus und steht plötzlich vor John Cameron, dem Mann aus ihrer Vision. Welches Geheimnis hütet der Schotte? Und warum behauptet er, sie sei in großer Gefahr? Mystery pur - Martina André erzählt von einer geheimen Bruderschaft und dem gefährlichen Versuch, den Tod zu überwinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1106
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Über Martina Andrè
Martina Andrè, Jahrgang 1961, lebt mir ihrer Familie bei Koblenz. Im Aufbau Taschenbuch Verlag erschien von ihr der Bestseller "Die Gegenpäpstin". Zuletzt veröffentlichte sie den Roman "Schamanenfeuer - Das Geheimnis von Tunguska" (Verlag Rütten & Loening).
Informationen zum Buch
Schottland 1647. Der Highlander John Cameron hat Krieg und Pest überlebt, als er auf Madlen MacDonald trifft, von der es heißt, sie sei die Mätresse eines zwielichtigen Lords und mit dem Teufel im Bunde. Nach einer gemeinsamen Liebesnacht wird John wegen falscher Anschuldigungen ihres Gönners zum Tode verurteilt. Im Verlies erfährt er, dass der Lord Häftlinge kauft, um an Ihnen Experimente durchzuführen.
Edinburgh 2009. Die Biologin Lilian versucht, den Erinnerungscode in menschlichen Genen zu entschlüsseln. Bei einem Selbstversuch sieht sie einen Mann in altertümlicher Kleidung. Auf der Suche nach den Hintergründen dieses Mysteriums, gerät sie in ein Herrenhaus und steht plötzlich vor John Cameron, dem Mann aus ihrer Vision. Welches Geheimnis hütet der Schotte? Und warum behauptet er, sie sei in großer Gefahr?
Mystery pur – Martina André erzählt von einer geheimen Bruderschaft und dem gefährlichen Versuch, den Tod zu überwinden.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Martina André
Die Teufelshure
Roman
Inhaltsübersicht
Über Martina Andrè
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Edinburgh – Weihnachten 1644 – »Outbreak«
Teil I
1 Edinburgh 1647 – »Horsemarket«
2 Edinburgh 1647 – »Seelenfänger«
3 Edinburgh 1647 – »Jungfrauenopfer«
4 Edinburgh 1647 – »Checkers«
5 Edinburgh 1647 – »Fegefeuer«
6 Edinburgh 1647 – »Tolbooth«
7 Edinburgh/Bass Rock 1647 – »Rednose Rosie«
8 North Berwick/Bass Rock 1647 – »Höllenfeuer«
9 Bass Rock 1647 – »Die Gezeichneten«
10 North Berwick 1647 – »Versuchung«
11 Auf der Flucht 1647 – »Jagdfieber«
12 Auf der Flucht 1647 – »Blutzoll«
13 Auf der Flucht 1647 – »Blutsbande«
14 West Highlands 1647 – »Loch Iol«
15 West Highlands 1647 – »Tor Castle«
16 West Highlands 1647 – »Rabenjagd«
17 West Highlands 1647 – »Höllenhunde«
18 West Highlands 1647 – »Teufelsbraut«
19 West Highlands 1647 – »Claymore«
20 Sommer – Lowlands 1648 – »Witch Finder«
21 Sommer – Lowlands 1648 – »Hexenjagd«
Teil II
22 Schottland 2009 – »Leith«
23 Schottland 2009 – »Unvergesslich«
24 Schottland /München 2009 – »CSS«
25 Schottland 2009 – »Eternity«
26 Schottland 2009 – »Unsterbliche Seele«
27 Schottland 2009 – »Blinddate«
28 Schottland 2009 – »Tigerlilly«
29 Schottland 2009 – »Familienbande«
30 Schottland 2009 – »Rosenkrieg«
31 Schottland 2009 – »Nachtwache«
32 Schottland 2009 – »Nichts als die Wahrheit«
33 Norwegen 2009 – »Secret Cemetery«
34 Norwegen 2009 – »FOXO3A«
35 Norwegen 2009 – »Tränen der Nacht«
36 Highlands 2009 – »Götterdämmerung«
37 Highlands 2009 – »Venusfalle«
38 Highlands 2009 – »Corby Castle«
39 Highlands 2009 – »Die Bruderschaft«
40 Highlands 2009 – »Seelenschau«
41 Highlands 2009 – »Lapis Philosophorum«
Epilog
Highlands – Juni 2009 – »Gottes Wille«
Nachwort und Danksagung
Impressum
Dieses Buch widme ich meinen Fans aus den Leserunden – ohne Eure Begeisterung, Eure hilfreichen Anmerkungen und Euer Engagement würde das Schreiben nur halb soviel Spaß machen.
Prolog
Tha mi creidsinn ann an Dia an t-Athair Uilechumhachdach, Cruithfhear nèimh agus talmhainn.
(erster Satz des apostolischen Glaubensbekenntnisses in Schottisch-Gälisch)
Edinburgh – Weihnachten 1644 – »Outbreak«
Weihnachten 1644 war für John das traurigste Fest seines Lebens; was nicht etwa daran lag, dass die presbyterianische Kirche in Schottland die katholischen Feierlichkeiten zur Geburt Christi verboten hatte.
John hätte gerne auf Haggis, Whisky, Tanz und bunte Girlanden verzichtet, wenn wenigstens die Kinder am Leben geblieben wären. Aber nun starrte er auf neun übelriechende Leichen, die er eigenhändig in weißes Leinen gehüllt und zu einem Berg aus leblosen Leibern aufgeschichtet hatte, damit der Bestatter sie abholen konnte – falls er sich überhaupt in nächster Zeit in die ausgestorbenen Straßenschluchten der Kings Close verirren würde.
Doktor Jon Paulitius, der wohl bestbezahlte Arzt Schottlands, war der vorletzte Mensch, den John – außer Granny Beadle – lebend gesehen hatte. Erst vor wenigen Tagen hatte der einzige offiziell bestellte Pestarzt dem kläglichen Rest der Beadles einen Besuch abgestattet und den achtjährigen Matthew zur Ader gelassen.
John hatte dem Jungen Vater und Mutter ersetzen müssen, die in den Tagen zuvor nacheinander gestorben waren, ebenso wie vier ältere Geschwister und der erst vor kurzem geborene Säugling. Großmutter Beadle war zu krank, um ihren letzten Enkel zu trösten.
Der Doktor trug ein langes schwarzes Gewand, einen schwarzen breitkrempigen Hut und eine Schnabelmaske aus hellem Leder, die ihn vor krankmachenden Dämpfen schützen sollte und ihn wie einen übergroßen hässlichen Raben aussehen ließ. Die Augen waren von schützenden Kristallgläsern bedeckt und verwandelten die Pupillen dahinter in furchterregende schwarze Knöpfe.
Matthew flößte das Aussehen des Arztes höllische Angst ein, und als der Doktor sich über ihn beugte, sammelte er seine letzten Lebenskräfte und schrie wie am Spieß. Erst recht, als Paulitius sich anschickte, ihm die Ader zu öffnen. John hatte es selbst mit der Angst zu tun bekommen, aber nicht weil er Paulitius als so furchterregend empfand (obwohl er das tatsächlich war), sondern weil er befürchtete, das Kind würde am Schock sterben.
John hatte den fiebernden Jungen gehalten und immer wieder beruhigend auf ihn eingeredet, während der Doktor das geschärfte Lasseisen an der schlecht zu stauenden Armvene justierte.
Nachdem Matthew eine gnädige Ohnmacht befallen hatte, öffnete Paulitius bei John eine Pestbeule und behandelte die Wunde mit dem Kautereisen, um die Wundränder auszubrennen. Es stank nach Eiter und verbranntem Fleisch, und John biss die Zähne zusammen, weil er sich den Schmerz nicht anmerken lassen wollte.
»Habt Ihr noch etwas Laudanum?«, fragte er Paulitius hoffnungsvoll. »Ich kann Euch bezahlen.« John hatte seine gesamte Habe an einem sicheren Ort außerhalb der Stadt vergraben. Einem Pestkranken war es jedoch bei Todesstrafe verboten, das Haus zu verlassen, in dem er sich bei Ausbruch der Krankheit befunden hatte. Und so musste er sparsam sein und das Wenige, was er unter seiner Strohmatratze verborgen hielt, zur Linderung der größten Not mit der Familie teilen, die ihm den Schlafplatz in ihrer bescheidenen Behausung vermietet hatte.
Wie die bereits verstorbenen Beadles zuvor litt John nicht nur an zwei dicken Geschwüren, am meisten litt er am Fieber und an den unerträglichen Kopfschmerzen. Es war nur eine Frage der Zeit, wann der Tod seine Hand auch nach ihm ausstrecken würde.
Paulitius schüttelte den Kopf, was den Arzt noch grotesker erscheinen ließ. »Es tut mir leid«, antwortete er mit gedämpfter Stimme. »Das Laudanum ist mir ausgegangen. Obwohl die halbe Stadt dahingerafft wurde, gibt es immer noch zu viele Menschen, die vor allem an den Schmerzen leiden, und wenn ich ehrlich bin, bleibt mir kaum etwas anderes, womit ich ihnen helfen könnte.« Seine Stimme klang mutlos.
John schluckte seine Enttäuschung hinunter und nickte nur, als der Doktor sich ohne Händedruck von ihm verabschiedete. Paulitius ging zur Tür und nahm seinen Stab, der ihn als Pestarzt zu erkennen gab, obwohl es eines solchen Zeichens gar nicht bedurft hätte. Er war der einzige Mensch in ganz Edinburgh, der eine solche Gewandung trug und sich in die Häuser der Kranken wagte.
Zwei Tage später starb Matthew an Entkräftung, obwohl John ihm trotz der eigenen Beschwerden kühlende Umschläge bereitet und versucht hatte, ihn mit Milch und Brot zu füttern, das die Stadtväter neben Wein und Bier kostenlos bis an die Haustüren liefern ließen. Aber all das hatte nichts genützt, und John musste einen weiteren Leichnam in ein weißes Leinentuch schlagen, das ihm ebenfalls kostenfrei zur Verfügung stand.
Danach blieb ihm nur noch Granny Beadle. Die alte Frau lag in der guten Stube stöhnend auf einem Strohsack in dem einzigen großen Bett, das ihr nunmehr allein gehörte.
»John?« Ihre Stimme klang brüchig. »John? Bist du da?«
John hatte eine Öllampe entzündet, weil das Licht von der Straße, das in die schmalen Kellerschächte fiel, selbst bei Tage nicht ausreichte, um das winzige Zimmer zu erhellen.
»Ja, Granny, ich bin hier«, erwiderte er und nahm einen Krug mit Wein und einen Becher, um der alten Frau den peinigenden Durst zu stillen. Sie war völlig abgemagert. Ihr Kopf sah mit einem weißen Gespinst von Haaren wie ein Totenschädel aus.
Als er den Becher an ihre ausgetrockneten Lippen setzte, hielt sie ihn mit ihren knochigen Fingern am Handgelenk fest.
»Nein«, sagte sie leise. »Ich will nicht trinken. Setz dich nur ein bisschen zu mir, John.« Der Blick ihrer trüben blauen Augen schmerzte ihn mehr als die Geschwüre, die ihm unter den Armen und in der Leiste brannten. Granny Beadle hob ihre zittrige Hand und legte sie auf sein Haupt. Dann strich sie bedächtig über sein langes, verfilztes Haar bis hinunter zu seinem struppigen Bart, in den die Läuse längst Einzug gehalten hatten.
»Du bist ein guter Junge, John. Gott der Herr wird dich beschützen.« Ihre Fürsorge gab ihm den Rest. Sie hatte alles verloren, an dem ihr Herz gehangen hatte, und war immer noch in der Lage, ihm Liebe und Anteilnahme zu geben.
Sein Kopf sank auf ihre hagere Brust, und als sie den Arm federleicht um seine Schultern legte, ließ ein Schluchzen seinen Körper erzittern. Und dann weinte er, wie er noch nie in seinem Leben geweint hatte. Seine Tränen tränkten Granny Beadles fadenscheiniges Nachthemd, und ihre geflüsterten Worte der Zuversicht machten alles nur noch schlimmer. Als er den Kopf hob, lächelte sie matt, und er fühlte sich schuldig, weil er schwach geworden war, und rang um eine Erklärung.
»Was ist das nur für ein Gott«, stammelte er verzweifelt, »der so etwas zulässt?« Hastig rieb er sich den Rotz von der Nase und deutete auf die verstorbenen Kinder. Dann streckte er die Faust zur Decke und setzte eine kämpferische Miene auf. »O Herr! Ich, John Cameron, fordere einen Beweis Deiner unendlichen Güte! Mach dem Sterben ein Ende und schenke den Menschen das ewige Leben auf Erden und nicht erst im Himmelreich! Tust Du es nicht, bist Du ein grausamer Gott, und ich kann nicht weiterhin an Dich glauben – von nun an bis in alle Ewigkeit, Amen!«
Während John eine gewisse Erleichterung verspürte, obwohl er nicht annahm, dass sich nun etwas änderte, hatte das Gesicht der alten Frau einen ernsten Ausdruck angenommen.
»Versündige dich nicht, John Cameron«, flüsterte sie besorgt. »Der Herr empfängt all unsere Gebete, und was wirst du tun, wenn Er deine Worte erhört?«
Teil I
1Edinburgh 1647 – »Horsemarket«
John Cameron verspürte nicht die geringste Lust, den letzten Atemzug des Henry Stratton mitzuerleben, und doch blieb ihm keine andere Wahl. Abraham Brumble, Johns Vorarbeiter im Hafen von Leith, hatte seinen Untergebenen unerwartet frei gegeben, weil sie auf Befehl der Stadtkommandantur Zeugen einer öffentlichen Hinrichtung im nahen Edinburgh werden sollten. In der Ankündigung hatte es geheißen, dass die Hinrichtung des Delinquenten als Warnung zu verstehen sei – für alle, die eine Revolution gegen das schottische Parlament planten.
Brumble war alles andere als begeistert. Wegen eines solchen Blödsinns, wie er sich auszudrücken pflegte, blieben seinen Hafenarbeitern nur noch ein paar Stunden zum Entladen eines großen Dreimasters. Denn morgen war Sonntag, der Tag des Herrn, an dem alles stillstand, und das Schiff sollte am frühen Montagmorgen wieder nach Frankreich auslaufen.
Es regnete in Strömen, als John und drei seiner Gefährten ihre Arbeit niederlegten, um sich endlich zu Fuß auf den Weg nach Edinburgh zu machen. Sie waren spät dran. Die Mittagsglocke hatte längst geläutet, als sie die Festungsmauern von Leith durch das große Südportal passierten und die Hauptstraße nach Edinburgh nahmen. Paddy Hamlock, ein graubärtiger, grobschlächtiger Ire aus Ulster, und Malcolm und Micheal MacGregor, völlig gleich aussehende, sechzehnjährige Zwillinge aus Stirling, begleiteten John in den befestigten Teil der Stadt, deren Festungsanlage auf einem hohen Fels, dem sogenannten Castle Rock, nicht nur die Stadt, sondern auch die umliegende Hügellandschaft weithin überragte.
Die Hinrichtung war für zwei Uhr nachmittags angekündigt. Somit blieb ihnen knapp eine Stunde, um zum Horsemarket zu gelangen, wo die Exekution durch den Galgen stattfinden sollte. Die drei Männer hatten keine Mühe, mit John mitzuhalten, obwohl sie allesamt ein ganzes Stück kleiner waren als der hochgewachsene Highlander. John schien es nicht eilig zu haben. Paddy und die beiden anderen konnten an seiner verbissenen Miene ablesen, dass ihm der Grund ihres unverhofften Ausflugs ganz und gar nicht behagte. Zusammen mit Heerscharen von Menschen marschierten sie über die schlechten Straßen rund um Edinburgh, vorbei an Gemüsefeldern, Obstgärten und Schweineweiden, und wichen dabei immer wieder den riesigen Pfützen aus, die der lange Regen hinterlassen hatte.
John hatte schon mehrmals versucht, aus Paddy herauszubekommen, warum man Stratton so plötzlich an den Galgen bringen wollte. Erst vor drei Tagen war das Urteil in einem Schnellverfahren gefällt worden – schuldig wegen Landesverrats und Verschwörung gegen das schottische Parlament –, doch niemand wurde so recht schlau daraus.
John kannte Stratton von diversen Kneipenzügen rund um Edinburgh, bei denen sie sich immer wieder begegnet waren. Was jedoch nicht bedeutete, dass er oder einer seiner Kameraden mit ihm befreundet gewesen waren. Stratton gehörte zu jener Sorte von adligen Arschlöchern, die sich nie mit einem Arbeiter von den Docks auf einen Drink oder ein Kartenspiel eingelassen hatten.
Paddy war mit Stratton schon einmal wegen eines Krugs Whisky aneinandergeraten, den der hochnäsige Pinsel im Half Moon Inn, ohne zu fragen, auf seine Rechnung getrunken hatte. Der Ire hätte eigentlich wissen müssen, warum man Stratton in Wahrheit hängen wollte, denn ihm entging so gut wie nichts, was in der Stadt passierte. Aber selbst er hatte eisern geschwiegen, wenn der ein oder andere seinen Zweifel an Strattons Schuld hatte verlauten lassen.
»Man sagt, er habe sich den königstreuen Cavaliers angeschlossen und mit ihnen Attentate auf hochrangige Mitglieder der Covenanters im schottischen Parlament vorbereitet«, knurrte Paddy im Gehen ungeduldig, weil nicht nur John ihm mit seiner ewigen Fragerei auf den Geist ging. »Angeblich hat er sogar Flugblätter mit einem Aufruf drucken lassen, in dem er die Ermordung presbyterianischer Bischöfe fordert. Es hieß, er wollte damit den Verrat der Schotten an König Charles rächen.«
»Stratton?« John sah seinen irischen Freund ungläubig an. Stratton war alles, was man sich vorstellen konnte, nur nicht religiös und schon gar nicht politisch. Und soweit John wusste, hatte er weder in der königlichen Armee unter Charles I. noch unter Cromwells Truppen als Söldner gedient. Er galt als geschniegelter Galan, der zwar aus noblem Hause stammte, aber leider kaum eigene Mittel besaß. Sein Vater weilte im niederländischen Exil, und Henry, der schon vor längerem mit seiner Familie gebrochen hatte, machte sein Geld beim Wetten und Kartenspiel oder als verlässlicher Begleiter alternder, vermögender Edeldamen. Dabei mied er die Kirche wie der Teufel das Weihwasser und war politisch nie in Erscheinung getreten.
Paddy reckte seinen Hals über den Kragen seiner Joppe hinaus und entblößte sein lückenhaftes Gebiss zu einem hämischen Grinsen.
»Der Aufschneider ist Lord Chester Cuninghame in die Quere gekommen.« Die Stimme des Iren klang verschwörerisch, als er seine schwielige Hand schützend an seinen Mund legte, obwohl ihn bei dem lautstarken Durcheinander, das in den Straßen herrschte, ohnehin kaum jemand hätte verstehen können. Er näherte sich John so weit, dass er ihm direkt ins Ohr sprechen konnte. Flüsternd verfiel er ins Irisch-Gälische, das John wegen seiner schottisch-gälischen Herkunft leidlich zu verstehen vermochte. »Cuninghame ist Parlamentsmitglied und unglaublich vermögend. Er hat verwandtschaftliche Beziehungen bis in die höchsten Regierungskreise und pflegt vielfältige politische Verbindungen, die er überwiegend zu seinem persönlichen Vorteil nutzt. Allerdings heißt es auch, er sei das schwarze Schaf der Familie, weil er sich bisher einer angemessenen Ehe verweigert. Angeblich gehört er einer geheimen Bruderschaft an, die den Freimaurern zugetan ist. Offiziell ist er ein Anhänger der Covenanters – inoffiziell soll er bis zum Ansatz im Arsch unseres Königs stecken. Darüber hinaus munkelt man, er stehe mit den Mächten der Finsternis im Bunde, und wenn er es will, bringt er jeden an den Balken, der ihm nicht in den Kram passt.«
John schaute verwundert auf. Bis auf die letzte Bemerkung erschien ihm Cuninghames korruptes Verhalten für einen Parlamentarier als ziemlich normal. Ein hintergründiges Lächeln umspielte seinen Mund. »Willst du damit etwa sagen, dieser teuflische Lord ist ein Sodomit und unserem gutaussehenden König bereits nahe genug gekommen, um ihm die Eier zu schaukeln?«
Malcolm und Micheal, die Johns Replik mit angehört hatten, begannen laut zu kichern.
Paddy machte eine unwirsche Handbewegung in Johns Richtung. »Sei still, du Dummkopf, oder willst du, dass wir Stratton folgen?« Der Ire wandte sich ab und tauchte vor John in die Menge ein, die sich stetig dem engen Einlass am Leith Wynd Port näherte, einem der nördlichen Stadttore von Edinburgh. John ließ sich nicht beirren und beschleunigte seine Schritte, dabei hielt er Paddy am Arm seiner braunen Filzjoppe fest und hinderte ihn daran, weiterzugehen. »Das erklärt aber nicht, warum er ausgerechnet Stratton baumeln lässt.«
Paddys Miene verdüsterte sich, und seine mit Whisky geschmirgelte Stimme klang bedrohlich, als er sich von neuem an einer Erklärung versuchte. »Ich habe es doch gesagt. Offiziell wird Stratton beschuldigt, an einem Komplott gegen das Parlament beteiligt gewesen zu sein.«
»Und inoffiziell?« Erst jetzt gab John ihn frei und folgte dem Iren weiter hinein in die Menge. Das Grölen und Schwatzen all der wartenden Menschen übertönte sogar seine kräftige Stimme.
Paddy hatte ihn trotzdem verstanden und hob spöttisch eine seiner buschigen Brauen. »Inoffiziell hat er Cuninghames junge Mistress gevögelt.«
John grinste unfroh und rückte sich rasch seinen schwarzen breitkrempigen Hut zurecht, nachdem er ihn im Vorbeigehen gelüftet hatte, um ein blondes, rotwangiges Mädchen zu grüßen, das ihm ein strahlendes Lächeln zugeworfen hatte. Es geschah nicht selten, dass Frauen ganz fasziniert zu ihm aufschauten, wenn sie ihm begegneten. Er war groß, hatte ein markant geschnittenes Gesicht und einen ansehnlichen Körper. Darüber trug er meist ein ungebleichtes Hemd und das gegürtete Plaid eines Highlanders – als untrügliches Zeichen seiner keltischen Herkunft. Das zweimal drei Meter große Stück dicht gewebten Wollstoffs, auf Höhe der Taille mit einem breiten Ledergürtel fixiert, umspielte wie ein Rock seine bloßen Knie und schützte gleichzeitig, nach oben hin gerafft und über Brust und Rücken drapiert, vor Nässe und Kälte. Es war ein archaisches Kleidungsstück, auf das er mit Stolz blickte, besonders seit man es während der Pest in Edinburgh und Umgebung zunächst aus hygienischen Gründen verboten und dann später, als die Epidemie vorüber war, wiederzugelassen hatte. Nicht selten kam es vor, dass die Mägde in den Schankstuben zu vorgerückter Stunde und mit einem hysterischen Kreischen darunterfassten und erstaunt feststellten, dass John tatsächlich – verborgen unter dem braun und blau karierten Muster – nichts anderes trug als seine stattliche Männlichkeit. Nach Ansicht der Frauen war er ein gutaussehender Kerl mit einschlägigen Qualitäten, die jedem Mädchen die Sinne raubten, wenn er es nur nahe genug an sich herankommen ließ. Mittlerweile wusste er um seine Wirkung, obwohl nach seiner Pesterkrankung ein paar hässliche Narben auf seiner Brust zurückgeblieben waren. Sein dichtes zimtfarbenes Haar trug er schulterlang, dazu einen modischen Spitzbart, wie alle Männer, die etwas auf sich hielten.
Mit einer flüchtigen Geste wischte er sich den Regen aus den Augen. »Ist sie wenigstens hübsch?«
»Die Mistress? Machst du Witze?« Paddy sah ihn entrüstet an. »Sie ist eine Schönheit. Aber in Wahrheit ist sie nichts anderes als eine Teufelshure. Allein ihr Anblick vermag kluge Männer im Handumdrehen in sabbernde Narren zu verwandeln.« Paddy verfiel in ein heiseres Flüstern. »Es gibt Stimmen, die behaupten, Cuninghame bediene sich ihrer, um mit dem Satan Kontakt aufzunehmen.« Der Ire hob den Kopf und sah sich beinahe ängstlich um, und erst als die Luft rein zu sein schien, fuhr er fort. »Aber selbst wenn sie eine Heilige wäre.« Er schnaubte verächtlich. »Für mich gibt es kein Weibsbild, das es wert wäre, dafür zu sterben! Außer meiner Mutter natürlich. Doch die ist längst tot.«
John erwiderte nichts. Der Regen war schwächer geworden, aber noch immer jagten düstere Wolken am Himmel entlang.
Ziemlich durchnässt und mit schlammverdreckten Stiefeln passierten sie schließlich unter den scharfen Blicken der Wachmannschaften das nördliche Stadttor von Edinburgh. John wurde wie immer auf Waffen kontrolliert. Nicht nur seine hünenhafte Erscheinung und das kantige Gesicht trugen Schuld daran, dass ihm die Stadtwachen misstrauten. Die »Toun Rats«, meist ältere, hartgesottene Veteranen, erkannten alleine an Johns Aufmachung, dass sie es mit einem geborenen Krieger zu tun hatten. Nicht umsonst rekrutierten Armeen aller Couleur ihre Soldaten bevorzugt in den Highlands. Den meisten Männern aus dieser Region Schottlands pulsierte das wilde Blut der Wikinger in den Adern, das sie selbst in Friedenszeiten nicht zur Ruhe kommen ließ. Obwohl John nur den üblichen Sgian Dubh bei sich trug, einen kleinen schwarzen Dolch, der gewöhnlich im Stiefel steckte, konnten die Soldaten ihm ansehen, dass er problemlos in der Lage war, ein panzerbrechende Waffe zu führen, jenes gefürchtete Breitschwert, das zu einem Highlander gehörte wie sein Plaid.
»Wo sollte ich denn ein Clagmore versteckt haben?«, bemerkte John spöttisch und lüftete für einen Moment sein Plaid, als die Wachen ihn nach dem Besitz des beinah eineinhalb Meter langen Schwertes befragten.
Wenig später schlenderten John und seine Kameraden die High-Street hinauf in Richtung Castle Rock, um kurz davor in den Strait-Bow einzubiegen, der direkt hinab zum Horsemarket führte. Von einer von steilaufragenden Häusern gesäumten Anhöhe aus konnte man den Galgen gut erkennen, an dem Stratton seinen letzten Atem aushauchen sollte. Das Balkengerüst aus massivem Eichenholz erhob sich mit seinem hölzernen Podest aus einem wogenden Meer von Alten und Jungen, Kranken und Gesunden, die alle nur ein Ziel verfolgten – das grausige Ende eines armen Sünders unter Pfiffen, Zurufen und Beifall zu begaffen. Die Plattform, auf welcher der Delinquent sein letztes Gebet sprechen würde, bevor er zur Hölle fuhr, war noch leer und von einer buntgeschmückten Balustrade umrandet, geradeso als ob es ein großes Fest wäre, einen jungen, kerngesunden Kerl hängen zu sehen.
Es war nicht das erste Mal, dass der weitläufige Platz sich eines solch morbiden Spektakels erfreute, und die zahlreichen Gasthäuser, die das Areal begrenzten, verdienten bei einer Hinrichtung weit mehr als an einem gewöhnlichen Markttag, wenn hier Pferde und Kühe den Besitzer wechselten.
Ein Kommando der Stadtwache hatte auf dem sogenannten Horsemarket Aufstellung genommen, um Ruhe und Ordnung zu sichern. Nicht selten versuchten Rebellen in letzter Minute ihre Kameraden vor dem Tod zu retten, indem sie zu Pferd den Hinrichtungsaufbau stürmten und den Gefangenen vom Galgen schnitten. Doch wer sollte Stratton befreien? Er war mit Sicherheit kein Mann, der viele Freunde besaß. Er gehörte zu keinem Clan und zu keiner Partei, und die Anschuldigungen des Gerichts, er sei ein Rebell, erschienen John geradezu lächerlich. Die Soldaten stießen und drängten die wartenden Menschen mit Knüppeln hinter eine Absperrung, um die reibungslose Zufahrt des Delinquenten auf seinem offenen Gefängniswagen zu garantieren. John kannte einige der Männer, sie stammten wie er aus dem schottischen Hochland und waren nach Edinburgh gekommen, um als gut entlohnte Söldner ein besseres Leben zu führen.
Der Henker prüfte ein letztes Mal das Seil, an dem sich Strattons Schicksal erfüllen sollte.
John war mulmig zumute. Er hasste den Tod – erst recht, seit er vor zwei Jahren die Beulenpest überlebt hatte. Es war nicht so sehr die Angst vor dem Sterben überhaupt, sondern vielmehr vor der Art, wie es geschah. Während der Pest hatte er aus nächster Nähe Alte und Junge unter unvorstellbaren Qualen dahinsiechen sehen, und außer beten war ihnen nichts geblieben, um das grausame Schicksal noch einmal von sich abwenden zu können. Vielleicht war da ein Genickbruch, wie er manchmal beim Hängen eintrat, das geringere Übel. Aber nicht oft hatten die Verurteilten ein solches Glück. Gehenkt zu werden bedeutete in der Regel einen qualvollen, langsamen Tod. Oft baumelte der Betroffene eine halbe Ewigkeit, nachdem man ihm die Schlinge um seinen Hals gelegt und den Körper so weit nach oben gezogen hatte, dass die Füße den Boden verloren. Stück für Stück schnürte sich dem Todgeweihten die Kehle zu. Auf diese Weise zu sterben stellte sich John alles andere als angenehm vor.
Doch es gab noch andere Todesarten, die man selbst seinem schlimmsten Feind nicht wünschen würde. Kein Tag verging, an dem John nicht an das grauenvolle Sterben des kleinen Jeremy Cook denken musste. In manchen Nächten erwachte er schweißgebadet aus diesem immer wiederkehrenden Alptraum. Zu lebhaft stand ihm vor Augen, wie er bei seinem ersten anständigen Job in der Stadt vergeblich versucht hatte, den schmächtigen sechsjährigen Schornsteinfegergehilfen an einem langen Seil, das der Junge um die Brust geknotet trug, aus einem endlos erscheinenden schmalen Kaminschlot herauszuziehen. Chimney-Sweeps, wie man die kindlichen Schornsteinfeger von Edinburgh nannte, wurden erbarmungslos ausgenutzt, weil nur ihre schmale Gestalt in die mehrstöckigen engen Schlote passte und damit an Stellen gelangen konnte, wo weder Bürste noch Eisenkugel halfen. Noch immer verfolgte John das Geräusch, als das Seil riss, und der Schrei des Jungen, als er in die Tiefe stürzte. So lange, bis das unglückliche Kerlchen zwischen den eng gemauerten Steinen steckenblieb und im heißen Rauch und dichten Kohlenruß elendig erstickte. Obwohl so etwas tagtäglich geschehen konnte und zum wahrhaft schmutzigen Geschäft gehörte, gab John sich die Schuld an Jeremys schrecklichem Tod. Er ganz allein hatte die Verantwortung für den Jungen getragen, und es war ihm nicht gelungen, rechtzeitig die Wand an jener Stelle aufzustemmen, wo er das sterbende Kind in dem zwölfstöckigen Gemäuer vermutet hatte.
Bis zur Hinrichtung dauerte es noch eine Weile. John schlug vor, dass man auf ein Ale in einen der vielen Pubs einkehren sollte. Paddy entschied sich für das White Hart Inn, weil das Bier einen guten Ruf hatte und man von dort aus direkt auf den Galgen schauen konnte.
Während John für vier Krüge Bier anstand, drängten sich immer mehr Gäste in den Schankraum. Durch die geöffneten Fenster konnte er beobachten, dass draußen etliche Kutschen und Sänften eintrafen, denen meist adlige oder zumindest vermögende Edinburgher Bürger entstiegen, um sich von Lakaien zu ihren Ehrenplätzen auf einer eigens für die Hinrichtung errichteten Holztribüne geleiten zu lassen.
Paddy, Malcolm und Micheal stellten sich an die offene Tür, als sie endlich ihre Bierkrüge in Händen hielten, damit ihnen nichts entging. John setzte sich abseits in den rückwärtigen Schankraum auf den einzig freien Stuhl. Er stieß einen Seufzer aus und nahm einen großen Schluck Bier. Ein langer Trommelwirbel lockte die Gäste schließlich schneller hinaus, als sie hereingekommen waren. John beobachtete das Geschehen über den Rand seines Kruges hinweg und entschied sich kurzerhand, einfach sitzen zu bleiben.
Bis auf ihn und zwei Frauen, die den Bierausschank zur Straße bedienten, war niemand mehr in der Gaststube, als sich mit einem Mal die Tür öffnete und zwei Lakaien in samtgrüner Livree eine prachtvoll gekleidete junge Frau stützten, um sie auf einen der freien Stühle zu bugsieren. John musste zweimal hinschauen. Trotz ihrer halb geschlossenen Lider erschien ihm die Unglückselige wie jene Göttin, die Paddy gemeint haben musste, als er sagte, es gebe keine Frau, die es wert sei, für sie zu sterben. Selbst wenn diese Frau so aussah, als wolle sie selbst sterben, war sie dennoch anziehend genug, dass es John jederzeit für sie getan hätte, wenn es notwendig gewesen wäre.
In ihrer Begleitung befand sich eine ältere, ganz in Grau gekleidete Dienerin. »Wir benötigen ein Bett oder ein Sofa!«, rief sie mit strenger Miene, während ihre Augen in Panik umherhuschten, auf der Suche nach einem Sofa. Doch weit und breit waren nur Stühle und Tische in Sicht, die keinerlei Bequemlichkeit boten.
»Wenn sie in ein Bett soll, muss sie jemand hinauf in die Kammer tragen«, krakeelte die dralle Meg hinter dem Ausschank und steckte sich rasch ein paar blonde Haarsträhnen unter die gestärkte Haube.
Halb bewusstlos und so bleich wie der feine Kapuzenmantel, den sie trug, sah die junge Frau aus, als wäre sie soeben dem Holyrood-Palace entsprungen. Ihre Dienerin nahm ihr den filigranen Strohhut ab, worauf ihre dunklen Locken wie ein seidiger Vorhang über ihr makelloses Antlitz fielen. Die Lakaien zuckten mit den Schultern, weil sie sich offenbar nicht in der Lage sahen, die Frau gemeinsam ein Stockwerk höher zu tragen.
John erhob sich. »Ich mache das«, sagte er und nahm die Bewusstlose in seine starken Arme. Sie war nicht besonders schwer, und selbst als er sie anhob, um mit ihr die schmalen Stiegen ins Obergeschoss hinaufzugehen, regte sie sich kaum.
Meg und die Dienerin waren vorangegangen und lotsten John in eine abgedunkelte Kammer, direkt neben der Treppe. Ihm stieg der süße Duft von Maiglöckchen und Rosen in die Nase, und er nahm noch einen tiefen Atemzug, bevor er seine kostbare Fracht beinahe andächtig in ein großes Bett sinken ließ. Meg öffnete das einzige Fenster und entzündete einen dreiflammigen Kandelaber. Die Dienerin zog ihrer Herrin die feinen Lederstiefelchen aus und brachte niedliche Füße in hellen Seidenstrümpfen zum Vorschein. Dann stützte sie den Rücken der Frau mit einem Wust von Kissen und fächerte ihr aus einem rasch geöffneten Kristallfläschchen Ammoniakdämpfe zu.
Fasziniert beobachtete John, wie die junge Frau langsam zu sich kam. Und obwohl er seinen Teil an der Rettungsaktion längst erfüllt hatte, konnte er seinen Blick weder von ihrem langen weichen Haar lösen, das schwarz wie Ebenholz über die Schultern fiel, noch von ihren dunkelblauen Augen, die unter langen braunen Wimpern dankbar und zugleich neugierig zu ihm aufschauten.
Die Lakaien hatten sich unterdessen auf Befehl der Dienerin ins Untergeschoss zurückgezogen, und auch Meg war nach unten gegangen, um für die Kranke einen Kräutertee zuzubereiten.
»Wie ist Euer Name?« Die Stimme der jungen Frau klang melodisch und hatte einen leichten Akzent, der John an seine Heimat erinnerte.
Er reagierte einen Moment zu spät und räusperte sich verlegen, bevor er zu sprechen begann.
»John«, sagte er und nahm rasch seinen Hut ab. »John Cameron.« Von draußen brandete das Grölen der Massen zu dem kleinen Fenster herein, und er sah, wie sich die feinen Gesichtszüge dieser außergewöhnlichen Schönheit verdunkelten.
Sie blinzelte einen Moment, und er konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie mit den Tränen kämpfte. John drehte sich um, ging zum Fenster und schaute hinaus. Die Hinrichtung hatte bereits ihren Lauf genommen, und die Zuschauer standen so dicht auf dem gesamten Horsemarket, dass kein Boden mehr zu sehen war. Stratton war nicht betrunken, wie man es von einem üblichen Delinquenten hätte annehmen können. Er stand stolz, mit kurzgeschorenem Haupt und gefesselten Händen, auf dem Podest und ließ mit unbewegter Miene die zahlreichen Anschuldigungen über sich ergehen.
John zögerte nicht länger und schloss die angelehnten Fensterläden. Die Stimmen wurden sofort leiser, und er wandte sich wieder der jungen Frau zu, indem er ein Stück auf sie zuging. Dabei zog er instinktiv den Kopf ein, um nicht an der niedrigen Zimmerdecke anzustoßen. Als er aufschaute, sah sie ihm ohne jegliche Scheu direkt in die Augen.
»Ich danke Euch.« Ihr Blick lag wohlwollend auf seinem Gesicht. Dann wandte sie sich an ihre Dienerin, die mit mürrischer Miene neben ihr stand.
»Ruth, geh hinaus und sage Ehrwürden, dass es mir besser geht und er sich keine Sorgen zu machen braucht.« Mit einer wedelnden Geste gab sie der Dienstmagd zu verstehen, dass sie das Zimmer verlassen sollte, während sie selbst immer noch sitzend im Bett residierte.
Nachdem die Dienerin hinausgegangen war, getraute John sich endlich, seinerseits eine Frage zu stellen. Dabei hielt er seinen Hut mit beiden Händen und knetete nervös die breite Krempe.
»Wollt Ihr so gütig sein und mir sagen, mit wem ich die Ehre habe, Mylady?«
»Wollt Ihr Euch nicht einen Moment lang zu mir setzen?« Ihre Mundwinkel hoben sich zu einem einladenden Lächeln. Er stand immer noch stocksteif vor ihrem Bett und fixierte ihre vollen Lippen, welche die gleiche Farbe hatten wie das granatrote Seidenkleid, das sie trug. Dessen tiefer Ausschnitt blitzte zwischen den offenen Mantelschließen hervor und zeigte unverhohlen einen Ausblick auf ihre appetitlichen Brüste.
Mit einer leichten Verlegenheit lenkte John seinen Blick auf ihre linke Hand, die von einem cremefarbenen Spitzenhandschuh verhüllt war und mit der sie auf den einzigen Stuhl gegenüber dem Bett deutete.
Schweigend folgte er ihrem Angebot, wobei er, kaum dass er saß, unter dem zum Rock gerafften Plaid, seine langen Beine ausstreckte, um es sich ein wenig bequemer zu machen.
»Ich bin mir fast sicher, dass wir uns schon einmal begegnet sind«, sprach sie weiter und warf ihm dabei einen eingehenden Blick zu.
»K… keine Ahnung«, stotterte John und gab sofort peinlich berührt seine entspannte Haltung auf, indem er sich gerade hinsetzte und die Knie anwinkelte. Fieberhaft überlegte er, wann und wo er ihr schon einmal über den Weg gelaufen sein konnte. »Ich entstamme einem Ort in der Nähe von Loch Lochy – Blàr mac Faoltaich«, erklärte er mit rauer Stimme. »Es ist ein ziemlich kleines Nest auf dem Gebiet der Camerons of Loch Iol. Ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Lady, wie Ihr es seid, schon einmal dort gewesen ist.«
»Dachte ich’s mir doch.« Ihr Lächeln bezeugte Genugtuung. »Tha mo chairdean ag radh Madlen rium – meine Freunde nennen mich Madlen«, erwiderte sie in fließendem Gälisch. Ihr Lächeln geriet etwas schief und wirkte dennoch verwegen. Es entblößte ihre makellosen Zähne, und sie erschien John damit noch begehrenswerter.
»Du bist Iain, jedenfalls nanntest du dich früher so, der älteste Sohn des alten Dhonnchaidh Camranach, einem Clansmann des jungen Eoghainn Camshrōn nan Loch Iol … stimmt’s?«
Wenn sie John hatte verblüffen wollen, so war ihr das gelungen. Die schöne Fremde wusste weit mehr über ihn als die meisten Menschen, mit denen er in dieser Stadt zu tun hatte. Dumm nur, dass er gar nichts über sie wusste.
»Und Ihr?« John entschied sich, zunächst bei einer höflich distanzierten Anrede zu bleiben. Immerhin war sie eine Lady und er nur ein einfacher Dockarbeiter. »Wo seid Ihr ursprünglich beheimatet?«
»Nicht weit davon entfernt. Glencoe. Meine Leute gehörten zum dort ansässigen Clan MacDhomhnaill.«
»Gehörten?« John sah sie prüfend an. Glencoe lag vom Haus seines Vaters nur ein paar Meilen entfernt. Eingehend betrachtete er ihre harmonischen Gesichtszüge, doch er konnte sich beim besten Willen nicht an dieses Mädchen erinnern. »Was ist mit ihnen geschehen?«
»Nichts.« Sie lächelte unfroh. »Es geht ihnen gut, soweit ich weiß. Mit der einen Ausnahme, dass ich das Ehrgefühl meines Vaters verletzt habe, indem ich mich weigerte, den Mann zu heiraten, den er für mich auserwählt hatte. Daraufhin glaubte er mich aus der Familie verstoßen zu müssen.«
John verwunderte ihre unvermittelte Offenheit. Sie machte es ihm leicht, nicht weniger offen zu sein. »Dann haben wir mehr gemeinsam als gedacht. Selbst wenn ich mich beim besten Willen nicht an Euer Gesicht erinnern kann. Auch ich habe mich gegen den Willen meines Vaters gestellt und musste meine Heimat verlassen.« Immer noch suchte er nach Spuren. Ihre blauen Augen und ihr dunkles, fast schwarzes Haar waren typisch für den Clan der MacDonalds, ganz gleich, welchem Zweig der Familie sie angehörten. Dazu das puppenhafte Gesicht und der porzellanfarbige Teint einer Adligen. Nein, bei allen Heiligen, die Begegnung mit einer solchen Frau wäre ihm gewiss nicht entgangen.
»Woher kommt es, dass ich mich so gar nicht an Euch erinnern kann?« John fühlte sich unwohl. Vielleicht wusste sie weit mehr über seine Vergangenheit, als ihm lieb sein konnte.
»Du darfst mich ruhig Madlen nennen«, erwiderte sie keck. »Soweit ich mich erinnern kann, waren unsere Väter geschäftlich verbunden. Es gab da einen großen schlaksigen Kerl mit zimtbraunen Haaren«, fuhr sie mit einem betörenden Augenaufschlag fort, »der eines Tages in Begleitung seines Vaters auf unserem Hof erschien. Dein Vater hat mit Vieh und Waffen gehandelt, und du bist mir sofort aufgefallen. Von dem Tag an, als ich dich das erste Mal gesehen habe, musste ich immer an dich denken. Bei unserem Hufschmied konnte ich in Erfahrung bringen, dass mein junges Herz für Duncan Camerons ältesten Sohn Iain entflammt war.« Sie schmunzelte leise. »Fortan habe ich jedem aufgelauert, der unser Anwesen besuchte, in der Hoffnung, dich endlich wiederzusehen. Aber du hast mich nie bemerkt, und ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Vielleicht lag es daran, dass ich als junges Mädchen ausgesprochen hässlich gewesen sein soll. Dürr, pickelig und mit einer Zahnlücke, die so groß war, dass man einen dicken Strohhalm dazwischenstecken konnte. Jedenfalls behaupteten das meine Brüder. Später erzählte man sich unter den Männern, du seist mit dem Marquess of Montrose in den Krieg gezogen. Ich erinnere mich, wie mein Vater prahlte, ihr hättet im August vierundvierzig die Armee der Covenanters unter Lord Elcho bei Tippermuir geschlagen.«
»Aye«, gab John zögernd zu. »Aber das ist lange vorbei, und Montrose ist keine gute Empfehlung mehr, wenn du verstehst, was ich meine. Er ist vor Monaten überstürzt ins Exil geflohen, erst nach Norwegen, und nun erzählt man sich, er sei in Frankreich gelandet. Außerdem war es für mich mehr ein Krieg gegen meinen eigenen Vater als gegen die Covenanters oder das englische Heer.« John versuchte abermals, ihr schönes Gesicht einzuordnen. Vergeblich. Vielleicht war es schon zu lange her, seit er das letzte Mal daheim gewesen war. Immerhin befand er sich schon mehr als fünf Jahre auf Wanderschaft, und sie war vielleicht gerade mal zwanzig.
John schüttelte verwundert den Kopf. Dann grinste er. »Ist es am Ende meine Schuld, dass du nicht den geheiratet hast, den du heiraten solltest?« Jetzt war er doch zu einer vertraulichen Anrede gewechselt, obwohl es ihm bei ihrem Anblick immer noch schwerfiel, zu glauben, dass sie sich in der Vergangenheit tatsächlich schon so nahe gekommen waren.
»Gut möglich.« Madlen zwinkerte schelmisch und schlug danach sittsam die Augen nieder.
Als sie aufschaute, erwiderte John ihren seltsamen Blick – lange genug, dass sie ihm mit einiger Verlegenheit auswich. Was immer ihre Brüder behauptet hatten: Von Hässlichkeit konnte bei ihr weiß Gott nicht die Rede sein. Und ganz gleich, wer sie war, ihm gefiel der Gedanke, so unvermittelt ein Stück Heimat gefunden zu haben.
»Liegt es an deiner Königstreue, dass du in eurer Familie auf die Nachfolge deines Vaters verzichtet hast?« Die Frage war ziemlich direkt und traf John unvorbereitet.
Er lenkte sein Augenmerk auf einen leeren Vogelkäfig, der am anderen Ende der Kammer auf einem weißen Schränkchen stand. »Das ist eine lange Geschichte«, erklärte er seufzend und schenkte Madlen erneut seine Aufmerksamkeit. »Mein Vater und ich, wir haben uns nicht so gut verstanden. Er hat mir nie verziehen, dass ich das katholische Erbe meiner verstorbenen Mutter angetreten habe. Sie war Irin und wäre niemals zu den Presbyterianern konvertiert. Nachdem ich mich entschlossen hatte, für Montrose und nicht für den Marquess of Argyll zu kämpfen, hat mein Vater meinem jüngeren Bruder den Vorzug gegeben und ihm das Erbe angetragen. Angeblich hatte ich der Familie großen Schaden zugefügt, indem ich mich gegen die Interessen unseres neuen Clanchiefs gestellt habe. Als ein treuer Gefolgsmann des jungen Loch Iol war mein Vater ein rückhaltloser Befürworter Argylls und der Covenanters. Es ist die Ironie dieses Krieges, dass Loch Iol zum guten Schluss mit Argyll gebrochen hat und selbst zu Montrose und den Interessen des Königs übergelaufen ist.« John schwieg für einen Moment, und auch Madlen erwiderte nichts, sondern schaute auf ihre Hände.
»Bei mir war es umgekehrt«, sagte sie leise. »Meine Mutter war eine Campbell. Mein Vater hat sie geraubt und gegen ihren Willen geschwängert. Danach musste sie ihn ehelichen, um ihre Ehre nicht ganz zu verlieren. Er zwang sie, mich und meine Brüder im katholischen Glauben zu erziehen. Was mich betraf, so hat sie sich ihm heimlich widersetzt und mich die presbyterianischen Glaubensgrundsätze gelehrt. Ich nehme an, sie hat meinem Vater niemals verziehen. Ohne ihren Einfluss hätte ich ihm kaum den Gehorsam verweigert.«
»Eine verrückte Welt, in die wir da hineingeboren wurden, nicht wahr?« John sah Madlen mitfühlend an.
Erst jetzt schaute sie auf, und John ahnte, dass sie wusste, wovon er sprach, weil es ihr nicht anders erging. Ihre Stimme war sanft und voller Anteilnahme, als sie erneut zu sprechen begann.
»Wie es scheint, konntest du deinem Vater nach allem, was geschehen ist, auch nicht verzeihen, habe ich recht?«
John stieß einen Seufzer aus. »Wer wem nicht verzeihen kann, haben wir noch nicht geklärt.«
»Ist das der einzige Grund, warum du bis heute nicht nach Hause zurückgekehrt bist?«
»Nicht ganz«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Ich möchte endlich ein normales Leben führen, falls das in diesen Tagen überhaupt möglich ist. Und in den Highlands würde ich niemals zur Ruhe kommen, weil es dort keine Ruhe gibt. Wenn du mich fragst, halte ich den schottischen Bürgerkrieg für einen hausgemachten Wahnsinn, da es nur einen Verlierer geben wird, nämlich das schottische Volk selbst, ganz gleich, welche Sprache es spricht.« Er schluckte seine schmerzvollen Erinnerungen an unzählige tote Kameraden und all die Not und das Elend hinunter, das ihn auf etlichen Feldzügen begleitet hatte, und räusperte sich. »Während wir die Schlachtfelder mit unserem edelsten Blut tränken, reiben sich die Engländer die Hände.« Er schwieg einen Moment und versuchte sich dann an einem aufmunternden Lächeln. »Ich gehe jetzt einer anständigen Arbeit nach, unten in Leith, in den Docks. Es geht mir gut, und ich komme auch ohne meine kriegslüsterne Familie zurecht.« Das stimmte zwar, aber für einen Menschen, der in einem kriegerischen Clan aufgewachsen war, in dem jedes einzelne Mitglied für den anderen die Verantwortung trug, war es nicht leicht, plötzlich ganz auf sich allein gestellt zu sein.
Einen Augenblick lang überlegte er, Madlen zu fragen, was sie nach ihrer Vertreibung aus Glencoe nach Edinburgh geführt hatte und welcher glückliche Umstand sie in die Lage versetzte, trotz des Krieges und der schlechten Wirtschaftslage ein augenscheinlich luxuriöses Leben zu führen. Mit Dienerinnen, Lakaien und einem Kleid, für das ein Mädchen in den Highlands mehr als ein Jahr arbeiten musste. Doch dann verwarf er seine Absicht, weil er befürchtete, dass sie genauso ungern über sich sprach wie er selbst.
»Und was verbindet uns sonst noch?« Madlen tat, als ob sie seine Unsicherheit nicht bemerkte.
»Wir verabscheuen Hinrichtungen.«
Ihr Blick streifte ihn, und auf einmal entdeckte er die Trauer darin.
»Kanntest du Stratton?« John konnte sich nicht vorstellen, warum eine so schöne und offenbar reiche Frau freiwillig an einer solch grausamen Veranstaltung teilnahm, schon gar nicht, wenn sie darunter litt.
Madlen schüttelte kaum merklich den Kopf. »Nein, ich kannte Stratton nur flüchtig. Wir sind uns ein paar Mal bei jenen Teenachmittagen begegnet, mit denen die Edinburgher Gesellschaft ihre Langeweile zu vertreiben sucht. Aber du hast recht. Ich verabscheue es grundsätzlich, wenn ein Mensch auf diese Weise sein Leben lassen muss.« Sie zögerte einen Moment, bevor sie John abermals eingehend musterte. Er spürte, wie ihre Blicke seine nackten Schienbeine bis zu den Knien hinaufwanderten und weiter über den groben Rock, der seine Oberschenkel bedeckte, bis ihre Aufmerksamkeit einen Wimpernschlag lang an dem breiten Ledergürtel haften blieb, den er um seine Taille trug. »Du siehst immer noch blendend aus«, bemerkte sie lächelnd. »Ein keltischer Krieger wie er im Buche steht. Ich kann kaum glauben, dass es dich nicht weniger graust als mich, einer Hinrichtung beizuwohnen. Ich dachte immer, Männer fürchten sich nicht vor dem Tod. Jedenfalls hat Rupert, mein älterer Bruder, das früher behauptet.«
»Und Männer mögen kein Zuckerzeug. Hat er das etwa vergessen?« John grinste breit. »Das ist eine ebensolche Lüge wie zu behaupten, dass ein Mann sich nicht vor dem Tod fürchtet. Zumindest, wenn er sein Hirn nicht versoffen hat.« Seine Stimme hatte einen spöttischen Tonfall angenommen.
»Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe drei Kriege erlebt, die Pest und das grausame Sterben eines kleinen Jungen, der mir sehr am Herzen lag. Seither hasse ich den Tod mehr als den Teufel.«
Er machte eine kleine Pause, und als Madlen nichts erwiderte, fuhr er fort: »Wenn du mich fragst, fürchten sich die Männer mehr vor dem Tod als die Frauen, die bekanntlich haufenweise im Kindbett sterben und sich trotz dieses Risikos nicht scheuen, den Männern zu Willen zu sein.«
»Und warum bist du dann hier, wenn du den Tod doch so sehr verachtest?«
»Der Stadtrat von Leith hat die Order gegeben, dass alle arbeitenden Männer und Frauen als Zeugen an dieser Hinrichtung teilnehmen. Unser Vorarbeiter hat uns eigens dafür freigegeben. Aber du hast mich mit deiner Ohnmacht von dem Übel erlöst, ohne es zu wissen.« Er lächelte zaghaft. »Noch ein wunderbarer Zufall. Findest du nicht?«
»Es gibt keine Zufälle, John. Das solltest du wissen, wo du doch wie ich aus den Highlands stammst.«
Vergeblich versuchte er ihrem Blick auszuweichen.
»Und was«, hob er vorsichtig an, »hat uns – deiner Meinung nach – hier zusammengeführt?«
»Vielleicht war es das Schicksal?« Madlen sah ihn herausfordernd an.
»Welches Schicksal?« Er hatte keinerlei Ahnung, worauf sie hinauswollte.
»Bist du verheiratet?«, fragte sie.
»Gott bewahre.« John grinste verhalten.
»Hast du nie daran gedacht, eine eigene Familie zu gründen, John?«
Was für eine Frage? John überlegte einen Moment, was er darauf antworten sollte.
»Nein, bei allen Heiligen.« Ein halbherziges Lächeln flog über sein Gesicht, dann zwinkerte er scherzhaft. »Obwohl ich schon Mitte zwanzig bin. Wenn es nach meiner verstorbenen Mutter ginge, wäre ich längst so weit. Aber die Zeiten sind schlecht, und ich wüsste beim besten Willen nicht, wie ich mit achtzehn Pfund Jahressalär und ohne eigenes Land eine Frau und sechs Kinder ernähren sollte. Nein, nein, es ist gut so, wie es ist.«
»Sechs Kinder? Warum müssten es gleich so viele sein?« Madlen lächelte wehmütig. »Fühlst du dich nicht trotzdem manchmal einsam, so ganz ohne einen Menschen, der dir das Bett wärmt und dem du vertraust?«
John schluckte, bevor er antwortete. »Warum willst du das wissen?«
»Weil ich mich nach einem guten Mann sehne und nach einer eigenen Familie und mir nicht vorstellen kann, dass es tief im Innern nicht jedem so ergeht.«
»Und? Steht jemand in Aussicht, der deine Sehnsucht erfüllt?« John bereute die Frage, bevor er sie ausgesprochen hatte, und ihre Antwort gab ihm recht.
»Bisher noch nicht«, erwiderte Madlen mit trauriger Miene. Der Ton in ihrer Stimme kam direkt aus dem Herzen, das konnte er hören.
John spürte plötzlich sein eigenes pochendes Herz und war ratlos, was Madlen mit ihrer Offenheit bezweckte. Vielleicht hieß es ja, dass er auf mehr hoffen durfte, als einem einfachen Arbeiter zustand. Doch da war immer noch der Stolz des unbesiegbaren Kriegers, den er selbst nach dem Verlassen der Armee nicht abgelegt hatte und der ihn davon abhielt, um die Hand einer Frau zu betteln, nur weil sie ihm passend erschien. Madlen wäre ohne Frage ganz nach seinem Geschmack gewesen, und sie allein für sich zu besitzen musste den Himmel auf Erden bedeuten. Doch seiner Erfahrung nach hatten die Frauen, die ihm gefielen, ihr Herz meist schon an bessere Partien vergeben. Erst recht, wenn sie wie Madlen unglaublich schön und augenscheinlich zu Wohlstand gekommen waren. John wusste, dass es nicht gut für ihn sein konnte, mit anderen Männern um die Gunst einer solchen Frau zu buhlen. Zumal wenn er ihr kaum mehr zu bieten hatte als seinen Schutz und seinen Körper.
»Nun ja«, gestand er beinahe flüsternd und wich dabei ihrem wachsamen Blick aus. »Tagsüber, wenn ich Baumwollballen und Fischkisten im Hafen schleppe, bemerke ich es nicht. Aber des Abends, wenn ich in meiner Koje liege und das Schnarchen meiner Kameraden mich wach hält, wünschte ich mir manchmal ein zuverlässiges Herz an meiner Seite, dem ich ganz und gar vertrauen kann und das mit einer einzigen Berührung all die Wunden zu heilen vermag, die einem das Leben tagtäglich schlägt.« Er hatte absichtlich ein wenig übertrieben und dabei poetisch klingen wollen. Doch wenn er ehrlich zu sich selbst war, wünschte er sich tatsächlich nichts sehnlicher als eine anständige Gefährtin, die das Leben mit ihm teilte, auf die er sich verlassen konnte und die nach einem zärtlichen Liebesspiel in seinen Armen einschlief.
»Ich würde dich gerne wiedersehen, John.« Madlens dunkle, große Augen und ihr sinnlicher Mund drückten eine solche Sehnsucht aus, dass es John ganz heiß wurde. Nicht nur im Herzen, sondern auch an jener Stelle zwischen seinen Schenkeln, die sich immer meldete, wenn er eine Frau zu sehr begehrte und sich heimlich vorstellte, wie es sein würde, mit ihr das Lager zu teilen. Er rief sich augenblicklich zur Ordnung und sorgte mit einer fahrigen Handbewegung für Ruhe in den unteren Gefilden seines Körpers. Danach räusperte er sich verlegen, bevor er erneut das Wort ergriff.
»Ich würde dich auch gern wiedersehen, Madlen. Aber wenn ich dich so anschaue, bin ich fast sicher, dass ich nicht der Einzige bin, mit dem du dich triffst. Habe ich recht?«
»Ich habe zwar einen Verehrer, doch ich lebe allein und bin ihm nur bedingt Rechenschaft schuldig«, gestand sie frei heraus. »Er muss nichts von uns wissen.« Ohne Johns Antwort abzuwarten, kramte sie in ihrem mit Spitzen besetzten Täschchen, dessen gedrehte Seidenschnüre sie bis dahin um ihr Handgelenk geschlungen hatte. Sie zog eine fein bedruckte Karte heraus und gab John einen Wink, näher zu kommen, damit sie ihm das kleine rechteckige Stück Büttenpapier überreichen konnte. Er erhob sich rasch von seinem Stuhl und machte einen verhaltenen Schritt nach vorn, nahe genug, dass er das kleine weiße Papier vorsichtig entgegennehmen konnte, ›Mistress Madlen Eleonore MacDonald‹ stand in schöner, geschwungener Schrift darauf. Darunter befand sich eine Adresse in einer der besten Wohngegenden Edinburghs, der unteren Canongate, unweit des Holyrood-Palace, dort, wo die Misteinsammler Überstunden machten und es anders als sonst in der Stadt bei Strafe verboten war, seine Scheiße direkt auf die Straße zu kippen.
»Morgen ist Sonntag. Vielleicht hast du am Nachmittag ein wenig Zeit und leistest mir in meinem Haus zum Fünf-Uhr-Tee Gesellschaft? Ich möchte mich gerne erkenntlich zeigen für das, was du für mich getan hast.«
John sah überrascht auf. Hatte er richtig gehört? Mit fassungsloser Miene hielt er die Karte in Händen. Dann machte er eine hilflose Handbewegung, bevor er den Beweis ihrer Zuneigung unbeholfen in seine traditionelle Felltasche stopfte, die er immer an seinem Gürtel trug. »Ich habe doch nichts getan, was nicht jeder andere anständige Mann auch getan hätte«, erwiderte er.
»Wenn du keinen Dank möchtest, könnten wir unser unverhofftes Wiedersehen feiern.«
Ihr Blick erschien ihm so bittend, dass er nicht zu widerstehen vermochte. »Wirst du kommen?«
Er nickte wie betäubt, aber bevor er etwas erwidern konnte, stürmte ein Mann in vornehmer schwarzer Kleidung mit einem schwarzen Hut und einem weißen Kragen die Treppe hinauf. Der Unbekannte war mindestens sechzig, vielleicht auch älter. Sein Gesicht unter der grauen, schulterlangen Lockenperücke erschien hager, aber nicht faltig. Geschmeidig wie ein Raubtier näherte er sich dem Bett, und nichts erinnerte dabei an die steifen und schmerzerfüllten Bewegungen gewöhnlicher Greise. Sein düsterer Blick wirkte stechend und wach. Kaum dass er John wahrgenommen hatte, zog er die scharf geschwungenen Brauen zusammen. Etwas Satanisches lag in seinem Gesichtsausdruck. John lief unvermittelt ein kalter Schauer über den Rücken.
»Darling?« Die Stimme des Mannes klang respektlos und besitzergreifend, als er sich Madlen mit herrischer Miene näherte. »Was in Gottes Namen tust du hier? Noch dazu in Gesellschaft eines Fremden?«
Ruth, die alte Dienerin, kam hinter dem Mann die Treppe hinaufgehetzt. »Es tut mir leid, Mylord«, rief sie atemlos und ging dabei unterwürfig in die Knie, den Kopf reumütig gebeugt. »Ich habe die Herrin nur einen Moment lang alleine gelassen, um Euch Bericht zu erstatten. Es ist nichts geschehen, was nicht hätte geschehen dürfen.«
Madlen überging den peinlichen Moment, indem sie ein bezauberndes Lächeln aufsetzte. »Ihr könnt ganz beruhigt sein, Chester. Ich befinde mich in bester Obhut.« Sie machte eine galante Geste mit ihrer Rechten in Johns Richtung, der unmerklich einen Schritt von ihrem Bett zurückgetreten war. »Darf ich Euch meinen Retter vorstellen? Das ist John Cameron. Wir kennen uns bereits seit Kindertagen«, erklärte sie mit aufgeregter Stimme, wobei sie für Johns Verständnis eindeutig schwindelte. Von kennen konnte wohl kaum die Rede sein. Offenbar nahm sie es im Übrigen mit der Wahrheit nicht so genau, denn auch ihre Aussage, dass sie vor niemandem Rechenschaft ablegen musste, stimmte anscheinend nicht. Wie sonst war es zu erklären, dass sie Johns Anwesenheit vor dem unvermittelten Besucher so hartnäckig zu rechtfertigen versuchte? Zudem war John aufgefallen, dass der merkwürdige Kerl offenbar von ihr eine unterwürfige Haltung verlangte.
»John war es, der mich in meiner Ohnmacht die Stufen zu diesem Zimmer hinaufgetragen hat«, berichtete sie atemlos weiter. »Ist das nicht eine wunderbare Fügung? Ich konnte ihn unmöglich gehen lassen, ohne ihm meinen ausdrücklichen Dank auszusprechen.«
Madlens Stimme war unnatürlich hoch, wie die eines aufgeregten Kindes, und ihre Augen flackerten unsicher, als ob sie den Mann besänftigen wollte. Ihr Gegenüber taxierte John mit zusammengekniffenen Lidern und einem nervösen Zucken in den Mundwinkeln.
»John«, fuhr sie atemlos fort, »das ist Lord Chester Cuninghame, mein persönlicher Beschützer und Gönner, ohne den ich in dieser entsetzlichen Stadt nicht bestehen könnte.«
John schwieg, obwohl er allergrößte Mühe hatte, nicht Nase und Mund aufzureißen, so sehr schockierte ihn diese Neuigkeit. Cuninghame – also war sie die Teufelshure, wie Paddy sie schmählich bezeichnet hatte, für die Stratton angeblich sein Leben ließ.
John verbeugte sich, wobei er seinen Hut wie ein Schutzschild vor die Brust hielt. Der Eisklumpen, den er augenblicklich in seinem Magen verspürte, ließ ihm gleichzeitig das Herz erkalten. Madlens Lächeln wirkte unterdessen gequält bei dem vergeblichen Versuch, Johns starre Miene zu erheitern.
»Ich werde dann wohl besser mal gehen«, erklärte er mit verhaltener Stimme. »Farewell, Mylady.« Er verbeugte sich galant in Madlens Richtung, ohne ihr jedoch in die Augen zu schauen. Dann wandte er sich an Cuninghame. »Mylord«, presste er mühsam hervor und zwang sich nochmals zu einer abgehackten, militärischen Verbeugung, bevor er sich hastig der Treppe zuwandte.
»A Iain! Feith rium!« Madlens Aufforderung zu warten knallte wie ein Peitschenhieb hinter ihm her. Widerwillig blieb er stehen und drehte sich langsam zu ihr um, wobei er geflissentlich dem Blick ihres Gönners auswich.
»Mylady?«
»Ich danke dir nochmals für deine Hilfsbereitschaft.« Ihr Lächeln wirkte trotz des unverkennbaren Liebreizes mit einem Mal gefroren – wie das eines Engels, der sich in ständiger Begleitung des Teufels befand.
»Keine Ursache.« John drehte sich um und stolperte die Treppe hinunter. Die Enttäuschung über Madlens wahre Verbindungen verursachte ihm eine plötzliche Übelkeit.
Draußen angekommen, schnappte er hastig nach Luft. Die Menschenmenge hatte sich aufgelöst. Nur ein paar Betrunkene torkelten noch herum und suchten offenbar Streit. Ansonsten hätte man getrost von einem prachtvollen Nachmittag sprechen können, wenn da nicht dieser lange wankende Schatten gewesen wäre, der das einfallende Sonnenlicht ungnädig störte.
Strattons Gestalt baumelte mit heraushängender Zunge am Balken, der Hals abgeknickt wie ein Gerstenstängel nach einem Hagelsturm. Dazu hatte ihm der Henker wie bei einem frisch erlegten Hirsch fachmännisch den Leib aufgebrochen. Bei näherer Betrachtung sah es ganz danach aus, als ob man Stratton das Herz entfernt hatte, während die restlichen Eingeweide grau und schwer über seine blutbesudelten Schenkel herabhingen. Der süßliche Geruch von rostigem Eisen und halbverdauten Exkrementen wehte zu John herüber und erinnerte ihn an geschlachtetes Vieh. Er spürte, wie sein Magen abermals rebellierte und wie sich unvermittelt ein Würgereiz einstellte, den er nur schwer zu unterdrücken vermochte. Gleichzeitig fragte er sich, warum man Stratton am Ende so grausam zugerichtet hatte.
Jemand schlug John auf die Schulter, so dass er zusammenzuckte.
Paddy grinste ihn mit seinem lückenhaften Gebiss an. »Mann, wo warst du die ganze Zeit? Oder hast du dir etwa vor Angst in die Hosen geschissen?« Das Lachen des Iren klang scheppernd.
»Ich war im Pub«, erklärte John mit heiserer Stimme und wies mit einem beiläufigen Nicken auf das White Hart Inn. »Hab der Wirtin geholfen.«
Paddy schüttelte ungläubig den Kopf. »Dann hast du wahrhaftig etwas verpasst, mein Junge. Nicht nur, dass es ewig gedauert hat, bis der Kerl tot war. Bevor Stratton der Strick angelegt wurde, hat er Cuninghame und seine Helfershelfer auf ewig als Hexer verflucht. Und allein der Teufel weiß, was er damit gemeint haben könnte.«
Plötzlich kam ein eisiger Wind auf. John zog fröstelnd sein Plaid um die Schultern. »Wo sind die Jungs?« Er blickte sich suchend nach Micheal und Malcolm um.
»Dort drüben«, antwortete Paddy und deutete auf ein paar junge Männer, die unter einer haushohen Linde standen und offenbar angeregt über die Geschehnisse des Nachmittags debattierten. Paddy schien verwundert darüber, dass John an weiteren Einzelheiten nicht interessiert war.
»Komm jetzt«, murmelte John. »Lass uns so rasch wie möglich verschwinden. Das hier ist kein Ort für aufrichtige Männer.«
2Edinburgh 1647 – »Seelenfänger«
Für einen Moment hatte Madlen gehofft, auf dem Weg vom White Hart Inn zu den Gespannen noch einmal auf John Cameron zu treffen, doch der Highlander schien wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Ebenso wie die blutgierige Meute von Schaulustigen, die sie zuvor auf dem Weg von der St. Giles Cathedral hoch oben in der Stadt bis hinunter zur Hinrichtungsstätte auf dem Horsemarket wie eine Herde dümmlicher Schafe begleitet hatte. Nur noch vereinzelt liefen ein paar Neugierige herum, die sich am Anblick von Strattons Leichnam ergötzten, vor dem ein Kommando der Stadtwache Position bezogen hatte, damit ihn niemand vorzeitig abhängen konnte.
Madlen beschlich das Gefühl, in einen Leichenwagen zu steigen, als sie mit Hilfe eines Lakaien in die rabenschwarze Kutsche ihres Gönners kletterte. Die beiden riesigen Rappen, die das Gefährt zogen, verstärkten die düstere Erscheinung der Karosse noch. Lord Chester Cuninghame nahm auf der anderen Seite der Sitzbank Platz, während Ruth, Madlens Dienerin, zusammen mit den Lakaien in einer weiteren Kutsche folgte. Flankiert von vier Leibwächtern zu Pferd, setzte sich der Tross in Bewegung.
Madlen hatte Strattons Leichnam aus den Augenwinkeln heraus an dem langen, hohen Balken baumeln sehen, doch sie hatte darauf verzichtet, ihn genauer zu betrachten, und deshalb traf es sie wie ein Schock, als sie aus dem Kutschenfenster hinausschaute und ihre Aufmerksamkeit eher zufällig auf sein lebloses Gesicht fiel. Es schien, als ob ihr Strattons gebrochene Augen einen unmissverständlich anklagenden Blick zuwarfen. Sollte sie sich schuldig fühlen? Nein, schließlich war nicht sie es gewesen, die ihn in ihr Bett gelockt hatte, sondern Chester Cuninghame – mit der schändlichen Absicht, ihr von Stratton ein Kind zeugen zu lassen, weil er selbst angeblich nicht dazu in der Lage war. Die Summe, mit der er diesen widerwärtigen Galan animiert hatte, ihr die Unschuld zu rauben, war so horrend gewesen, dass man davon der Stadt ein neues Armenhaus hätte spenden können. Dass Stratton letztendlich seine Übereinkunft mit Cuninghame nicht hatte einhalten können, hatte auch nicht an der mangelnden Entlohnung gelegen, sondern daran, dass seine Manneskraft im entscheidenden Moment versagt hatte. Daraufhin hatte er mit erschlafftem Glied vor Madlen gestanden und sie als Hexe beschimpft. Ihr panischer Blick trage Schuld daran, dass ihm sein Schwanz nicht gehorche. Doch das war des Übels nicht genug gewesen. Stratton hatte offensichtlich Nachforschungen betrieben, nachdem Cuninghame das Geld von ihm zurückgefordert hatte. Dabei war es dem hochnäsigen Lebemann anscheinend gelungen, ein Geheimnis zu lüften, das den schwarzen Lord, wie Cuninghame oft genannt wurde, arg in die Bredouille brachte. Danach hatte Stratton von Cuninghame eine noch höhere Summe gefordert, um sein Schweigen zu erkaufen. Was genau Stratton so sicher gemacht hatte, zu bekommen, was er wollte, wusste Madlen nicht – nur eins wusste sie genau: dass Cuninghame nicht mit sich spaßen ließ.
»Du hast etwas verpasst, meine Teuerste.« Cuninghames Stimme war so düster wie seine Kleidung und drückte seine Genugtuung über Strattons grausamen Tod aus. Der windige Sohn einer verarmten Aristokratenfamilie hatte ihn zu hintergehen versucht, etwas, das er, der allseits geschätzte Lord Chester Cuninghame of Berwick upon Tweed, auf keinen Fall zulassen durfte. Zumal Stratton sein Vertrauen schändlich missbraucht hatte. Niemals wieder würde er einen Außenstehenden einer geheimen, alchimistischen Verwandlung unterziehen und ihn anschließend laufen lassen, ohne das Initiationsritual »Caput mortuum« vollendet zu haben. Nur wenn der Adept in einer Art hypnotischen Umwandlung Geist und Seele dem allumfassenden Meister Mercurius verschrieben hatte, befand er sich unter der Kontrolle der Bruderschaft. Ein unerlässlicher Umstand, weil nur so sichergestellt werden konnte, dass sich der Betroffene der Bruderschaft gegenüber loyal verhielt und eisern über seine Erlebnisse während der Umwandlung und über seine neu erworbenen Fähigkeiten schwieg. Bei Stratton hatte Cuninghame leider versäumt, aufs Ganze zu gehen, weil der Adlige Madlen ein Kind zeugen sollte. Cuninghames eigene leidvolle Erfahrung, dass eine vollständige Initiation in den meisten Fällen zur Impotenz führte, hatte den Ausschlag gegeben, bei Stratton darauf zu verzichten. Warum Stratton auch ohne das »Caput mortuum« bei Madlen versagt hatte, war nun nicht mehr herauszufinden. Zur Sicherheit hat Cuninghame dafür gesorgt, dass der Henker Stratton nach dem Hängen das Herz herausschnitt. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Keinesfalls durfte er riskieren, dass Stratton von den Toten wiederauferstand – was wegen des Ritus durchaus möglich gewesen wäre, solange man ihm nicht den Kopf oder das Herz entfernte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: