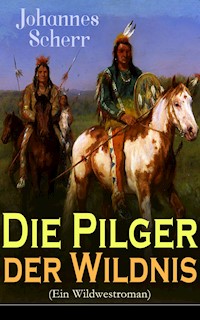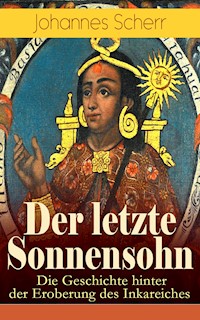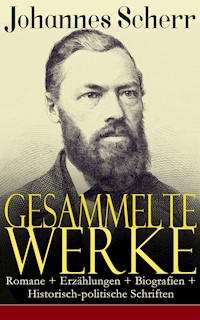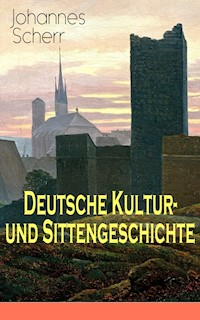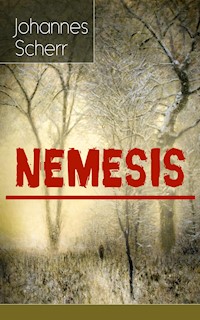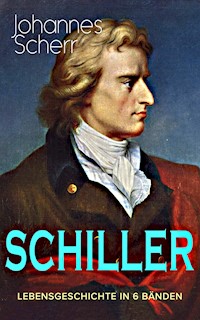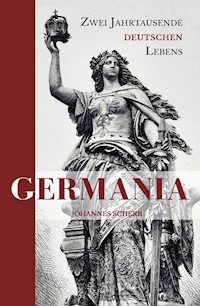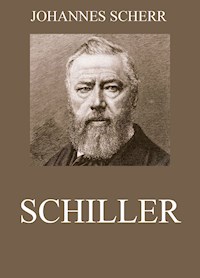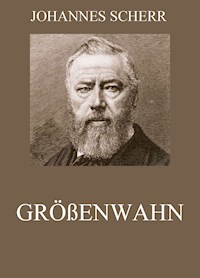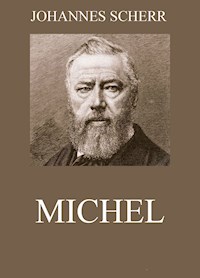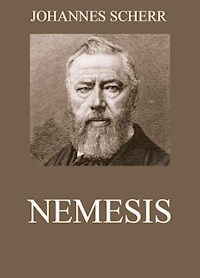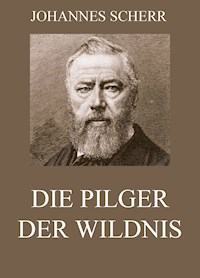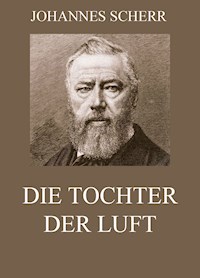
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman, der bereits während Scherrs Exil in der Schweiz entstanden ist. Scherr war einer der vielseitigsten Kenner der Literatur- und Kulturgeschichte und ein sprachgewandter und geistvoller Schriftsteller, dessen Leben und Wirken in gleichem Maße der Schweiz wie Deutschland angehörte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Tochter der Luft
Johannes Scherr
Inhalt:
Johannes Scherr – Biografie und Bibliografie
Die Tochter der Luft
Erstes Buch. Ort, Zeit und Personen der Handlung.
1. »O, wie ist es schön und lieblich, wenn Brüder einträchtiglich mitsammen wohnen!«
2. Mit wehendem Schleier.
3. Goldforellenwirts Goldforelle.
4. Herr Gleichsam.
5. Eine milde Kritikerin und ein scharfer Kritiker.
Zweites Buch. Eva.
1. Im verwunschenen Schloß.
2. Typen und Kontraste unserer Tage.
3. »Ich weiß, wo einsam einer ruht.«
4. Eva erzählt.
5. La Madrilena.
Drittes Buch. Die Liebessignale.
1. Der alte Brosi wird »fuchsteufelswild«.
2. Von Mägen, Dichtern und Weibern.
3. Und hast du in der Liebe Glück, So rat' ich: schweig fein still!
4. Nacht und Morgen.
5. O, wecke die Dämonen nicht Auf Frauenherzens Grund!
Viertes Buch. Die Katastrophe.
1. Unerhört romantisches Abenteuer, welches nachtschlafender Weile zwei berühmten Dichtern im Schwarzwalde zugestoßen.
2. Ein Stück Bauernadel.
3. »Ich sag', das ging nicht mit rechten Dingen zu.«
4. Schuldig oder Nichtschuldig?
5. In die weite Welt und in die Brautkammer.
Schlußkapitelchen, worin die Moral des Stückes brieflich angedeutet wird und Autor einem werten Publico sich empfiehlt.
Die Tochter der Luft, J. Scherr
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849634919
www.jazzybee-verlag.de
Johannes Scherr – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 3. Okt. 1817 in Hohenrechberg bei Schwäbisch-Gmünd, gest. 21. Nov. 1886 in Zürich, besuchte das Gymnasium in Gmünd und die Universitäten in Zürich und Tübingen, wirkte dann eine Zeitlang als Lehrer und ließ sich 1843 in Stuttgart nieder. wo er 1844 mit der Schrift »Württemberg im Jahr 1844« den politischen Kampfplatz betrat, auf dem er sich in den nächsten Jahren als Vorkämpfer aller freiheitlichen Bestrebungen hervortat. 1848 wurde er in die württembergische Abgeordnetenkammer und in den Landesausschuß gewählt und stand während der Revolutionszeit an der Spitze der demokratischen Partei, weshalb er nach Auflösung der Kammer 1849 nach der Schweiz flüchtete. Er ließ sich zunächst in Winterthur nieder, wo er längere Zeit schriftstellerisch tätig lebte, bis er 1860 als Professor der Geschichte und Literatur an das eidgenössische Polytechnikum in Zürich berufen wurde. Außer einer Reihe von Romanen und Erzählungen (darunter: »Schiller«, Leipz. 1856; 3. Aufl. 1902, 2 Bde.; »Michel. Geschichte eines Deutschen unserer Zeit«, Prag 1858, 4 Bde.; 10. Aufl., Leipz. 1905, 2 Bde.; »Rosi Zurflüh«, Prag 1860; »Die Gekreuzigte«, St. Gallen 1860; 2. Aufl., Leipz. 1874) sowie einigen humoristischen Schriften veröffentlichte er: »Bildersaal der Weltliteratur« (Stuttg. 1848; 3. Aufl. 1884, 3 Bde.), woraus im Sonderdruck der »Bildersaal der deutschen Literatur« (1887) erschien; »Deutsche Kultur- und Sittengeschichte« (Leipz. 1852–53, 11. Aufl. 1902); »Allgemeine Geschichte der Literatur« (Stuttg. 1851; 10. Aufl. als »Illustrierte Geschichte der Weltliteratur«, das. 1900, 2 Bde.); »Geschichte der deutschen Literatur« (2. Aufl., Leipz. 1854); »Geschichte der englischen Literatur« (das. 1854, 3. Aufl. 1883); »Geschichte der Religion« (das. 1855 bis 1857, 2 Bde.; 2. Aufl. 1859); »Dichterkönige« (das. 1855; 2. Aufl. 1861, 2 Bde.); »Geschichte der deutschen Frauenwelt« (das. 1860; 5. Aufl. in 2 Bdn. 1898); »Schiller und seine Zeit« (illustrierte Quartausgabe, das. 1859, 3. Aufl. 1902; Volksausgabe, 4. Aufl. 1865); »Drei Hofgeschichten« (das. 1861, 3. Aufl. 1875); »Farrago« (das. 1870); »Dämonen« (das. 1871, 2. Aufl. 1878); »Blücher, seine Zeit und sein Leben« (das. 1862–63, 3 Bde.; 4. Aufl. 1887); »Studien« (das. 1865–66, 3 Bde.); »Achtundvierzig bis Einundfünfzig« (das. 1868–70, 2 Bde.; 2. Aufl. u. d. T.: »1848, ein weltgeschichtliches Drama«, das. 1875); »Aus der Sündflutzeit« (das. 1867); »Das Trauerspiel in Mexiko« (das. 1868); »Hammerschläge und Historien« (Zürich 1872, 3. Aufl. 1878; neue Folge 1878); »Sommertagebuch des weiland Dr. gastrosophiae Jeremia Sauerampfer« (das. 1873); »Goethes Jugend« (Leipz. 1874); »Menschliche Tragikomödie«, gesammelte Studien und Bilder (das. 1874, 3 Bde.; 3. Aufl. 1884, 12 Bde.); »Blätter im Winde« (das. 1875); »Größenwahn, vier Kapitel aus der Geschichte menschlicher Narrheit« (das. 1876); das Prachtwerk »Germania. Zwei Jahrtausende deutschen Lebens kulturgeschichtlich geschildert« (Stuttg. 1876–78, 6. Aufl. von H. Prutz, 1905); »1870–71. Vier Bücher deutscher Geschichte« (Leipz. 1878, 2 Bde.; 2. Aufl. 1880); »Das rote Quartal« (das. 1882); »Vom Zürichberg«, Skizzen (das. 1881); »Porkeles und Porkelessa« (Stuttg. 1882, 3. Aufl. 1886); »Haidekraut«, neues Skizzenbuch (Teschen 1883); »Neues Historienbuch« (Leipz. 1884); »Gestalten und Geschichten« (Stuttg. 1885); »Die Nihilisten« (u. Aufl., Leipz. 1885); »Letzte Gänge« (Stuttg. 1887). S. war ein vorzugsweise der eigentümlichen darstellenden und räsonierenden Weise Th. Carlyles nachgearteter Schriftsteller, von blitzender Lebendigkeit, begeistert oder maßlos in seinen Abneigungen, von schneidiger Schärfe und gelegentlich körnigster Grobheit, in seinen letztern Schriften jedoch allzusehr der Kopist seiner eignen Manier. Ein Teil seiner Erzählungen erschien gesammelt als »Novellenbuch« (Leipz. 1873–77, 10 Bde.).
Die Tochter der Luft
Erstes Buch. Ort, Zeit und Personen der Handlung.
Servus Ostiarius: Guten Morgen Herr! Wünsche, wohl geruht zu haben, Herr! Und da draußen, Herr, steht ein Schock Personen, Herren und aufwarten möchten.
Dominus Publicus: Nur herein mit ihnen! Vielleicht sind Leute darunter, die das Zeug dazu haben, mir für ein Stündchen die Langeweile zu vertreiben.
Verschollenes Stück.
1. »O, wie ist es schön und lieblich, wenn Brüder einträchtiglich mitsammen wohnen!«
»Gottlob! es gibt auf deutscher Erde noch Berghalden, welche nicht von dem eintönigen Gerassel der Lokomotive widerhallen. Es gibt noch Talgelände, in welchen geldgierige Spekulation der Natur nicht auf Schritt und Tritt Gewalt antut. Es gibt noch heimliche Waldgründe, wo die alten Eichen rauschen und die Rehmutter ihr Junges äsen lehrt. Herrgott, wie schnürt es die Brust zusammen, wenn einem da drunten im Flachland bei jeder Ecke, um die man biegt, eine Dampfmaschine in die Ohren keucht. Mechanik und nichts als Mechanik! Die menschliche Gesellschaft auf dem Weg, ein kolossaler Automat zu werden, ein Automat, der sich von den in Wachsfigurenkabinetten gezeigten nur dadurch unterscheidet, daß er ißt und verdaut. Und dieser Pöbel von Fabriksklaven, die Signatur des Hungers, der Knechtschaft und der sittlichen Versunkenheit auf der Stirne; diese Haufen skrophulöser Kinder, welchen man ansieht, daß ihre Eltern von Jugend auf keine andere Luft als die verpestete der Baumwollspinnereien eingeatmet. O, wie bin ich sie satt, eure gerühmte moderne Zivilisation, eure heuchlerische Barbarei, eure uniformierte Langeweile! Da oben spürt man doch einmal wieder, daß man ein mit Gefühl, Vernunft und Willen begabtes Wesen ist und nicht bloß ein mehr oder weniger miserables Stiftchen oder Rädchen in der großen dummen Maschine, welche sie die Gesellschaft nennen. Tu auf deine Hallen, grüner Wald, damit ich in dir gesunde Luft atme und unter Buchenschatten all den Jammer der Zeit vergesse. Empfangt mich freundlich, wie in den Tagen der Jugend, all ihr Berge und Täler mit euren malerisch geschwungenen Linien, euren Felsgruppen, euren klaren Erlenbächen, worin es hoffentlich noch immer so köstliche Forellen gibt wie früher. O sieh, wie prächtig die Morgensonne über dunkeln Waldkuppen heraufkommt und dort unten im Tal den Fluß aufblitzen macht! Wie ist das alles so schön, so keusch, so morgenfrisch und waldeinsamlich! Sei mir gegrüßt, mein geliebter Schwarzwald, viel tausendmal gegrüßt, und Gruß auch dir, Romantik!
Ja, dir, Verstoßne durch Verblendung – Wie bist du reich trotz Zeit und Zorn! Du leerst in göttlicher Verschwendung Tagtäglich noch dein Wunderhorn. Ich grüße dich mit frommem Sinne, Wie ist dein Reich so grün und weit, Du Fürstin vielgetreuer Minne, Sei tausendmal gebenedeit!«
Der so sprach, ritt auf einem guten Rosse dem Morgenwind eines Frühjahrstages von 1854 entgegen und war selbstverständlich ein noch junger Mann, denn wie hätte er sonst so romantisch sich äußern können? Allein so ganz jung war er doch wohl nicht mehr, denn die kritische Reflexion schlug ihm sogleich in den Nacken.
Auf den Enthusiasmus folgte die Abkühlung der Selbstpersiflage.
»Bei allen Göttern,« rief der Reiter laut auflachend aus, »ich bilde mir ein, noch der Fuchs zu sein, welcher mit einem Band von des Knaben Wunderhorn in der Tasche und der schwarzrotgoldenen Schleife an der Uhr durch diese Berge und Wälder strich. Tut mir's der alte Schwarzwald an oder war ich wirklich im Grunde meines Herzens immer ein Romantiker? Fast möcht' ich's glauben, denn wenn mir die alten romantischen Weisen durch den Kopf summen, wandeln mich stets die alten Schnurren von Tieckscher Waldeinsamkeit und Kernerschem Heimweh und all dergleichen Zeug an, welches ein anständiger Mensch meines Alters doch langst verwunden haben sollte. 's ist auch eitel Phantasie und Einbildung! Die bewußte Romantik ist lächerlich, unendlich lächerlich, und zur naiven, ach, zur naiven gehört die blanke, blöde Jugendeselei, welche, ausgerüstet mit einer himmelblaubebänderten Gitarre, dem nächsten besten Backfisch ein schüchternes Ständchen bringt, einem Backfisch, welcher inzwischen mit Abfassung eines Liebesbriefes an den nächsten besten Leutnant beschäftigt ist. Schäme dich, Ottmar Horst, Dr. j. u. und ziemlich beschäftigter Rechtskonsulent, schäme dich gründlich! Du hast zwar nicht die gehörige Anlage zu dem, was ein leidlicher Mensch heutzutage von Rechts und Staats wegen sein soll, zu einem Philister nämlich, aber die romantischen Hörner könntest du dir meines Erachtens füglich allgemach abgelaufen haben. Dein Stubennachbar auf der Festung, der gute Wate im Bart, pflegte zwar zu sagen, er kalkuliere, du würdest ein Narr bleiben dein Leben lang, allein es ist weltbekannt, daß der alte Wate ein Mensch ohne psychologischen Blick und ein pessimistischer Brummbär war, ist und sein wird. Bei alledem jedoch ist etwas an den alten romantischen Schnurren. Könnt' ich nur herauskriegen, was! Wate meinte zwar, die Romantik sei nichts als verhockte und verstockte Säfte, aber er hatte gar kein Organ für Poesie. Im übrigen möcht' ich wissen, wo der gute Junge hingekommen. Vielleicht ist er irgendwo hier herum untergekrochen: er ist ja auch ein Schwarzwälder Kind, freilich keins aus Auerbachs Dorfgeschichten. Es war meiner Treu ein erhabener Moment, als er am Tage vor unserer Entlassung aus der verhenkerten Festung mit Pathos unter uns trat, sprechend: ›Hört, liebe Jungen und Festungskollegen, ich will euch zum Abschied eine große Wahrheit sagen und die lautet so: Der Dümmste von euch allen war ich, denn ihr andern ranntet in hellem Unverstand in euer Unglück, ich aber wußte mit mathematischer Gewißheit, daß die ganze Komödie so jämmerlich enden würde, und dennoch hab' ich sie mitgemacht, woraus ihr die Moral ziehen könnt, daß eine Gesellschaft von Narren auch einen Klugen zum Toren macht.‹ Doch fort mit all den Erinnerungen an jenen nichtswürdigen Ort, wo zahllose Freischaren von Wanzen dem Prinzip der Ruhe und Ordnung Hohn sprachen! Fort damit, die Welt ist so schön, und den Frühling kann doch niemand verbieten oder konfiszieren!«
Der junge Mann – sofern das Wort jung in unserer Zeit noch auf eine Person paßt, die dem dreißigsten Jahr nahe stand oder gar dasselbe schon hinter sich hatte – der junge Mann, dessen Selbstgespräch wir belauschten, war mit Tagesanbruch von Trausig, wo er übernachtet hatte, weggeritten und hatte, statt der ins Forgtal hinüberführenden Straße zu folgen, den über die Höhen des Pfaffenwaldes ziehenden Fußweg eingeschlagen, auf welchem, wie er aus früherer Zeit her wußte, auch ein Reiter ziemlich leidlich fortkommen konnte. Der stattliche Braune, auf dem er leicht und sicher saß, hatte tüchtig ausgegriffen und trug jetzt seinen Reiter rasch über das Plateau hin, welches, gegen Norden und Westen von Hochwaldkuppen überbaut, von Osten gegen Süden zu in einen scharfen Winkel ausläuft. Dieser fällt mit jähem Absturz in die Tiefe, und da, wo sein granitener Fuß die Talsohle berührt, mündet der Trausigbach in die stolzrauschende Forg, welche sodann, einen gewaltigen Bogen beschreibend, südwestwärts in ein krausverschlungenes Talgewinde hineintritt, um von dort ihren Lauf hinauszurichten in das Flachland, dem alten Rhein zu.
Steht man auf der Höhe des Absturzes unter den drei uralten kolossalen Rüstern, welche dieselbe krönen, so genießt man nach drei Seiten hin einer prächtigen Aussicht. Geradeaus schweift der Blick über die mählich in die Niederung sich verlierenden Hügelketten weg, welche die südwestliche Vormauer des Waldgebirges bilden, und verliert sich in der in weiter Ferne blauenden Ebene des Elsasses, aus welcher die Nadel des Straßburger Münsterturms hervorragt. Rechter Hand in der Tiefe drunten stürzt der Trausigbach mit allem Ungestüm eines Hochwaldwassers aus einem engen Tal hervor, und unweit der Stelle, wo er in der stillen und breiter dahergleitenden Forg verschwindet, liegen an seinem rechten Ufer die weithin zerstreuten Häusergruppen des großen Dorfes Moosbrunn, mit seiner altertümlichen Kirche und dem stattlichen Pfarrhaus. Linker Hand weitet sich das Forgtal ostwärts hinauf, durchschritten von dem Fluß, dessen Lauf die menschliche Betriebsamkeit um der Holzflößung willen einigermaßen geregelt hat. Weiter aufwärts sind seine Wasser auch den Hochöfen und Hüttenwerken dienstbar, deren schwarze Schlote da und dort sich erheben. Etwa eine Wegstunde von Moosbrunn entfernt liegt am linken Ufer der Forg das Dorf Forgau, von dessen Gassen eine bedachte Holzbrücke nach der andern Seite des Flusses hinüberführt. Von der Straße, welche dort am Wasser hinausläuft, biegt ein Fahrweg in die Einfahrt eines stattlichen Gehöftes aus, welches, von einem Obstbaumwald im Rücken und auf den Seiten eingefaßt, wohlig auf die Berghalde hingebettet ist. Der Ort heißt »Im Buhl« und das Haus ist das Wirtshaus »Zur Goldforelle«, im ganzen Gebirge wohlbekannt und wohlberufen. Verfolgt von da das Auge die Straße flußaufwärts, so wird es durch eine lange Allee von Pappeln zu einem mächtigen, betürmten Bauwerk geleitet, dessen ganze Erscheinung noch jetzt es berechtigt, eine Burg zu heißen, die sich hinter einem von der Forg gespeisten Graben mittelalterlich finster und drohend genug erhebt. Es ist Bernwartshall, der Sitz des alten Geschlechts der Grafen von Bernwart. Einen starken Kontrast mit diesem düsteren Feudalhaus bildet ein im kokettesten Zopfstil erbautes Schloß, welches auf der andern Seite der Forg, Bernwartshall fast in gerader Linie gegenüber und nur einen Kanonenschuß davon entfernt, inmitten eines weiten Parkes steht, Eigentum des freiherrlichen Geschlechtes derer von Moosbrunn. Lenkt man den Blick endlich von diesem Herrenhaus ab und den Bergen zu, welche hinter dem Park schroff ansteigen, so bemerkt man auf einer der vorspringenden Felsklippen des Bärenkopfs in schwindelnder Höhe das sogenannte Bärenschlößchen, das mehr als zur Hälfte in Trümmern liegt, aber noch vor kurzem von einem Förster der Grafen von Bernwart bewohnt war.
Im ganzen und großen trägt die Gegend einen alpenhaften Charakter. Zwar das eigentliche Hochgebirge, die Schnee- und Eiskolosse, die ungeheuren Basaltpyramiden und Gletscher der Schweiz und Tirols fehlen ihr, aber zu etwelchem Ersatz für diese Größe und Majestät hat sie etwas außerordentlich Malerisches, Anmutiges, Deutschheimeliges. Die weit auseinander liegenden Häusergruppen der Dörfer und die Bauart der überall an den Berghängen zerstreuten Höfe und Hütten erinnern stark an die Idyllik der schweizerischen Bergkantone.
Ottmar Horst hatte sein Pferd der Franzosenschanze zugelenkt. So hieß die Stelle unter den drei Rüstern, denn es hatten hier in den Revolutionskriegen die Franzosen eine Schanze aufgeworfen, deren Umrisse noch jetzt deutlich zu sehen sind. Der junge Mann stieg ab, band sein Pferd fest und schaute lange und unverwandt hinaus und hinab auf Berg und Tal.
Es war gar schön da draußen und da drunten. Die Frühlingssonne lag golden auf den Bergkuppen, im jungen Grün der Wälder spielend, die Wasser rauschten klingend von den Hohen und die Täler entlang spannten Tausende von Obstbäumen eine ungeheure Blütengirlande.
Hingerissen von dem Zauber der Stunde, brach Ottmar in die Worte aus, womit der arme Hölderlin dereinst seine Rückkehr in die Heimat gefeiert hatte:
»Ihr milden Lüfte, Boten Italiens, Und du mit deinen Pappeln, geliebter Strom! Ihr wogenden Gebirg', o all ihr Sonnigen Gipfel, so seid ihr's wieder.«
Das Heimatgefühl überkam ihn, ein aus Freude und Wehmut seltsam gemischtes Gefühl. Er hatte den Ort lange nicht mehr gesehen, der seine Heimat war und doch auch wieder nicht war, weil außer den Banden der Erinnerung keine andern mehr ihn mit demselben verknüpften. Er hatte hier nichts mehr zu suchen, es führte ihn auch nicht etwa ein sentimentaler Zug her, sondern er kam auf dem Geschäftsweg und in recht prosaisch advokatischen Absichten. Und doch pochte ihm jetzt laut das Herz beim Anblick der Fluren, wo er als Knabe gespielt und als Jüngling geschwärmt. Er wähnte einen Augenblick um mindestens zehn Jahre jünger geworden zu sein und vergessen zu können, daß er als Fremdling die Heimat wiedersah.
Die Phantasie, des Menschen beste Freundin, wird nie müde, ihn mit Selbsttäuschungen zu umweben, allein die Wirklichkeit ist rasch genug bei der Hand, das bunte Gewebe wieder zu zerreißen.
Ottmar hatte sich auf einen Steinbock niedergelassen, welcher am Fuße der verfallenen Schanze lag. Er heftete seine Blicke auf den Moosbrunner Friedhof, dessen schwarze Kreuze im Morgensonnenschein deutlich wahrnehmbar waren. Eine Wolke der Trauer überflog die männliche, scharfmarkierte und intelligente Physiognomie des jungen Mannes. Dort unter den niedrigen Grabhügeln waren auch die seiner Eltern. Dort in der Kirche hatte sein Vater gepredigt, der milde, liebreiche Pfarrherr von Moosbrunn, welcher den Verlust der trefflichen Gattin nicht lange zu überleben vermocht.
»Es war eine schwere Stunde, als wir sie begruben,« sagte Ottmar leise vor sich hin. »Ich hab', es dem Vater wohl angesehen, daß er diesen Schlag nicht verwinden würde. O, wie war sie gut und klug und vollkommen! Gewiß, es ist nur kindliche Pietät, wenn ich glaube, daß es eine zweite Frau und Mutter, wie sie war, nicht mehr gibt. Der Vater mußte ihr nachsterben, denn er hatte sie geliebt, wie sie es verdiente. Meinte doch auch ich verzweifeln zu müssen, als die Gute nun so starr und stumm vor mir dalag. Und doch war es gut, daß sie starb, bevor ich ihr so großen Kummer verursachte. Was hätte die fromme Frau leiden müssen, wenn sie erfahren, daß ihr Ottmar mit Steckbriefen verfolgt und verwundet von einem unglückseligen Schlachtfeld weg in den Kerker gebracht wurde, um als ein Verbrecher verurteilt und eingetürmt zu werden, weil er – doch gleichviel. Ihr hätte es das Herz gebrochen, und das blieb ihr erspart, wie mir der qualvolle Vorwurf, sie bis zum Tode betrübt zu haben. Ja, es ist gut so, wie es ist. Seltsam nur, daß mir beim Anblick der altbekannten Stätten zumute wird, als müßte ich dieselben nie mehr verlassen, als müßte ich in der Heimat, die mir schon halb und halb eine verschollene war, eine neue Heimat suchen und finden, um da zu leben und zu sterben. Wie doch der Frühling die Menschen wunderlich stimmt und aufregt! Wahre dich vor Phantasmen, mein guter Ottmar Horst. Es wird, meine ich, rätlich sein, daß du das Geschäft, welches dich herführt, möglichst rasch abtuest, maßen du sonst leicht Gefahr laufen könntest, in Ahnungen, Sentimentalitäten und anderen dergleichen romantischen Schnickschnack zurückzufallen, aus welchem dich herauszuarbeiten du dir erklecklichste Mühe gegeben hast.«
So weit war Ottmar in seinem Monolog gekommen, als seine Aufmerksamkeit durch eine Erscheinung im Tale drunten in Anspruch genommen wurde. Aus der erwähnten Pappelallee hervor kam ein Reiterzug, an dessen Spitze eine Dame ritt, und sprengte am Ufer der Forg herab, unten am Bühl vorbei, auf die Forgauer Brücke zu. Über diese reitend, verschwand er für einige Augenblicke hinter den Holzhäusern von Forgau, brach dann wieder aus den Gassen des Dorfes hervor, kreuzte das Blachfeld auf dem rechten Ufer des Flusses und bog in eine der Schluchten ein, in welche das Plateau des Pfaffenwaldes talwärts ausläuft.
Die Sonne schien so hell durch die klare Luft, daß der junge Mann von der Franzosenschanze aus die Bewegungen des Reiterzuges deutlich wahrnehmen konnte. Indem er aber den Bewegungen desselben mit dem Interesse der Neugierde folgte und zu diesem Zwecke mehr an den Rand des Absturzes vortrat, fielen seine Blicke seitwärts auf einen schwarzgekleideten Mann, welcher langsam auf die Schanze zukam, oft stehen blieb und mit einem vor die Augen gehaltenen Fernglas angelegentlich in das Tal hinunterspähte. Er verfolgte augenscheinlich gleichfalls die Richtung der Kavalkade, denn als diese in der Schlucht am Fuße des Plateaus verschwunden war, schob er sein Fernglas zusammen, steckte es in die Tasche und ging auf den Platz unter den drei Rüstern zu, in tiefen Gedanken, wie es schien, denn er bemerkte die Anwesenheit Ottmars erst, als das Pferd desselben bei Annäherung des Fremden eine rasche Bewegung machte.
Jetzt stand er still, warf den Kopf zurück und zeigte Ottmar das wohlgenährte, blühende Gesicht eines Mannes, welcher etwa zehn Jahre älter sein mochte als er selber. Es war eine Physiognomie, welcher man das Prädikat priesterlicher Klugheit, um nicht zu sagen, priesterlicher Schlauheit zu geben versucht war. Dieses Gesicht mit seinen hinter einer Brille versteckten wasserblauen Augen, dem sinnlichen Mund und der etwas zurückspringenden Stirne deutete, zusammengehalten mit einem gewissen theologischen Habitus der ganzen Gestalt, auf einen Charakter, der sich, je nach den Umständen, in Welt und Menschen zu schicken wußte oder aber beide seinen Leidenschaften dienstbar zu machen willens war.
Ein halbunterdrückter Ausruf kam über die Lippen Ottmars, und er machte eine Bewegung, als wollte er sich rasch in den Sattel werfen, um der Begegnung mit dem Schwarzgekleideten zu entgehen. Allein er führte diese Absicht, wenn er sie hegte, nicht aus, sondern blieb stehen und erwartete den Herankommenden mit einer Miene, als wollte er sagen, derselbe sei ihm zwar eine bekannte, aber auch gleichgültige Person.
Der Schwarzgekleidete seinerseits litt offenbar an Kurzsichtigkeit, denn er langte, als er des Reisenden gewahr wurde, mit indifferenter Höflichkeit an den Hut und sagte in zeremoniösem Tone:
»Guten Morgen, mein Herr.«
»Danke, danke, lieber Jeremias,« lautete die Antwort Ottmars, ebenfalls mit kühlster, fast spöttischer Betonung gegeben.
Der Ankömmling schob die Brille fester vor die Augen, fixierte den jungen Mann und prallte einen halben Schritt zurück, als vor etwas ganz Unerwartetem. Augenblicklich jedoch kehrte seine Fassung wieder und er machte eine Gebärde, als wollte er Ottmar die Hand bieten.
Dies wirkte auf den letzteren sympathisch, und auch er streckte halb und halb die Hand zum Gruß aus. Allein diese Hände, bereit, sich zu drücken, fanden sich nicht. Der Schwarzgekleidete schob die seinige in seinen auf der Brust zugeknöpften Rock, und Ottmar legte die Arme auf den Rücken, indem er sich bemühte, noch gleichgültiger auszusehen, als er wirklich war.
»Das ist ein unerwartetes Zusammentreffen, Herr Bruder,« sagte er.
»In der Tat ein unerwartetes,« gab der andere zurück und setzte nach einer kleinen Pause mit einem forschenden Blick hinzu: »Ich glaubte dich im fernen Westen von Amerika, beschäftigt, mit dem Gelde des Onkels demokratisch-sozialistische Träume zu verwirklichen.«
»Ah, die Erbschaft vom Onkel! Wie spricht der Herr? ›Sorget euch nicht um Schätze, welche der Rost und die Motten fressen!‹ Der gute Onkel kannte deinen geistlichen und meinen weltlichen Sinn; daher fand er es passend, mir sein Geld und dir seine theologische Bibliothek zu vermachen. Er war, wie im Leben, so auch im Tode noch ein gerechter Mann. Außerdem motivierte er, wie du weißt, in seinem Testamente seinen Entschluß damit, daß er sagte: ›Mein Neffe Jeremias ist durch seine Frömmigkeit der paradiesischen und durch das Vermögen seiner Frau der irdischen Freuden ohnehin gewiß: in Anbetracht dessen vermache ich meinem Neffen Ottmar mein sämtliches Besitztum, mit Ausnahme meiner theologischen Bücher, welche der fromme Jeremias hinnehmen mag, um sich mittels derselben immer mehr der Schlacken des Weltlebens zu entäußern.‹«
»Der alte, gottesleugnerische Spötter! Er hat zugunsten von einem testiert, der ihm nachzuspotten weiß.«
»Spotten? Fällt mir nicht ein. ›Heil dem Manne, der da nicht sitzet, wo Spötter sitzen.‹ Psalm 1, Vers 1. Du siehst, ich erinnere mich noch der Zeit, wo ich hebräisch lernen mußte.«
»Ich sehe, du bist der alte Ottmar geblieben.«
»Der alte gutmütige, leichtsinnige, uneigennützige Knabe, willst du sagen? Aber da irrst du gewaltig, mein bester Jeremias. Wäre ich noch so ganz der Alte, so wäre ich, als man mir, nach Erstehung meiner Festungsstrafe, die Erbschaft des Onkels einhändigte, sentimental genug gewesen, mit dir zu teilen. Ich tat es nicht.«
»Nein, du gingst lieber nach Amerika, um dich mit Weitling und Komp. zu assoziieren.«
»Fehlgeschossen. Erstens habe ich den kommunistischen Schwindel überhaupt nie mitgemacht, zweitens bin ich nicht nach Amerika gegangen, weil mir auf der Fahrt dahin in England Bekannte, die aus Amerika zurückgekehrt waren, sagten, die Yankees seien zehnfach potenzierte Engländer. Schon diese aber flößten mir den gehörigen Horror ein und mochte ich es also mit jenen gar nicht probieren.«
»Und jetzt reitest du wohl als Emissär des Londoner Revolutionskomitee durchs Land, damit das Geld des Onkels grundsätzliche Verwendung finde?«
»Es scheint, die Frömmigkeit habe deinem Scharfsinn im Kombinieren bedeutenden Eintrag getan. Sehe ich aus wie ein Emissär der Propaganda? Hätte der beständige Blick nach dem Himmel nicht deine Augen geschwächt, so müßtest du in mir einen Advokaten aus der Residenz erkennen, welchen bloß der juristische Geschäftsweg in die Provinz herausgeführt hat.«
»Du hast dich wieder als Rechtskonsulent in die Residenz gesetzt?«
»So ist es, und ich glaube jetzt die Anlage in mir zu verspüren, ein so trefflicher Philister zu werden wie alle die andern. Noch mehr, zuweilen wandelt mich das Gefühl an, als sei ich zu einem jener Edlen bestimmt, welche man in den Familien als Onkel Sparhäfen adoriert.«
»Ein Geschäft, sagst du, führe dich in den Schwarzwald herauf?«
»Freilich. Der Graf Bernwart hat mich zu seinem Anwalt gewählt in einer sehr verwickelten Rechtssache. Es handelt sich darum, das Familienarchiv zu durchstöbern und streitige Lokalitäten an Ort und Stelle zu studieren.«
»Das geht wahrscheinlich den Prozeß an, welchen der Graf mit seinem Halbbruder, dem Freiherrn von Moosbrunn, führt?«
»Allerdings. Es gibt viel brüderliche Liebe in der Welt.«
»Und wirst du dich herablassen, während deines Aufenthaltes im Forgtal das Pfarrhaus von Moosbrunn zu deiner Herberge zu machen?«
»Das Pfarrhaus von – Moosbrunn?«
»Nun ja, es ist seit etwa einem halben Jahre mein Pfarrhaus.«
Dein Pfarrhaus? Du predigst jetzt auf der Kanzel, von welcher herab unser trefflicher Vater Aufklärung und Humanität verkündete? Deine Kinder bevölkern jetzt die Räume, wo wir als Knaben gelärmt und uns gezankt?«
»Hast du denn meine durch besondere Gnade des Monarchen mir gewährte Versetzung hierher nicht in der Zeitung gelesen?«
»Nein. Ich blicke seit längerer Zeit in die Zeitungen nur noch, wenn ich gerade muß.«
»Wirklich? Also ist die politische Mode abgetan und du bist vom morbus democraticus kuriert? Die Kasematten und die Festungshaft haben ihre Heilkraft bewährt, scheint es.«
»Recht brüderlich gesprochen und ganz christlich obendrein,« versetzte Ottmar und fügte, mehr für sich als zu dem Bruder gewendet, die Worte Shakespeares hinzu:
»Es ist das Unglück Prüfstein der Gemüter – Gemeine Not trägt ein gemeiner Mensch. Es fährt auf stiller See mit gleicher Kunst Ein jedes Boot; doch tiefe Herzenswunden, Die Glück in guter Sache schlägt, verlangen Den höchsten Sinn.«
»Du bist, wie ich sehe, noch immer stark in Zitaten,« sagte der Pfarrer, ein klein wenig verlegen, aber auch nur ein klein wenig.«
»Ich kann das Kompliment zurückgeben, lieber Jeremias, obgleich du von deiner unter den Stillen im Lande berühmten Fertigkeit, Bibelsprüche zu zitieren, heute noch keinen Gebrauch gemacht. Wenn nicht in die Erbschaft des Onkels, haben wir uns doch in die Literatur brüderlich geteilt. Du liebst es, biblische, ich liebe es, profane Verse zu zitieren. Mit ersteren kommt man entschieden weiter im Himmel und – auf Erden. Du kannst dich also über die Teilung nicht beklagen.«
»Lassen wir das. Wenn zwei Brüder nach langer Zeit sich wiedersehen, sollten sie etwas anderes als Bitterkeit auf den Lippen haben.«
»Gewiß, aber besser so, als wenn es hieße: Mel in ore, fraus in corde.«
Der Pfarrer tat, als beachte er diese Worte gar nicht, und sagte:
»Ich wiederhole meine Frage: Willst du im Hause unserer Eltern mein Gast sein?«
»Ah, sieh da, du kriegst Respekt vor dem angehenden Onkel Sparhafen?«
»Hältst du mich für einen Elenden?«
»Ich halte dich für den, der du bist. – Wart einmal –
Laß dir erzählen einen guten Schwank, Da 's jetzt die Zeit ist, Schwänke zu erzählen.
Es waren mal zwei Brüder. Der ältere war sehr fromm, der andere sehr ›jugendlich töricht schwärmerisch‹, wie die klugen Leute sagten. Seine Schwärmerei für Deutschlands Einheit und Größe und andere dergleichen obsolete Dinge brachte ihn in arge Schwulitäten. Er lag verwundet und krank im Gefängnis, von allen Mitteln entblößt, denn sein reicher Onkel, der ihn sonst liebte, hatte sich damals besagter Schwärmerei halber mit ihm entzweit. In dieser Not schrieb er an seinen Bruder, nicht um Hilfe, sondern nur um Teilnahme. Der Mensch hat nun einmal in solchen Lagen das Bedürfnis, zu erfahren, ob sich denn auch in weiter Welt noch jemand um ihn bekümmere. Der fromme Bruder gab gar keine Antwort. Des Bruders Frau aber, dessen ältestes Mädchen der Gefangene über die Taufe gehalten, hielt es in ihrer Herzensmilde für Pflicht, dem Schwager, der ihr und ihren Kindern immer ein freundlicher und treuer Verwandter gewesen, in dieser Not beizuspringen. Sie wollte mit ihrem ältesten Töchterlein, welches dem lustigen Onkel lebhaft zugetan war, nach der Stadt hinunterreisen, wo der Kranke damals gefangen lag, wollte ihn besuchen, ihn pflegen, so es nötig wäre. Aber ihr Mann, der fromme Pfarrer, der Prediger der christlichen Liebe, verbot es ihr ausdrücklich, verwehrte es der Guten in Ausdrücken, wie solche bei solcher Gelegenheit eben nur ein Frommer gebrauchen kann. ›Der sündhafte ungläubige Rebell mag seine Frevel büßen!‹ sagte der fromme Bruder. ›Wenn der Herr die Rute seines Zornes erhoben hat, will es sich nicht ziemen, ihm in den Arm fallen zu wollen.‹ Die Nutzanwendung von dieser Geschichte, mein bester Jeremias, magst du selber suchen.«
»Die Nutzanwendung?« entgegnete der Pfarrer, ohne einen Augenblick zu stocken. »Da hast du sie: Jeder folgt seiner Überzeugung. Du, der Prinzipienmensch, wirst dagegen nichts einwenden wollen.«
»Überzeugung?« versetzte Ottmar mit unverhohlener Verachtung. »Bah! Du hattest dein Leben lang von etwas, was einer Überzeugung nur entfernt ähnlich sah, nie die geringste Ahnung, außer vielleicht von der Überzeugung deiner – doch ich will mich bescheiden, statt deiner die Nutzanwendung meines kläglichen Schwankes zu ziehen. Verflucht sei mein Fuß, wenn ich ihn je auf die Schwelle eines Menschen setze, der an seinem Bruder in solcher Lage so handeln konnte. Selbst wenn ich an dir gefrevelt, hättest du zu jener Stunde dich erinnern müssen, daß einer Mutter Leib uns getragen. Ich wenigstens, beim Himmel, ich hätte an deiner Stelle dessen mich erinnert! Nein, ich kann und mag dein Gast nicht sein! Den Gräbern der Eltern meine Ehrfurcht zu bezeugen, werde ich wohl Gelegenheit finden; aber nimmer gemeinsam mit einem, der in schnöder Herzlosigkeit die Bande der Natur zerriß. Mache nur keine Versuche, dieselben wieder aneinander zu knüpfen. Ich sage dir, Jeremias, ich bin nicht mehr so ganz der gutmütige Junge, welchen du vordem an dem Gängelband deiner Heuchelei führtest. Wir sind getrennt für immer, und es ist wohl am besten so,« »Quel bruit pour une omelette!« sagte der Pfarrer mit vollendeter Selbstbeherrschung. »Du scheinst, lieber Ottmar, die Zeit noch nicht ganz verwunden zu haben, wo du in Klubs und bei Volksversammlungen schwarzrotgoldig oder wohl auch etwas dunkelrötlich donnertest. Vielleicht auch beherrscht dich gerade jetzt wieder deine Zitatensucht, denn mir ist, als schmeckten deine Tiraden von vorhin sehr stark nach des verschollenen Klinger Zwillingen. Dergleichen kraftgeniale Tollheiten sollten aber, denke ich, billig in der Mumiensammlung der Literarhistorie ruhen bleiben, um so mehr, da du im Forgtal schwerlich einen zur Etablierung eines Liebhabertheaters geeigneten Platz und die geeigneten Personen finden dürftest.«
Ein scharfer Zornblick fuhr aus dem Auge des jungen Mannes auf die Züge des Bruders, um dessen Mundwinkel ein frostiger Hohn spielte. Gerade diese höhnische Ruhe des Pfarrers gab auch Ottmar seine Fassung und sogar seinen Humor wieder.
Er lachte laut auf und sagte:
»Beim Zeus, du hast recht. Es dürfte nicht sehr vergnüglich sein, wenn wir mitsammen ein Leisewitz-Klingersches Schauspiel, betitelt: Die feindlichen Brüder, aufführten. Es ist auch gar nicht nötig, daß wir uns lächerlich machen und den Leuten etwas zu klatschen geben. Bemühen wir uns daher, eine leidliche Vereinbarung zustande zu bringen. 's ist ja jetzt ohnehin Mode, das Widerhaarigste zu vereinbaren, weil es der Welt an Mut gebricht, die Gegensätze walten zu lassen.«
»Gut, vereinbaren wir uns.«
»Meiner Treu, du weißt dich in die Umstände zu schicken, und wenn ich mir nochmals einen Eingriff in dein literarisches Gebiet erlauben wollte, würde ich das bekannte Wort von der Schlangenklugheit zitieren; doch zur Sache. Dein Gast werde ich nicht sein, aber wenn wir uns während meines Aufenthaltes im Forgtal begegnen sollten, so wollen wir uns gegenseitig als Gentlemen benehmen. Ich bilde mir ein, es müßte unserer Mutter im Grabe wehtun, wenn die Leute über die Uneinigkeit ihrer Söhne Glossen machten.«
»Wohl, es sei, wie du willst. Ich zweifle auch gar nicht, daß die zwischen uns obwaltenden Differenzen in Bälde sich werden schlichten lassen; ich zweifle um so weniger daran, als ich sehe, daß du dir die heroischen Hörner abgelaufen hast und von einem in dir schlummernden diplomatischen Talent Gebrauch zu machen anfängst.«
»Ei, wohl gar! Ich sage dir ganz unverblümt, daß es bei einer äußerlichen Vereinbarung sein Bewenden haben wird und muß.«
»Lassen wir das jetzt! Wird dein Aufenthalt in diesen Bergen lange währen?
»Je nachdem. Es ist eine verwickelte Geschichte, zu deren Schlichtung ich beitragen soll, ein Prozeß, der sich schon durch mehrere Generationen hindurchgeschleppt hat.« »Wahrscheinlich handelt es sich um den Streit, welchen Graf Bernwart mit seinem Halbbruder um den Forgforst führt?«
»Ja. Ich erinnere mich ans meinen Knabenjahren, daß der Prozeß schon damals und schon lange zuvor zwischen dem gräflichen und dem freiherrlichen Hause im Gange war. Ich meine aber auch einmal gehört zu haben, die Streitsache sei bei Gelegenheit der zweiten Heirat der Gräfin Bernwart mit dem Freiherrn vertragen worden.«
»Es war nur ein Waffenstillstand. Aber sag mir, da du nun einmal so eigensinnig bist, meine Einladung zu verschmähen, wo wirst du denn dein Quartier aufschlagen?«
»Hm, das weiß ich selbst noch nicht. Eigentlich konnte und sollte ich in Bernwartshall Herberge nehmen, da ich hierzu von meinem Klienten, dem Grafen, in verbindlichster Weise eingeladen worden bin. Aber ich mag weder geniert sein, noch genieren, und deshalb gedenke ich meinen Braunen und mich selbst im ersten besten Wirtshaus unterzubringen, wo es mir hinlänglich gefällt.«
Der Pfarrer schwieg eine Weile und fragte dann leichthin:
»Du kennst die Gräfin?«
»Nein. Der Graf ist also verheiratet?«
»Ja.«
»Seit wann?«
Seit etwa zwei Jahren. Die Heirat erfolgte bald nach der Rückkehr des Grafen von seinen, wie man sagt, abenteuerlichen Reisen.«
»So?« versetzte Ottmar gleichmütig. »Ich bin doch recht fremd in meiner Heimat geworden, seit mich nach dem Tode des Vaters der Onkel zu sich ins Unterland nahm. – Woher ist denn die Frau meines gräflichen Klienten?« »Aus nächster Nähe. Erinnerst du dich nicht mehr des alten Sonderlings von Förster, welcher da drüben auf dem Bärenschlößchen hauste?«
»Doch. Der Alte war ein finsterer Griesgram. Er hätte mich fast einmal über die Felsen hineingeworfen, auf welchen das schon damals halbzerfallene Nest liegt. Er wollte demselben niemand nahe kommen lassen, weshalb man sich die wunderlichsten Dinge von dem Bärenschlößchen erzählte. Ich aber war, als er mich damals so schnell hinausspedierte, in ganz guter Absicht gekommen, indem ich nur die verirrte Enkeltochter des Alten heimgeleitet hatte, als ich das kleine, nur ein paar Spannen hohe Ding im wildesten Walde gefunden. Ich erinnere mich, daß es mich mit seinen merkwürdig großen schwarzen Augen seltsam anguckte und dann wie ein scheues Reh vor mir davonlaufen wollte, bis ihm mein freundliches Zureden Vertrauen einflößte.«
»Eine romantische Erinnerung! Das kleine Ding ist jetzt Gräfin Bernwart,«
»Was?«
»Gräfin Bernwart, sagte ich.«
»Nun, beim Zeus, da sieht man, daß der alte Schwarzwald noch immer seine romantischen Mucken hat.«
»Ja, diese Heiratsgeschichte war ziemlich romantisch, um so mehr, da sich beim Tode des alten Försters herausgestellt haben soll, derselbe sei eigentlich ein Edelmann von hoher Abstammung gewesen, ein spanischer Grande, durch tragische Geschicke aus seiner Heimat vertrieben. Dort hätte er in früherer Zeit den alten Grafen kennen gelernt, und dieser habe ihm dann das Bärenschlößchen als Asyl angewiesen.«
»Das ist ja ein ganzer Roman.«
»Es sieht so aus. – Doch die Sonne ist höher gestiegen und mahnt mich zur Heimkehr, da ich vor Tische noch eine Kopulation und andere pfarramtliche Geschäfte vornehmen muß. – Du willst mich also nicht begleiten?« »Nein, mein Bester. Vergiß mir aber nicht, meine Schwägerin und die Kinder herzlichst zu grüßen. Im übrigen sage ich mit Schiller:
»Geh du rechtswärts, laß mich linkswärts gehn.«
»Du bist unverbesserlich, Ottmar. Aber ich tröste mich mit der Hoffnung, daß auch die divergierendsten Wege die Menschen dennoch am Ende oft zusammenführen. Auf Wiedersehen also und vergiß unserer Vereinbarung nicht!«
Mit diesen Worten entfernte sich der ältere Bruder und ging in pfarrherrlich gravitätischer Weise ein halbhundert Schritte weit auf dem Fußpfad fort, welcher von der Franzosenschanze rechtshin am Rand es Absturzes mählich bergab führt.
Ottmar wandte sich zu seinem Pferde und hatte schon den Fuß im Bügel, als er den Bruder umkehren und ihm zuwinken sah.
Er wartete des Herankommenden, und dieser sagte: »Höre, Ottmar. Meine Worte sind dir zwar Wind, aber dennoch fühle ich mich verpflichtet, dir auf der Schwelle unserer Heimat eine Warnung zukommen zu lassen, für welche du mir möglicherweise später dankbar sein könntest.«
»Eine Warnung! Wovor?«
»Vor der Gräfin Eva von Bernwart.«
»Vor der Gräfin? Das ist spaßhaft.«
»Kinder finden es auch spaßhaft, mit dem Feuer zu spielen, bis sie sich tüchtig damit verbrannt und das Haus in Brand gesteckt haben.«
»Ich bin kein Kind.«
»Aber ein heißblütiger Romantiker bist du.« »Bah!«
»Ein Romantiker, ja, deinem Unglauben und deinem Demokratismus zum Trotz.«
»Und wenn?«
»Die Gräfin ist eine Vollblut-Romantikerin und gleich und gleich –«
»Gesellt sich gern, meinst du? Aber sei ganz ruhig, lieber Jeremias. Wenn auch deine Warnung imstande wäre, meine Eitelkeit zu kitzeln, so kann ich dir zum Troste oder zum Possen sagen, daß ich weder für schreibende noch für nichtschreibende Romantikerinnen die geringste Passion habe.«
»Und trotzdem wiederhole ich: Nimm dich vor der Gräfin in acht!« sagte der Pfarrer fast mit Heftigkeit.
»Ei, beim Jeus,« entgegnete Ottmar, indem er sich lachend in den Sattel schwang, »das muß ja ein furchtbares Weib sein, welches die brüderliche Besorgnis meines frommen Bruders so sehr aufregt. Aber beruhige dich, lieber Jeremias. Ist die Gräfin wirklich ein so gefährliches Feuer, wie du andeuten zu wollen scheinst, so sag' ich dir, daß ich schon mehr als einem Feuer gegenüber bewiesen, ich sei nicht von Stroh. Und damit Gott befohlen!«
2. Mit wehendem Schleier.
Nachdem die »vereinbarten Brüder« bei der Franzosenschanze sich getrennt hatten, lenkte der jüngere sein Pferd wieder einen Büchsenschuß weit rückwärts auf das Plateau und wandte sich dann zur rechten Hand, einen scharfen Trab anschlagend.
Während ihn der Braune leicht über das junge Heidekraut hintrug, verarbeitete Ottmar in sich die Eindrücke, welche ihm das Zusammentreffen mit seinem Bruder hinterlassen.
»Daß mir gerade der Jeremias auf der Schwelle der Heimat begegnen mußte!« brummte er mißmutig vor sich hin. »Soll ich es für ein böses Omen nehmen? Oder kann ich es für ein anderes nehmen? Er war immer ein Schleicher – und jedenfalls wäre es besser gewesen, wenn ich dieses Gesicht mit seiner stereotypen Gottseligkeit nie mehr gesehen hätte. Was könnten wir noch miteinander gemein haben? Ein paar Jugenderinnerungen vielleicht. Aber die sind durch neuere Erfahrungen so vergällt und vergiftet, daß ich sie lieber allesamt über Bord werfe. – Was doch alles die Poeten über den Zauber der Bande des Blutes faseln! Die natürliche Sympathie tritt weit zurück vor der Antipathie des Bewußtseins. Um wieviel kostbarer ist ein Bruder im Geiste als ein Bruder im Fleische! Aber freilich, die Brüder im Geiste sind Raritäten. Wo sind denn meine Pyladesse und Pythiasse aus der Universitätszeit? So ziemlich alle, glaub' ich, unter das sitzende, kniende und stehende Heer gegangen, Philister geworden jeder Zoll. 's ist ein Graus, wie schnell die Leute heutzutage alt werden! Auch das geht mit Dampf, wie alles andere. Wie alles? Bah, ich denke, man hat sich in Deutschland, in Europa überhaupt in bezug auf viele Dinge eben nicht sehr über Dampfgeschwindigkeit zu beklagen, und mir will scheinen, daß in eben dem Maße, in welchem die Maschinen vorwärts stürzen, die Menschen zurückgehen. – Was aber nur in aller Welt meinen wohlehrwürdigen Bruder bewog, mich vor der Gräfin zu warnen? Daß Jeremias schon als Knabe nie etwas ohne bestimmte Absicht, ohne Berechnung tat, ist ein historisches Faktum. Welcher Kalkul also mag seiner merkwürdig eifrigen Brüderlichkeit in diesem Falle zugrunde liegen? Die Gräfin interessiert ihn, soviel ist sicher. Steht er in geistlichen Relationen zu ihr und besorgt er vielleicht, ich möchte seine circulos theologicos stören? Oder, oder, hm, beim Zeus, in jedem dieser Pietisten steckt ein gut Stück Mucker – das ist eine alte Geschichte. Es wäre doch, bei Baal und Astarte, es wäre sublim, wenn der alte Duckmäuser einen verliebten Rappel hätte. Arme Margaret, arme Schwägerin, das könntest du noch brauchen. Ich weiß, du hast an der Seite des frommen Wohlehrwürdigen ohnehin keine sehr rosenfarbigen Tage verlebt. – Ja, ja, am Ende ist's so: die Eifersucht, die dümmste, grundloseste, verrückteste Eifersucht sprach aus dem edlen Jeremias. Wäre die Margaret nicht, so müßte mich diese lächerliche Idee höchlich gaudieren. – Und aber, die Worte meines cher frère gestatten die Vermutung, daß die Gräfin Bernwart eine nicht gewöhnliche Person sein müsse. Wer hätte das gedacht, daß ich die Enkeltochter des fremden bärbeißigen Alten droben im Bärenschlößchen dereinst in solcher Situation wiederfinden sollte? Ich erinnere mich des kleinen Dinges noch recht gut; es hatte abenteuerlich schöne große schwarze Augen. Und jetzt Frau Gräfin, vor welcher man kratzfüßeln und katzenbuckeln soll? Ei, das Leben ist doch 'ne Komödie, trotz alledem, und es fehlt ihm nicht an buntem Wechsel und hübschen Überraschungen.«
Der junge Mann sollte auf der Stelle eine Bestätigung dieser Ansicht vom Leben erhalten.
Eine Überraschung wurde ihm zuteil, welche jedenfalls eine hübsche genannt werden durfte.
Er hatte die Hochebene des Pfaffenwaldes hinter sich und war im Begriffe, den Braunen einem Hohlweg zuzulenken, welcher, wie er von alten Zeiten her wußte, den waldigen Abhang hinab ins Forgtal führte.
Da zog er plötzlich überrascht die Zügel an, denn aus dem Dunkel des Hohlweges heraus tönte fröhliches Sprechen und Lachen, eine glockenhelle und glockentonrunde Frauenstimme rief: »Ah, da sind wir endlich oben!« und im selben Moment tauchte die Sprecherin, auf einem prächtigen Schimmel reitend, aus dem Hohlweg auf, versetzte, den Oberkörper vorbeugend, ihrem Pferde einen Schlag mit der Reitgerte, daß es mit einem plötzlichen Ruck und kühnen Satz das Plateau gewann und dann, da ihm seine Reiterin die Zügel schießen ließ, in gestrecktem Galopp über die Fläche hinsauste.
Die Dame saß mit vollendeter Sicherheit und Anmut im Sattel. Ihre schlanke Gestalt, deren tadellos schöne Formen der enganliegende grausamtene Spenzer des Reitkleides hervortreten ließ, folgte zwanglos den Bewegungen des Pferdes. Der Morgenwind hatte ihre feingeschnittenen Züge rosig angehaucht, ihre großen schwarzen Augen blickten unter kühngeschwungenen dunklen Brauen voll Feuer und Leben in die Welt hinein, und wie sie so dahinflog mit wehendem Schleier und ihr die unter dem Reithut üppig hervorquellenden schwarzen Locken im Nacken tanzten und schaukelten, und sie, voll erregten Lebensbewußtseins, einen hellen Ruf der Freude von den Lippen springen ließ, da gewährte sie einen wahrhaft phantastisch-romantischen Anblick, welcher an den Aufzug der Romanze in Tiecks Kaiser Oktavianus erinnern könnte.
Diese Erinnerung regte sich auch in Ottmar. Sein Bruder hatte doch wohl nicht so ganz unrecht gehabt, wenn er ihn einen Romantiker nannte.
Die stille, grüne, waldumschlossene Heide und darauf die feenhaft schöne Erscheinung der kühnen Reiterin, es war eine in Wirklichkeit übersetzte Reminiszenz aus Tagen, wo Ottmar, während des Gesenius berühmtes hebräisches Lesebuch auf der Schulbank lag, unter derselben in Fouqués »Zauberring« und »Sängerliebe« schwelgte.
Er hatte auch keine Zeit, diese Reminiszenz von einem Schatten moderner Skepsis überstiegen zu lassen.
In dem Augenblick, wo der Schimmel mit seiner schönen Last an dem jungen Mann vorüberschießen wollte, erblickte ihn die Reiterin, und sogleich zügelte sie mit außerordentlicher Gewandtheit ihr Pferd.
»Guten Morgen, Herr Doktor Horst, und willkommen im Schwarzwald!« sagte die Dame mit schalkhaftem Lächeln.
Ottmar glaubte zu träumen. Er meinte dieses Antlitz mit der gebietenden Stirne und den wunderbaren Augen schon einmal gesehen zu haben; es hatte einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht – und doch, wo war es nur, daß er es gesehen? Er wußte sich diese Frage nicht zu beantworten: das machte ihn verlegen, und er kam sich recht tölpelhaft vor.
»Mein Fräulein –« stotterte er endlich.
»Fräulein?« versetzte die Dame mit sonderbarer Betonung, während eine Wolke ihre strahlenden Züge überflog. Aber nur für einen Moment, denn im nächsten hatten sie ihren, wie es schien, gewöhnlichen Ausdruck sorglos heiterer Entschiedenheit, um nicht zu sagen Kühnheit, wieder angenommen.
Lachend sagte sie:
»Was doch die Männer für ein kurzes Gedächtnis haben! Vor einigen Monaten unterhielt mich in der Fremdenloge des Theaters der Residenz in den Zwischenakten vom Nathan ein gewisser junger Rechtskonsulent recht artig über Lessing, über die Idee des Humanismus und andere hübsche Sachen –«
»Ach ja, meine Gnädige,« rief Ottmar eifrig aus. »Aber schreiben Sie mir nicht ein zu kurzes Gedächtnis zu. Nur das romantisch Plötzliche, die überwältigende Macht Ihrer Erscheinung auf dieser Heide –«
»Hat Sie so geblendet, mein Herr Doktor, daß Sie Ihr Gedächtnis einbüßten?«
Es klang herber Spott aus diesen Worten der Dame, und ihr tiefes Auge ruhte mit strengem Forschen auf Ottmars Zügen, als sie hinzufügte:
»Haben auch Sie die Fibel der Phraseologie auswendig gelernt? Damals im Theater glaubte ich fast, Sie bildeten eine Ausnahme von der Männerrasse, welche die fixe Idee hat, einer Frau gegenüber stets und unter allen Umständen adulatorische Abgeschmacktheiten auskramen zu müssen.«
Ottmar blickte der Sprecherin fest in die Augen, aus denen ihm jetzt plötzlich eine Erinnerung aufstieg, welche viel weiter zurückging als zu dem Theaterabend in der Residenz, wo die blendende Erscheinung der fremden Dame einen gewaltigen, wenn auch vorübergehenden Eindruck auf ihn gemacht hatte. Er hatte jetzt seine gute Laune völlig wiedergewonnen und sagte nun seinerseits lachend: