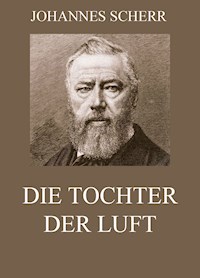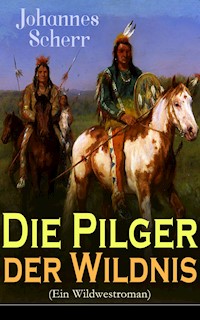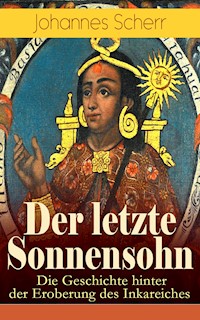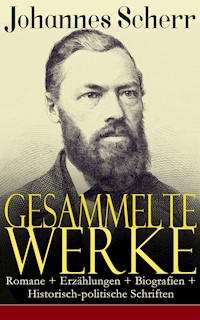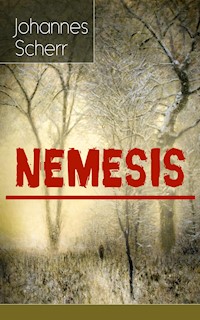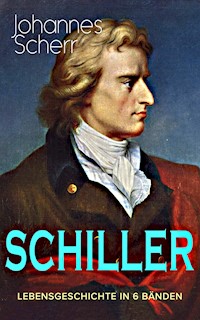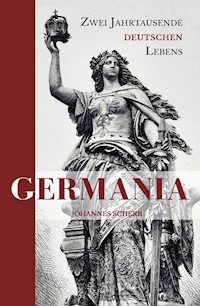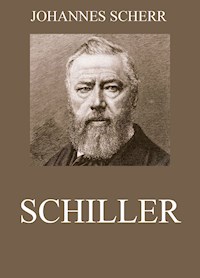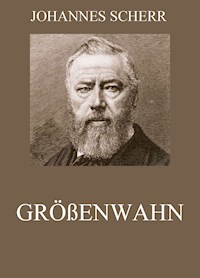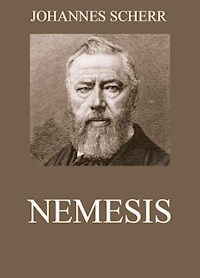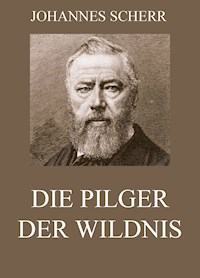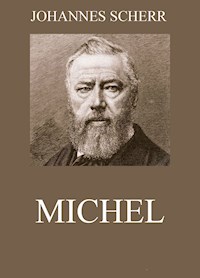
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte eines Deutschen unserer Zeit. Scherr war einer der vielseitigsten Kenner der Literatur- und Kulturgeschichte und ein sprachgewandter und geistvoller Schriftsteller, dessen Leben und Wirken in gleichem Maße der Schweiz wie Deutschland angehörte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 771
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michel
Johannes Scherr
Inhalt:
Johannes Scherr – Biografie und Bibliografie
Michel
1. Band.
Erstes Buch. Jugendidyll.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Zweites Buch. Theorie.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel,
Drittes Kapitel,
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Drittes Buch. Praxis
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel,
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel,
Sechstes Kapitel.
Viertes Buch. Die Rotte der Zukunft.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel,
Zweiter Band.
Fünftes Buch. Die Söhne Mammons.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel,
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel,
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Sechstes Buch. Mammon auf dem Dorfe.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel,
Sechstes Kapitel.
Siebentes Buch. Auf der roten Fluh
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel,
Drittes Kapitel,
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Finale
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel,
Drittes Kapitel.
Michel, J. Scherr
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849634933
www.jazzybee-verlag.de
Johannes Scherr – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 3. Okt. 1817 in Hohenrechberg bei Schwäbisch-Gmünd, gest. 21. Nov. 1886 in Zürich, besuchte das Gymnasium in Gmünd und die Universitäten in Zürich und Tübingen, wirkte dann eine Zeitlang als Lehrer und ließ sich 1843 in Stuttgart nieder. wo er 1844 mit der Schrift »Württemberg im Jahr 1844« den politischen Kampfplatz betrat, auf dem er sich in den nächsten Jahren als Vorkämpfer aller freiheitlichen Bestrebungen hervortat. 1848 wurde er in die württembergische Abgeordnetenkammer und in den Landesausschuß gewählt und stand während der Revolutionszeit an der Spitze der demokratischen Partei, weshalb er nach Auflösung der Kammer 1849 nach der Schweiz flüchtete. Er ließ sich zunächst in Winterthur nieder, wo er längere Zeit schriftstellerisch tätig lebte, bis er 1860 als Professor der Geschichte und Literatur an das eidgenössische Polytechnikum in Zürich berufen wurde. Außer einer Reihe von Romanen und Erzählungen (darunter: »Schiller«, Leipz. 1856; 3. Aufl. 1902, 2 Bde.; »Michel. Geschichte eines Deutschen unserer Zeit«, Prag 1858, 4 Bde.; 10. Aufl., Leipz. 1905, 2 Bde.; »Rosi Zurflüh«, Prag 1860; »Die Gekreuzigte«, St. Gallen 1860; 2. Aufl., Leipz. 1874) sowie einigen humoristischen Schriften veröffentlichte er: »Bildersaal der Weltliteratur« (Stuttg. 1848; 3. Aufl. 1884, 3 Bde.), woraus im Sonderdruck der »Bildersaal der deutschen Literatur« (1887) erschien; »Deutsche Kultur- und Sittengeschichte« (Leipz. 1852–53, 11. Aufl. 1902); »Allgemeine Geschichte der Literatur« (Stuttg. 1851; 10. Aufl. als »Illustrierte Geschichte der Weltliteratur«, das. 1900, 2 Bde.); »Geschichte der deutschen Literatur« (2. Aufl., Leipz. 1854); »Geschichte der englischen Literatur« (das. 1854, 3. Aufl. 1883); »Geschichte der Religion« (das. 1855 bis 1857, 2 Bde.; 2. Aufl. 1859); »Dichterkönige« (das. 1855; 2. Aufl. 1861, 2 Bde.); »Geschichte der deutschen Frauenwelt« (das. 1860; 5. Aufl. in 2 Bdn. 1898); »Schiller und seine Zeit« (illustrierte Quartausgabe, das. 1859, 3. Aufl. 1902; Volksausgabe, 4. Aufl. 1865); »Drei Hofgeschichten« (das. 1861, 3. Aufl. 1875); »Farrago« (das. 1870); »Dämonen« (das. 1871, 2. Aufl. 1878); »Blücher, seine Zeit und sein Leben« (das. 1862–63, 3 Bde.; 4. Aufl. 1887); »Studien« (das. 1865–66, 3 Bde.); »Achtundvierzig bis Einundfünfzig« (das. 1868–70, 2 Bde.; 2. Aufl. u. d. T.: »1848, ein weltgeschichtliches Drama«, das. 1875); »Aus der Sündflutzeit« (das. 1867); »Das Trauerspiel in Mexiko« (das. 1868); »Hammerschläge und Historien« (Zürich 1872, 3. Aufl. 1878; neue Folge 1878); »Sommertagebuch des weiland Dr. gastrosophiae
Erstes Kapitel.
Wie meine Mutter strickte und mein Vater einen wunderlichen Heiligen anrief. – Vom alten Hylas, ferner von einem Reinettenbaum und endlich von einem aus der Klasse gejagten Michel.
»Nun?« fragte meine Mutter, indem sie meinen neben ihr sitzenden Vater von der Seite ansah und ihr Strickzeug mit einer Tatkraft handhabte, daß die Nadeln laut aneinander klangen und das auf den Schoß der Strickerin niederhängende Strumpfende sehr charakteristische Bewegungen machte.
»Was nun?« gegenfragte mein Vater.
Frage und Gegenfrage prallten in recht eigen zugespitztem Tone gegeneinander.
Außerdem gaben sich noch andere verhängnisvolle Symptome kund, welche auf eine gar bedenkliche Sachlage schließen ließen.
Die noch immer mädchenhaft frischen Lippen des kleinen Mundes meiner Mutter waren trotzig aufgeworfen, und zwischen ihren braunen Brauen, unter welchen ein dunkelblaues Augenpaar so sanft, gut und liebevoll hervorblickte, zeigte sich etwas wie der Schatten einer Falte. Auch strickte sie, wie schon gesagt, heftig. In gewöhnlicher Verfassung, wenn die getrennten Gewalten des ehelichen Konstitutionalismus in parlamentarischer Harmonie lebten, pflegte die Gute weder heftig noch überhaupt häufig zu stricken, weil ihr Eheherr einen stark ausgeprägten Widerwillen gegen diese Beschäftigung hegte.
Mein Vater warf mit einem ungeduldigen Ruck die Feder auf das große altfränkische Schreibzeug, stieß das vor ihm liegende Aktenheft zurück und faßte mit der Rechten in seinen buschigen Backenbart, dessen Schwarz reichlich mit Grau gesprenkelt war. Dann nahm er mit der Linken die Pfeife mit dem langen Weichselrohr aus dem Munde, blies die Backen auf und ließ einen unendlichen, dünnen Rauchstrahl mit eigentümlich pfeifendem Ton zwischen seinen Lippen hervorbrechen.
Dies getan, lehnte er sich in den Rohrstuhl zurück und stieß den lauten Seufzer aus:
»O, heiliger Semmelziege!«
Ich verstand den Sinn der Anrufung dieses wunderlichen Heiligen damals noch nicht. Später aber begriff ich, warum bei dieser Anspielung auf die Figur des Hofrats Semmelziege in Tiecks »Däumchen«, welchen Hofrat die Strickmanie seiner Gattin Ida bekanntlich sehr unglücklich machte, meine sittsame Mutter so über und über errötete, wie sie tat.
Sie rückte schmollend ihren Stuhl weiter von dem ihres Eheherrn hinweg und ließ an ihrer Stelle die Stricknadeln antworten, welche bitterböse klirrten.
In dem verlegenen Schweigen, welches herrschte, suchte mein Vater Trost bei seiner Pfeife. Aber sie war ausgegangen.
»Schlechter Tabak!« brummte er.
Meine Mutter schwieg, doch machte sie unwillkürlich eine Bewegung, um nach dem Feuerzeug zu langen, welches gerade vor ihr auf dem grünen Gartentische stand, als wollte sie nach ihrer Gewohnheit den Vater mit Feuer versorgen. Aber sie zog die schon ausgestreckte Hand wieder zurück, warf das Mäulchen auf und strickte, als gälte es ein Wettstricken.
Mein Vater stellte die Pfeife beiseite, verschränkte die Arme, gähnte verdrießlich, schaute in den rötlichen Abendhimmel hinaus, dann aufwärts in die Zweige des alten, prächtigen Apfelbaumes, welcher den Tisch überschattete und bemerkte:
»Die Reinetten gehen schon der Reife entgegen. Es war aber auch ein heißer Sommer.«
Meine Mutter schwieg und strickte.
Mein Vater, indem er leise seufzte, legte seine Hand auf den Kopf seines alten Hühnerhundes, welcher vor ihm saß. Der Hund hob seine Schnauze auf das Knie seines Herrn und blickte ihm mit den großen braunen Augen teilnahmevoll ins Gesicht.
»Alter Hylas, lieber, guter, friedsamer Kerl!« sagte mein Vater, den Hund liebkosend.
Das Wort friedsam war ganz eigen betont, und der alte Hylas verstand unzweifelhaft die Meinung seines Herrn. Aber er warf einen demütig fragenden Blick nach seiner Herrin hinüber, hielt sich ganz stille und ließ seinen buschigen Schweif nur ganz leise auf dem bekiesten Boden hin und her gehen. Es lag aber doch unbeschreiblich viel Sympathie in diesem hündischen Gebärdenspiel.
Der Hylas war nämlich ein Vieh von Geist und Gemüt. Wenigstens behauptete das sein Herr.
Die Stricknadeln klangen unter den Händen meiner Mutter, heftig, demonstrativ, ich möchte fast sagen eifersüchtig.
Meine gute Mutter liebte den Hund, wie überhaupt alle Tiere, nicht weniger als mein Vater. Und doch sah sie jetzt den armen Hylas so böse an, als sie überhaupt etwas anzusehen vermochte.
Dann, als sie bemerkte, daß ihr Eheherr sie nicht beachtete, warf sie einen verstohlenen Blick auf ihn, einen Blick, der eine Welt von Liebe offenbarte.
Da mein Vater sich plötzlich umkehrte, hatte sie nicht mehr Zeit genug, diesen Blick ganz zu verbergen.
Sie schlug die Augen nieder und strickte wieder mit fliegender Eile.
Mein Vater ließ sich aber dadurch nicht irre machen.
»Hör mal, liebes Kind,« sagte er, »morgen hab' ich ohnehin ein Geschäft in der Stadt. Du kannst mitkommen, und da wollen wir mitsammen sehen, was es denn mit dieser Geschichte eigentlich für eine Bewandtnis habe. 's ist am Ende doch nur 'ne Lumperei, wett' ich, ein Bubenschnickschnack. Läßt sich wohl leicht beilegen. Der Rektor, mußt du wissen, ist ein ungeheurer Pedant. Kenne ihn von alters her. Weiß nicht, absolut nicht, was Humor ist, der alte Deklinationenhetzer und Konjugationenbrüster. Unser Michel jedennoch ...«
»Unser Michel,« fiel meine Mutter ein, aber sie strickte jetzt nicht nur nicht mehr, sondern auch war das unglückselige Strickzeug, welches den ästhetischen Sinn meines Vaters so sehr beleidigte, plötzlich ganz verschwunden – »unser Michel ist mit Schimpf und Schande aus der Klasse gejagt worden. Ach Gott, der unglückliche Bub'! Wie soll ich das verwinden?«
Und die gute Frau brach in Tränen aus.
Der alte Hylas stand auf, schlich sich unter dem Tische durch, legte seinen Kopf schüchtern auf den Schoß meiner Mutter, blickte sie teilnehmend an und wedelte höchst gefühlvoll mit seinem Federschweif.
Ihres Kummers ungeachtet konnte meine Mutter doch nicht umhin, das treue alte Tier mit ihrer weißen Hand hinter den Ohren zu krauen.
»Nun, nun,« begütigte mein Vater, »verderb dir doch die Augen nicht mit überflüssigem Weinen, Gertrud. Du weißt, ich kann's nicht leiden. Schöne Frauenaugen sind eine edle Gottesgabe; man sollte sie pflegen; weißt du? ... Was aber die verdrießliche Tagesfrage betrifft, so ist es allerdings eine feststehende Tatsache, daß unser Michel – wo nur der Junge den ganzen Abend stecken mag? – in etwas barscher Weise das consilium abeundi erhalten hat. Wenn indessen der Grund kein anderer ist als der von ihm angegebene – und du weißt, der Junge lügt nicht – so hat es in der Welt schon größere Mißgeschicke gegeben, denk' ich.«
»Ja,« entgegnete meine Mutter, noch immer weinend – »ich weiß wohl, du würdest so sprechen, auch wenn dir der Himmel über dem Kopfe zusammenfiele.«
»In der Tat, liebe Alte« – dieser Ausdruck meines Vaters hatte meiner Mutter gegenüber immer etwas Komisches, denn er war mindestens zwanzig Jahre älter als sie – »in der Tat, vielleicht würde ich in diesem Fall mit dem alten Horaz sprechen:
Si fractus illabatur orbis, Impavidum ferient ruinae–
vorausgesetzt nämlich, daß ich dann überhaupt noch zum Sprechen Zeit hätte und – du mir nicht widersprächest.«
»Ja, spaße nur,« versetzte meine Mutter, den Stich gutmütig hinnehmend. »Das ist so Männerart. Während wir uns härmen, scherzt und lacht ihr euch die Sorgen von der Brust weg. Was aber deinen Michel angeht ...«
»Meinen Michel?« fiel ihr mein Vater lächelnd ins Wort. »Hm, liebes Kind, ich denke, ein gut Teil von dem Jungen gehört dir an. Um so mehr, weißt du? da er, wie auch sein neuestes Heldenstück verrät, verteufelt oppositionell gesinnt ist. Im übrigen kann nicht geleugnet werden, daß der Junge ein Wildfang aus dem ff ist, ja geradezu das, was die Franzosen sehr bezeichnend ein enfant terrible nennen. Indessen ist mir das lieber, als wenn er ein Schleicher und Duckmäuser wäre, weit lieber. Wird sich die Hörner schon ablaufen, unser Michel.«
»Ach«, sagte meine Mutter wehmütig, »ich fürchte, der Junge ist zum Unglück bestimmt.«
»Warum nicht gar! Er ist ein derbknochiger Bursch. Desto besser! Er wird sich schon durch die Welt beißen und hauen. Ihm selber möcht' ich's nicht sagen, aber dir sag' ich's, liebe Alte; ich hab' eine rechte Freude an dem Jungen. Er hat Haare auf den Zähnen und Mark in den Knochen und gesunden Atem in der Lunge. Er fürchtet keinen seines Alters, selbst größere und stärkere nicht; er kriegt sie unter.«
»Ja, der ewigen Rauferei wegen kann man ihm auch nicht Kleider genug anschaffen,« seufzte meine Mutter.
»Tut nichts. Er läuft wie ein junger Hirsch über die Berge, schwimmt wie 'ne Ente, scheut sich nicht, das wildeste Pferd zu besteigen, kein Baum ist ihm zu hoch ...«
Wenn mein Vater wollte, daß sein Sohn Michel dieses nicht grundlose Lob nicht mit anhören sollte, so hätte er bedenken sollen, daß in der Tat dem Jungen kein Baum zu hoch war, namentlich solche nicht, welche ganz oder auch nur halbwege reife Früchte trugen.
Mehrbesagter Michel, mit dem Erzähler dieser seiner denkwürdigen Geschichte eine und dieselbe Person, hatte schon seit einigen Tagen die Wahrnehmung gemacht, daß die reifenden Reinetten auf dem Baume, welcher den Lieblingsgartenplatz seines Vaters überschattete, für seinen Geschmack gerade wenig säuerlich genug wären. Der »Wildfang aus dem ff« pflegte solcherlei Wahrnehmungen eifrigst auszunützen. Heute war er, nachdem ihm vormittags in der nahen Stadt, wohin er seit einigen Jahren täglich gewandert, um das dortige Lyzeum zu besuchen, eine gewisse Fatalität zugestoßen, den ganzen Nachmittag im Garten herumgestrichen, um der Fortsetzung gewisser unangenehmer häuslicher Erörterungen auszuweichen. Hunger und Durst hatten ihn vermocht, sich bei dem Reinettenbaum zu Gaste zu laden; aber kaum hatte er sich in den Ästen des ehrwürdigen Patriarchen festgesetzt, als Vater und Mutter unter demselben Platz nahmen. Und da heute kein Tag war, wo es ratsam gewesen wäre, daß Michel sich vor seinem Vater auf vorzeitiger Zehntung des väterlichen Lieblingsobstes ertappen ließ, so fühlte er sich bewogen, seine Operationen nur mit äußerster Vorsicht zu verfolgen. Zuletzt hatte er dieselben sogar ganz eingestellt, um, hinter den dicken Stamm gedrückt und, sich möglichst klein machend, aus seinem Blätterversteck herab mit begreiflicher, wenn auch nicht verzeihlicher Neugier einer Verhandlung zuzuhören, welche seine eigene werte Person betraf.
Zweites Kapitel.
Ringe oder Wolken? – Ein »denkender« Landpfleger. – Große Debatte über den unglückseligen Namen »Michel«. – Von einer Mainacht »unter der Linde«. – Wie heillos ein Friedenskuß gestört werden kann.
Mein Vater hatte seine Pfeife wieder gefüllt und die Mutter den brennenden Zunder auf den schwellenden Varinas gedrückt.
Ihr Stuhl stand jetzt wieder dem ihres Eheherrn dicht zur Seite.
Mein Vater fühlte sich bei diesen offenkundigen Vorzeichen friedfertiger Annäherung sehr behaglich. Hierfür lag ein untrüglicher Beweis vor oder schwebte vielmehr in der milden Abendluft in Gestalt einer unendlichen Reihe meisterhaft geblasener Rauchringe von allen Größen, die unablässig aus dem Munde des Rauchenden hervorquollen.
Wenn die Bauern, Pächter, Förster und Pastoren in Geschäften zu uns aufs Rentamt kamen, machten sie immer zuerst meiner Mutter die Aufwartung, um sich, wie sie sagten, nach der Witterung zu erkundigen.
»Frau Kons'lentin,« fragten sie dann, »hat der Herr Kons'lent beim Morgenkaffee Ringe geblasen oder aber Wolken?«
Gab die Mutter mit einem verhaltenen Seufzer zur Antwort: »Wolken, schwere Wolken!« so gab's ein bedenkliches Kratzen hinter den Ohren, und die Leute schlichen sehr behutsam nach der Amtsstube. Antwortete hingegen meine Mutter mit ihrem herzgewinnenden Lächeln: »Ringe, Prächtige Ringe!« so schritten die Leute laut und lachend den Gang nach den Geschäftszimmern hinab, als hätten sie den günstigen Bescheid auf ihre verschiedenen Anliegen schon schriftlich in der Tasche. Manchmal freilich erwies sich nach Art anderer Orakel auch das Ringe- und Wolkenorakel trügerisch, sehr trügerisch.
Meine Mutter konnte das wissen, allein sie wollte sich heute an solche unliebsame Erfahrungen wahrscheinlich nicht erinnern.
Ihre kleine, weiße, weiche Hand auf die große, knochige, gebräunte meines Vaters legend, fragte sie recht herzlich: »Willst du mir einen Gefallen tun, lieber Fritz?«
»Zwei für einen, Trudchen.«
»Danke, danke! Ich verlange nur einen, aber du mußt mir versprechen, mich nicht auszulachen um deswillen, was du meinen Aberglauben nennen wirst.«
»Dich auslachen, Trudchen? Wegen des Aberglaubens? Fällt mir nicht ein! Ein bißchen Aberglaube steht euch Frauen ganz vortrefflich, weißt du? Und was ist eigentlich Aberglaube? Es möchte sehr schwierig sein, diese Frage bestimmt zu beantworten. Wollte den sehen, der mir ganz genau, auf den Punkt hin sagen könnte: Da hört der Glaube auf und da fängt der Aberglaube an. Müßte ein siebenfach destilliert gescheiter Kerl sein, der das könnte. Denn siehst du, liebe Alte, die Frage: Was ist Wahrheit? ist bis heute von allen unsern Philosophen gerade noch so wenig befriedigend beantwortet, als sie es zur Zeit des Landpflegers Pilatus war. Besagter Pilatus ...«
Meine Mutter verzog ein wenig, nur ein klein wenig, aber doch wahrnehmbar den Mund, und ihr Arm zuckte leise, als wollte sie ihre Hand von der ihres Eheherrn zurückziehen. Und diese Regung der Ungeduld war sehr verzeihlich. Wenn mein Vater mal ins Dozieren hineinkam, so war ihm sehr schwer beizukommen.
»Besagter Pilatus,« fuhr mein Vater fort, »war ohne Zweifel ein denkender Landpfleger ...«
»Bitte, lieber Schatz,« fiel meine Mutter ein, »laß doch den denkenden Landpfleger, der schon so lange ausgedacht hat, in Ruhe und höre lieber, was ich wünsche.«
»Was wünschest du, Trudchen? Du weißt, alle deine Wünsche sind mir Befehle ...«
»Die aber selten vollzogen werden,« wollte offenbar meine Mutter mittels des bittersüßen Lächelns sagen, welches ihre Mundwinkel kräuselte. Indessen begnügte sie sich zu äußern:
»Das wollen wir gleich sehen, lieber Fritz. Du weißt, es hat mich stets geärgert und gekränkt, daß unser Bub den unglückseligen Namen Michel führt ...«
»Warum nicht gar!«
»O, du weißt es wohl. Du solltest auch noch nicht vergessen haben, wie tödlich ich erschrak, da ich, als ihr den Täufling aus der Kirche zurückbrachtet, erfahren mußte, daß du ihm als ersten Namen Michel gegeben habest und erst als zweiten den Namen Siegfried, wie sein Pate, mein Bruder selig, hieß.«
»Alte Geschichten, Trudchen, alte Geschichten. Im übrigen hab' ich nie begreifen können und begreife auch jetzt noch nicht, wie du gegen den ehrlichen Namen Michel eingenommen sein konntest und kannst.«
Die Hand meiner Mutter lag nicht mehr auf der meines Vaters, als sie erwiderte:
»Gegen den ehrlichen? Gegen den garstigen, gemeinen, pöbelhaften, willst du sagen. Nur Fuhrleute und Holzhacker heißen Michel.«
Der Stuhl meiner Mutter, als wäre er ein fühlendes Wesen und gehorche den Stimmungen der auf ihm Sitzenden, rückte wie von selbst eine Spanne weit von dem meines Vaters weg.
»Daß ihr Frauen doch alle eingefleischte Aristokratinnen seid!« sagte mein Vater gleichmütig und setzte an, um einen recht großen Ring zu blasen. Aber er brachte es nicht zustande, wahrscheinlich aus Schrecken über die zwischen den Brauen meiner Mutter abermals sich entwickelnde Falte. Der Rauch kam ganz wolkig und anarchisch aus seinem Munde.
»Ich bin keine Aristokratin, ich!« versetzte meine Mutter gereizt. »Ich weiß, daß Fuhrleute und Holzhacker ganz gute und achtbare Menschen sein können und oft auch wirklich sind. Aber wer wird es einer armen Mutter verübeln, wenn sie nicht will, daß ihr einziger Sohn so fuhrmännisch oder holzhackerisch heiße? Bitte, lieber Fritz, wir wollen den Knaben künftig nur mit dem Namen Siegfried rufen.«
»Liebes Kind, ich habe ganz und gar nichts dagegen, wenn du den Jungen lieber mit dem Namen Siegfried rufst.«
»Nicht so, Alterle, nicht ich allein. Du und alle, alle sollen ihn künftig so rufen. Er soll sich auch künftig nur noch Siegfried Helmut schreiben, nicht mehr – doch ich will den garstigen Namen gar nicht mehr auf die Zunge nehmen. Er klingt so roh, so flegelhaft ...«
»Aber, Schatz, der Junge ist ja gerade auch in den Flegeljahren.«
Ohne diesen Einwurf zu beachten, fuhr meine Mutter eifrig fort:
»Siegfried dagegen, wie klingt das vornehm, stolz, heldisch! Hast du mir, als du mich im letzten Winter beredetest, das lange, lange Nibelungenlied zu lesen, nicht zu wiederholten Malen gesagt, der Siegfried sei der herrlichste aller Helden unserer alten Sagenwelt gewesen?«
Das hieß meinen Vater an einer seiner schwächsten Seiten anfassen, an der Begeisterung, welche er den Erinnerungen vaterländischer Heldensage weihte.
»Diplomatin du!« gab er lachend zur Antwort.
»Ach nein,« versetzte meine Mutter abwehrend. »Ich weiß und will nichts von der Diplomatie. Ich verlasse mich lediglich auf mein Muttergefühl. Das sagt mir, daß der Name Michel ein Unglück für den Knaben sei, weil voll der übelsten Vorbedeutung. Was kann aus einem Michel werden?«
»Etwas Rechtes, liebes Kind, etwas Rechtes!« erwiderte mein Vater eifrig.
Und indem er die Pfeife fest mit den Zähnen packte und mit dem Zeigefinger der rechten Hand demonstrierend auf die innere Fläche der ausgestreckten tippte, fuhr er fort:
»Ich muß dir sagen, Gertrud, du hegst da in der Tat einen wunderlichen Aberglauben. Der Name Michel sei von übler Vorbedeutung, meinst du? Welcher krasse Irrtum! Als ob ich dem Jungen den Namen nicht mit rechtem und reiflichem Vorbedacht gegeben hätte!«
»Ja, mir zum Ärger.«
»Trudchen, Trudchen, jetzt sieh, das glaubst du selber nicht.«
»Hm,« murmelte meine Mutter, und ihr Stuhl entfernte sich immer weiter von dem ihres Eheherrn.
»Nicht dir zum Ärger, Gertrud, sondern weil ich der Hoffnung lebte, daß zwar nicht ich selber, wohl aber unser Junge eine Zeit erleben werde, wo jeder Deutsche stolz sein würde, ein deutscher Michel zu heißen.«
»Warum nicht gar!«
»Alles Ernstes! Das in unserer Zeit bei der Namengebung ohne allen Sinn und Verstand, ohne alles vaterländische Gefühl verfahren werde, haben verständige und patriotische Männer längst gerügt. Es ist ganz und gar nicht unwichtig, was für einen Namen der Mensch trage.«
»Da hast du leider nur zu recht!«
»Als mir daher meine selige Mutter den großen, kräftigen Jungen, den du mir Glücklichem gegeben, zuerst in die Arme legte und du von deinem Bette her voll Freude flüstertest: ›'s ist ein starker Bub', liebster Fritz!‹ und der Bursch gar nicht weinerlich tat, sondern mich mit seinen dunklen Augen frisch und keck anguckte, und mit seinen Händchen nach meinem Backenbart zu langen versuchte, da beschloß ich bei mir: Der soll Michel heißen!«
»Eine höchst vortreffliche und glückliche Namenwahl... in der Tat!«
Meine Mutter bemühte sich offenbar nach Kräften, diese Einschaltung spöttisch zu betonen, aber es ging nicht recht; die in den letzten Worten meines Vaters liegende Erinnerung an eine Stunde voll Mutterseligkeit ließ es nicht zu.
»Eine vortreffliche und glückliche Namenwahl allerdings!« bestätigte mein Vater mit Nachdruck.
»Ei ja doch!«
»Freilich, freilich. Sträube dich immerhin, Trudchen; aber sieh, du bist zuletzt doch viel zu verständig, um einer augenscheinlichen Tatsache widersprechen zu wollen.«
»Geh doch!«
»Im Gegenteil, ich komme erst angerückt, liebes Kind, und zwar an der Spitze einer ganzen Armee schwerbewaffneter Gründe.«
»Verschone mich! Ich bin wahrhaftig nicht zum Scherzen aufgelegt.«
»Ich ebensowenig. Zwar hat, wie du weißt, eine gütige Fee... nein, zum Henker mit den Feen! 's ist keltisch-französisches Lumpenzeug ... also eine Elfin hat mir, wofür den Göttern Lob und Preis sei, den Humor als unzerstörbares Angebinde in die Wiege gelegt, allein dessenungeachtet werde ich wissenschaftliche Gegenstände stets mit dem gebührenden Ernste behandeln.«
»Du lieber Gott, als ob der Name Michel etwas mit der Wissenschaft zu tun hätte.«
»Siehst du, jetzt paßt mal wieder Schillers Satz: Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort – wie angemessen auf dich, liebe Alte ...«
Der Widerspruch in dieser Äußerung wirkte so komisch, daß ich ums Haar in ein lautes Lachen ausgeplatzt wäre. Meine Mutter empfand den prickelnden Reiz ebenfalls und vermochte ihm nicht ganz zu widerstehen.
Ihr Lachen hatte etwas Anmutiges, Ach, alles an ihr war anmutig – sogar ihr Schmollen.
Mein Vater in seiner demonstrativen Laune fuhr dozierend fort:
»Es ist festgestellt und meines Wissens auch gar nirgends bestritten, daß das altdeutsche Wort michel durchaus identisch ist, nämlich dem Sinne nach, mit unserm norddeutschen Wort stark, gewaltig, mächtig, riesenhaft. Bei unseren mittelhochdeutschen Dichtern finden sich die Belegstellen genug dafür. So z. B. sagt Hartmann von der Aue, der Wieland des Mittelalters, in seinem Iwein ›der michel Knabe‹ und in seinem Crek ›der michel Mann‹, wo er nach unserm heutigen Sprachgebrauch in jenem Falle gesagt hätte ›der Riesenknabe‹, in diesem der ›Riese‹. Ausdrücke, wie ›es nimmt mich michel wunder‹ für ›es nimmt mich gewaltig wunder‹ und andere dergleichen, wo sich mit dem Wort michel immer der Begriff des Bedeutenden, Starken, Gewaltigen, Ungewöhnlichen verbindet, sind in unserer mittelhochdeutschen Literatur gang und gäbe. Ich werde dir das bei nächster Gelegenheit an Dutzenden von Beispielen schwarz auf weiß beweisen. Und so wäre denn dargetan, wie ganz irrtümlich deine Meinung war, der Name unseres Jungen sei von mißlicher Bedeutung und übler Vorbedeutung. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil, der Name Michel ist von sinniger Bedeutung, voll glücklicher Vorbedeutung, ist ein rechter Kern- und Ehrenname. Die Sache ist dir jetzt klar, völlig klar, nicht wahr?«
»O ja, sie ist mir klar, völlig klar, das heißt, ich weiß jetzt, daß mein armer Junge den abscheulichen Namen nicht loswerden soll.«
Mein Vater zuckte die Achseln, und meine Mutter versank in eine schwermütige Träumerei. Was mich angeht, so wurde es mir in meinem Laubversteck allmählich bedenklich ungemütlich und langweilig zumute. Ich durfte es aber doch nicht wagen, dasselbe zu verlassen, da mein Rückzug kaum unbemerkt bewerkstelligt werden konnte. An einem und demselben Tage als weggejagter Lyzeist und als Horcher zu erscheinen, mochte ich nicht auf mich nehmen. Die Unbehaglichkeit meiner Lage zu erhöhen, hing auf ein paar Armlängen weit ein prachtvoller Apfel lockend vor mir. Einladender konnte der weltberühmte Apfel, womit Frau Eva ihren Gemahl weiland im Paradiese betörte, unmöglich ausgesehen haben. Die Beute zu ergattern, reckte und dehnte ich meine Gelenke, als wären es die einer Katze; aber umsonst, denn zu weit über den Ast hinaus durfte ich mich nicht wagen, weil derselbe gerade über dem Gartentische stand und demnach die Entdeckung des »enfant terrible« durch eines der elterlichen Augen fast unausbleiblich gewesen wäre.
Während ich so die Qualen des armen Tantalus, welche mich in der Objektivität, womit der alte Rektor bei Gelegenheit davon gesprochen, ziemlich ungerührt gelassen hatten, zu meinem großen Mißvergnügen subjektiv durchkostete, hob drunten das Gespräch wieder an.
Mein Vater blätterte in seinen Akten, meine Mutter saß mit gesenktem Haupte und über den Knien gefalteten Händen. Sie mußte sich tief in ihre Gedanken und Erinnerungen versenkt haben, denn sonst hätte sie nicht so lange müßig sitzen können. Mit einem schweren Seufzer sagte sie jetzt: »Ich bleibe dabei, lieber Fritz; der Knab' war von Anfang an zum Unglück bestimmt, von der Taufe, von der Geburt an, ja schon ...,«
Sie stockte errötend und brach ab.
»Erinnerst du dich noch jener Mainacht,« fuhr meine Mutter zögernd und leise fort – »wo uns das furchtbare Gewitter im Park überraschte? Ich war dir entgegengegangen, du kamst spät. ...«
Ein heller Schimmer ging über die Stirne meines Vaters. Er blickte mit zärtlichem Lächeln zu der Mutter hinüber, schob den Aktenfaszikel zurück und begann nach einer alten Melodie, die er häufig pfiff und summte, mit seiner sonoren Stimme halblaut zu singen:
»Unter der Linden An der Heide Die Blumen auf dem grünen Grund Sie mögen es künden, Wo wir beide Gefeiert unsrer Liebe Bund. Vor dem Wald im stillen Tal – Tandaradei – Sang dazu die Nachtigall.«
»Pst, Pst!« machte meine Mutter, ganz Purpur im Gesicht und die Hände abwehrend gegen den Vater ausstreckend. Dann setzte sie, wie um ihre Verlegenheit zu bemeistern, rasch hinzu:
»Es war auch gar keine Linde.«
»Keine Linde, Trudchen? Was denn?«
»Ein Traubenkirschbaum.«
»Welche Idee!«
»Ja, dir und deinem Walter von der Vogelweide zum Trotz, es war ein Traubenkirschbaum.«
»Opposition muß sein! Aber du machst mir nichts weis, liebes Kind. Ich weiß noch alles, als wär's gestern abend gewesen.«
»Still! ich bitte dich.«
»Warum denn? Ich hatte noch spät am Abend nach dem Girlitzer Pachthof hinüber gemußt. Du hattest mir versprochen, mir bis zur kleinen Hinterpforte des Parkes entgegenzukommen, und du hieltest Wort. Du warst damals erst seit acht Tagen, was du noch heute bist, mein Goldtrudchen, mein Herzensweib. Als ich das Pförtchen hinter mir hatte, sah ich dein weißes Kleid unter den tiefgesenkten Ästen der Linde hervorschimmern ...«
»Des Traubenkirschbaums, willst du sagen, lieber Fritz.«
»Es war eine wundervolle Nacht, lau, lind, voll rauschender Düfte. Im Waldgrund drunten schlugen zärtlich die Nachtigallen, silbern lugte dann und wann der Mond durch tauschweres Gewölke; es war, als hörte man die große Lebensmutter Natur wie in glücklichen Träumen leise aufatmen; fernab ein Wetterleuchten, sonst aber alles heilige Ruhe.«
»Aber das schreckliche Gewitter, welches so rasch heranzog ...«
»Was tat es? Mir war es, wie vormals den frommen Griechen, nur ein günstiges Omen mehr, daß Zeus donnerte. Du warst so schön und hold und gut. Duftstreuend rauschte uns zu Häupten die blühende Linde ...«
»Der Traubenkirschbaum! Soll ich denn immer unrecht haben?«
»O, es war eine Linde, ganz gewiß, Kind. Mir fielen ja dabei alle die herzigen Worte ein, welche unsere Minnesänger und unsere alten Volkslieder zum Lob und Preis des deutschen Lieblingsbaumes gesungen und gesagt haben. Denn sieh, Schatz, es ist eine ganz dumme Meinung, wenn man glaubt, die Eiche sei der alte Lieblingsbaum unseres Volkes gewesen. Dieses Vorurteil wurde erst durch die Klopstocksche Bardenschule aufgebracht. Unsere echte alte Dichtung dagegen feiert immer und überall die Linde. Eine Linde beschattete die Burghöfe, unter einer Linde tanzte die Dorfjugend. Die herzförmige Form der Blätter dieses Baumes, seine bergende Schattenfülle, sein süßer Duft machte ihn recht eigentlich zum Baum der Liebenden ...«
»Das ist alles recht gut und schon, lieber Fritz, aber es war doch keine Linde – die Linden blühen gar nicht so frühzeitig – sondern, wie gesagt, ein Traubenkirschbaum.«
»Nun denn, in's Drei ...« wollte mein Vater auffahren. Aber er besann sich, lachte laut und sagte: »Wahrlich, Schatz, von dir gilt der lateinische Spruch: »varium et mutabile semper feminarum genus« keineswegs; du bleibst beharrlich und charakterfest.«
Und nach einer Weile fügte er mit jenem weichen und zärtlichen Ton, wie nur er denselben in der Brust hatte, hinzu:
»Lindenbaum oder Traubenkirschbaum – einerlei. Er beschattete ein glückliches Paar. War es nicht eine selige Stunde, Gertrud?«
Meiner Mutter Stuhl hatte sich im Verlaufe des Gespräches allmählich so weit von dem meines Vaters entfernt, daß sie auf der entgegengesetzten Seite des Gartentisches saß. Als aber jetzt der Varer ihr über den Tisch hinüber die Hand hinbot, lag in dieser Gebärde doch so viel Magnetismus, daß die Gute nicht umhin konnte, ihre Linke in die dargebotene Rechte des Gatten zu legen, wenn auch mit etwelchem Zögern.
»Denkst du noch der Stunde, Trudchen?« fragte mein Vater. »War sie nicht schön?«
Meiner Mutter Stuhl folgte dem sanften Zwange, welchen die Hand meines Vaters ausübte, und näherte sich diesem. Aber nur noch einen Schritt von demselben entfernt, stand er wieder still.
»Ist es nicht eine schönste Stunde einer schönen Zeit gewesen, Trudchen?« wiederholte mein Vater.
»Doch, doch, Alterle,« gab meine Mutter zur Antwort. »Aber Recht muß trotzdem Recht bleiben: es war ein Traubenkirschbaum, verlaß dich drauf. Ich habe noch lange Zeit nachher seines eigentümlichen Duftes nicht vergessen können.«
»Ja, liebes Kind, Lindenblütenduft ist ebenso süß als stark.«
»Lindenblütenduft? Geh doch mit deiner ewigen Linde!«
»Na, sei es, dir zu Gefallen, Trudchen. Also es war ein Traubenkirschbaum ...«
»Traubenkirschbaum oder Lindenbaum, meinetwegen was du willst. Aber eins weiß ich.«
»Was?«
»Daß es ein Unglücksbaum war.«
»Ein Unglücksbaum? Nun lieber gar!«
»Ja, ein Unglücksbaum.«
»Aber wie kannst du die Erinnerung an jene Stunde des Glückes mit einer solchen Vorstellung verknüpfen?«
»Es war auch eine unglückliche Stunde.«
»Me miserum! Vor einem Augenblick sagtest du ja das bare Gegenteil.«
»Was tut man nicht alles einem lieben Manne zu Gefallen, um ihm jeden Schatten von Grund zu entziehen, zu glauben oder gar zu sagen, man sei eine Widerbellerin.«
»O! O!«
Nach einer Pause sagte meine Mutter flüsternd:
»Jener schreckliche Donnerschlag, weißt du noch?»«
»Freilich, freilich, und ich wiederhole: Zeus donnerte, es war ein glückliches Omen.«
»Ach nein, lieber Fritz.«
»Warum denn nicht, Trudchen? Wie kann man so unklassisch denken?«
»Siehst du, lieber Mann, ich wurde damals sogleich von trüben Ahnungen erfüllt ... Es hätte auch nicht sein sollen, denn ... nun, ich weiß, was ich weiß, und ... kurzum, es schickte sich nicht.«
»Im Gegenteil, Trudchen,« versetzte mein Vater lachend, »es schickte sich ganz gut, weißt du?«
»Böser Mann,« sagte meine Mutter, ihr glühendes Gesicht an der Schulter meines Vaters verbergend ... »Siehst du, seit unser Knabe zur Welt kam, haben sich alle meine unglücklichen Ahnungen bestätigt. Jene unglückselige Gewitternacht ...«
»Versündige dich nicht, Gertrud. Dein Liebling Jean Paul würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüßte, wie gewaltsam du dich anstrengst, dir eine schöne Erinnerung zu vergällen. Sieh, Kind, das nenne ich eine Sünde. Aber ich weiß, es ist dir damit gar nicht Ernst. Du stellst dich nur so an, weil du heute etwas übriges tun zu müssen glaubtest, um meiner Disputierlust gerecht zu werden. Ich kenne das. Aber komm, es ist Zeit, daß unser trojanischer Krieg für heute ein Ende nehme. Komm, Trudchen, und küsse mich zum Friedensschluß; küsse mich so, wie damals unter der Linde ... nein, unter dem Traubenkirschbaum ... in jener gesegneten Mainacht.«
Meine Mutter wollte abwehrend den Kopf schütteln, aber es ging nicht recht und, wenn auch zögernd, neigte sie ihr schönes Antlitz doch allmählich gewährend dem des Gatten zu.
»Jetzt oder nie!« dachte ich. »Wart', du verdammter Apfel, ich krieg' dich!«
Und mit einer verzweifelten Anstrengung schnellte ich meinen Oberkörper hinter dem Stamm hervor, weit auf den Ast hinaus. Aber meine Hast verdarb alles, mir den Apfelraub und denen drunten noch etwas Besseres.
Der unvorsichtige Stoß meines Armes machte zwar den Apfel fallen, aber leider nicht mir in die Hand, sondern abwärts. Erschrocken hinter den Baumstamm zurückfahrend hörte ich von drunten einen Plumps. Die elterliche Gruppe stob so heftig auseinander, daß die Stühle umgeworfen wurden. Vater und Mutter schrien laut auf, und in diesen Aufschrei mischte sich ein helles Kinderlachen.
Der höllische Apfel war klatschend in das große Tintenfaß auf dem Tisch gefallen und hatte die Gesichter und Kleider meiner Eltern mit schwarzem Naß reichlichst überspritzt.
Ein allerliebstes Mädchen, meine zwölfjährige Schwester Hildegard, kam, den runden Strohhut im Nacken, die dunkeln Locken verworren um die Schultern fliegend, über den Rasenplatz gesprungen, schlug die kleinen Hände zusammen und rief lachend:
»Herr Jesus, Mama, Papa, wie seht ihr aus!«
»Garstig genug, ohne Zweifel,« sagte mein Vater, sich eifrig Stirne und Wangen abwischend und dadurch den Schatten nur noch größer machend. »Wer hätte geglaubt, daß die Reinetten schon so reif wären?«
Dann setzte er hell auflachend hinzu:
»Bei Wodan und Frouwa, Trudchen, du siehst auf und eben einer Schwarzelfin gleich.«
»Aber wenn du erst dich sähest, lieber Alter,« versetzte die Mutter, und beide stimmten sie in das schmetternde Lachen ihres Töchterchens ein.
Unter dem Lärm dieser allgemeinen Fröhlichkeit bewerkstelligte ich unbemerkt meinen Rückzug. Nachdem ich mich an der Hinterseite des Apfelbaumes hatte niedergleiten lassen, machte ich es ohne Umstände wie Seumes Kanadier, der »Europens übertünchte Höflichkeit« nicht kannte und sich »seitwärts in die Büsche« schlug.
Drittes Kapitel.
Ein Frühgang. – Das Raben-Orakel. – Eine Landschaft. – Ketzerische Ansicht über das Money-making-Dogma unserer Tage. – »Zieh deine Schuhe aus, denn du trittst auf heiligen Grund!« – Keine Regel ohne Ausnahme. – Die Beichte eines weggejagten Lyzeisten.
»Laß los, Berthold! oder ...«
»Sachte, sachte,« entgegnete eine Stimme, welche nicht die meines Kameraden Berthold war, mit dem ich, wie so oft im Wachen, jetzt im Traume in einem heftigen Faust- und Ringkampf begriffen gewesen.
»Ah, du bist's, Vater?« fragte ich, mir den kriegerischen Traum aus den Augen reibend und mich im Bette aufrichtend.
»Ja, Bursch. Steh auf und zieh dich an, aber mach kein Geräusch, denn die Mutter schläft noch.«
Ich gehorchte rasch, denn der Ernst auf meines zum Ausgehen angekleideten Vaters Stirne machte jedes Zaudern, Zögern und Fragen unratsam.
Wir gingen. Als wir an der Schlafkammer meines Schwesterchens vorbeikamen, hörten wir Hildegard drinnen laut ihr Morgengebet sprechen. Sie mußte trotz unseres sachten Auftretens unsere Schritte vernommen haben, denn sie öffnete ihre Türe halb, streckte ihr rosiges Gesichtchen heraus und rief uns mit gedämpfter Stimme nach:
»Guten Tag! Wohin schon? Darf ich nicht mit, Papa?«
»Nein, Kind,« erwiderte mein Vater leise. »Ich habe mit dem Michel ein Geschäft vor. Mache deine Zöpfe zurecht, Liebchen, und sorge, daß die Mutter beim Erwachen einen frischen Blumenstrauß auf ihrer Bettdecke finde. Das freut sie, weißt du?«
Wir stiegen vorsichtig die gewundene Treppe hinab und traten durch die Hintertür in den Garten hinaus. Während wir den Mittelgang hinabschritten, machte das kleine Mädchen droben neugierig ihr Kammerfenster auf, bog sich heraus und sang uns mit schelmischer Stimme die Anfangsworte einer alten Volksballade nach:
»Es ritten zwei Reiter früh am Tag Durch Nebel und Morgengrauen. Gilt's einem Feind mit Stoß und Schlag? Gilt's einer schönen Frauen?«
»Die kleine neugierige Hexe!« murmelte mein Vater lächelnd. Aber sogleich wurde sein Gesicht wieder ernst, und rasch ausschreitend winkte er mir, ihm zur Seite zu bleiben.
Unser Garten wurde durch den Plankenzaun des freiherrlichen Parkes begrenzt. Der Vater öffnete mit einem Schlüssel, den er bei sich trug, die schmale Bohlentüre, die sich hier befand. Wir schlugen aber nicht den Weg ein, welcher rechtshin nach dem Schlosse führte, dessen stolze Türme in einiger Entfernung aus den Baumgruppen hervorragten, sondern verfolgten in entgegengesetzter Richtung einen schmaleren Pfad. Der Morgennebel strich schwerfällig durch die schon in ihren bunten Herbstfärbungen prangenden Baumwipfel und bedeckte rings den Rasen mit seinem feuchten Geriesel.
Wir kamen an dem sogenannten Krähenhorst vorbei, einer einsamen Stelle des Parkes, wo von alters her auf uralten Bäumen eine Kolonie von Krähen und Raben ungestört ihre Wirtschaft trieb. Die Vögel waren schon auf und schwatzten und krächzten da droben bunt durcheinander. Wahrscheinlich hatten die Tiere meinen Vater gewittert, der ihr großer Gönner war.
»Aha,« sagte er stillstehend, »die schwarzen Herren singen schon ihre Morgenvigilie und, richtig, da ist ja auch Se. Gnaden, der Herr Abt.«
Mein Vater behauptete nämlich, das Gemeinwesen dieser Vögel sei ganz entschieden ein klösterliches, aber das Krähenkloster sei sehr verständigerweise so eingerichtet wie dem Rabelais zufolge Gargantua dem Bruder Jehan ein Kloster errichten ließ. Mein Vater nannte daher den uralten Raben, der hart vor uns auf einem der niedrigsten Äste einer riesenhaften Ulme saß, nicht anders als Bruder Jehan und begrüßte denselben auch jetzt mit diesem Namen.
Der würdige alte Herr, in der Rentei ein oft und gern gesehener Gast, erwiderte den Morgengruß seines Gönners in seiner Manier. Er sträubte seine altersgrauen Halsfedern, reckte den Kopf weit vor, rührte höflich ein wenig die Flügel, blinzelte gescheit, klappte den Schnabel auf und zu und stieß ein recht gemütliches Kwah-Kwah aus.
»Michel,« sagte mein Vater ernsthaft zu mir, »frage den Herrn Abt, ob unser Vorhaben einen günstigen Erfolg haben werde.«
»Was für ein Vorhaben, Vater?«
»Das geht dich einstweilen nichts an, Junge.«
Da ich meines Vaters echter Sohn, das heißt ebenfalls nicht ohne eine Ader von Humor war und überdies triftige Gründe hatte, heute sehr folgsam zu sein, tat ich, wie mir befohlen worden. Ich stellte mich in Positur, zog die Mütze, machte einen Kratzfuß und fragte den alten Kerl von Raben:
»Was meinst du, hochwürdiger Bruder Jehan, wird unser Vorhaben gut ausfallen?«
Der Herr Abt blinzelte uns nur so von der Seite an, ließ ein kurzes, heiseres Gekoller hören, schüttelte verachtungsvoll sein Gefieder und schickte sich an, den Kopf unter seinen rechten Flügel zu stecken, als ob er gar nichts davon wissen wollte. Dann besann er sich eines anderen, lugte meinen Vater wie fragend an und fuhr mit seinem mächtigen Schnabel wetzend auf dem Ast hin und her.
»Ah, Bruder Jehan,« rief mein Vater lachend und in seine Rocktasche greifend, »ich will nicht Helmut heißen, wenn du nicht gerader Linie von Odins Raben Hugin und Munin abstammst: so klug bist du. Du weißt sicherlich, daß noch zu keiner Zeit ein Gott oder ein Priester gratis einen Orakelspruch gespendet hat. Sieh da!«
Der Abt hatte kaum den Käsebrocken erblickt, welchen mein Vater zwischen den Fingern hielt, als er sich mit einer Lebhaftigkeit gebärdete, die der klösterlichen Gravität nicht ganz angemessen war. Mein Vater warf ihm den Brocken zu, welchen er geschickt mit dem Schnabel auffing. Statt aber gierig in die Beute einzuhacken, bewährte jetzt der alte Kerl seine Bildung. Er legte den Käse säuberlich auf den Ast, setzte einen seiner mit Schwielen bedeckten Füße darauf und nickte mir zu, als wäre er bereit, die verlangte Auskunft zu erteilen.
»Wiederhole deine Frage, Michel,« sagte mein Vater.
Ich gehorchte, das Lachen verbeißend.
Bruder Jehan nahm eine höchst tiefsinnige Miene an, wiegte den Kopf bedächtig hin und her, schloß die Augen, riß sie dann weit auf, schlug mit den Flügeln und stieß ein dreimaliges, lustig gellendes Kwah aus, welches man mit etwelcher Anstrengung der Phantasie allerdings für eine bejahende Antwort nehmen konnte.
»Accipe omen, mi fili!« sagte mein Vater und ging weiter.
Mein Vater hatte ganz eigene Ansichten über den Zusammenhang der Dinge, und so sagte er denn, als er bemerkte, daß mir die Begegnung mit dem alten Raben spaßhaft vorkam:
»Du brauchst gar nicht zu lachen, Junge, und kannst dir bei dieser Gelegenheit merken, daß es töricht ist, zu glauben, die Menschen hätten, wie man zu sagen pflegt, alle Weisheit allein gefressen. Der Bruder Jehan hat hundert Jahre und vielleicht noch länger gelebt, er müßte keine so gescheite Kreatur sein, wie er ist, wenn er sich über das, was er alles gesehen und erlebt, nicht seine Gedanken gemacht hätte. Es ist etwas Dämonisches in manchen Tierarten, etwas, was den Tierkult, wie er von mehreren alten Völkern geübt wurde, wahrscheinlich viel weniger albern und lächerlich erscheinen ließe, wenn wir genauer darüber unterrichtet wären. Unsere germanischen Altvordern bedienten sich des Gewiehers der Rosse zur Orakeleinholung, was einen gar nicht sehr verwundern kann, falls man bedenkt, das noch heutzutage manches Pferd mehr denkt und klüger ist als sein Reiter.«
Da ich die Art meines Vaters kannte, machte ich mich auf eine einläßliche Abhandlung über das Pferdeorakel der alten Germanen gefaßt – ein Thema, welches mich, offen gestanden, um so weniger interessierte, als mich die lebhafte Neugierde plagte, zu erfahren, was denn dieser frühe Morgengang eigentlich zu bedeuten habe.
Mein Vater schien jedoch keineswegs aufgelegt, heute sein bereits halb und halb gesatteltes germanistisches Steckenpferd zu besteigen. Er schritt mir rasch und schweigend voran, abwärts an dem hellen Forellenbach, welcher den kleinen See in der Nähe des Schlosses speist, dann in vielfachen Windungen den Park durchfließt und da, wo er aus demselben heraustritt, einen schönen Wasserfall bildet, um, noch wild von dem Sprunge über die Felsen, etwas weiter unten auf die Räder der Dorfmühle sich zu stürzen. Diese liegt ein paar Büchsenschüsse von den zerstreuten Häusergruppen unseres stattlichen Dorfes entfernt, in einem engen Tälchen voll malerischer Felspartien. Zwischen diesen und den buchenbekronten Hügeln windet sich der Bach in eine finstere Schlucht hinein, hinter welcher rechts und links hohe, tannenbewachsene Bergwände steil ansteigen. Von der Höhe derselben sieht man nach Süden und Westen weit in das offene Land hinaus und kann da und dort den Spiegel des großen Stromes blitzen sehen, welchem die vielen Wasser unserer Berge tributbar sind. An hellen Tagen macht sich den dort oben Stehenden am südlichen Saume des Horizonts ein weißer, mannigfach gezackter Streifen bemerkbar, welchen der Unkundige für einen Wolkengürtel nehmen könnte. Es sind aber die Alpen. Noch jetzt erinnere ich mich lebhaft des großen Eindrucks, welchen ich empfing, als mein Knabenauge zum erstenmal von dort herab die Alpenfirnen im Strahl der untergehenden Sonne purpurn erglühen sah. »Ist dort der Himmel?« hatte ich damals meinen Vater gefragt. »Ein Stück zur Erde gefallenen Himmels jedenfalls,« hatte er mir zur Antwort gegeben. – Mein Vater lebte und webte in und mit der Natur, und er versäumte keine Gelegenheit, das eigene rege Naturgefühl auch in seinen Kindern wach zu rufen und zu nähren. Er lehrte uns in dem Wechsel der Jahreszeiten, in der Gestirne Auf- und Niedergang, in dem erhabenen Schweigen der Winterlandschaft wie in der heiligen Stille der Sommermondnacht, im Blütenjubel des Frühlings wie in der wehmütig milden Ruhe sonniger Herbsttage das Walten von Göttlichem erkennen.
Wir überschritten den Steg, welcher unterhalb der Mühle über den tief in seinem felsigen Bett rauschenden Bach führt, und stiegen drüben den Hügel hinan, welcher, an der Westseite des Dorfes weit in das Tal vorspringend, die schone alte Dorfkirche trägt. Zwei Steinlinden beschatten die Vorhalle, und rings um das Gotteshaus zieht sich der Friedhof mit seinen bescheidenen ländlichen Denkmalen. Er ist mit einer Mauer eingefaßt, und eine feste Lage verschaffte ihm in den französischen Revolutionskriegen zweimal die traurige Ehre, blutigen Gefechten zwischen den Kaiserlichen und den Franzosen zum Schauplatz zu dienen.
Es ist ein stiller, schöner Platz und könnte einen deutschen Gray wohl zu einer Dorfkirchhofs-Elegie anregen. Aber die Zeit der Elegien ist ja überhaupt vorbei. Von rastloser Sorge für die Gegenwart gestachelt, von unruhvollem Bangen vor der Zukunft gequält, haben die Menschen nicht mehr Zeit, Vergangenes zu betrauern und zu beklagen. Sie müssen hastig leben, fieberhaft hastig, um in dem ungeheuren Wirbel, in dem atemlosen Wettlauf der Konkurrenz nicht zurückzubleiben. Wie wäre da ein wehmütig-liebevoller Rückblick auf Gewesenes erlaubt oder auch nur möglich? Laßt die Toten ihre Toten begraben und – schon der Prediger Salomo sagte es – besser ein lebendiger Hund als ein toter Löwe! Man könnte leicht zu dem Glauben kommen, die Hunde hätten sich das seither so gut gemerkt, daß sie gar keinen Löwen mehr aufkommen lassen.
Über die niedrige Einfassungsmauer des Friedhofs hinweg hört man drunten im Talgrund rauschend die Mühle gehen. Drüben linkshin irrt der Blick in einem Labyrinth von waldigen Bergjochen und kühnen Felskuppen, aus deren bizarrem Durcheinander der Geolog ein Stück Urgeschichte der Erde herauslesen mag; sonstige Beschauer werden daran sich erfreuen als an einer malerischen Gebirgspartie. Wenden sie das Auge weiter zur Rechten, so dacht sich dort der Bergzug zu einer Hochebene ab, deren ganzer Raum, von hier aus gesehen, von dem Park eingenommen erscheint, welcher das Schloß des freiherrlichen Geschlechtes von Rothenfluh umgibt. Noch weiter rechtshin fällt das Plateau zu einer weiten Niederung ab, in welcher in einem langgestreckten Halbbogen das Dorf liegt, dessen rotbraune Dächer und weißgraue Giebel zur Sommerzeit in dem Blättergrün seines Obstbaumwaldes fast verschwinden. Gegen Morgen und Mittag zu läuft das Tal in ein fruchtbares Acker- und Wiesengelände aus, und gegen Abend springt, wie schon erwähnt, der Kirchenhügel vor, dessen südliche Wand mit Rebenpflanzungen bedeckt ist. Die ganze Dorfmark trägt den Charakter behaglicher Abgeschlossenheit und idyllischen Friedens, und dieser Charakter dürfte noch lange vor Beeinträchtigung um so mehr geschützt sein, als die etwa eine Wegstunde entfernt südwärts in der Ebene gelegene kleine Stadt zu den stillsten im Lande gehört. Sie war vormals der Sitz eines Domkapitels, einer Deutschherrenballei und ist jetzt noch der eines adeligen Fräuleinstiftes. Von alters her ist ihr das Gepräge geistlicher Beschaulichkeit geblieben, und es hat noch heute gar nicht den Anschein, als würde sie desselben sobald, wenn überhaupt jemals, verlustig gehen. Die Bekenner des Money-making-Dogmas, die Gläubiger der Busineß-Kirche unserer Tage, mögen über solche »Verrottung« mitleidig die Achseln zucken; aber irre ich nicht, so dürften unsere Nachkommen froh sein, in der industriellen Wüste dereinst da und dort noch so eine Oase anzutreffen, wo keine Dampfmaschine keucht, keine Lokomotive poltert, die Kinder nicht skrophulös sind und die Erwachsenen noch rote Backen haben. Ich habe von unserer mit Leib und Seele einem dämonischen Erwerbstrieb verfallenen Zeit industrieller Herrlichkeit genug gesehen, um diese Prophezeiung nicht für eine allzu kühne zu halten.
Die Morgensonne glänzte siegreich über den talwärts gedrückten Nebelschwaden, als wir den Friedhof betreten hatten. Ihre Strahlen spielten auch auf den feuchten Blättern der Astern und anderer Herbstblumen, welche einen sorgfältig gepflegten Grabhügel krönten. Die Zweige einer Trauerweide hingen darüber her, und inmitten der Blumen erhob sich ein einfaches Kreuz von grauem Sandstein. Auf dem Querbalken waren die Worte: »Hinc surrectura« eingemeißelt. Die Stelle war mir wohl bekannt und teuer.
Mein Vater näherte sich diesem Orte nie, ohne daß seine Züge den Ausdruck ehrfurchtsvoller Trauer getragen hätten. Heute jedoch war seine Miene eine besonders feierliche, und als er nun zu mir sagte: »Ziehe deine Schuhe ans, mein Sohn, denn du trittst auf heiligen Grund!« da klang seine Stimme so eindringlich, daß ich dem seltsamen Befehl ohne Zögern nachkam.
»Lege deine Rechte auf das Grabkreuz,« fuhr mein Vater fort. »Du weißt, hier schläft den langen Schlaf eine, die mich und dich sehr geliebt hat.«
»Deine Mutter, Vater, meine liebe, liebe Großmutter,« versetzte ich, von dem feierlichen Wesen meines Vaters unwillkürlich mit ergriffen.
»Und erinnerst du dich noch, Michel, welche Lehre die Gute dir so oft eingeschärft hat, zuletzt noch auf ihrem Sterbebette?«
»Ehre Vater und Mutter und lüge nie!«
»Gut, mein Knabe. Bei der Erinnerung an alle die Liebe, welche dir die Tote erwiesen, bei der Ehrfurcht, welche du ihrem Andenken schuldest, bei diesem Grab und bei der Sonne da oben beschwör' ich dich und fordere dich auf, mir zu dieser Stunde die Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen!«
»Ich will es, Vater.«
Die feierliche Beschwörung wirkte auf mich wie ein Anhauch von Poesie. Mir war andächtig zumute. Das Bild meiner geliebten Großmutter, der ehrwürdigen Greisin mit den schneeweißen Haaren, stand wie leiblich vor mir. Ich glaubte den Blick ihrer noch im hohen Alter schönen Augen wieder auf mir ruhen zu fühlen, so sanft und zärtlich, wie er in den Tagen der Kindheit mich behütet, beschwichtigt, gesegnet hatte ... Ich habe vielfache Ursache, meinem Geschick mich dankbar zu bezeigen. Schon deshalb, weil es, mir eine Jugend gegönnt, deren Glück so ziemlich nur von mir selber getrübt wurde. Versenke ich mich in die Erinnerungen jener Jahre, so muß ich betonen, daß ich unter dem vielen Guten und Schönen, was das elterliche Haus mir gewahrte, auch des seltenen Anblicks genoß, daß selbst Schwiegermutter und Schwiegertochter unter einem Dache in bester Harmonie lebten – gewiß eine Ausnahme von einer leidigen Regel. Nur zuweilen konnte es scheinen, als ob sich für Augenblicke etwas wie Eifersucht in der Seele meiner Mutter regte, wenn sie sah, mit welcher unendlichen Verehrung und Zärtlichkeit ihr Gatte seine Mutter behandelte. Mein Vater fühlte das, selbst in jener bittern Stunde, wo seine angebetete Mutter in seinen Armen ihren letzten Atemzug verhaucht hatte. Wie im Innersten gebrochen, saß er lange regungslos neben der Toten, scheinbar teilnahmlos für alles, was um ihn vorging, teilnahmlos auch für meine Mutter, die mit uns Kindern leise weinte. Zufällig aufblickend, mochte mein Vater hinter dem Tränenschleier ihrer Augen etwas wie leisen eifersüchtigen Vorwurf erblicken, und seine Herzensgüte machte ihn die Erstarrung des bittersten Kummers überwinden. Er stand auf, ging um das Bett herum, neigte sich zu meiner Mutter herab, küßte ihre nassen Augen und sagte weich: »Sie ist gegangen, aber sie hat mir dich zurückgelassen, Gertrud – es ist alles gut...«
»Ich lese in deinen Augen, daß deine Versicherung aufrichtig gemeint ist,« fuhr mein Vater fort, mich fest, aber liebevoll anblickend. »Du kennst den innigsten Herzenswunsch deiner Mutter, Michel?«
»Ja, Vater. Sie wünscht, daß ich ein Geistlicher werde.«
»Und du? Vermagst du es? Du bist jetzt alt genug, um wenigstens einigermaßen zu begreifen, was es heißen will, ein Priester zu werden. Fühlst du Trieb und Kraft genug in dir, die Pflichten dieses Berufes auf dich zu nehmen? Vermagst du es, mein Junge?«
»Ich will es versuchen, Vater.«
»Der Mutter zuliebe?«
»Der Mutter zuliebe.«
»Knabe, bedenke wohl, was du sprichst. Diese Stunde kann für dein ganzes Leben entscheidend sein. Du sollst nicht gezwungen werden.«
»Ich will es freiwillig versuchen, Vater. Als im letzten Herbst des Müllers Gregor in der Kirche dort seine Primiz hielt und nach beendetem Hochamt alles der Müllerin Glück wünschte und sie weinte vor Freude, und dann die Mutter an dieser Stelle zu mir sagte: ›O, wenn du mir einmal diese Freude machtest, Michel!‹ – da hab' ich bei mir beschlossen, daß sie diese Freude haben soll.«
Mein Vater schwieg eine Weile nachdenklich. Ein flüchtiger Schatten ging über sein offnes Gesicht, und während seine Augen mit einem ganz eigen sorglichen Ausdruck auf mir ruhten, war es, als wollte ein Seufzer seine Brust schwellen. Dann, wie um trüber Gedanken sich zu entschlagen, machte er eine hastige Bewegung und sagte lächelnd:
»Und um deine Geneigtheit, deiner Mutter Wunsch zu erfüllen, recht deutlich zu manifestieren, Michel, hast du damit angefangen, dir deinen Laufpaß vom Lyzeum zu erwirken?«
»O,« entgegnete ich ziemlich kleinlaut, »das kam so ganz gegen meinen Willen. Es war eine recht dumme Geschichte, ich seh' es jetzt ein.«
»So? Und wie war es denn eigentlich? Wie ging es dabei her? Aufrichtig, Junge, aufrichtig!«
»Es war so,« begann ich, allein der Vater unterbrach mich mit den Worten: »Nicht hier, Knabe, nicht hier. Das ist ein heiliger Ort, und er soll durch die Beichte eines leichtsinnigen Schülerstreiches nicht entweiht werden. Ziehe deine Schuhe an und komm.«
Ich gehorchte. Im Weggehen stand der Vater noch einmal still und sagte mit tiefem Ernst:
»Mein Sohn, senke die Erinnerung an diese Frühstunde an dem Grabe deiner Großmutter fest in dein Herz. Diese Erinnerung kann dir eine starke Wehr sein in Augenblicken, wo die Versuchungen des Lebens lockend an dich herantreten. Der heutige Morgen sei dir ein geweihter; laß seine Wirkung eine dauernde sein.«
»Ich will es, Vater,« versetzte ich, und ich glaube auch heute noch sagen zu dürfen, daß ich in der Tat jener Weihestunde im Wirbel des Lebens nie ganz vergessen, ihre Nachwirkung oft gefühlt habe.
Wir verließen den Kirchhof auf der entgegengesetzten Seite und stiegen den gewundenen Fußweg am südlichen Abhang des Kirchenhügels hinab. Als wir an dem behaglich in seinem hübschen Baum- und Gemüsegarten liegenden Pfarrhof vorüberkamen, wo der Ortsgeistliche wohnte, ein stattlicher Herr, der zugleich die Würde des Kapiteldekans bekleidete, wurde uns von der rundlichen Jungfer Base desselben, welche in der ganzen Gegend des unbestrittenen Rufes genoß, die weißesten Hauben zu tragen, die edelsten Spargel zu ziehen und die Weichselkirschen am delikatesten »einzumachen«, über die niedrige Gartenmauer ein freundlicher Morgengruß geboten. Zugleich lief die gute Base hurtig zu dem Frühtraubenspalier, welches an der Hauswand mit verlockend dunkelblauen Früchten prangte, und im nächsten Augenblick streckte sie ihre runde Patschhand über die Mauer herab, eine prächtige Traube haltend, welche in meiner Mütze aufzufangen ich keineswegs lässig war.
»Ist der Herr Dekan schon auf?« fragte mein Vater die freundliche Spenderin.
Die Traubenbeere, welche ich in den Mund genommen, blieb mir bei dieser einfachen Frage vor Schrecken in der Kehle stecken; denn mir kam plötzlich der Gedanke, der Vater beabsichtige, mich bei dem Herrn Dekan in die Lehre zu geben. Ich hatte vor Sr. Hochwürden einen heiligen Respekt und wußte, daß er jedenfalls noch weit kürzeren Prozeß mit mir machen würde, als der Rektor des Lyzeums gemacht hatte.
Als daher mein Vater auf die Antwort der Jungfer Base, der hochwürdige Herr sei gestern abend ziemlich spät von der Kapitelskonferenz heimgekommen und ruhe jetzt noch, ohne weitere Bemerkung seinen Weg bergabwärts fortsetzte, wohlete es mir ordentlich. Ich sollte jedoch bald erfahren, daß ich, sozusagen, aus einem bloß befürchteten Regen unter eine wirkliche Traufe kam.
»Was die Trauben schon süß sind!« sagte ich, indem ich mir es im Gehen schmecken ließ.
»Er handelt sich jetzt nicht um süße Trauben, sondern um bittere Früchte alberner Streiche,« entgegnete mein Vater.
»Aber koste doch 'mal,« sagte ich, da ich wohl wußte, was für ein Traubenliebhaber mein Vater war.
Ich bot ihm die halb geleerte Traube über den Weg hinüber. Er nahm eine Beere, dann eine zweite; wir blieben stehen, und während wir gemütlich die Gabe des Bacchus miteinander verzehrten, ging folgender Dialog vor sich.
»Wie war's mit deinem consilio abeundi, Michel?« fragte mein Vater.
»Ja, siehst du,« erwiderte ich, »der langhalsige französische Sprachlehrer ist eigentlich an der ganzen Geschichte schuld.«
»Der? Wieso?«
»Weißt du? ich kann das verhenkerte Genäsel, das Französische nicht ausstehen ...«
»Da hast du recht, ganz recht ... das heißt, ja, siehst du, das heißt, alles Französische taugt keinen Pfifferling ... indessen, hm, indessen ...«
Ich verbiß ein Lachen über die Verlegenheit meines Vaters, so gut ich konnte. Er bemerkte es aber doch und sagte:
»Wart', du kleiner Schurke, du willst mich an meiner antifranzösischen Gesinnung fassen? Was du da von dem langhalsigen Franzosen vorbringen wolltest, ist wohl eitel Fabulei und Firlefanz?«
»Bewahre Gott! Die Sache war sehr ernsthaft. Der Berthold und ich ...«
»Ja, ja, der Berthold! Das ist grade so ein Bursch wie der Michel. Aber, lieber Junge, bedenke, der Berthold ist der einstige Besitzer der schönen Freiherrschaft Rothenfluh, das heißt, er gehört zu den wenigen, welche nicht zu arbeiten und am Ende auch nicht sehr viel zu wissen brauchen; der Michel aber gehört zu den vielen, welche arbeiten müssen und daher auch etwas wissen müssen. Doch weiter im Text!«
»Der Berthold und ich waren neulich für drei Stunden ins Karzer gesteckt worden auf Betreiben des Franzosen ...«
»Der Mann wird seine Gründe dafür gehabt haben, meine ich.«
»Er meint es auch. Nämlich er hatte uns, den Berthold und mich, erwischt, wie wir während seiner Sprachstunde unter dem Subsellio in einem Geschichtenbuch lasen.«
»In was für einem Geschichtenbuch?«
»In Fouqués ›Zauberring‹.«
»Da wollt' ich, er hätte euch das dumme Buch recht tüchtig um eure dummen Köpfe geschlagen. Schämt ihr euch nicht, solches Zeug zu lesen, auf oder unter dem Subsellio? Bei Wodan und Frouwa, der Fouqué war von jeher ein Phantast, ein vollständiger Narr. Es hat nie solche Ritter gegeben, wie er sie aus Marzipanteig knetete.«
»Wir konnten das aber nicht wissen, der Berthold und ich. Auch war in dem Buche so gar viel Schönes von den Schlachtrossen der Ritter zu lesen.«
»Dummes Zeug, Junge, purer Unsinn. Ich sag' dir, Fouqués Gäule sind Zuckerbackwerk wie alles andere. Aber weiter!«
»Im Karzer machten wir einen Anschlag, es dem Franzosen einzutränken ...«
»Wirklich? Die Strafe scheint sehr bessernd auf euch gewirkt zu haben, das muß ich sagen.«
»Vorgestern brachte der Berthold Knallbonbons mit in die Schule und verabredete mit mir, wie wir damit dem Franzosen einen Tort antun wollten.«
»Schlingel!« sagte mein Vater und zog die Brauen zusammen, aber ich bemerkte, daß zugleich die humoristischen Linien um seine Mundwinkel leise zu zucken begannen, und fuhr daher ungeschreckt fort:
»Wir hielten die Knallbonbons unter dem Subsellio bereit und stellten uns, als ob wir während der französischen Sprachstunde wieder in einem Buche unter der Bank läsen. Der Franzos glaubte, es geschähe wirklich, kam wie der Blitz herbeigefahren, guckte unter die Bank und steckte, da er etwas kurzsichtig ist, den Kopf recht tief in das Zwischenfach. Nun rissen wir im selbigen Augenblick die Bonbons entzwei und der Knall ging los, hart vor seiner Nase. Er fuhr zurück und torkelte in seinem Schrecken an die große Rechentafel. Diese fiel um mit samt ihrem Gestell, und Tafel und Gestell und Franzos kegelte alles bunt über Eck auf dem Boden hin. Es war ein großer Spektakel.«
»Heillose Buben!« murmelte mein Vater rasch, eine Traubenbeere zwischen seine Lippen schiebend, die sich unwillkürlich zum Lachen geöffnet hatten.
»Der Franzos, als er sich wieder aufgerabbelt hatte, mit verwirrter Frisur und voll Staub, welschte ganz verworrenes Zeug durcheinander von attentat und assassinat und machte sich dann fort, ganz käsebleich.«
»Kein Wunder! Schändliche Attentäter, die ihr seid! Aber dann?«
»Dann hielt der alte Rektor gestern im Beisein sämtlicher Professoren und Präzeptoren und Schüler ein großes Gericht. Der Franzos mußte ihm ganz ungeheuerliche Sachen vorgeschwatzt haben, denn der alte Herr war wie ein Berserker, ganz wie ein Berserker.«
»Berserker – das ist gut. Woher hast du den Ausdruck, Junge?«
»Von dir, Vater. Du hast mir ja 'mal von den altnordischen Wikingern und Berserkern erzählt.«