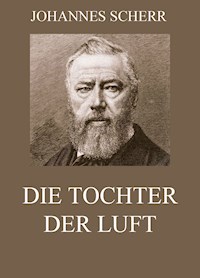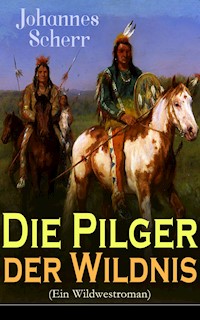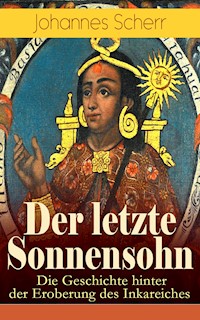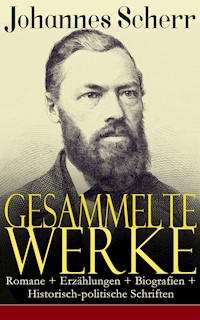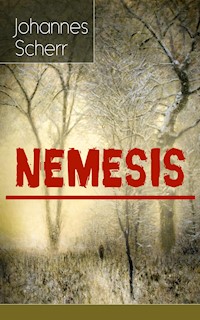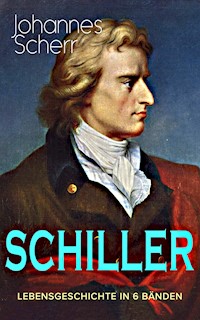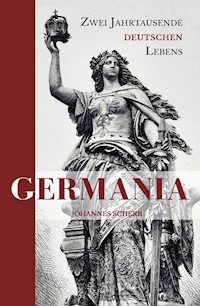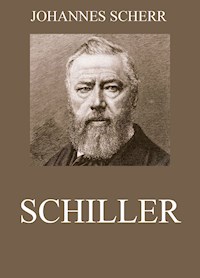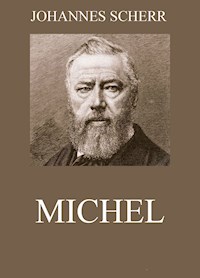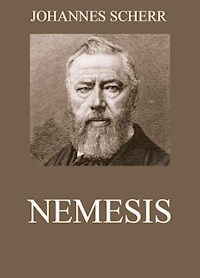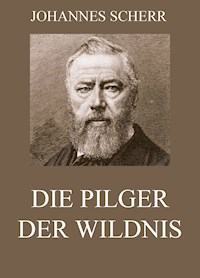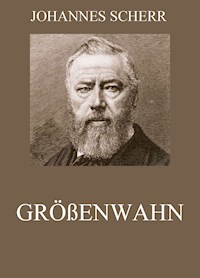
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Scherr erzählt vier Kapitel aus der "Welt menschlicher Narrheit": Mutter Eva. König Jan der Gerechte. Die Gekreuzigte. Historie einer Heilandin. Das rote Quartal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Größenwahn
Johannes Scherr
Inhalt:
Johannes Scherr – Biografie und Bibliografie
Größenwahn
Für die, welche Vorreden lesen.
Präludium.
1.
2.
Mutter Eva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Erster Zwischensatz: Die tragische Geschichte von Ambrosius Gigax, dem Ordnungsfanatiker.
1.
2.
3.
König Jan der Gerechte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zweiter Zwischensatz: Frohe Botschaft aus Emanzipazia
Die Gekreuzigte. Historie einer Heilandin
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Dritter Zwischensatz: Ein literarischer Dialog
Das rote Quartal. (März – Mai 1871.)
Vorspruch.
1. Mordspektakel
2. Wie die Blauen demonstrieren – Und die Roten remonstrieren.
3. Endlich haben wir die Kommune!
4. Wer waren sie? Was wollten sie?
5. Verhaftet euch untereinander!
6. Es wird kanoniert, prophetiert und scharlatanisiert
7. Verfolgungswahnsinn
8. Zerstörungscancan
9. »O, welcher Mordkampf hat sich da entsponnen!«
10. Das rote Gespenst geht leibhaft um
11. Blut und Feuer – Feuer und Blut.
12. Fazit
Größenwahn, J. Scherr
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849634926
www.jazzybee-verlag.de
Johannes Scherr – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 3. Okt. 1817 in Hohenrechberg bei Schwäbisch-Gmünd, gest. 21. Nov. 1886 in Zürich, besuchte das Gymnasium in Gmünd und die Universitäten in Zürich und Tübingen, wirkte dann eine Zeitlang als Lehrer und ließ sich 1843 in Stuttgart nieder. wo er 1844 mit der Schrift »Württemberg im Jahr 1844« den politischen Kampfplatz betrat, auf dem er sich in den nächsten Jahren als Vorkämpfer aller freiheitlichen Bestrebungen hervortat. 1848 wurde er in die württembergische Abgeordnetenkammer und in den Landesausschuß gewählt und stand während der Revolutionszeit an der Spitze der demokratischen Partei, weshalb er nach Auflösung der Kammer 1849 nach der Schweiz flüchtete. Er ließ sich zunächst in Winterthur nieder, wo er längere Zeit schriftstellerisch tätig lebte, bis er 1860 als Professor der Geschichte und Literatur an das eidgenössische Polytechnikum in Zürich berufen wurde. Außer einer Reihe von Romanen und Erzählungen (darunter: »Schiller«, Leipz. 1856; 3. Aufl. 1902, 2 Bde.; »Michel. Geschichte eines Deutschen unserer Zeit«, Prag 1858, 4 Bde.; 10. Aufl., Leipz. 1905, 2 Bde.; »Rosi Zurflüh«, Prag 1860; »Die Gekreuzigte«, St. Gallen 1860; 2. Aufl., Leipz. 1874) sowie einigen humoristischen Schriften veröffentlichte er: »Bildersaal der Weltliteratur« (Stuttg. 1848; 3. Aufl. 1884, 3 Bde.), woraus im Sonderdruck der »Bildersaal der deutschen Literatur« (1887) erschien; »Deutsche Kultur- und Sittengeschichte« (Leipz. 1852–53, 11. Aufl. 1902); »Allgemeine Geschichte der Literatur« (Stuttg. 1851; 10. Aufl. als »Illustrierte Geschichte der Weltliteratur«, das. 1900, 2 Bde.); »Geschichte der deutschen Literatur« (2. Aufl., Leipz. 1854); »Geschichte der englischen Literatur« (das. 1854, 3. Aufl. 1883); »Geschichte der Religion« (das. 1855 bis 1857, 2 Bde.; 2. Aufl. 1859); »Dichterkönige« (das. 1855; 2. Aufl. 1861, 2 Bde.); »Geschichte der deutschen Frauenwelt« (das. 1860; 5. Aufl. in 2 Bdn. 1898); »Schiller und seine Zeit« (illustrierte Quartausgabe, das. 1859, 3. Aufl. 1902; Volksausgabe, 4. Aufl. 1865); »Drei Hofgeschichten« (das. 1861, 3. Aufl. 1875); »Farrago« (das. 1870); »Dämonen« (das. 1871, 2. Aufl. 1878); »Blücher, seine Zeit und sein Leben« (das. 1862–63, 3 Bde.; 4. Aufl. 1887); »Studien« (das. 1865–66, 3 Bde.); »Achtundvierzig bis Einundfünfzig« (das. 1868–70, 2 Bde.; 2. Aufl. u. d. T.: »1848, ein weltgeschichtliches Drama«, das. 1875); »Aus der Sündflutzeit« (das. 1867); »Das Trauerspiel in Mexiko« (das. 1868); »Hammerschläge und Historien« (Zürich 1872, 3. Aufl. 1878; neue Folge 1878); »Sommertagebuch des weiland Dr. gastrosophiae Jeremia Sauerampfer« (das. 1873); »Goethes Jugend« (Leipz. 1874); »Menschliche Tragikomödie«, gesammelte Studien und Bilder (das. 1874, 3 Bde.; 3. Aufl. 1884, 12 Bde.); »Blätter im Winde« (das. 1875); »Größenwahn, vier Kapitel aus der Geschichte menschlicher Narrheit« (das. 1876); das Prachtwerk »Germania. Zwei Jahrtausende deutschen Lebens kulturgeschichtlich geschildert« (Stuttg. 1876–78, 6. Aufl. von H. Prutz, 1905); »1870–71. Vier Bücher deutscher Geschichte« (Leipz. 1878, 2 Bde.; 2. Aufl. 1880); »Das rote Quartal« (das. 1882); »Vom Zürichberg«, Skizzen (das. 1881); »Porkeles und Porkelessa« (Stuttg. 1882, 3. Aufl. 1886); »Haidekraut«, neues Skizzenbuch (Teschen 1883); »Neues Historienbuch« (Leipz. 1884); »Gestalten und Geschichten« (Stuttg. 1885); »Die Nihilisten« (u. Aufl., Leipz. 1885); »Letzte Gänge« (Stuttg. 1887). S. war ein vorzugsweise der eigentümlichen darstellenden und räsonierenden Weise Th. Carlyles nachgearteter Schriftsteller, von blitzender Lebendigkeit, begeistert oder maßlos in seinen Abneigungen, von schneidiger Schärfe und gelegentlich körnigster Grobheit, in seinen letztern Schriften jedoch allzusehr der Kopist seiner eignen Manier. Ein Teil seiner Erzählungen erschien gesammelt als »Novellenbuch« (Leipz. 1873–77, 10 Bde.).
Größenwahn
Für die, welche Vorreden lesen.
Es ist ein ernstes Buch, welches ich hier veröffentliche, ein wahrheitstrenges Buch für ernste Menschen, die in Büchern etwas anderes und besseres suchen als die Befriedigung eines flüchtigen Unterhaltungskitzels.
Daß es von solchen Lesern und Leserinnen, welche der Erörterung fragwürdigster Fragen nicht aus dem Wege gehen, sondern vielmehr einem Autor, der mit dem Eifer, die Wahrheit zu suchen, den Mut, sie rückhaltslos zu sagen, verbindet, aufrichtig zugetan sind, immerhin noch eine stattliche Anzahl gibt, kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen.
Bin ich doch in der Literatur meinen eigenen Weg gegangen, habe niemals weder den Tonangebern der Tagesmoden noch den Pythonissen der Teekesseldreifüße nachgefragt und habe weder für das gelehrte Vorder- noch für das gelehrttuende Hinterborneo, weder für den urteilslosen Haufen noch für die blasierte Feinschmeckerei geschrieben. Auch bin ich nie Mitglied einer jener auf Gegenseitigkeit des Geschäftsbetriebes beruhenden Kameradschaften gewesen, welche die Spitze des bekannten Hebelschen Schwankes umgeschliffen haben zu der Maxime: »Lobst du meinen Juden, lob' ich deinen Christen.« Bei allem, was ich schrieb, hatte ich nur mein Volk im besten Sinne vor Augen, d. h. alle Deutschen und Deutschinnen von Kopf und Herz, und ich bin – warum sollt' ich es nicht sagen? es ist ja wahr – gelesen und verstanden worden, soweit Deutsche über den Erdball hin wohnen.
Angesichts dieser Tatsache kann ich es mit dem Achselzucken gebührender Verachtung geschehen lassen, so dann und wann einer aus dem hintersten Borneo aus eigenem Antrieb oder auf Befehl seiner »gnädigen Herren und Oberen« an meinem Wege lauert, um vom hochaufgeblasenen Maulesel der Parteiborniertheit herab mit dem stumpfen Spieße des Unverstandes nach mir zu stechen. Solche Gesellen vom Opportunitätsgesindel muß man in ihrer Obskurität verkommen lassen, ohne ihnen auch nur die Ehre einer Namensnennung anzutun. Was vollends die schwarzen Grunzer und die roten Kläffer angeht, bah! wer wird von solchem Getier etwas anderes erwarten als Gegrunz und Gekläff? ...
Zur Herausgabe des vorliegenden Buches hat mich zunächst ein äußerlicher Umstand veranlaßt. Mein Büchlein »Die Gekreuzigte« sollte im Laufe dieses Jahres in dritter Auflage gedruckt werden. Das brachte mich auf den Gedanken, dasselbe nicht wieder einzeln erscheinen zu lassen, sondern in einer Sammlung von Essays, worin verwandte Probleme behandelt sind. Um die Zahl dieser kulturgeschichtlichen Darstellungen auf vier zu bringen, wurde das Münstersche Wiedertäuferdrama aus meinem »Novellenbuch« herübergenommen, wohinein es, weil strenghistorisch gefaßt und durchgeführt, doch nicht recht paßte.
Warum ich dem Buche den Gesamttitel »Größenwahn« gab, wird, hoff ich, aus dem »Präludium« wie aus den einzelnen Hauptstücken erhellen. Der Titelbeisatz »Vier Kapitel aus der Geschichte menschlicher Narrheit« – rührt davon her, daß die vier mitgeteilten Historien ursprünglich als Abschnitte einer von mir seit langem geplanten »Geschichte der menschlichen Narrheit« gedacht, entworfen und ausgeführt wurden.
Man wird schon zugeben müssen, daß eine solche Geschichte nicht übel am Platze wäre zu einer Zeit, welche so wie die unsere von Schwindel, Selbstüberhebung und Dünkeltobsucht strotzt. Sie darf ja geradezu einen Ehrenplatz ansprechen im Weltnarrheitsbuch, diese Zeit, wo das tolle Dogma vom 18. Juli 1870 möglich war, kraft dessen ein alter Mann, welcher schon sechs Jahre zuvor größenwahnwitzig genug gewesen, mit seinem im »Al Gesù« präparierten Syllabusschwamm die Resultate einer tausendjährigen Kulturarbeit wegwischen und mittels der aus besagtem Schwamm abtröpfelnden »Kanones« die moderne Gesellschaft ins Mittelalter zurückfluchen zu wollen, alle die hierarchischen Hochmutsdelirien der mittelalterlichen Gregore und Innocenze noch überbieten durfte. Und sotaner Riesenschwindel spektakelt keineswegs allein auf der Bühne der Gegenwart, bewahre! Er hat ebenbürtige Mitspieler. Da ist z. B. der gelehrte Größenwahn, welcher auf dem Treibsand irgend einer gerade modischen, mehr oder weniger windigen Hypothese mit »affenartiger Geschwindigkeit« eine neue »Weltanschauung« nach der andern, jedesmal natürlich die »absolut vernünftige, wahrhaft wissenschaftliche und einzig zeitgemäße« Weltanschauung aufschwindelt, bis der nächste, aus einer andern Studierstube kommende Hypothesenwind das anspruchsvolle Kartenhaus wieder umbläst. Da ist auch der Größenwahn der arbeitscheuen Rafferei und Rapserei, welcher sich als »volkswirtschaftliches« Genie und »realpolitisches« Verdienst aufzuspielen weiß mit solchem Erfolg, daß jeder beliebige Schmutzchrist oder Stinkjude, dem es gelungen, die Million oder gar die Milliarde zu erdiebsfingern, als ein dreimal gebenedeiter Apis im papierenen Börsendorado vom unteren, mittleren und oberen Pöbel mit Halleluja und Hosianna umtanzt wird. ...
Leider aber mußte ich die Hoffnung, das geplante große Unternehmen weiterführen und vollenden zu können, fahren lassen, nachdem ich erkannt hatte, daß diese Arbeit für zehn Kulturhistoriker allzu riesenhaft wäre, geschweige für einen und noch dazu grauhaarigen.
Die vier nachstehenden Größenwahngeschichten sind durch drei »Zwischensätze« getrennt, welche eingefügt wurden, damit der Leser ausruhen und von den düsteren Eindrücken, die er etwa von den Hauptstücken empfangen hätte, sozusagen sich erholen könnte.
Ich habe Grund, zu hoffen, daß auch dieses mein Buch sich Freunde werben werde. An Feinden wird und soll es ihm ebenfalls nicht fehlen. Denn alles, was dumm und dünkelhaft, verlogen und windbeutelig, heuchlerisch oder fanatisch, gemein und knechtisch, impotent und neidisch, ist mir feindlich gesinnt, und die ganze Sippschaft der Windfahnen, Gunstbuhler und Kriechkünstler hat einen naturgemäßen Aberwillen gegen meine Schriften.
Das wäre mein Stolz, wenn es sich überhaupt der Mühe lohnte, auf irgend etwas stolz zu sein in dieser närrischen Welt.
Am Zürichberg, Ostern 1876.
Präludium.
1.
Wenn die Darwinisten recht haben, so muß, auch die denkbar langsamste und sachteste Entwickelung vorausgesetzt, einmal ein Augenblick gewesen sein, wo der Riß zwischen Tierheit und Menschheit, zwischen tierischem Traumsein und menschlichem Bewußtsein geschah.
Falls wir aber dem ersten Wesen, welches sich im Gegensatze zum Tier als Mensch fühlte, nicht etwa die Schande antun wollen, uns dasselbe als einen Idioten vorzustellen, so muß es bald, sehr bald gemerkt haben, daß das Leben nichts weniger als eine Schlaraffei sei. Schon in den ersten Menschen dürfte der Kampf ums Dasein mitunter die Frage angeregt haben: Ist dieses Dasein eines solchen Kampfes wert? Man könnte, so man von einem Adam im biblischen Sinne sprechen wollte, unschwer auf die Vermutung kommen, schon der erste Mensch müßte notwendig ein Skeptiker gewesen sein und sich mitunter gefragt haben: Was tu' ich eigentlich da?
Eine sehr fragwürdige Frage, fürwahr, und bis heute noch unbeantwortet, obzwar alle Religionen und alle Philosophien sich abgemüht haben, eine Antwort zu finden. Was sie fanden? Fabeln und Phrasen.
Auch die Poesie wußte die Frage nur scharfschneidig zu formulieren, nicht aber zu beantworten.
Solche Frageformeln sind der Hiob, der Prometheus, der Faust, der Kain.
Der letztere, die echteste, gefühlteste und großartigste dichterische Schöpfung des neunzehnten Jahrhunderts, in welcher der Genius Byrons in seiner ganzen Kraft und Düsternis sich offenbarte, ist keineswegs ein Anachronismus. Denn warum sollte, die biblische Mythe einmal zugelassen, der Erstgeborene Evas nicht der erste Pessimist gewesen sein? War er ein denkendes Wesen, so mußte sich das Gefühl des Verhängnisses, Mensch zu sein, bleischwer auf ihn legen, und mußte er klagen, wie der Dichterlord ihn klagen läßt:
»Und dies ist Leben? Sich stets zu mühn – warum soll ich mich mühn? Ich lebe, ja, doch einzig um zu sterben, Und seh' im Leben nichts, den Tod verhaßt Zu machen, als ein innerliches Bangen, Den widerwärt'gen, unbesieglichen Instinkt, zu leben, den ich wie mich selbst Verachte, doch nicht überwinden kann. So leb' ich denn. O, hätt' ich nie gelebt!«
Der Ekel, die Verzweiflung müßte es doch schließlich über den »widerwärtigen Instinkt« davontragen, falls sich dieser nicht zwei starke Helfershelferinnen beigesellt hätte: Geduld und Gewohnheit. Diese lehren den Menschen ertragen, was an und für sich – persönliches »Glück« oder »Unglück« ganz beiseite gelassen – des Ertragens in keiner Weise wert ist.
Denn wo wäre ein auch nur halbwegs vernünftiger Zweck des Menschendaseins auch nur halbwegs annehmbar nachgewiesen? Nirgends. Religiöse Märchen und philosophische Redensarten die Hülle und Fülle, aber nicht die Spur von einem Nachweis, von welchem ein ehrlicher, anständiger und geschulter Mann sagen möchte: Daran kann ich glauben.
Wie? Auch an die Arbeit nicht? Als an ein Mittel, ja; als an den Zweck, nein. Denn warum soll ich arbeiten? da die schreckliche geheime Stimme in mir immerfort raunt: Dein Arbeiten ist am Ende aller Enden gerade so eitel und zwecklos wie das aller, die vor dir waren und die nach dir sein werden. Warum? Wozu? Wofür?
Es ist ganz wahr, die ungeheure Mehrzahl der Menschen wird durch diese Fragen gar nicht behelligt, weil sie das Leben tierisch-naiv faßt und führt. Die kleine – genau betrachtet, sehr kleine – Minderzahl, die Wissenden, welche den Dingen auf den Grund sehen möchten, sie haben sich von jeher redlich abgequält mit dem furchtbaren Warum? Wofür? Wozu? Man muß es auch sehr begreiflich und verzeihlich finden, wenn die armen zweifelnden, fragenden, suchenden Menschen sich von Zeit zu Zeit eine angebliche Lösung des unlösbaren Problems durch irgend einen Schelling oder Hegel – will sagen: durch diesen oder jenen betrogenen Betrüger – vorgaukeln lassen, bis dann die angebliche Lösung immer wieder als ein aus den Hüllen schamloser Begriffenotzucht und grausamer Sprachefolterung herausgeschältes faules Windei sich darstellt.
Aber ist es denn nötig, allzeit und überall dem Warum? nachzugrübeln? Lassen wir das Woher? und Wohin? und Wozu? und nehmen wir die Welt, wie sie nun einmal ist. Anders machen können wir sie ja doch nicht, und so wird es denn wohl das klügste sein, uns praktisch darin zurecht zu finden. Tun wir das, so werden wir weder bestreiten können noch wollen, daß die menschheitliche Arbeit im Laufe der Jahrtausende denn doch was Hübsches vor sich gebracht und daß die Vervollkommnungsschule Weltgeschichte erkleckliche Erziehungsresultate zutage gefördert habe. Wer wollte das bezweifeln? Wir laufen nicht mehr im Tierfellkostüm herum und nähren uns nicht mehr mit Eicheln. In der Schaffung und Verfeinerung von Formen hat sich die menschliche Kulturarbeit wahrhaft groß erwiesen. Was das Wesen angeht, so wollen scharfe Augen entdeckt haben, daß der Mensch im Perfektibilitätsfrack noch ganz derselbe sei, welcher er im pfahlbäuerischen Wolfs- oder Bärenfell gewesen. Gerade herausgesagt, die dermalen Tag und Nacht mechanisch Hergebetete Fortschrittslitanei vermag keinen Geschichtekenner zu überzeugen, daß die Zivilisation den Menschen substantiell verändert oder beziehungsweise veredelt habe. Soweit die geschichtliche Kenntnis in die Vorzeit hinaufreicht, ist der Mensch und ist die menschliche Gesellschaft dem Wesen nach ganz so gewesen, wie sie heute noch sind: – der Mensch ein Mischmasch von Widersprüchen, die Gesellschaft ein Wirrsal von gegensätzlichen Interessen. Zu allen Zeiten dieselben Illusionen und Enttäuschungen, dieselben Anlagen und Leidenschaften, dieselben Bedürfnisse und Begehrnisse, dieselbe Tugendtheorie und dieselbe Lasterpraxis. Zu allen Zeiten Schwindler und Beschwindelte, Ausbeuter und Ausgebeutete, Schelme und Narren. Ob aber dereinst aus dem verfallenden Erdenhause der letzte Mensch als der letzte Schwindler oder als der letzte Beschwindelte, als der letzte Narr oder als der letzte Schelm hinausziehen werde, darüber sind die Gelehrten noch nicht einig.
Darüber dagegen sind, wenn nicht die Gelehrten, so doch die Verständigen einig, daß die Erde nichts weniger als ein Eden, daß das »goldene Zeitalter« der Freiheit, des Friedens und der Freude wie in der Vergangenheit so auch in der Zukunft nur ein Ammenmärchen, daß die Natur unerbittlich und erbarmungslos, daß unser Menschenleben mit seiner jämmerlich unbehilflichen Kindheit und seinem einsamen bresthaften Alter, mit seinen Krankheiten und seinen Torheiten, mit seinen grellen Ungerechtigkeiten und ekelhaften Roheiten, mit seinen zahllosen Niederträchtigkeiten, Schurkereien und Freveltaten, mit seinen ruhelosen Wünschen und unzulänglichen Befriedigungen, mit seinen boshaften Verkettungen und seinen wehvollen Trennungen, mit den Luftspiegelungen des Ehrgeizes, mit den Verführungen des Reichtums und den Demütigungen der Armut, mit allen seinen Sorgen, Mühen, Schmerzen, geknickten Hoffnungen und bitteren Erfahrungen, sogar mit seinem sogenannten Glücke, seinen flüchtigen Genugtuungen und seinen täuschungsvollen Genüssen – ja, daß die Erde mit allem, was darauf, nichts als eine, mit dem armen Leopardi zu sprechen, »grenzenlose Nichtigkeit«, eine »inutile miseria«, oder auch nichts als eine schnöde Prellerei, ein niederträchtiger Schwindel.
Was folgt aus alledem?
Daß der »loathsome and yet all invincible instinct of life«, wovon der Byronsche Kain spricht, die Menschen zwang, eine Erfindung zu machen, mittels welcher sie über die Erdennot sich hinwegtäuschen konnten.
Diese Erfindung, die Lehre von der Fortdauer der Seele des Menschen nach seinem leiblichen Tode und die damit eng verbundene Vorstellung von einer Vergeltung in einem sogenannten Jenseits, ist die tröstlichste gewesen, welche ein Menschengehirn jemals ausgesonnen hat. Nur Abstraktoren, wie z. B. der verwichene Doktor Strauß, dem sein eigen Volk gerade so fremd gewesen wie etwa das japanische, nur dürre Doktrinäre, welche niemals in und mit dem Volke gelebt haben, vermögen zu verkennen, welche unermeßliche und unerschöpfliche Wohltat für die arme Menschheit der Unsterblichkeitsglaube war und ist. Die wirklich Weisen aller Länder und Zeiten, Denker und Dichter, Propheten und Politiker, haben das wohl erkannt. In den Katakomben Ägyptens, auf den Bergen von Baktrien, in den Banianenhainen am Ganges, unter den Platanen des Ilissos, auf den Triften Galiläas, in den Sandsteppen Arabiens wie in dem Schattendüster der Wälder Germaniens und unter den Druideneichen Armorikas ist diese Lehre verkündigt und geglaubt worden, und überall hat sie ungezählte und unzählige Millionen von Menschen die schwere Last des Lebens tragen gelehrt.
Wenn die menschliche Zivilisation etwas so Hehres und Herrliches ist, wie ihr sagt, wohlan, nur der Unsterblichkeitsglaube hat sie möglich gemacht. Dadurch möglich gemacht, daß er den Geschlechtern der Menschen die Hingebung und Ausdauer verlieh, inmitten von allen den Bedrängnissen des Daseins ihre Arbeit zu tun.
Darf das ein bloßer Wahn genannt werden? Kann es ein bloßer Wahn sein? Und wenn es ein Wahn, ist er verwerflich und entbehrlich?
Aber was ist denn eigentlich Wahn, und was ist Wahrheit? Das, was dafür zu halten man übereingekommen ist, stillschweigend oder ausdrücklich.
Wahrheit oder Wahn, gleichviel, ohne den Unsterblichkeitsglauben, ohne das hoffende Hinübertasten in eine vorgestellte jenseitige Welt müßte die Menschheit aus dumpfem Überdruß an der Zwecklosigkeit der diesseitigen schon längst verdorben und gestorben sein.
2.
Die gedankenlose Wohllebigkeit wie der schönselige Optimismus – jene kann nicht, dieser will nicht logisch denken – sie fühlen sich natürlich nicht verunbequemt durch die Tatsache, daß vom Anbeginn der Zeiten alle auserwählten Geister Pessimisten gewesen sind, d. h. die Flüchtigkeit und Nichtigkeit des Daseins erkennende und beklagende Denker.
Kein Träger des Genius vom Anfang bis heute, welcher nicht empfunden hätte, was Firdusi in seinem Heldenliede vom Kai Chosru aussprach:
»Der Weise wünscht, er wäre nie geboren, Ihn hätte nie im Erdenfrost gefroren Und niemals ihn die Glut der Welt versengt; Unheil nur wird durch die Geburt verhängt, Nur Wechsel herrscht und Trübsal hier auf Erden: Drum ist es besser, nie gezeugt zu werden.«
Dieses Thema hat zahllose Variationen gefunden, allzeit und allenthalben, in ältester wie in jüngster Zeit, unter allen Völkern, unter allen Rassen, soweit sie überhaupt zum Denken gelangt sind. Wollte man eine Bibel des Pessimismus zusammenstellen, alle Männer von Genie und Herz, welche jemals und irgendwo aufgestanden, würden die Verfasser derselben sein.
Am geläufigsten ist die Vorstellung von der Welt als von einem Rätsel, einem ungelösten und unlösbaren. Problem.
Wer hat dieses Welträtsel aufgegeben? Oder hat es sich selbst aufgegeben? Warum ist es aufgegeben? Wozu existiert es?
Alle vom Anfang bis heute versuchten Antworten sind nur leeres Gestammel und unartikuliertes Gestotter. Die Physik stottert bei ihren Antwortsversuchen nicht minder, als die Metaphysik gestammelt hatte. Der Streit, ob zuerst die Henne oder zuerst das Ei gewesen, sei zu Ende, sagen exakte Forscher; denn das »Omne vivum ex ovo« – sei abgetan und überwunden. Gut, wir wollen es glauben. Aber nun möchten wir wissen, woher anderweitig, woher überhaupt das »vivum« gekommen, in dem Blutkügelchen, das in unseren Schläfen rollt, in der Urqualle, in der Urzelle, im Urschleim? Keine Antwort oder höchstens die schon uraltbekannte ausweichende: »Die Materie ist eben von Ewigkeit her und folglich ist das auch die dem Stoffe innewohnende Kraft.« Aber was ist Ewigkeit? Ein unfaßbarer Begriff, ein Undenkliches, also Sinnloses. Und wäre denn mit dieser unvorstellbaren »Ewigkeit« das »Woher die Materie?« und »Warum die Kraft in derselben?« irgendwie aufgehellt und erklärt? Wäre damit ein letzter Grund, der letzte Grund nachgewiesen? Das wird selbst der gelehrte Größenwahn nicht behaupten wollen. Das uralte und immerjunge Welträtsel bleibt also, was es war und ist, und wir wissen, was wir von dem unartikulierten Gestotter, das sich gar häufig für ein Triumphlied des Allesbegriffen- und Alleserklärthabens ausgeben möchte, zu halten haben. Wenn der philosophische Optimismus sich daran erbauen mag, alles auf eine sogenannte »Weltvernunft« zurückzuführen, so hat der philosophische Pessimismus gewiß auch das Recht, die Grundwurzel von allem in einer »Weltunvernunft« zu erblicken. Diese macht sich wenigstens tagtäglich und allstündlich fühl- und spürbar, während jene nichts ist als eine Verkleidung der alten theologischen Fraubase Teleologie....
Auch als Schlaf und Traum wird das Dasein gefaßt. Von Heiden und Christen. Ein altarabischer Dichter sagte: »Die Menschen schlafen; wann sie aber sterben, dann wachen sie auf.« Der spanische Erzkatholik und Mystiker Calderon dichtete einen prächtigen dramatischen Kommentar zu seinem Texte: »Das Leben ein Traum.« Der geisteshelle deutsche Protestant Rückert sang:
»Die Zypress' ist der Freiheit Baum, Weil man sie dir pflanzt aufs Grab. Dein Leben nur im Kerker ein Traum, Bis der Tod dir Flügel gab.«
Endlich wurde und wird das Leben gefühlt als eine Krankheit, und der Tod begrüßt als die Genesung. Sokrates, welcher, wenn man ihn auch nicht gerade dem delphischen Orakel zu gefallen für den weisesten Menschen hält, doch immerhin einer der weisesten gewesen ist, hat bekanntlich, als ihm nach geleertem Schierlingsbecher der Tod ans Herz trat, seine Freunde gebeten, dem Asklepios einen Hahn darzubringen als Dankopfer für seine Genesung von der Krankheit des Daseins.
Wenn nun schon ein antiker Mensch, noch dazu ein Hellene, ein Athener, das Gefühl der Daseinskrankheit hatte, um wieviel stärker muß dieses Gefühl in unserer modernen, durchweg gekünstelten, verkünstelten, auf Schrauben und Stelzen gestellten, an den Krücken einer verlogenen Konvenienz einherhinkenden Gesellschaft sich bemerkbar machen! Wo ist denn heutzutage ein Mensch – ich meine ein denkender und ehrlicher – welcher von sich sagen möchte, er sei leiblich und seelisch ganz gesund?
Wohin immer ein sehendes Auge sich wendet, überall treten ihm die tausenderlei Symptome der einen großen Krankheit »Leben ist Leiden!« entgegen, und noch erschreckender und betrübender als die Merkmale physischer Übel sind die immer mehr sich häufenden Symptome psychischer Störungen.
Die Zahl der Narrheiten und Narren heißt Legion.
Ich weise mit dem Finger auf die schwärende Wunde der modernen Gesellschaft. Ihr Name ist »Größenwahn«.
Freilich, auch dieses Neue unter der Sonne ist nur Altes.
Als Bonaparte am Fuße der Pyramiden von Gizeh zu seinen Grenadieren sagte: »Vom Gipfel dieser Monumente blicken vier Jahrtausende auf euch herab!« hätte er auch sagen können: Von der Spitze dieser gemauerten Berge grinst euch der uralte und immerjunge menschliche Größenwahn an!
Denn wenn so ein Pharao Chufu hunderttausend halb oder ganz nackte Sklaven zusammentrieb und sie Jahrzehnte hindurch zu fronden zwang, um einen Berg auszumauern, in dessen Grabkammer der Wurmfraß seiner pharaonischen Mumie der Zerstörung trotzen sollte, was war das anderes als naiver Größenwahn? Und wenn der Pharao Napoleon seinerseits sechshunderttausend uniformierte Sklaven zusammentrieb, um an ihrer Spitze dem Phantom Weltherrschaft nachzujagen bis ins brennende Moskau hinein, was war das sonst als raffinierter Größenwahn?
Ein großes Stück Weltgeschichte gehört eigentlich in die Psychiatrie. Geniale Irrenärzte sollten die Geschichte der römischen Cäsaren, der römischen Päpste, der Attila, Dschingiskhan und Nadirschah, die Geschichte Philipps des Zweiten und Ludwigs des Vierzehnten schreiben. Napoleon der Erste war ein tobender, Napoleon der Dritte ein grübelnder Größenwahnsinniger.
Und nicht etwa nur auf der Weltgeschichtebühne, nein, auch im Alltagsleben grassiert die unheimliche Geisteskrankheit. Sie ist geradezu die moralische Pest der Gegenwart. Der ordinäre Schmierung in irgend einem Winkelblatt, der ordinärere Maultrommler in irgend einem Winkelklub, der ordinärste Kathedrarier an irgendeiner Winkeluniversität, das verkannte Dichter-, verkanntere Maler- und verkannteste Zukunftsmusikhalbtalent, der große Patriot, größere Liberale und größte Dividendenschnapper, dessen A er selbst und dessen O die Million, die ganze Jobbers- und Robbersbande vom jüdischen Börsenschakal bis hinauf oder auch hinab zum christlichen Aufsichtsratfürsten und Gründerherzog: lauter arme – obzwar mitunter sehr reiche – Größenwahnbehaftete.
Aber der bevorzugte Tummelplatz des Größenwahns war und ist doch das Gebiet der Religion. Da hat er sich von jeher in allen Formen und Farben geoffenbart, als höchste Tragik wie als tiefste Komik. Ein riesigeres Sammelsurium von Narrheit als das christliche Legendenbuch, die dreiundfünfzig von den Bollandisten redigierten Folianten der »Acta Sanctorum« ist kaum denkbar. Und durch die ganze ungeheure Kakophonie geht als Grundton der Größenwahn. Wollt ihr eine ganz meisterliche Kennzeichnung dieses christlichen, d. h. mit Demut geschminkten Größenwahns kennen lernen, so lest des Engländers Tennyson »Sankt Simeon Stylites«. Nur ein Eingeborener des Lieblingslandes der Scheinheiligkeit vermochte uns die unter der Selbsterniedrigungsmaske hervorbrechende grenzenlose Eitelkeit des religiösen Größenwahnwitzigen so aufzuzeigen. Ich wünschte, ein rechter Dichter machte sich einmal daran, uns jenen gelehrten Mönch des neunten Jahrhunderts vorzuführen, den Paschasius Radbertus, den Erfinder oder wenigstens Ausbildner und Feststeller der Lehre von der Transsubstantiation, welcher zufolge jeder beliebige Priester tagtäglich den Herrgott schafft, indem er Brot und Wein in das Fleisch und Blut Christi verwandelt. Der Mensch macht den Gott, gewiß ein erbauliches Beispiel von mittelalterlich-gläubigem Größenwahn! Oder war der närrische Paschasius etwa ein vorweggenommener Feuerbach? Einem Shakespeare der Zukunft könnte man auch die seiner würdige Aufgabe stellen, einen Arbues oder Torquemada als Typen des religiösen Größenwahns zu zeichnen, und vielleicht dürfte man noch den Luther hinzufügen, in Anbetracht, daß er den Papst kaum vom Stuhle der Unfehlbarkeit hinabgestoßen hatte, als er schon sich selber recht breit darauf setzte, die Bibel als einen unantastbaren Schild zwischen seine unfehlbare Autorität und die Vernunft stellend, welche er ja bekanntlich »des Teufels H... andlangerin« schalt. Die Arme ist das für die richtigen lutherischen »Diener am Worte« bis zum heutigen Tage geblieben und mußte es bleiben. Denn wie könnten sie sonst ihren römischen Kollegen, den richtigen »Dienern am Altar«, die Stange halten und wetteifernd mit diesen den »Frieden Gottes unter den Menschen« fördern? ...
Wo der Größenwahn in weltgeschichtlichen Gestalten, in einem siebenten Gregor, einem Luther, einem Napoleon zur Erscheinung kommt, erinnert er an den Satz Senekas, daß dem Genie immer eine Dosis Wahnsinn beigemischt sei (»nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae«). Shakespeare hat, wie jedermann weiß, das auch vom Dichtergenius geglaubt (»Des Dichters Aug', in schönem Wahnsinn rollend, blitzt auf zum Himmel, blitzt zur Erde nieder«). In beiden Fällen kehrt uns die Krankheit ihre tragische Seite zu. In die komische sodann schlägt sie um, wenn das Können des größenwahnsinnigen Individuums zu seinem Wollen in einem gar zu burlesken Mißverhältnisse steht. Indessen kommt auch hier, wie überall, das Reintragische ebenso selten zum Vorschein wie das Reinkomische, sondern zumeist verbinden sich beide Seiten zur Tragikomik. Natürlich! Das ganze Menschendasein, persönlich und geschichtlich genommen, ist ja die vollendete Tragikomödie.
Von den vier Größenwahngeschichten, welche ich auf Grund quellenmäßiger Zeugnisse in diesem Buch erzählen will, spielen zwei, die erste und die dritte, auf spezifisch-religiösem Boden, eine, die zweite, auf religiös-politischem und eine, die vierte auf sozialpolitischem. Die erste trägt einen vorwiegend komischen Charakter, während die drei übrigen als echt tragikomische Auftritte der großen menschlichen Tragikomödie sich darstellen.
Ist dieses Drama ein ebenso zufällig entstandenes wie zwecklos verlaufendes?
Ist es von einem »Gott« gedichtet und von einem »Teufel« travestiert in Szene gesetzt?
Ist es eine Generalprobe für die Aufführung auf einer »höheren« Bühne?
Wer weiß es?
Als Meister Rabelais im Fahre 1553 in Paris zu sterben kam, tat er es mit den Worten: »Je m'en vais chercher un grand Peut-être.« Wir verbringen unser Leben mit dem Suchen nach einem andern »grand Peut-être« Denn all unser Wissen vom Wissenswertesten ist und bleibt ein großes »Vielleicht!«
Mutter Eva.
1.
Am 27. Mai von 1705 erließ das Peinliche Halsgericht von Laasphe an der Lahn folgende Ladung:
»Des Hochgebohrnen Grafen und Herrn, Herrn Heinrich Albrecht, Grafen zu Sayn, Witgen- und Hohenstein, Herrn zu Valenthar, Neuenmagen, Lehra und Klettenberg u. s. w. Unsers Gnädigen Grafen und Herrn, Wir verordnete Richter und Schöppten des Hochgräflichen Peinlichen Halßgerichts allhier zu Laasphe, thun dir, Justus Gottfried Winter von Eschwege, dir, Johann Georg Appenfeller von Schleusingen aus Francken, dir, Eva Margaretha, Jean de Vesias, Fürstlichen Eisenachischen Pagen-Hoffmeisters Eheweib, gebohrene von Buttlarin, und dir, Anna Sidonia von Kallenberg von Forstwesten aus Hessen bey Cassel hiermit zu wissen, wie daß hiesiger Hochgräfl. Fiscalis, Amts-Ankläger an einem, entgegen und wieder euch allen, als peinlichen Beklagten am andern Theile, wegen beschuldigter Verspottung und Verletzung der Allerheiligsten Majestät und Dreyeinigkeit GOttes (gestalten, du Winter, dich vor GOtt den Vater, du Appenfeller, dich vor GOtt den Sohn, und du Eva Margaretha, dich vor GOtt den heiligen Geist, vor das neue Jerusalem und unser aller Mutter ehren lassen, und ob solche 3. göttliche Personen von euch sichtbahrlich aus- und eingingen, gotteslästerlich vorgegeben, und du, Eva Margaretha, die Thür solches Aus- und Eingangs seyst, und daß eure Naturen dergestalt mit der Gottheit vereiniget, daß sie zusammen einen Gott und Christum macheten, dahero eure Naturen auch als göttlich müsten veneriret werden, und ihr unter diesem Schein und eurer eingebildeten Gottseeligkeit und Frömmigkeit nicht anders als Hurerey, Ehebruch, Blutschande, große Gottes-Lästerungen, darunter auch Mord und andere grosse Uebelthaten, vor GOTT und der Welt ärgerliche, abscheuliche, grausame Laster, die man anhero zu setzen billig einen Scheu tragen muß, mit untergeloffen und gegen dich, Anna Sidonia von Kallenbergen, wegen absonderlich beschuldigten infanticidii, darum du Winter, und du Eva Margaretha von Buttlar, mit begriffen), bei diesem Hoch-Gräfl. peinlichen Halß-Gericht verschiedene artikulirte peinliche Amts-Anklagen übergeben, darauf litera affirmative contestiret, ihr zwar auch eure Responsiones darauf judicialiter abgeleget, und weiln ihr eines und das andere verneinet oder sinistre interpretiren wollen, Fiscalis zu eurer Ueberführung denominationem testium cum directorio übergeben und solche nunmehr eydlich und judicialiter prout moris et styli abzuhören gebeten, auch in hoc puncto sowohl von eurem defensore als Fiscali zu Bescheid gesetzt worden, nichtsdestoweniger aber ihr, aus Trieb und Ueberzeugung eures bösen Gewissens, noch vor Eröfnung dieses interlocuts flüchtig worden seyd, und ob man gleich dich Evam Margaretham von Buttlar annoch auf der Flucht ertappet, und du zu Biedenkopf im Hessen-Darmstädtischen auf Ersuchen von dasigen Beamten arrestiret worden, du dennoch durch Verwechselung der Kleider denen Wächtern entkommen und zum zweytenmahl dich davon und aus dem Staube gemacht, deswegen Fiscaliseine Eductal-Citation gegen euch allen zu erkennen, terminum ad comparendum zu prachgiren und die Citation an gewöhnliche Orte öffentlich anschlagen zu lassen gebeten hat. Nachdem nun sothanen Fiscalischen billig und rechtmäßigen Suchen deferiret und diese offene Ladung erkannt worden; hierum so citiren, heischen und laden im Nahmen Hochgedachter Ihrer Hoch-Gräflichen Gnaden auch von Amts-Gerichts- und Rechtswegen Wir dich Justus Gottfried Winter, dich Johann Georg Appenfeller, dich Eva Margaretha von Buttlar, dich Anna Sidonia von Kallenberg, daß ihr auf den XIX. schierkünftig, welchen wir euch allen vor den ersten, andern und dritten oder letzten Termin und peremptorie angesetzt haben wollen, beim peinlichen Halß-Gericht allhier aufm Rathhaus Morgens um 8. Uhr in Person erscheinet, eure Entschuldigung, daß ihr flüchtig worden seyd, vorbringet, der Sachen bis zu Ende abwartet, und rechtliche Erkänntniß gewärtig seyd, mit der Verwarnung, ihr kommt dem also nach oder nicht, daß nichtsdestoweniger auf Fiscalis förmliches Nachsuchen ergehen und geschehen soll, was recht ist, wornach ihr euch alle zu achten. Urkundlich des hierunter gedruckten Hoch-gräflichen peinlichen Gerichts-Insiegel.«
Geben zu Laasfphe den 27. May 1705.
Richter und Schöppen daselbst.
Aus dem barbarischen Schnörkelwerk der Gerichtssprache und des Kanzleistils von damals herausgeschält, stellt sich als Inhalt dieses Aktenstückes dar die in der Grafschaft Witgenstein vorgenommene Verhaftung einer Anzahl von männlichen und weiblichen Personen, gegen welche das gräfliche Kriminalgericht zu Laasphe eine Prozedur eröffnet hatte, ohne damit zum Ziele gelangt zu sein, weil die Bezichtigten dem Urteilsspruche durch ihre Flucht zuvorgekommen waren.
Die weitschichtige »Ladung« brachte nur die Wirkung hervor, daß, was bislang ein in hessischen und nassauischen Landen ausgehendes Gerücht von der »Buttlarschen Rotte« gewesen, jetzt zum lauten Geschrei wurde, welches bis nach Thüringen und Sachsen drang, sowie rheinaufwärts und rheinabwärts scholl. Zwar hatte der hellsichtige und klardenkende Thomasius, von der Hochwarte der Vernunft über das ruinenhafte Heilige Römische Reich Deutscher Nation ausblickend, schon im Jahre 1702 das widerwärtige Ding von gottseligem Schwindel erspäht. Aber doch nur von ferne und auch nur fernher war ihm zu Ohren gekommen, daß in Hessen »eine Hoffmeisterin aus Eisenach« weile, welche »schon über 70 Seelen an sich gezogen habe«, so untereinander in der »Paradisischen Freyheit« lebten. Allein erst drei Jahre später ist der hochverdiente Mann, der beste Deutsche seiner Zeit, in den Besitz des Aktenmaterials gelangt, woraus er seine Kenntnis des ganzen Handels schöpfte. Er hat die Akten mitgeteilt und auf Grund derselben sein rechtsgelehrtes Urteil über die beiden – erst zu Laasphe, dann zu Paderborn – gegen die »Rotte« angestrengten Prozeduren abgegeben, welches, wie nicht anders zu erwarten, durchweg der Anschauungs- und Denkweise des Mannes entsprach, der sein Leben lang ein allzeit schlagfertiger Bekämpfer von Unverstand und Unrecht gewesen ist.
Die nachstehende Darstellung der Größenwahnkomödie von der »Mutter Eva« ist durchaus aktentreu, und sind wir demnach dem alten ehrlichen Thomasius für die Lieferung der Materialien zu warmem Danke verpflichtet. Wo immer es angeht, wollen wir die Akten selber sprechen lassen; aber ich fürchte, es wird nicht allzuhäufig angehen, maßen die Sprache von damals zu derb und zu drastisch ist für die Nerven von heute. Damit soll zugleich angedeutet sein, daß die Rücksicht auf die heilige Konvenienz mir verwehre, das erste Hauptstück von den Abenteuern der »lebendigen Bibel«, wie die Hirtin der frommen Herde von ihren Schäflein genannt wurde, anders als obenhin abzuhandeln. Einläßlicher oder gar vollends aktenmäßig davon reden wollen, hieße so tollkühn sein, die Sprache eines Luther oder Thomasius zu einer Zeit zu sprechen, wo die Heuchelei unter den Kardinaltugenden obenan steht oder wohl gar die einzige Kardinaltugend ist.
2.
Die deutsche Reformation des sechzehnten Jahrhunderts hat, wie jedem bekannt, ihr Ziel kaum halbwegs erreicht. Die gehoffte und gewünschte Wiedergeburt der Nation wurde zur Mißgeburt einer bloßen »Kirchenverbesserung«, welche dem unseligen deutschen Zentrifugalgeist ein neues, ungeheuer kräftiges Element zuführte. Der Ursachen des Mißlingens einer nationalen Wiedererneuerung, wie die Genialität und der Feuereifer eines Hutten sie wollten, forderten und erstrebten, waren viele. Obenan standen die erbärmliche Reichsverfassung, die staatliche Zersplitterung, die gewaltige Verschiedenheit von Süd- und Norddeutschland, das Schlummern des nationalen Instinkts in den Massen, endlich der gänzliche Mangel an politischem Sinn und Verständnis in dem deutschen Reformator. In Wahrheit, daß Luther so ganz und gar kein Staatsbewußtsein besaß und in seine biblische Theologie völlig eingemauert war, das ist ein Nationalunglück von furchtbarer Tragweite gewesen. Statt eines Vaterlandes gab man den Deutschen die Bibel, statt des römischen Afterglaubens den jüdischen. Statt wie bis dahin an den katholischen Heiligen sollten sie sich fürder an den alttestamentlichen »Erzvätern« erbauen, dieser Bande von vorzeitlich-naiven »Gründern«, welche jedem Zuchthause Ehre machen würden, dieser würdigen Ahnen ihrer ebenbürtigen Nachkommen, der modern-abgefeimten Gründer und Millionendiebe. Das unübertreffliche Muster und Vorbild eines Gründer-Erzvaters ist der »ehrwürdige« Patriarch Abraham gewesen, welcher mit seiner schönen Frau Sarah wucherte und krebste und gründete (Genesis 12, 14–16; 20, 1–2), als wie – natürlich auf andere Manier – zu unserer Zeit der ewige Nachlaß-Varnhagen mit seiner nichtschönen Frau Rahel gekrebst und gegründet hat. Auf Kathedern und in Kompendien schleppt sich der Satz fort, die Erfolge der ganzen neuzeitlichen deutschen Kulturarbeit beruhten auf dem Protestantismus. Das ist wahr; nur muß man, wohlgemerkt, unter Protestantismus etwas ganz anderes verstehen als das offizielle Luthertum, welches ja zur Stunde noch von dem Größenwahn und Unfehlbarkeitsdünkel seines Stifters besessen ist und darum mit Händen und Füßen gegen alle Forderungen der Vernunft sich sträubt. Der Protestantismus, welcher seit Jahrhunderten in Deutschland zivilisatorisch gearbeitet hat und zur Stunde noch so arbeitet, ist jener Geist des Zweifels und der Forschung, welcher schon das ganze Mittelalter hindurch in einzelnen auserwählten Menschen geleuchtet und gerungen, der Geist, welcher vom vierzehnten Jahrhunderte an den Humanismus in die Wissenschaft und die Renaissance in die Kunst einzuführen begonnen und seither den Freiheitskrieg gegen das Dogma, d. h. gegen allen kirchlichen und staatlichen Absolutismus, rastlos und unermüdlich geführt hat.
Schon im siebzehnten Jahrhundert war das Luthertum völlig verpfafft. Aus der schrecklichen Probe und Prüfung des Dreißigjährigen Krieges ging es als eine Kirche hervor, welche an hierarchischer Anmaßung und Unduldsamkeit kecklich mit der katholischen wetteifern konnte, an Engherzigkeit und Kleingeisterei diese sogar noch weit übertraf. Wie beschämend fällt der Vergleich aus, wenn man zusammenhält, was zur angegebenen Zeit, im siebzehnten Jahrhundert, der Protestantismus in Deutschland litt und was er in England und drüben in Nordamerika tat. Hüben bei uns ein jammerseliges Weitervegetieren in elenden theologischen Zänkereien und Stänkereien, drüben in England die Durchaderung des gesamten Staatslebens mit protestantischem Geist, welcher dem Despotismus die große Lehre vom 30. Januar 1649 gab und an den Gestaden von Neu-England eine neue Welt gründete, die Welt der modernen Demokratie.
Allerdings glomm auch unter der Verknöcherung des lutherischen Kirchenwesens noch ein Lebensfunke. Aber wie hätte dieser Funke zu einer leuchtenden, reinigenden und schaffenden Flamme werden können inmitten der trostlosen Zustände, welche der Westfälische Friede herbeiführte? Für Deutschland bedeutete die Reformation politische Ohnmacht, Demütigung und Schmach, für England staatlichen Aufschwung und stolze Machtentfaltung. In England zeugte der Protestantismus den Helden Puritanismus, welcher die Siegesschlachten von Marstonmoor, Naseby, Dunbar und Worcester schlug, in Deutschland dagegen zeugte er den Betbruder Pietismus, welcher sich in Konventikeln umtrieb und einen Aberwitz nach dem andern austiftelte.
Trotzdem darf nicht übersehen oder verschwiegen werden, daß der deutsche Pietismus eine kulturgeschichtlich-berechtigte Erscheinung von nicht geringer Bedeutung gewesen ist. In seinen Anfängen und ursprünglichen Wollungen muß der Pietismus geradezu als eine nationale Wohltat anerkannt werden, weil er in den stagnierenden Sumpf des offiziellen Luthertums immerhin ein Bewegungselement brachte. Ja, in seiner Art ist der fromme Philipp Jakob Spener sogar auch ein Stück Held gewesen, weil es eine ganz erkleckliche Dosis Mut erforderte, gegen die lutherischen Pfaffen, welche vor dem Baal Bibelbuchstab räucherten, knieten und tanzten, anzugehen und den Stier Sankt-Orthodox, wenn nicht bei den Hörnern, so doch beim Schwanze zu packen. So tat der Pietismus, indem er die Quelle der Religion aus dem Katechismus in das Gemüt verlegte und der Starrheit und Kälte dogmatischer Satzung die Milde und Wärme menschlichen Erbarmens entgegenstellte. Auch einen kräftigen Keim von Zweifel und Kritik enthielt der echte Pietismus, maßen er ja darauf ausging, zu zeigen, daß in dem verknöcherten Luthertum wenig vom wahren Evangelium zu finden sei. Kein Zweifel demnach, daß der Pietismus kraft seiner unmittelbar oder mittelbar an dem orthodoxen Kirchenwesen von damals geübten Kritik ein Vorläufer und Wegbahner des modernen Rationalismus geworden ist.
Aber »tout dégénère entre les mains de l'homme« ist ein Satz, für welchen sein Aussteller Rousseau den Pietismus als einen kräftigen Beweis hätte anführen können. Alles Menschliche muß bekanntlich seine Kehrseite haben, und gar viel Menschliches hat nur eine solche. Die Kehrseite des Pietismus kam noch bei Lebzeiten seines Stifters Spener schon dunkel genug zum Vorschein, in allerhand widerlichen Erscheinungen. Frühzeitig schon namentlich auch in solchen, welche zeigten, daß in Konventikeln, aus welchen Baal Bibelbuchstab ausgetrieben worden, Astoreth Unzucht eingezogen war. In der Tat, einer der frühesten und leider auch begründetsten Vorwürfe, welche die orthodoxen Zeloten den pietistischen Separatisten machten, ist der gewesen, die ursprünglichen – zuerst durch Spener im Jahre 1670 zu Frankfurt a. M. aufgetanen – »collegia pietatis« hätten sich in lupanaria voluptatis verwandelt. Sodann steht fest, daß die Ausscheidung aus dem Pferche der lutherischen Kirche eine Unmasse von Schafen drehend gemacht hat. Denn das Konventikelwesen verleitete in seinem Vorschreiten eine Menge von bildungslosen Leuten zur Grübelei über Fragen, auf welche selbst der gebildetste Mensch keine Antwort zu geben weiß. Gar nicht verwunderlich also, daß die Beantwortungsversuche, wie sie innerhalb der zahlreichen pietistischen Sekten angestellt wurden, häufig genug die Form der absonderlichsten Narrheiten annahmen. Und mit solcher Phantasterei, welche sich chiliastischen Träumen und apokalyptischen Delirien überließ, verband sich ein sehr ausgeprägter Hochmut. Denn der anfänglich so milde und demütige Pietismus bald zum Vollbewußtsein des Auserwähltseins auf- und ausgewachsen, machte mit seiner »Gotteskindschaft« förmlich Parade, suchte den geistlichen Dünkel des orthodoxen Zelotismus noch zu überbieten und gefiel sich nicht selten in der Pflege und Hätschelung eines Größenwahns, dessen Auslassungen mit zu den ungeheuerlichsten gehören, von welchen die Geschichte der menschlichen Narrheit überhaupt Kenntnis hat.
»Mutter Eva,« tritt hervor aus dem Schattendunkel der Vergangenheit und lege Zeugnis ab für das Gesagte!
3.
In den idyllischen Gegenden, welche die Lahn, die Dill, die Sieg und die Eder durchstießen, erschien im Jahre 1702 eine fremde Dame, welche dreißig Jahre oder auch etliche mehr zählen mochte. Ihr An- und Aufzug war so, wie eine Frau der »guten« Gesellschaft von damals sich trug und gab. Sie schien im Besitze ausreichender Reisemittel zu sein und war es auch wirklich, wie die mitgeführten Koffer, Kasten und Kisten auswiesen. Auch Gefolge hatte sie, männliches und weibliches, und sie wurde von ihrer Umgebung sehr respektvoll behandelt. Man hörte sie von ihren Begleitern und Begleiterinnen »Frau Hofmeisterin« betiteln, nahm aber auch wahr, daß ihre Vertrauten, Männer und Weiber, sie als »Mutter Eva« anredeten.
Sie hatte sich mit ihrer Reisegesellschaft in Thüringen und Hessen umgetrieben. Wanfried, Allendorf, Erfurt und Eschwege werden als ihre Rastorte genannt. Es scheint jedoch, daß man sie und ihr Geleite allenthalben bald weitergehen geheißen hatte, mehr oder weniger höflich. Die Wandererin hatte Gründe, nach einem Aufenthaltsort auszusehen, wo man es mit der katholischen oder lutherischen Orthodoxie nicht sehr genau nahm. Für ein solches Land der Duldsamkeit galt die Grafschaft Witgenstein, deren Souverän, Graf Heinrich Albrecht, weniger aus Toleranz- als vielmehr aus Finanzpolitik den Separatisten ein gnädiger Beschützer war. Er wußte, daß die Sektirer, welche von nah und fern herbeikamen, pünktlich die ihnen auferlegte Kopfsteuer (»Schutzgeld«) zahlten, um in den Waldtälern des Ländchens ungeschoren ihren Tifteleien nachhängen und daneben ihre mancherlei Gewerbetätigkeit treiben zu können. Man kann es nicht recht klarstellen, muß es aber vermuten, daß die Frau Hofmeisterin, im Reiche Witgenstein angelangt, anfänglich in Laasphe und in Schwarzenau ihr Zelt aufgeschlagen habe. Sicher dagegen ist, daß sie entweder am Ende von 1702 oder am Anfang von 1703 auf das im Schwarzenauer Tale gelegene Gehöft Sasmannshausen gezogen ist, welches die gräfliche Rentkammer ihr gegen Vorauserlegung einer Summe, die den Betrag des stipulierten jährlichen Mietzinses erreicht haben mag, eingeräumt hatte.
Das Gehöft lag einsamlich, als wie zu einem Nest der »Gottseligkeit« so recht gemacht. Nur zwei Nachbarn gab es: den Pächter des »unteren« Hofes, Christian Wirth, und den separatistischen Pfarrer Philipp Jakob Dilthey, welcher, um seiner »hitzigen Pietisterei« willen von seiner Pfarre zu Häyger im Nassauischen ausgetrieben, ein ebenfalls zu dem gräflichen Gut Sasmannshausen gehöriges »Häuslein« bewohnte und als der bemittelte Mann, der er war, dem Herrn Grafen von Witgenstein 2000 Taler vorgeschossen hatte, wie es scheint, in der Absicht, einzelne Teile des herrschaftlichen Gutes oder auch wohl das ganze in seinen Besitz zu bringen.
Hier in Sasmannshausen versammelte nun die »Hofmeisterin« viele »liebe Seelen« um sich, Männlein und Weiblein, einen förmlichen Hof sozusagen, der mitunter die Zahl von 60 oder 70 Personen erreichte, und der liebselige Dienst der »Mutter Eva« hatte seinen gedeihlichen Fortgang, bis zu Ende des Jahres 1704 ein arger Ruch – die Kinder der Welt würden nicht anstehen, denselbigen Ruch einen Stank zu nennen – von Sasmannshausen ausging unter die Leute, ein bös' Geschrei über die »Buttlarsche Rotte«.
Wie war es mit dieser, und wer war die »Hofmeisterin«, genannt die »Mutter Eva«?
Bedauerlich zuvörderst, daß uns die Akten keine Mittel gewähren, uns von der physischen Erscheinung der »lebendigen Bibel« eine deutliche oder überhaupt nur eine Vorstellung zu bilden. Häßlich kann sie aber doch wohl nicht gewesen sein: häßliche Even pflegen nicht einen ganzen Troß von Adamen hinter sich her zu ziehen. Wir werden daher, alles erwogen, kaum fehlgehen, so wir uns die Frau Hofmeisterin als ein Weib, ich will nicht sagen von großer Schönheit, aber doch von üppiger Hübschheit vorstellen. Mir persönlich ist beim Durchlesen der Akten ihrer Geschichte oft vorgekommen, als müßte sie gewesen sein, was die Franzosen »une beauté du diable« nennen: – eine jener Lüsternheit atmenden Gestalten, schlank und schmiegsam, rundschulterig und hochbusig, goldrot von Haaren, schwarzäugig, ein herausforderndes Stumpfnäschen über dem etwas großen Mund mit seinen sinnlich frischen und feuchten Lippen, item Grübchen auf Wangen und Kinn.
Was die moralische oder, genauer gesprochen, die unmoralische Erscheinung der Dame betrifft, so sind die Akten hierüber weniger zurückhaltend. Wir wollen uns aber vorderhand nicht mit ihrer Moral oder Unmoral, sondern nur mit ihren Personalien abgeben.
Am 27. September von 1703 richtete der Herr Jean de Besias, fürstlich sächsischer Pagen-Hofmeister, an »Ihro Durchlauchtigkeit zu Eisenach« ein Ehescheidungsbegehren, welches also anhob: »Es ist leider! ohne weitleuftiges Anführen land-kundig, wasgestalt mein Ehe-Weib Eva Margaretha, gebohrene von Buttlar, nun unterschiedene Jahre ihrer ehelichen Pflicht gegen mich ganz vergessen« – und nach Herzählung der einzelnen Beschwerden des armen Ehemannes mit diesen Worten schloß: »Daher implorire Ew. Hoch-Fürstl. Durchlaucht unterthänigst um die Ehescheidung und daß mir wegen meiner zumahl öfters baufälligen Leibes-Constitution gnädigst erlaubet werden möge, mich anderweit Christlich zu verheyrathen.« Neben diese Äußerung des baufälligen Pagenhofmeisters, der ein geborener Franzos, vielleicht der Sprößling französischer Réfugiés gewesen sein mag, stellen wir etliche Sätze aus der Verteidigungsschrift, welche später der Wetzlarer Anwalt Dr. Bergenius, ein schwärmerischer Verehrer der »lebendigen Bibel«, für diese beim Reichskammergerichte einreichte. Der genannte Doktor der Rechte, mit welchem die Hofmeisterin bald nach ihrem im März von 1702 bewerkstelligten Entweichen aus Gattenhaus und Heimat bekannt und vertraut geworden sein muß, maßen sie ihn von Wetzlar nach Eisenach schickte, um ihre dortigen Angelegenheiten zu ordnen, ließ sich in dem erwähnten Schriftstück also vernehmen: »Es ist auswärts benannte Frau von Buttlar als das einzige in ihrer Eltern hohem Alter erzielte Kind in aller Frömmigkeit und Adeligem Hochmuth erzogen und nach des Herrn Vaters frühzeitigem Ableben in ihrem 15. Jahr des Alters, mit nicht gar genehmen Willen der annoch lebenden Mutter, an einen Fürstl. Sächsischen Pagen-Hoffmeister verheyrathet worden. Die sonderbahre Gnade des Grund-gütigen Gottes aber hat sie auf allerhand Art von innen und von außen mit vielem Creutz und Trübsal heimgesucht, bis sie dadurch vor Gott die Nichtigkeit ihres eingebildeten Standes und bisherigen Hoff-Lebens annebenst verschiedene Mißbräuche des dasigen Kirchenwesens, sonderlich beym Beicht- und Abendmahl-Gehen, mit sehr empfindlicher Wehmüthigkeit eingesehen, dahero zu gehorsamer Folge ihres Heylandes Christi sie den üppigen Kleider-Pracht ab- und geringere erbare Tracht angeleget, auch vor aller Welt-eitlen Gesellschaft einen Widerwillen bekommen, hingegen ihre Erbauung mit gleichgesinnten Christlichen Seelen gesucht, worüber dann erstlich die Verachtung bei Hofe und nachgehends die spöttliche Nachrede des gemeinen Pöbels erfolget.«
Schade nur, daß sich die Sachen etwas anders verhielten. Daß das junge, kaum fünfzehnjährige, hübsche, von väterlicher Seite her vermögliche, als einziges Kind ihrer Eltern, wie bestimmt zu vermuten ist, gehörig verzogene Ding von Evchen in der Ehe mit dem baufälligen »Pagen-, Hoff- und Tantz-Meister« de Vesias kein Glück und kein Behagen gefunden, ist begreiflich; daß sie aber zunächst nicht nach dem Heiland als nach einem Tröster sich umgesehen, steht fest. Es war da nämlich ein junger Lateinschüler, Johann Georg Appenfeller – (in den Akten auch Appenfelder geschrieben) – welcher, von gleichem Alter mit Eva oder sogar ein Paar Jährchen jünger als sie, zu Eisenach mit ihr im selben Hause wohnte und ihr herzlich befreundet wurde. Der gute Sancho Pansa als der große Liebhaber von Sprichwörtern, der er war, würde sagen: »Jung und jung gesellt sich gern« – und »Gelegenheit macht Diebe«. Ich meinesteils sage nur: Es ist nicht erwiesen, daß die beiden jungen Leute schon dazumalen gegen das sechste Verbot sich vergangen haben; wohl aber, daß Eva später nicht ohne den Appenfeller sein und leben mochte. Was ihn betrifft, so hat er seine Lateinstudien in Gotha fortgesetzt und an diesem Orte ist er zuerst in die Konventikelei verstrickt worden. Dann studierte er zu Jena und Wittenberg Medizin, war ein gefürchteter Renommist, »zerhauen und zerstochen«, tat sich auch als »Poete« auf und führte als solcher den Namen Leander. Er hatte seine Medizin absolviert und hielt sich in der Nähe von Eisenach bei einem Verwandten auf zur Zeit, als der Doktor Bergenius mit seinem Schreiber Ichtershausen in Geschäften Evas in genannter Stadt weilte. Der Doktor lud nun im Auftrag und Namen seiner Klientin den jungen Mann nach Sasmannshausen ein, und zwar in ebenso dringender als geheimnisvoller Weise. Denn »es könnte das Werk Gottes nicht ehe vollzogen und recht offenbahret werden, biß der Student herbey käme; er müßte herbey und sollte er auch in Stücken herbey kommen; er wäre einmal dazu beruffen, das müßte geschehen«. Solcher Beschwörung vermochte sogar ein zerhauener und zerstochener Jenenser Renommist nicht zu widerstehen. Der dienstbeflissene Doktor verschaffte ihm ein Pferd, gab auch das Reisegeld her, und so machte sich denn Jung-Leander dahin auf den Weg, von woher ihm mysterienhafte Ehren winkten.
Wir lassen ihn reiten und bleiben noch eine kleine Weile in Eisenach, um die Bekanntschaft eines sicheren Justus Gottfried Winter zu machen, von welchem wir wissen, daß er so um 1677 herum zu Merseburg geboren und sodann als eifriger Jünger von zwei pietistischen Hauptpropheten, des Ernst Christoph Hochmann von Hochenau und des Doktor Horch, nach glücklich bewerkstelligtem »Durchbruch« zur Gnade »wiedergeboren« worden. Hochmann von Hochenau ist der Verkündiger der von seinem Schüler Winter nachmals praktizierten Lehre vom Urmenschen, der Mann und Weib zugleich gewesen sei, woraus die Schlußfolgerung gezogen wurde, daß dieser Urmenschzustand wiederum herzustellen und zu diesem Ende die natürliche Bestimmung des Weibes zu verunmöglichen sei. Wie der Winter mit der Eva zuerst in Beziehung gekommen, wissen wir nicht. Aber es muß noch zur Eisenacher Zeit der Frau Hofmeisterin geschehen sein, und zwar muß schon damals die Verbindung oder – mormonisch zu sprechen – die »Versiegelung« der beiden fix und fertig geworden sein. Denn für Winter war Eva bereits die »Mutter«, wie ein von ihm an sie nach Eisenach gerichteter Brief bezeugt. Diese Epistel beginnt im Dithyrambenstil des Pietismus: »Meine Seele erhebet den Herrn und mein Geist freuet sich Gottes meines Heylandes. Der Herr hat große Dinge an mir gethan, Halleluja. Liebe Mutter« usw. nach bekannter Melodie. Um über die Natur und Art dieser »Mutterschaft« keinen Zweifel aufkommen zu lassen, will ich gleich einen kleinen Ausschnitt aus dem witgensteinschen Gerichtsprotokoll vom 3. Dezember 1704 anfügen. Eva erklärte auf Befragen, sie »wäre mit dem Winter verbunden in Gott, nach Leib, Seel' und Geist«. Auf die Frage, »ob solches denn kein Ehebruch sei?« erwiderte sie: »Nein. Ihr Mann (de Vesias) wäre ihr civiliter abgestorben; es wäre keine Ehe gewesen, es wäre eine Ehe vom Teufel gewesen, die mit Winter aber von Gott.«
4.
Nach Leanders Ankunft auf dem Hofe Sasmannshausen war da auch der rechtsgelehrte Doktor Vergenius ab und zu in diesem Tabernakel der Gottseligkeit erschien, die »Buttlarsche Rotte« jetzo daselbst vereinigt im Herrn. Eine ziemlich gemischte Gesellschaft, profan zu reden. Denn neben den Vertretern der theologischen, medizinischen und juristischen Fakultät, Winter, Appenfeller und Vergenius, gab es da verbummelte Schreiber wie Ichtershausen, wegen Betrugs weggejagte Schulmeister wie Reuter, gewerbsmäßige Vagabunden wie Pintner aus Bern und arbeitsscheue Handwerker wie Spillner, der Schreiner. Die adelige Damenschaft wurde repräsentiert durch die Mutter Eva selbst, sowie durch die beiden Schwestern Sidonia und Charlotte von Kalenberg, der bürgerlich- und bäuerlich-weibliche Stand durch die Bäckersfrau Dorothea Kronemus und die beiden Mägde Anna Mannus und Martha Hartmann.
Bei so vielseitigen Kräften konnte nun ernstlich daran gedacht werden, das »Werk Gottes« zu tun. Was war das für ein Werk? Torheit und Affenschande. Größenwahnsinnige Phantasterein und wüste Sinnlichkeit brodelten da mitsammen in dem Hexenkessel der Sektiererei. Der daraus aufsteigende Qualm ballte sich zu Gestalten und Gruppen, deren Umrisse traumhaft wechselten. Da erschien das Gebilde einer absonderlichen Dreieinigkeit, in welcher Winter den »Vater«, Eva die »Mutter«, Appenfeller-Leander den »Bruder« vorstellte. Dann wieder handelte es sich um die Herstellung des sündenlosen mannweiblichen »Urmenschen«. Der neue Adam war Winter. »Sollte aber der neue Adam solches Werk (Schaffung des Urmenschen) verrichten, so mußte er auch eine neue Evam haben, und eine solche neue Eva und Mutter aller Lebendigen war sie, die Hofmeisterin. Durch den neuen Adam und die neue Eva sollte alles, was durch den alten Adam und die alte Eva verloren worden, wiederum restituiret werden.« Soweit konnte der Unsinn noch für harmlos gelten. Weiterhin aber verfiel er ins Babylonische und Frevelhafte. Die neue Eva spielte, um die Männer zur Rückkehr in den Urstand zu befähigen, sozusagen die Göttin Baaltis oder Mylitta. Sie war die Buhlerin von allen, um »als himmlisch berufenes Werkzeug die böse Lust in ihnen zu tödten«. Das wäre – so steht in den Akten – »der Weg der Reinigung« und sie, die Mutter Eva, »wäre der Teich Bethesda, worinnen sich alle baden müßten, welche da wollten seelig werden«. Der neue Adam seinerseits hatte die Mission und kam derselben eifrig nach, mittels grausamer Verstümmelung die Weiber unfruchtbar zu machen. Und abermals wechselte die tolle Phantasmagorie, und es erschien eine Variation der neuen Dreieinigkeit, dergestalt, daß »sonderlich sichtbahr das dreyeinige Haupt, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! der Vater sichtbahr in Wintern, der Sohn in Appenfellern, der Geist in der Eva, welche drey Personen auch sichtbahr von einander ausgingen, auch wiederum ein. Sie aber, die Hofmeisterin, ist die Thür solches Aus- und Eingangs.« Neben der Dogmatik wurde auch der Kultus berücksichtigt. »Beten, singen und der gantze privat- und öffentliche Gottesdienst muß aufhören. Tauffe, Abendmahl, Bibel-Lesen besteht alles in einem lebendigen Wesen und, mit einem Worte, in der geistfleischlichen Verbindung. Denn die lebendige Bibel ist die Hoffmeisterin.«
Das »gottselige« Tun und Lassen der »lieben Seelen« in der Einsamkeit von Sasmannshausen ist aber nicht lange unbehelligt geblieben. Die Welt ist so böse und deutet die »Werke« und die »Geheimnisse« Gottes so böswillig! Auch hatten die neue »Dreyeinigkeit« und ihre Anbeter, zwei schlimme Feinde von Anfang an, und hätte die »Buttlarsche Rotte« ihr Wesen hundert Jahre später getrieben, so konnte sie mit Schillers Tell sagen:
»Es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben, So es dem bösen Nachbar nicht gefällt.«
Statt eines bösen Nachbars hatten aber die Frommen und Frömmsten von Sasmannshausen deren zwei: den Pächter Wirth und Se. Ehrwürden Dilthey, welche beide auf die Erwerbung des Gehöftes spekulierten und »spannten«. Item beide besorgten auch, die »Hoffmeisterin« mit ihren reichlichen Geldmitteln würde ihnen den Hof »vor der Nase wegkaufen«. Beide umlauerten und bespionierten nun die »Rotte« bei Tag und bei Nacht. Wirth will dabei noch in besonderem Auftrage Sr. Gnaden des Herrn Grafen von Witgenstein gehandelt haben. Jedenfalls griff er zu allerhand nicht sehr ehrlichen Praktiken, zum Löcherbohren und dergleichen mehr, um die Vorgänge im Inneren des Tabernakels auszukundschaften. Seine Aussagen über das von ihm Erlauerte und Erlauschte waren von bäuerischer Drastik und Plastik, wohl auch übertrieben und jedenfalls gehässig gefärbt. Indessen ist sein Zeugnis unbedingt glaubhafter als das des Muckers Dilthey, der offenbar aus purem Eigennutz gegen die »Rotte« vorging. »Klug wie die Schlangen,« kleidete er sein Verlangen, daß die Mutter Eva und ihr Anhang das Feld, d.h. den Hof Sasmannshausen räumen möchten, in die liebsüßchristliche Besorgnis um das Seelenheil der Rotte. Ja, er unternahm einen förmlichen Feldzug gegen den bösen Feind, um demselben die lebendige Bibel und Kompanie aus dem brüllenden Rachen zu reißen. Als Hilfevölker zu diesem Unternehmen verschrieb er sich aus Schwarzenau – einer unfern gelegenen Sektiererkolonie – eine gehörige Anzahl von »lieben Seelen«, als da waren der Rechtskonsulent Hoffmann, der Prophet Hochmann von Hochenau, der Pastor Weigel, die Pastorin Wetzel und die verwitibte Gräfin von Leiningen-Westerburg samt ihrer ledigen Schwester Anna. An der Spitze dieser Streitmacht versuchte Ehren Dilthey »nach demüthigem Gebet« die Mutter Eva und Konsorten »in Gottesnamen« dem Teufel abzuringen und auf den richtigen Weg zurückzubringen. Aber der Kreuzzug vergeckte kläglich: die Rotte hielt stand und schlug unter Anstimmung des Schlachtgesanges: »Zerfließ, mein Geist, in Jesu Blut und Wunden!« den Angriff tapfer ab. Das Gefecht wütete in Form einer heftigen Disputation, in welcher die Rotte Dilthey gegenüber der Rotte Buttlar entschieden den kürzeren zog. Leider hat der streitbare Prädikant nicht für gut gefunden, die Einzelnheiten seiner Niederlage aufzuzeichnen. Nur die eine Gefechtsszene, allwo sich der Kampf um das häkelige Objekt der Be- oder Verschneidung drehte, fand er scharf zu betonen für gut und zwar so: »Die Hoffmeisterin Eva schlug die Bibel und zwar das 5. Kapitel des Hohen Liedes auf, reichte dasselbige Herrn Hoffmann dar und mit ihrem Finger zeigete sie ihm den 4. Vers, sagende: Hier habt Ihr den Grund unserer Beschneidung!« ... Nach bewerkstelligtem Rückzug scheint Ehren Dilthey über seinen Fehlschlug erst recht erbost worden zu sein. Es war ihm jetzt ganz klar, daß »die Mutter Eva eigentlich die apokalyptische Jesabel sei, welche gutwillige Seelen zu gräulichen Sünden verführe«. Nachträgerisch, wie nur ein Pfaff es sein kann, hat er dann die im November von 1704 eingetretene Katastrophe der Rotte benutzt, um an die »Gräflichen Kommissarien« eine Angebereischrift zu richten, worin er die Mitglieder der Rotte aller möglichen Greuel bezichtigte und schließlich erklärte: »Ich vor meine Person zweifle nicht, daß die Eva und die andern, so bei ihr sind, mit dem Teuffel in einem Bund sehn, ihn anbeten und diesem bösen Geist einen Sabbath nach dem andern feyren.«
5.
Wie vorhin angedeutet worden, hat im November von 1704 der gottselige Wandel der lieben Seelen von Sasmannshausen eine gewaltsame Unterbrechung erfahren.
Der Herr Graf von Witgenstein war einer jener mehreren Hunderte von reichsunmittelbaren Miniatursouveränen und Duodeztyrannen, welche die hohe und niedere Gerichtsbarkeit besaßen und dieselbe häufig genug im ritterlichen, d.h. im raubritterlichen Sinne ausübten. Das Elend der Justizpflege oder, richtiger gesprochen, der Injustizpflege im damaligen Deutschen Reiche kann man sich gar nicht groß genug vorstellen. Nur das auserwählte Volk der Geduld und Fürstenfürchtigkeit konnte sich dazu hergeben, dieses und anderes Elend mehr zu ertragen. Der einzige tatsächliche Rechtsschutz, d. h. die einzige Möglichkeit, den Griffen der »Kabinettsjustiz« zu entgehen, bestand in der häufig ins Grotesk-Komische gehenden Unmacht der zahllosen kleinen Tyrannen, die Sprüche ihrer »Halsgerichte« und »Malefizgerichte« in Vollzug zu setzen.
Der Beherrscher des Reiches Witgenstein hatte schon lange lüstern die Ohren gespitzt, in welche der Pächter Wirth allerhand Verführerisches zu raunen wußte von dem großen Geld und Gut, so die Buttlarsche Rotte zu Sasmannshausen besäße. Gut, dachte Serenissimus, da ließe sich ja ein prächtiger Fang machen und noch dazu aus gebieterischer Pflicht. Bin ich nicht summus episcopus meines Landes? Freilich bin ich das. Und liegt mir als solchem nicht ob, über die Reinheit der orthodoxen Lehre zu wachen und Häresie und Blasphemie gebührend zu strafen? Allerdings. Was folgt daraus? Daß über die Sasmannshäuser komme, was Rechtens.
Fast scheint von solchem Selbstgespräch und Entschluß Sr. Gräflichen Gnaden etwas nach Sasmannshausen hinüber ruchbar geworden zu sein. Denn mit einmal kam es der Mutter Eva in dem Neste der Gottseligkeit nicht mehr ganz geheuer vor, und sie war gerade im Begriffe, mit Appenfeller-Leander nach Wetzlar abzureisen, um »etliche von den besten Sachen in Verwahrung zu bringen«, als das Verhängnis auf die Rotte fiel und zwar in Gestalt des »Land-Schultzen Bilgen, welcher uns den Arrest im Namen des Grafen von Witgenstein ankündigte, allwo ich« – setzt der Erzähler dieses Auftrittes, der zerhauene und zerstochene Leander hinzu – »sechszehn Wochen lang mit arretiret war, nicht wissend warum«.
Die ganze Sippschaft wurde in Laasphe eingetürmt, und nun hob eine Prozedur an, welche in ihrer Art nicht weniger skandalhaft war als die Sasmannshauser Gottseligkeit in der ihrigen. Das erste und eiligste, was die Witgensteinsche Justitia tat, war, daß sie auf die Habe der Verhafteten zu Sasmannshausen eine räuberische Hand legte. Die Beute war recht ansehnlich: bares Geld, Silbergeschirr, feines Mobiliar, ein hübscher Vorrat an Weißzeug und Kleidern erfreuten das Herz des raubritterlichen Gerichtsherrn. Um aber ein »rechtskräftiges« Urteil vorzubereiten, welches den Raub in Konfiskation verwandelte, ernannte der Herr Graf den ganz bildungslosen Landschulzen Bilgen, einen zweiten beliebigen Kaffer und einen blutjungen Kanzlisten zu Untersuchungskommissarien, welche in formlosester, ja geradezu brutal-gemeiner Weise die Verhöre der Verhafteten führten. Vergebens bot der evagläubige Dr. Vergenius von Wetzlar her alle Ränke und Schwänke seiner weitschichtigen Rechtsgelehrsamkeit zugunsten der »Mutter« und ihrer Kinder auf, vergebens berief er sich feierlich auf die »Reichskonstitutionen« und auf »Kaiser Karoli peinliche Halsgerichtsordnung«, das tumultuarisch zusammengebrachte Aktenmaterial bot dem gräflichen Fiskal genug und übergenug Stoff zur Formulierung einer peinlichen Anklage, auf Grund welcher auf dem Rathause von Laasphe das peinliche Halsgericht ganz formlos gehegt wurde. Der redliche Thomasius hat über das ganze Verfahren einen scharfen Tadel ausgesprochen.