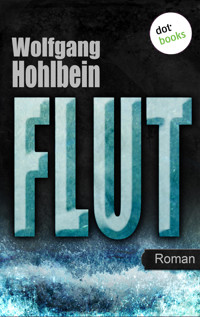9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Wenn die ganze Welt vor dem Abgrund steht: »Die Todeselemente« beinhaltet erstmals alle drei Katastrophen-Thriller von Wolfgang Hohlbein – als eBook bei dotbooks. Es hört nicht auf zu regnen, seit Wochen, überall auf der ganzen Welt. Während alles zu ertrinken droht, wird die junge Rachel in eine Verschwörung verwickelt, die das Ende aller Tage einläuten könnte … Auf die Flut folgt das Feuer: Köln wird von mysteriösen Bränden heimgesucht und der Kleinkriminelle Will denkt, er hat damit überhaupt nichts zu tun. Doch warum scheinen ihm die Flammen stets zu folgen? … Wenn Flut und Feuer toben, folgt der Sturm: Der IT-Experte Dirk muss seine verschwundene Tochter finden und folgt einer Spur nach Afrika. Doch am Ufer des Ogowes erfährt Dirk von einem uralten Mythos über einen Sturm, der alles vernichten kann – und dass seine Tochter der Schlüssel zu der alten Legende ist … »Temporeich geschrieben! Überraschende Wendungen – atemloses Lesen!« BILD am Sonntag Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Todeselemente« von Wolfgang Hohlbein beinhaltet die drei Katastrophen-Thriller »Flut«, »Feuer« und »Sturm«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 3082
Ähnliche
Über dieses Buch:
Es hört nicht auf zu regnen, seit Wochen, überall auf der ganzen Welt. Während alles zu ertrinken droht, wird die junge Rachel in eine Verschwörung verwickelt, die das Ende aller Tage einläuten könnte … Auf die Flut folgt das Feuer: Köln wird von mysteriösen Bränden heimgesucht und der Kleinkriminelle Will denkt, er hat damit überhaupt nichts zu tun. Doch warum scheinen ihm die Flammen stets zu folgen? … Wenn Flut und Feuer toben, folgt der Sturm: Der IT-Experte Dirk muss seine verschwundene Tochter finden und folgt einer Spur nach Afrika. Doch am Ufer des Ogowes erfährt Dirk von einem uralten Mythos über einen Sturm, der alles vernichten kann – und dass seine Tochter der Schlüssel zu der alten Legende ist …
Über die Autoren:
Wolfgang Hohlbein, 1953 in Weimar geboren, ist Deutschlands erfolgreichster Fantasy-Autor. Der Durchbruch gelang ihm 1983 mit dem preisgekrönten Jugendbuch Märchenmond. Inzwischen hat er 150 Bestseller mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern verfasst. 2012 erhielt er den internationalen Literaturpreis NUX. Zeitgleich startete der in Neuss lebende Autor ein innovatives Hohlbein-TV-Projekt.
Wolfgang Hohlbein im Internet: www.hohlbein.de
Dieter Winkler, geboren 1956 in Berlin, stand bereits mit fünf Jahren im Rosenkavalier auf der Bühne, hat als Jugendlicher in verschiedenen Bands gespielt und erste Kurzgeschichten veröffentlicht. Nach langen Jahren als Chefredakteur hat sich der Phantastik-Preisträger mit international erfolgreichen Buch-Reihen (Enwor, Netsurfer) und verschiedenen Hörspiel- und Theaterprojekten einen Namen gemacht.
Bei dotbooks veröffentlichen Wolfgang Hohlbein und Dieter Winkler gemeinsam die in diesem Band zum ersten Mal vereinte Todeselemente-Trilogie mit den Einzelbänden Flut, Feuer und Sturm.
***
eBook-Sammelband-Originalausgabe Oktober 2019
Einen Quellennachweis für die in diesem Band vorliegenden Romane finden Sie am Ende dieses eBooks.
Copyright © der Originalausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Adobe Stock/XtravaganT und shutterstock/Waj, ahupepo
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96148-919-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Todeselemente« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wolfgang Hohlbeinmit Dieter Winkler
Die Todeselemente
Drei Thriller in einem Band
dotbooks.
Flut
Prolog
Pjotr sah zum ungefähr fünfundzwanzigsten Mal innerhalb der letzten fünf Minuten auf die Uhr. Die Bewegung war ruhig, aber wie alles, was der Russe tat, so zielgerichtet, dass es sehr schnell wirkte und fast ein bisschen unheimlich. So, wie Pjotr selbst ein bisschen unheimlich war. Wäre dieses winzige, verräterische Zeichen von Nervosität nicht gewesen, hätte man glauben können, dass der Russe zu keinerlei Gefühlsregung fähig war. Sein Gesicht, das auf eine brutale Art gut aussehend wirkte, ganz egal, mit welchen Vorurteilen belastet man es auch betrachtete, zeigte immer den gleichen Ausdruck, als wäre es nicht mehr als eine perfekt gemalte Maske aus starrem Kunststoff; und selbst seine Augen wirkten wie glitzernde Kugeln aus kaltem Glas, nicht wie die Fenster zur Seele, die sie doch eigentlich sein sollten. Vielleicht, weil er keine hatte.
Torben erschrak, als er diesen Gedanken dachte, und verscheuchte ihn hastig. Er tat dem Russen damit Unrecht. Pjotr war ohne Zweifel ein Verbrecher, ein Dieb, Betrüger, Erpresser und Schläger und mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar ein Mörder, aber das traf auf seine drei Begleiter ebenso zu, und er, Torben, hatte ganz bestimmt nicht das Recht, über sie zu urteilen. Diese vier Männer waren, was sie waren. Er hatte sie nur deshalb ausgewählt, weil das Schicksal ihnen vermutlich niemals gestatten würde, eine andere Art von Leben zu führen. Er selbst aber hatte diese Wahl und deshalb wog das Verbrechen, das er begehen würde, ungleich schwerer.
Torben verscheuchte auch diesen Gedanken und sah nun ebenfalls auf die Uhr. Noch acht Minuten. Es wurde Zeit. Er hatte die Strecke in den letzten sechs Wochen ein Dutzend Mal zurückgelegt, immer in verschiedenen Verkleidungen und in großen, vor allen Dingen unregelmäßigen zeitlichen Abständen, damit sich niemand an ihn erinnern konnte, und er war auf eine Spanne von vier oder vielleicht fünf Minuten gekommen, dazu noch einmal sechzig Sekunden, um den Weg vom Aufzug bis zum Kreißsaal zurückzulegen, und eine kleine Reserve für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Zwischentür geschlossen war und Pjotr sie aufbrechen musste. Sie durften auf keinen Fall zu spät kommen, aber auch nicht zu früh.
Sie hatten so verzweifelt wenig Zeit für eine so entsetzlich große Aufgabe.
Er stand auf. Pjotr und die drei anderen Söldner erhoben sich ebenfalls und sie verließen wortlos den kleinen Kellerraum, in dem sie die letzten anderthalb Stunden zugebracht hatten. Es waren die sonderbarsten anderthalb Stunden gewesen, an die sich Torben erinnern konnte. Auf der einen Seite schienen sie sich zu anderthalb Ewigkeiten gedehnt zu haben, die einfach kein Ende nehmen wollten, und zugleich hatte er das Gefühl, vor wenigen Augenblicken überhaupt erst gekommen zu sein. Aber es hatte ja auch noch nie zuvor so viel auf dem Spiel gestanden.
Auf dem Weg zum Aufzug zogen die Männer ihre Kittel an. Der Russe setzte zusätzlich eine Brille mit schwerem Horngestell auf und strich sich das schwarze Haar aus der Stirn. Die Veränderung, die durch diese wenigen, simplen Handgriffe mit den Männern vonstatten ging, war erstaunlich. Selbst Torben hätte Pjotr den jungen Assistenzarzt auf dem Weg zu einem Routineeinsatz beinahe geglaubt.
Sie mussten einen Moment warten, bis der Aufzug kam, aber Torben hatte eine Minute dafür einkalkuliert. Sie lagen immer noch gut in der Zeit. Als Pjotr die Hand nach der Schalttafel ausstreckte, klaffte sein weißer Arztkittel auf und Torben sah schwarz eingeöltes Metall darunter glitzern. Er erschrak. Natürlich hatte er gewusst, dass der Russe bewaffnet war, aber nun hatte er die Uzi direkt unter den Gürtel geschoben, griffbereit. Pjotr registrierte seinen Blick selbstverständlich. Er sagte nichts, aber in seinen Augen blitzte es auf eine Weise auf, die Torben zwar nicht deuten konnte, die ihn aber beunruhigte, während er zurücktrat und sich zu ihm herumdrehte. Vielleicht einzig wegen dieses Blickes fragte Torben: »Was soll diese Waffe?«
Pjotr ließ eine Sekunde verstreichen, ehe er antwortete. »Nur zur Sicherheit. Für alle Fälle.« Er sprach einen schweren, rollenden Akzent, der seine Herkunft deutlich verriet, aber trotzdem klar verständlich war und eine seltsame Wirkung hatte. In der Rolle des Söldners hatte er ihn bedrohlicher und auf schwer greifbare Weise gefährlicher wirken lassen, jetzt, in der Rolle des jungen Assistenzarztes, hatte er etwas Vertrauen Einflößendes.
»Ich will nicht, dass irgendjemandem etwas passiert«, sagte Torben. Wie lächerlich diese Worte selbst in seinen eigenen Ohren klangen.
Pjotr machte sich nicht einmal die Mühe zu antworten. Wozu auch? Torben hatte diesen einen Satz ungefähr tausend Mal gesagt, seit sie das erste Mal zusammengekommen waren, aber sie wussten alle, wie wenig es möglicherweise nutzte. Was geschehen würde, würde geschehen. So einfach war das.
Während der Aufzug nach oben summte, immerhin acht Etagen, das Kellergeschoss mitgerechnet, in dem sie eingestiegen waren, musste sich Torben mit aller Kraft beherrschen, um das blinkende Licht über der Tür nicht anzustarren, das etwas Hypnotisierendes zu haben schien. Ein blinzelndes Dämonenauge, das ihm voller tückischer Vorfreude erklärte, dass, egal was er tat, ihr Unternehmen nur in einer Katastrophe enden konnte. Er wollte nicht, dass die anderen seine Nervosität bemerkten, obwohl es keine Schande war. Sie alle waren nervös, selbst Pjotr. Er fragte sich, warum er eigentlich so sehr auf den Russen fixiert war. Die Söldnertruppe bestand aus vier Männern: Pjotr, Mikail – einem Rumänen oder Bulgaren, so genau wusste Torben das nicht, denn Mikail sprach kein Wort Deutsch – und den beiden Brüdern Lev und Stanislav, die aus Lettland stammten und aus ihrer feindseligen Haltung Pjotr gegenüber keinen Hehl machten. Der Russe war nicht einmal der Anführer der Söldnertruppe – es gab keinen –, aber der Einzige, dessen Name Torben nicht erst eine halbe Sekunde lang aus dem Gedächtnis kramen musste, und derjenige, dessen Gesicht sofort vor seinem inneren Auge erschien, wenn er über diesen Trupp gekaufter Krieger nachdachte oder über das, was sie vorhatten. Was seit drei Monaten praktisch ununterbrochen der Fall war. Irgendetwas Besonderes war an Pjotr. Torben wusste nicht, was. Der Söldner strahlte Gewaltbereitschaft und Tod aus wie einen schlechten Geruch, doch das galt für die drei anderen mindestens im gleichen Maß. Aber da war noch irgendetwas, das nur zwischen ihm und Pjotr war, und es war nichts Gutes.
Ein heller Glockenton erklang. Die Liftkabine kam mit einem kaum spürbaren Ruck zum Halten und die Türen glitten auf. Zu früh. Torben sah weder auf die Uhr noch blickte er auf die Leuchttafel über der Tür, aber etwas in ihm registrierte akribisch das Verstreichen jeder einzelnen Sekunde. Sie waren maximal in der sechsten Etage, vielleicht auch erst in der fünften. Etwas stimmte nicht.
Torben trat zur Seite, um Platz zu machen, als eine junge Krankenschwester ein Bett in die Kabine schob. Der Lift, der ihm bisher riesig vorgekommen war, wurde plötzlich winzig. Für fünf Männer, die Krankenschwester und das gut zwei Meter lange Bett schien er kaum auszureichen. »Nach oben?«, fragte die Schwester. Sie sah niemand Bestimmten dabei an und noch während sie die Frage stellte, streckte sie bereits die Hand aus und drückte den Knopf für die siebte Etage, aber Torben meinte trotzdem eine Spur von Verwirrung in ihrer Stimme zu hören. Vielleicht waren fünf fremde Gesichter auf einmal zu viel, selbst für ein Krankenhaus dieser Größe. Und vielleicht waren ihre Verkleidungen doch nicht so gut, wie er sich eingeredet hatte. Vielleicht sah man ihnen auch einfach an, weshalb sie gekommen waren.
Torben warf einen nervösen Blick in Pjotrs Richtung. Der Russe hatte seinen Kittel wieder geschlossen. Die Waffe war nicht zu sehen und in seinen Augen stand sogar die perfekte Lüge eines angedeuteten Lächelns, während er die junge Schwester ansah, auch wenn Torben nicht über den wirklichen Grund dieses Lächelns nachzudenken wagte. Es gab keinen Grund, nervös zu sein, versuchte er sich zu beruhigen. Es war ein paar Minuten vor Mitternacht. Der Schwester brannte die Zeit auf den Nägeln und sie war müde, und das war alles.
Die Kabine bewegte sich eine Etage weit in die Höhe und hielt dann wieder an. Torbens Herz begann erschrocken zu klopfen, als Pjotr sich zu der Krankenschwester herumdrehte und es so aussah, als wollte er etwas sagen, aber dann begnügte er sich doch damit, ihr mit dem Bett zu helfen, das sich mit sehr viel mehr Mühe wieder hinausbugsieren ließ, als sie es in die Kabine hineingeschoben hatte. Torben sah nun doch auf die Uhr. Noch drei Minuten. Die Krankenschwester mit ihrem Bett hatte ihre Sicherheitsreserve vollkommen aufgezehrt. Sie lagen immer noch genau im Zeitplan, aber nun durfte wirklich nichts mehr schief gehen.
Auf die Sekunde pünktlich verließen sie die Liftkabine und wandten sich nach links. Mikail und die beiden Brüder gingen voraus, wie sie es besprochen hatten, während Pjotr und er in langsamerem Tempo folgten. Auf diese Weise, so hoffte er, fielen sie weniger auf. Drei Ärzte, die sich beeilten, und ein vierter, der mit einem besorgten Angehörigen eines Patienten langsamer nachfolgte. Torben war der Einzige, der keinen weißen Kittel trug, sondern einen schlichten, dunkelgrauen Straßenanzug. Sein Herz schlug für einen Moment schneller, als sich Mikail der Zwischentür näherte. Sie war jedoch nicht verschlossen. Sie konnten ihren Zeitplan einhalten. Sie hätten es auch so gekonnt. Torben zweifelte nicht daran, dass die Söldner nur Sekunden gebraucht hätten, um die Tür aufzubrechen, obgleich sie einen äußerst stabilen Eindruck machte. Aber es war genau dieser Moment, vor dem er Angst hatte. Er hätte sich etwas vorgemacht, hätte er sich ernsthaft eingeredet, dass es ohne Gewalt oder zumindest ihre massive Androhung abgehen würde, aber noch waren sie nicht mehr als fünf Fremde, deren Anblick allenfalls Grund für ein fragendes Stirnrunzeln bot – und vermutlich nicht einmal das. Und bis sie den Kreißsaal verließen, musste das auch so bleiben.
Ein dumpfer Knall wehte von draußen herein, als sie durch die Tür traten, und Torben fuhr so erschrocken zusammen, dass auch Pjotr instinktiv die Hand hob und stirnrunzelnd in seine Richtung sah. Torben schüttelte hastig und sehr nervös den Kopf. Vor seinem inneren Auge sah er, wie der Russe die Bewegung fortführte und die Waffe unter dem Kittel hervorzog. Aber es war nur eine Vision.
»Nichts«, sagte er. »Alles in Ordnung. Nur ein Silvesterböller, den jemand zu früh gezündet hat.«
Das Gesicht des Russen blieb starr. Torben vermochte nicht zu sagen, ob er sich mit dieser Erklärung zufrieden gab oder nicht. Es spielte auch keine Rolle. Verstohlen sah er sich um. Der Flur war sehr lang, taghell erleuchtet und nicht annähernd so leer, wie er es gehofft hatte. Er sah auf Anhieb mindestens vier Personen, aber wahrscheinlich waren es mehr: Ein junger Mann in weißer Krankenhauskleidung stand an dem einzelnen Fenster am Ende des Ganges und blickte hinaus, in dem zum Flur hin verglasten Stationszimmer waren zwei junge Frauen damit beschäftigt, ein Tablett voller Sektgläser zu füllen, und auf einer schlichten Plastikbank neben der Tür zum Kreißsaal saß ein ziemlich nervös wirkender junger Mann, der mit den Händen rang und ununterbrochen auf die Uhr sah.
Der Vater.
Torben hatte gehofft, dass es sich um einen jener modernen Väter handelte, die bei der Geburt zusehen wollten, sah sich aber getäuscht. Er hatte offenbar vor, hier draußen zu warten, und das war nicht gut. Jede Person, die hier auf dem Flur blieb, ließ ihr Risiko explodieren, vorzeitig entdeckt zu werden. Er sah auf die Uhr. Noch vierzig Sekunden. Mikail und die beiden Brüder hatten die Tür zum Kreißsaal erreicht und waren davor stehen geblieben und Torben ging ganz automatisch langsamer, um nicht zu früh anzukommen. Der Kindsvater blickte bereits stirnrunzelnd zu den drei Söldnern hoch und fragte sich wahrscheinlich, wer sie waren und was sie hier taten. Wie werdende Väter sahen sie jedenfalls nicht aus.
Als hätte er seine Gedanken gelesen, murmelte Pjotr: »Keine Sorge, ich kümmere mich um ihn.«
»Sie werden ihm nichts tun.«
»Bestimmt nicht«, versicherte Pjotr. »Ich werde ihn in den Schlaf singen.«
Seine Antwort machte Torben wütend, aber sie waren schon zu nah und er hatte keine Zeit mehr, irgendetwas zu erwidern. Sie hatten noch zwanzig Sekunden.
Pjotr ging ein wenig schneller, lächelte dem Vater zu und beugte sich leicht vor, und der Mann setzte sich auf und sah dem Russen erwartungsvoll entgegen; vermutlich hielt er ihn für einen Arzt, der gekommen war, um ihm irgendetwas mitzuteilen. Pjotrs Neuigkeit bestand aus einem blitzschnellen Handkantenschlag gegen die linke Seite seines Halses, der ihm auf der Stelle das Bewusstsein raubte. Der Mann sackte nach vorne und wäre von der Bank gefallen, hätte der Russe ihn nicht aufgefangen und so drapiert, dass es aussah, als wäre er nur eingeschlafen. Die ganze Aktion hatte nicht einmal eine halbe Sekunde gedauert.
Torben sah sich alarmiert um. Der Pfleger sah immer noch aus dem Fenster, und auch im Schwesternzimmer rührte sich nichts. Niemand schrie, keine Alarmsirenen schrillten los. Niemand hatte etwas bemerkt. Sie hatten noch zwölf Sekunden. Torbens Hand glitt in die Jackentasche und schloss sich um den Griff des Dolches, den er darin trug. Das Messer war viertausend Jahre alt, aber das Metall fühlte sich so glatt an, als käme es frisch aus der Schmiede. Und es war kalt, eiskalt.
Auf ein Nicken Pjotrs hin schlenderte Lev scheinbar gemächlich auf den Pfleger am Ende des Ganges zu, während sein Bruder Stanislav ohne Eile zum Schwesternzimmer zurückging. Noch acht Sekunden.
»Jetzt«, sagte Torben.
Pjotr stieß die Tür zum Kreißsaal auf, trat ein und zog in der gleichen Bewegung die Uzi unter dem Kittel hervor, während in Mikails Hand wie aus dem Nichts eine großkalibrige Pistole erschien. Torben, der den Kreißsaal als Letzter betrat, nahm die Hand vom Messer und machte einen raschen Schritt zur Seite, um freie Sicht zu haben und sich zu orientieren. Er war schon ein Dutzend Mal hier oben gewesen, aber noch niemals hier drinnen, und obwohl er die Pläne des Krankenhauses gründlich studiert hatte, war er im ersten Moment erstaunt, wie klein der Raum wirkte. Der Kreißsaal war kein Saal, sondern eher eine Kammer. Zwischen dem OP-Tisch mit der riesigen Lampe – sie sah aus wie eine umgedrehte Lanzette aus der Serie »Raumpatrouille« – und den Wänden war gerade noch Platz, um einigermaßen bequem stehen zu können. Abgesehen von der Mutter und der Hebamme, die am Ende des Tisches stand, hielten sich noch eine Krankenschwester und zwei Ärzte hier drinnen auf, aber erstaunlicherweise nahm im ersten Moment niemand von ihrem rüden Eindringen Notiz.
Um genau fünf Sekunden vor Mitternacht richtete sich die Hebamme auf und hielt ein mit Blut und Schleim bedecktes Neugeborenes hoch. »Da ist es ja!«, rief sie. »Was für ein wunderschöner kleiner Schatz!«
Torben zog den Dolch aus der Tasche und empfahl seine Seele dem Herrn – und die Krankenschwester wandte den Blick zur Tür, sah die Waffe in Pjotrs Händen und stieß einen spitzen Schrei aus. Und im gleichen Moment verwandelte sich der Raum in ein einziges Durcheinander aus Schreien, Lärm, hektischer Bewegung und reinem Chaos.
Torben riss seinen Dolch in die Höhe und versuchte die Hebamme zu erreichen, aber es gelang ihm nicht, denn der Schrei der Krankenschwester hatte auch die beiden Ärzte herumfahren lassen. Einer der beiden erbleichte beim Anblick der Waffe, aber der andere war dumm genug, den Helden spielen zu wollen, und versuchte sich auf Mikail zu stürzen. Der Rumäne schlug ihn blitzschnell und ohne sichtbare Mühe zu Boden, aber seine weit ausholende Bewegung erwischte auch Torben und schleuderte ihn gegen ein Regal. Glas zerbrach. Irgendetwas biss mit einem dünnen, aber tiefen Stich in seinen rechten Handrücken. Er fiel nicht, aber der Dolch entglitt seinen Fingern und schepperte zu Boden, die Hebamme presste das Neugeborene an sich und schien verzweifelt nach einem Fluchtweg Ausschau zu halten, und die Frau auf dem Tisch begann in hohen, spitzen Tönen zu schreien.
Trotzdem hätte vielleicht doch noch alles so kommen können, wie es geplant war, wäre nicht ausgerechnet jene eine, schicksalhafte Sekunde gewesen. Torben spürte die Katastrophe kommen – den Bruchteil eines Herzschlags, bevor sie wirklich geschah: Die Zeit schien sich zu dehnen, als hielte die Schöpfung selbst den Atem an, und alles geschah scheinbar gleichzeitig: Die Frau auf dem Tisch schrie noch lauter. Auf dem Gesicht der Hebamme erschien ein Ausdruck fassungsloser Ungläubigkeit, als ihr Blick zwischen die weit gespreizten Beine der Gebärenden fiel. Die Krankenschwester und einer der Ärzte hatten die Arme gehoben und waren so weit zurückgewichen, wie es in dem engen Raum überhaupt möglich war, und auch der Arzt, den Mikail niedergeschlagen hatte, stemmte sich taumelnd wieder in die Höhe, wobei er sich mit der linken Hand an der Kante des Operationstisches festhielt. Draußen über der Stadt explodierten die ersten, pünktlich gezündeten Raketen und Böller. Vielleicht war es auch nur das Geräusch eines Sektkorkens, den eine der Krankenschwestern im Stationszimmer draußen Schlag Mitternacht knallen ließ, so sonderbar weich und gedämpft, wie das Geräusch klang. Doch so leise es war, es genügte, um die Katastrophe auszulösen.
Vielleicht hielt Pjotr es für einen Schuss. Vielleicht war es auch nur der Vorwand, auf den er gewartet hatte. Vielleicht gingen ihm schlichtweg die Nerven durch. Gleichgültig, aus welchem Grund: Er hob die Uzi, riss den Abzug durch und schwenkte die Waffe von links nach rechts. Die Mikro-Maschinenpistole stieß orangerotes Feuer und ein ratterndes Geräusch aus, das viel leiser war, als Torben erwartet hatte, und der Arzt und die junge Krankenschwester stürzten getroffen und in einem Hagel aus splitterndem Glas, Lack- und Metalltrümmern zu Boden. Querschläger prallten von Metallregalen und den gefliesten Wänden ab und richteten noch mehr Schaden an, und Pjotr schwenkte seine Waffe weiter, ohne den Finger vom Abzug zu nehmen. Etliche Geschosse trafen die große Lampe über dem OP-Tisch und überschütteten die Frau darauf mit scharfkantigen Splittern, und mindestens zwei Kugeln trafen den Arzt auf der anderen Seite des Tisches und schleuderten ihn ein zweites Mal und diesmal sterbend zu Boden. Torben schlug instinktiv die Arme über den Kopf und krümmte sich, als der Söldner die Waffe weiter in seine Richtung schwenkte, noch immer ohne den Finger vom Abzug zu nehmen, fast als könne er es nicht mehr, als zwinge ihn eine düstere Macht, das einmal begonnene Vernichtungswerk zu Ende zu bringen. Die Kugeln stanzten rasend schnell eine schnurgerade Linie greller Funkenschauer und Staubexplosionen aus den Wänden, zertrümmerten das Regal hinter ihm endgültig und verfehlten Torben buchstäblich um Haaresbreite, und vielleicht nicht einmal das. Er spürte einen heftigen Schmerz im Gesicht, konnte aber nicht sagen, ob ihn eines der Geschosse oder ein Glassplitter verletzt hatte. Aus den Augenwinkeln sah er, wie sich die Hebamme schützend über die hilflose Frau auf dem Tisch warf und auch Mikail hastig den Kopf einzog. Dann hörte das trommelfellzerreißende Hämmern der Uzi endlich auf. Aber es wurde nicht still. Zerbrochenes Glas regnete zu Boden, elektrische Kurzschlüsse zischten und eine Frau wimmerte. Von draußen drang das gedämpfte Knallen explodierender Raketen und Böllerschläge herein, und Schreie. Vielleicht waren die Schüsse gehört worden und in der Klinik brach bereits Panik aus. Aber vielleicht war es auch nur der Lärm der Feiernden, die ausgelassen auf das neue Jahr anstießen. Neben ihm wimmerte jemand vor Schmerz und obwohl er nicht hinsah, wusste er, dass es Mikail war, den eine von Pjotrs Kugeln getroffen haben musste.
Zitternd richtete sich Torben auf, sah auf die Uhr und blickte sich gleichzeitig um. Fünfzehn Sekunden nach Mitternacht. Zwanzig Sekunden, seit sie hereingekommen waren. In dieser Zeit waren drei Menschen getötet worden. Torben sah nach links und auf Mikail hinab und korrigierte sich in Gedanken: vier; und aus dem sterilen Raum war ein qualmender Trümmerhaufen geworden. Und das Allerschlimmste stand ihm noch bevor.
»Worauf warten Sie?«, fragte Pjotr. Er zog seelenruhig das Magazin aus der Uzi, steckte es ein und schob ein neues in die Waffe. Er hatte nicht etwa aufgehört zu schießen, weil ihm klar geworden war, dass er aus Versehen einen seiner eigenen Männer getroffen hatte, dachte Torben schaudernd, ihm war schlichtweg die Munition ausgegangen. Er war nicht einmal mehr sicher, dass er Mikail tatsächlich aus Versehen getroffen hatte. Aber der Russe hatte Recht. Worauf wartete er? Das Unvermeidbare wurde nicht weniger schlimm, wenn er es hinauszögerte.
Er bückte sich und hob den Dolch auf. Als sich seine Finger um den Griff der antiken Waffe schlossen, verletzte er sich an den scharfkantigen Glassplittern, die den Boden bedeckten. Blut aus einer zweiten Schnittwunde mischte sich mit dem aus der ersten, aber er spürte den Schmerz nicht einmal. Nur auf der bronzefarbenen Klinge schimmerte plötzlich helles Rot und es war die düstere Symbolik dieses Anblicks, die Torben für eine kostbare Sekunde wie versteinert dastehen und das Messer anstarren ließ. Er wartete darauf, dass er Entsetzen verspürte, Schrecken oder wenigstens Schuldbewusstsein, aber in ihm war nichts anderes als eine schreckliche, tiefe Leere. Vielleicht beschützte ihn etwas, damit er die Kraft fand, seine Aufgabe zu beenden, aber vielleicht war auch das genaue Gegenteil der Fall. Torben drängte auch diesen Gedanken zurück und trat an den Tisch heran. Die Frau war tot. Ihr Gesicht war von den Schnitten und tiefen Kratzern von der zerborstenen OP-Lampe übersät, aber er glaubte nicht, dass ihr noch Zeit geblieben war, um den Schmerz zu spüren, vielleicht nicht einmal, um wirklich zu begreifen, was mit ihr geschah. Eine verirrte Kugel hatte ihr Herz getroffen und ihr einen schnellen, gnädigen Tod gewährt. Ihre Augen standen noch offen. Torben streckte die Hand aus, zögerte noch einmal, dann schloss er ihre Lider und machte mit dem Daumen das Kreuzzeichen auf ihre Stirn. Er wartete darauf, dass etwas geschah, dass ihn ein Blitz göttlicher Verdammnis traf oder sich der Boden unter ihm auftat, um ihn im Feuer der Hölle zu verschlingen, aber der Himmel schwieg, und wie es aussah, wollte ihn die Hölle nicht haben. Jedenfalls noch nicht.
Er ergriff den Dolch fester und ging um den Tisch herum. Seine Lippen bewegten sich wie im lautlosen Gebet, aber auch seine Gedanken blieben stumm. Die Worte, die ihm ein Leben lang so viel Kraft und Trost gespendet hatten, waren nicht mehr da und sie würden auch nicht wiederkommen. Es gab Türen, die man nur einmal hinter sich schließen konnte, und Wege, die nur in eine Richtung führten. Und er befand sich auf einem solchen Weg. Vielleicht schon länger, als ihm bisher klar gewesen war.
Pjotr öffnete die Tür einen Spaltbreit, sah hinaus und sagte: »Beeilen Sie sich. Wir müssen weg.«
Torben trat mit einem großen Schritt über die Leiche des Arztes hinweg, den Pjotr erschossen hatte, umkreiste den Tisch vollends und blieb wieder stehen. Er begann zu zittern. Seine Lippen hörten auf sich zu bewegen. Vielleicht schlug auch sein Herz in diesem Moment nicht.
Auch die Hebamme war tot. Torben erinnerte sich genau, dass Pjotr sie mit seiner blindlings abgefeuerten Salve nicht getroffen hatte, aber nun hatte sich ein rasch größer werdender hellroter Fleck auf ihrem weißen Kittel gebildet. Das Kind, das sie fünf Sekunden vor Mitternacht auf die Welt geholt hatte, lag auf dem Boden neben ihr. Noch nicht abgenabelt und mit Blut und Mutterpech bedeckt, aber es weinte nicht und es war wach und sah ihn aus großen, beunruhigend wissenden Augen an. Torben wusste, dass Neugeborene nichts sehen konnten. Nicht wirklich. Ihre Welt bestand aus Schatten und verschwommenen Umrissen, aus Gerüchen und Lauten und dem Gefühl des Verlustes jener halbtelepathischen Verbindung zum Mutterleib, aus dem sie so brutal herausgerissen worden waren. Aber das galt vielleicht für alle anderen Kinder. Nicht für dieses.
Das Mädchen sah ihn an. Es blickte nicht einfach nur in seine Richtung. Es sah ihn an und es erkannte ihn, und es wusste, warum er gekommen war!
Er konnte es nicht tun. Es war falsch. Ganz egal, was dieses Kind war, ganz egal, was geschehen würde, wenn es am Leben blieb und heranwuchs: Er hatte nicht das Recht, es zu töten. Kein Mensch hatte das Recht, ein Leben auszulöschen, ganz gleich, was auf dem Spiel stand.
Waren das wirklich seine Gedanken, fragte er sich. War es Gottes Stimme, die er hörte, oder die des Satans, der in seinen Gedanken flüsterte, weil er kurz davor stand, seine Pläne zu durchkreuzen?
»Verdammt noch mal, worauf warten Sie?«, fragte Pjotr ungeduldig. »Wir müssen weg hier!«
Torben ließ sich langsam auf die Knie sinken. Seine Hand umklammerte das Messer so fest, dass es wehtat, und die Blicke des Kindes folgten jeder seiner Bewegungen sehr aufmerksam, aber auch vollkommen ohne Furcht, fast als wisse es genau, dass er ihm nichts zuleide tun konnte. Und das konnte er auch nicht. Er wollte den Arm heben und die heilige Klinge ihrer Jahrtausende alten Bestimmung zuführen, aber seine Muskeln verweigerten ihm den Dienst. In ihm war nichts als Leere, die gleichsam alle Kraft aus seinem Körper zu saugen schien, so dass er nun tatsächlich nicht mehr als eine leere, atmende Hülle war. Er spürte, dass Tränen über sein Gesicht liefen, aber er verstand nicht genau, woher sie kamen, denn er empfand nichts. Und wenn er etwas spürte, so war zwischen ihm und seinen Empfindungen eine Mauer, die sein bewusstes Denken nicht zu durchdringen vermochte.
»Verdammt!«, sagte Pjotr.
»Ich … kann das nicht«, murmelte Torben stockend. Die vier Wörter kosteten ihn beinahe mehr Kraft, als er aufzubringen imstande war.
Pjotr lachte böse. »Und ich werde es nicht tun«, sagte er. »Tun Sie es oder tun Sie es nicht. Aber ich bin in dreißig Sekunden hier weg. Aber vorher werde ich Sie erschießen. Ich töte keine Kinder.«
Als ob ihn diese Drohung schrecken könnte. Sein Leben war so oder so vorbei. Wenn es eine Hölle gab, dann war er bereits darin. Und er hatte Pjotr auf diese Weise auch nicht auffordern wollen, es für ihn zu tun. Es spielte keine Rolle, wessen Hand das Messer führte. Es wäre so oder so die seine gewesen.
Er streckte die Hand nach dem Gesicht des Kindes aus und berührte seine Stirn. Nur ein Hauch, und vielleicht nicht einmal das. Mit der anderen hob er den Dolch und setzte die Spitze direkt über dem winzigen Herz des Neugeborenen an. Es würde nichts spüren, allenfalls die Andeutung eines Schmerzes, vermutlich nicht einmal das. Sein Leben würde enden, noch bevor es wirklich begonnen hatte, und dieser eine, schmerzlose Tod würde Milliarden und Milliarden anderer Leben retten. Eine ganze Welt voller Leben. Er musste es nicht einmal wirklich tun. Selbst die bewusste Bewegung, dem Kind den Dolch ins Herz zu stoßen, blieb ihm erspart. Es reichte, wenn er sich vorbeugte und das Messer festhielt. Sein Körpergewicht und die Naturgesetze würden den Rest erledigen. Er musste es tun. Er wollte es nicht und er durfte es nicht, aber er musste. Er spürte den anklagenden Blick von Millionen ungeborener Seelen auf sich lasten. Ihre unausgesprochene Frage: Warum hast du uns verdammt? Er hatte keine Wahl. Seine Seele war verloren – so oder so. Aber es stand so unendlich viel auf dem Spiel! Sollte sein Opfer umsonst gewesen sein?
Als er es tun wollte, hörte er ein leises Wimmern. Doch es war nicht das Kind unter ihm. Das Neugeborene sah ihn weiter ruhig und aus diesen beunruhigend klaren Augen an, aber es gab keinen Laut von sich. Doch das Wimmern war da, und es war eindeutig die Stimme eines Kindes!
Torben zog den Dolch zurück, sah sich irritiert und erschrocken um und streckte schließlich die Hand nach der Hebamme aus. Sie war eine große, kräftige Frau und er war fast überrascht, wie schwer es ihm fiel, sie auf die Seite zu rollen.
Unter ihrem Körper lag ein zweites Kind.
Es war vielleicht eine Minute alt, noch nicht abgenabelt und mit Blut und schwarzem Schleim bedeckt, und es hatte die gleichen beunruhigenden Augen wie das Mädchen. Torben fühlte ein eisiges, lähmendes Entsetzen in sich aufsteigen. Es waren zwei Kinder! Zwei!
»Was ist los?«, fragte Pjotr. »Worauf zum Teufel warten Sie …? Oh, verdammt!«
Torben starrte abwechselnd und mit immer größer werdendem Entsetzen die beiden Neugeborenen an und plötzlich verstand er die ungläubigen.Blicke und den beinahe panischen Ausdruck im Gesicht der Hebamme. Sie hatte gesehen, dass es ein zweites Kind gab. Einen Zwilling, der seinem Geschwister nach wenigen Sekunden gefolgt war. Nach wie vielen Sekunden?, dachte er verzweifelt? Mehr als fünf? Und welches der beiden Kinder war das Erstgeborene? »Großer Gott!«, murmelte er. »Was sollen wir jetzt tun?«
»Das weiß ich nicht«, antwortete Pjotr, der sich aus irgendeinem Grund angesprochen fühlte. »Aber ich weiß, was ich jetzt tue. Der Hubschrauber landet in diesem Augenblick.«
Es gab nichts zu entscheiden. Es gab nicht einmal mehr eine Alternative. »Wir nehmen beide mit«, sagte Torben. »Helfen Sie mir!«
Pjotr rührte sich nicht, aber seine Augen wurden schmal. »Sie haben gesagt, das Erstgeborene …«
»Ich weiß, was ich gesagt habe, verdammt noch mal!«, fiel ihm Torben ins Wort. »Aber es sind zwei. Und die Einzige, die wusste, welches das Erstgeborene war, war sie!« Er deutete aufgebracht auf die Hebamme. »Aber Sie mussten sie ja erschießen. Sie elender Narr! Und jetzt helfen Sie mir gefälligst. Ich brauche eine Schere und etwas zum Abbinden!«
Pjotr starrte ihn noch eine Sekunde lang aus zu Schlitzen zusammengekniffenen Augen an, doch dann steckte er, fast zu Torbens Überraschung, die Waffe ein und trat neben ihn. Torben fühlte sich hilflos. Die Ereignisse hatten ihn einfach überrollt. So schnell und warnungslos, dass er noch nicht einmal wirklich begriffen hatte, was überhaupt geschehen war. Geschweige denn, was er tun sollte. Selbst der rein praktische Teil seines Vorhabens erschien ihm im ersten Moment unlösbar. Pjotr raffte Schere, Verbandszeug und eine Nierenschale zusammen und ließ sich damit neben ihm in die Hocke sinken, aber Torben war einfach nicht fähig, auch nur einen Finger zu rühren. Er war gelähmt. Er sah die verchromte Schale nur an, als handele es sich um ein Artefakt aus einer längst untergegangenen Kultur, über deren Verwendungszweck er nur Mutmaßungen anstellen konnte. Und nicht einmal das. Er konnte sich nicht bewegen, er konnte nicht denken.
Pjotr starrte ihn eine halbe Sekunde lang wütend an, dann fluchte er leise in seiner Muttersprache, stieß ihn grob zur Seite und ließ sich vollends auf die Knie herabsinken. Torben sah mit einem Gefühl wachsender Verblüffung zu, wie der Russe die beiden Säuglinge abnabelte und mit unerwartetem Geschick verband. Keines der beiden Kinder gab auch nur einen Laut von sich. Pjotrs Hände, von denen er geglaubt hatte, dass sie nur töten und Schmerzen zufügen konnten, gingen mit großem Geschick zu Werke. Die beiden Neugeborenen ließen die Prozedur klaglos über sich ergehen, folgten aber jeder Bewegung Pjotrs mit aufmerksamen, sehr wachen Blicken.
Schließlich stand der Russe auf, nahm zwei grüne OP-Tücher aus dem Regal und wickelte die Kinder darin ein, auf eine Weise, die Torben an russische Babypuppen erinnerte. »Jetzt aber raus hier!«, sagte er. »Nehmen Sie die Kinder. Und das hier.« Er bückte sich, nahm Mikails Waffe und hielt sie Torben mit dem Griff voran hin.
Torben starrte die großkalibrige Pistole angeekelt an und machte keine Bewegung, um danach zu greifen, bis Pjotr ungeduldig gestikulierte. Widerwillig nahm er die Waffe und ließ sie in die Jackentasche gleiten. Er konnte spüren, wie ihr Gewicht die Jacke auf der rechten Seite nach unten zog.
Pjotr zerrte ihn unsanft auf die Füße, drückte ihm die beiden Säuglinge in die Arme und versetzte ihm einen Stoß, der ihn quer durch den Raum, die Tür und noch einen Schritt weit auf den Gang hinaus stolpern ließ. Das Krachen und Knattern von draußen wurde lauter. Musikfetzen, Gelächter, allgemeiner Lärm, wieder eine ganze Salve knatternder Böllerschüsse. Das Silvesterfeuerwerk war noch in vollem Gange und Torben begriff zweierlei: Sie waren kaum länger als eine Minute im Kreißsaal gewesen, und die Schüsse und Schreie waren vermutlich gar nicht gehört worden. Hier draußen im Gang war alles ruhig. Zu ruhig.
Torben drehte sich nach links und sah, dass der Krankenpfleger reglos ausgestreckt auf dem Boden unter dem Fenster lag. Er betete, dass er nur bewusstlos war und nicht tot. Auf dem Boden war jedenfalls kein Blut. Und was seine Gebete anging: Sie würden sowieso nicht mehr erhört werden.
Pjotr machte eine unwillige Geste in die andere Richtung, zur Tür hin. Es war eindeutig ein Befehl, den eine unausgesprochene Drohung begleitete. Sie hatten die Rollen getauscht. Pjotr hatte das Kommando übernommen, was in der augenblicklichen Situation eigentlich in Ordnung war, Torben aber trotzdem wütend und bestürzt machte. Er widersprach jedoch nicht, sondern versuchte nur die beiden Kinder auf seinen Armen in eine einigermaßen bequeme Lage zu rücken und ging los.
Lev und Stanislav standen mit dem Rücken zur Glasfront des Schwesternzimmers und verstellten ihm auf diese Weise größtenteils den Blick. Torben versuchte auch nicht wirklich viel zu erkennen. Er wollte nicht wissen, wie es in dem Zimmer hinter der Glasscheibe aussah. Immerhin registrierte er, dass sich darin nichts mehr rührte.
Die beiden Söldner machten überraschte Gesichter, als sie die Kinder auf Torbens Armen erblickten, sagten aber kein Wort, sondern setzten sich gehorsam in Bewegung, als Pjotr eine entsprechende Geste machte. Die Waffen verschwanden unter ihrer Kleidung und auch der Russe schob die Uzi wieder in seinen Gürtel und schloss den weißen Kittel. Mit der anderen Hand rückte er seine Brille zurecht und fuhr sich mit den gespreizten Fingern als Kammersatz durchs Haar. Die Veränderung war ebenso radikal und verblüffend wie zuvor. Aus dem kaltblütigen Killer wurde wieder die Arztfigur, die Vertrauen und Ruhe verströmte und deren sympathischer Ausstrahlung sich selbst Torben für einen Moment kaum zu entziehen vermochte. Dieses unheimliche Beispiel von Mimikry erschreckte ihn jetzt jedoch ungleich mehr als das erste Mal. Vielleicht, weil er dieses andere Selbst, von dessen Existenz er vorher nur gewusst hatte, nun gesehen hatte.
Als sie durch die Tür traten, erwartete sie eine vollkommen andere Welt. Das Krachen der Silvesterraketen war hier nicht mehr so deutlich zu hören, aber der Flur war voller Menschen, die Sekt aus Plastikbechern tranken, auf das neue Jahr anstießen und lachten: Patienten, Angehörige, die es in dieser Nacht mit den Besucherregelungen nicht so genau nahmen, aber auch Krankenschwestern und Pfleger und der eine oder andere Arzt. Die ausgelassene Stimmung machte auch vor ihnen nicht Halt. Noch bevor sich Lev und Stanislav auch nur dagegen wehren konnten, sahen sie sich von einem halben Dutzend größtenteils junger Männer und Frauen umringt, die sie einfach vereinnahmten und ihnen Plastikbecher mit Sekt in die Hände drückten. Pjotr und ihm erging es kaum besser. Torben hatte keine Hand frei, um nach einem der Becher zu greifen, die ihm hingehalten wurden, aber das Gefühl der Erleichterung, das aus dieser Erkenntnis resultierte, währte nur eine Sekunde. Genau so lange nämlich, wie er brauchte, um sich wieder daran zu erinnern, dass er hier auf der Wöchnerinnenstation war. Wo es nichts Interessanteres gab als neugeborene Kinder – und er trug gleich zwei dieser Objekte der allgemeinen Begierde auf den Armen. Der rettende Aufzug war keine zwanzig Schritte entfernt, aber Torben hatte nicht einmal einen Bruchteil dieser Strecke zurückgelegt, als er auch schon hoffnungslos in einer regelrechten Menschentraube eingekeilt war; größtenteils junge Frauen, die alle unbedingt einen Blick auf die beiden winzigen Gesichtchen in den grünen Tüchern werfen wollten.
»Aber die sind ja allerliebst!«, ereiferte sich eine junge Frau, die Torben kurzerhand in den Weg getreten war. Zu sagen, dass sie schwanger aussah, wäre eine Untertreibung gewesen. Sie sah aus, als würde sie jeden Moment platzen. »O Gott, ich kann nur hoffen, dass ich auch zwei so wunderschöne Babys bekomme.« Sie strich sich Bewunderung heischend mit der flachen Hand über den Bauch. Ihre Augen leuchteten. »Ich erwarte auch Zwillinge, wissen Sie? Ich hatte gehofft, sie kämen heute, aber wie es aussieht, habe ich das Rennen verloren.« Sie seufzte. »Nun ja, wenigstens bin ich eine gute Verliererin. Herzlichen Glückwunsch.« Und du wirst nie erfahren, was für ein Glück du hattest, dachte Torben. Er suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit weiterzugehen, ohne unhöflich zu sein und dadurch Aufsehen zu erregen. »Aber jetzt macht es mir wirklich nichts mehr aus«, fuhr die junge Frau fort. »Es ist nicht schlimm, geschlagen zu werden, wenn auf dem ersten Platz zwei so wunderschöne kleine Engel liegen.«
Engel? Torben verspürte ein kurzes, eisiges Frösteln. O ja, eines von ihnen ist ganz zweifellos einer und das andere ist das genaue Gegenteil. Und nur Gott allein weiß, wer wer ist, und vielleicht nicht einmal er.
»Tun Sie etwas«, raunte Pjotrs Stimme an seinem Ohr, »oder ich werde etwas tun!«
»Bitte entschuldigen Sie mich jetzt«, sagte Torben laut. »Meine Schwiegermutter wartet unten in der Halle auf mich. Auf uns. Sie brennt darauf, die beiden Kleinen zu sehen.«
Schon während er die Worte aussprach, wurde ihm klar, wie dumm diese Ausrede war. Er kannte sich im Gesundheitswesen dieses Landes nicht besonders gut aus, aber es war garantiert auch hier nicht üblich, Neugeborene direkt aus dem Kreißsaal zu holen, um sie der stolzen Großmutter zu zeigen, die irgendwo wartete. Aber dumm oder nicht, die Worte taten ihren Dienst. Er konnte weitergehen und steuerte mit schnellen Schritten den Aufzug an und Pjotr folgte ihm. Von den beiden Brüdern war schon nichts mehr zu sehen. Torben nahm an, dass sie die Treppe genommen hatten, um auf das Dach hinaufzukommen, das nur eine Etage über ihnen lag. Ihnen wurde noch zwei oder drei Mal zugeprostet, aber sie erreichten den Lift, ohne noch einmal angehalten zu werden, und traten in die Kabine. Als sich die Türen jedoch schließen wollten, huschte noch eine weitere Person zu ihnen herein. Ein grauhaariger, sehr schlanker Mann mit einem Namensschildchen am Revers seines weißen Kittels, das ihn als Dr. Masewski auswies. Torben fuhr fast, aber eben nur fast, unmerklich zusammen. Sie waren aufgeflogen. Mit seiner dummen Ausrede hatte er die Aufmerksamkeit des Arztes wahrscheinlich erst geweckt.
Pjotr streckte ruhig die Hand aus, drückte den Knopf für das Dach und trat mit der gleichen Bewegung unauffällig hinter den Arzt. Masewski registrierte es nicht einmal. Er hielt ein Champagnerglas in der Linken, an dem er bisher allerdings nur genippt zu haben schien, und hatte, wie die Schwangere gerade, nur Augen für die beiden Babys. Er sah nicht einmal Torben an. »Das sind also unsere beiden Neujahrsbabys«, sagte er lächelnd. »Eigentlich dürfte ich das ja nicht erlauben, aber weil heute Silvester ist, will ich mal nicht so sein.«
Er nippte an seinem Glas, sah nun doch hoch und lächelte. Dann wurde aus diesem Lächeln etwas … anderes.
»Moment mal«, murmelte er. »Wer sind Sie? Was geht hier vor? Sie sind nicht …«
Pjotr brach ihm das Genick.
Es ging unglaublich schnell. Torben sah die Bewegung kaum und der Arzt spürte vermutlich nicht einmal mehr den Schmerz, als seine Wirbelsäule mit einem trockenen Knacken brach. Lautlos sank er in den Armen des Russen zusammen, und Pjotr brachte sogar noch das Kunststück fertig, das Champagnerglas aufzufangen, ehe es zu Boden fallen und zerbrechen konnte.
»Warum haben Sie das getan?«, murmelte Torben. Er war nicht sicher, ob er die Worte wirklich laut aussprach oder nur dachte, und die Antwort interessierte ihn auch nicht wirklich. Er konnte keinen Schrecken mehr empfinden, kein Entsetzen, eigentlich gar nichts mehr. Es war, als wäre er ausgebrannt, hätte in wenigen Augenblicken das ganze Maß an Entsetzen und Furcht und Angst ertragen müssen, für das die gesamte Lebensspanne eines Menschen gedacht war, so dass er nun gar nichts mehr spüren konnte. Er fragte sich nur, wie ihm die Ereignisse derartig aus den Fingern hatten gleiten können. Sein Plan war nicht nur nicht aufgegangen; er war auf die schlimmstmögliche Weise gescheitert.
Der Lift hielt an. Torben trat, ohne eine Antwort von Pjotr bekommen zu haben, aus der Kabine und fand sich in einem kahlen Treppenhaus aus unverkleidetem Beton wieder. Es gab nur eine einzige weitere Tür, die aus geriffeltem Drahtglas bestand, in dem ab und zu verschwommene Farben aufglommen. Es war sehr kalt. Pjotr benutzte den Oberkörper des toten Arztes, um die Aufzugtüren zu blockieren, dann ging er wortlos an Torben vorbei und stieß die Glastür zum Dach auf. Ein brutal kalter Wind fuhr herein und aus den verwaschenen Farben im Glas wurde das farbenfrohe Spektakel des Feuerwerkes, das noch immer über der Stadt abgebrannt wurde.
Als sie auf das Dach hinaustraten, stellte Torben beiläufig fest, dass die Tür gewaltsam aufgebrochen worden war und die beiden anderen Söldner bereits auf sie warteten. Lev stand direkt neben der Tür. Er hatte den weißen Kittel ausgezogen und hielt nun die gleiche Art von israelischer Maschinenpistole in beiden Händen, mit der auch Pjotr bewaffnet war. Sein Bruder war zur anderen Seite des Daches gegangen und blickte in den Himmel hinauf. Es sah aus, als beobachte er das Feuerwerk, aber natürlich hielt er nach dem Hubschrauber Ausschau. Er hätte längst hier sein müssen.
Torben sah umständlich auf die Armbanduhr und runzelte dann überrascht die Stirn. Seit sie in den Kreißsaal eingedrungen waren, waren noch nicht einmal fünf Minuten vergangen. Der Hubschrauber war überfällig, aber erst seit wenigen Sekunden, nicht seit einer Stunde, wie ihm sein vollkommen zusammengebrochenes Zeitgefühl vorgaukeln wollte. Dennoch – er war überfällig. Selbst jetzt, da aus ihrem so sorgfältig ausgeklügelten Plan ein vollkommenes Fiasko geworden war, erschreckte ihn diese weitere Verzögerung über die Maßen. Vielleicht wollte etwas sie hier festhalten. Vielleicht sollten sie dieses Dach nicht verlassen.
Eines der beiden Kinder gab einen meckernden Laut von sich; kein Weinen, sondern eher eine Beschwerde. Es war bitter kalt auf dem Dach. Die Temperaturen waren weit unter dem Gefrierpunkt, und die dünnen Tücher boten so gut wie keinen Schutz vor der Kälte und dem schneidenden Wind. Torben drehte sich so hemm, dass die beiden Säuglinge durch seinen eigenen Körper wenigstens notdürftig vor dem Wind geschützt wurden, aber er wusste, wie wenig es nutzen konnte. Sein Blick tastete abwechselnd über die Gesichter der beiden Neugeborenen. Es war ihm unmöglich zu sagen, welches Kind welches war. Obgleich unterschiedlichen Geschlechts, waren sie sich so ähnlich wie das sprichwörtliche Ei dem anderen. Eineiige Zwillinge mit unterschiedlichem Geschlecht. Er wusste nicht einmal, ob das möglich war. Aber welche Rolle spielte das schon bei diesen Kindern? Und noch etwas: Sie waren wunderschön! Torben war alles andere als ein Kindernarr. Anderenfalls hätte man ihn kaum für diese Aufgabe ausgewählt, aber er konnte die Begeisterung der jungen Frau auf der Wöchnerinnenstation plötzlich verstehen. Ihre Gesichter waren glatt und rosig, nicht verschrumpelt und zerknittert, wie es die wenige Minuten alter Säuglinge normalerweise waren, und ihre Augen waren klar und von einem fast furchteinflößenden Wissen erfüllt. Was haben wir diesen Kindern angetan?, dachte Torben schaudernd. Sie waren seit wenig mehr als fünf Minuten auf der Welt und sie hatten bereits das Schlimmste erlebt, was Menschen einander antun konnten.
Er hörte Schritte, sah hoch und wurde mit einem höchst ungewöhnlichen Anblick belohnt: Pjotr schlenderte auf ihn zu. Er hielt die Maschinenpistole in der rechten und ein klobiges Walkie-Talkie mit einer kurzen Gummiantenne in der linken Hand, und sein Gesicht sah ausnahmsweise einmal nicht aus wie eine Latexmaske, sondern zeigte ein breites Grinsen. »Steht Ihnen gut«, sagte er. »Für einen Mann, der hergekommen ist, um ein Kind zu töten, geben Sie einen hervorragenden Vater ab, finde ich.«
»Halten Sie den Mund«, antwortete Torben müde. »Sie wissen ja nicht, was Sie getan haben.«
»So, weiß ich nicht?«, fragte Pjotr. »Warum erklären Sie es mir dann nicht?«
Und für einen winzigen Moment wollte Torben es sogar. Er wollte nichts mehr, als diesem gewissenlosen Mörder die Wahrheit ins Gesicht zu schreien, damit Pjotr begriff, was er getan hatte, welchen unermesslichen Schaden er angerichtet hatte. Doch wozu? Pjotr würde ihm nicht glauben. Er konnte es nicht. Und selbst wenn, wäre es ihm vermutlich egal. »Weil es Sie nichts angeht«, sagte er grob.
Das Lächeln auf Pjotrs Gesicht wurde wieder zu der gewohnten undurchdringlichen Maske. Es blieb, aber es war jetzt falsch. »Und wenn ich anderer Meinung wäre?«
»Dann ist das allein Ihr Problem«, sagte Torben, so kalt, wie es ihm möglich war. »Ich bezahle Ihnen viel Geld dafür, dass Sie mich begleiten und dafür sorgen, dass ich unbehelligt an mein Ziel komme. Ich bezahle Sie nicht dafür, Fragen zu stellen.«
Pjotr nickte. Er wirkte ein bisschen nachdenklich. Langsam drehte er den Kopf, sah eine Sekunde lang nach rechts, dann eine weitere Sekunde nach links und nickte noch einmal. Etwas an dieser Bewegung beunruhigte Torben. »Ich habe gerade mit dem Hubschrauberpiloten gesprochen«, sagte der Russe. »Er wird in einer Minute hier sein. Wir müssten ihn schon fast hören können. Und Sie haben natürlich Recht. Sie bezahlen mir sehr viel Geld. Fast schon zu viel.« Er drehte sich gemächlich nach rechts, hob die Maschinenpistole und schoss Lev eine einzelne Kugel in die Stirn. Noch während der Söldner zusammenbrach, drehte er sich ohne Hast herum, schaltete seine Waffe auf Dauerfeuer und gab eine zwei- oder dreisekündige Salve ab, und Stanislaw warf die Arme in die Höhe, drehte sich in einer komplizierten Pirouette halb um seine Achse und kippte dann lautlos über das Dach in die Tiefe.
Torben riss entsetzt die Augen auf. »Warum … haben Sie das getan?«, keuchte er.
Der Söldner drehte sich wieder zu ihm herum und schwenkte seine Waffe dabei wie zufällig in Torbens Richtung. »Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann«, sagte Pjotr. »Sie haben viel Geld bezahlt. Also haben Sie auch Anspruch auf eine angemessene Gegenleistung. Ich bleibe ungern jemandem etwas schuldig.«
Torben starrte ihn an. Er verstand nicht, was Pjotr meinte, und er war unfähig, zu antworten oder auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Aber er wusste nun, was er stets in Pjotrs Gegenwart gespürt hatte und was er noch immer spürte. Gewalt und Tod waren auch ein Teil von Mikails und den Leben der beiden Brüder gewesen, und bis zu einem gewissen Punkt auch seines eigenen. Aber mit Pjotr war es anders. Plötzlich war ihm klar, dass er in der Nähe des Russen nicht nur einfach den Tod gespürt hatte, sondern seinen eigenen Tod. Pjotr würde ihn umbringen, so einfach war das. Seltsam – er war fast erleichtert.
»Wie gesagt: Sie waren sehr großzügig«, fuhr Pjotr fort, als er begriff, dass er keine Antwort bekommen würde. »Eindeutig zu großzügig. Das war ein Fehler.«
»Wieso?«
»Sie haben nicht viel Erfahrung im Umgang mit Leuten wie uns, nicht wahr?«, fragte Pjotr und beantwortete seine Frage gleich selbst, indem er den Kopf schüttelte. »Aber ich dafür mit Leuten wie Ihnen. Sie planen etwas. Etwas, das nicht legal ist und vor dem Sie selbst Angst haben. Also suchen Sie sich jemanden, der die Drecksarbeit für Sie erledigt und dabei nicht allzu viele Fragen stellt. Jemanden wie mich.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«, fragte Torben.
»Es gibt auch in unserem Gewerbe Regeln«, erwiderte Pjotr.
»Und es gehört zu diesen Regeln, Ihre Kameraden umzubringen?«, fragte Torben. Er wartete darauf, dass die Angst kam, aber er spürte sie immer noch nicht.
»Sie haben zu viel bezahlt«, sagte Pjotr. »Es gibt so etwas wie Tarife, wissen Sie? Selbst in unserem Gewerbe.«
»Und was ist das Leben eines Säuglings wert?«, fragte Torben bitter. Warum tötete Pjotr ihn nicht einfach? Er wünschte sich so sehr, dass es vorbei wäre.
»Ein Bruchteil dessen, was Sie mir und den anderen angeboten haben«, antwortete Pjotr. »Anfangs dachten wir nur, Sie wären einfach dumm oder verrückt. Ein reicher Spinner, der eine Menge Geld für einen leichten Job bezahlt.«
»Vielleicht bin ich das ja«, sagte Torben.
»Aber dann wurde ich nachdenklich«, fuhr der Russe unbeeindruckt fort. »Sie haben mich bezahlt, damit ich dabei zusehe, wie Sie ein Kind töten. Aber statt es zu tun, finden Sie ein zweites Kind und entschließen sich, beide mitzunehmen. Das ist seltsam.«
In das immer noch anhaltende Geräusch des Feuerwerks hatte sich ein neuer Laut gemischt; ein dumpfes Wummern, fast unterhalb der Hörgrenze, das allmählich näher kam. Torben sah hoch und erblickte einen winzigen Lichtpunkt, der nicht zum Feuerwerk gehörte, sich aber trotzdem bewegte und dabei dem Dach näherte. Der Hubschrauber. »Das geht Sie nichts an«, sagte er.
Pjotr schüttelte den Kopf, senkte seine Waffe und schoss Torben ins Knie. Es tat nicht weh. Torben spürte nur einen harten Schlag, dann knickte sein Bein unter ihm weg und er fiel schwer zu Boden. Irgendwie gelang es ihm, sich so zu drehen, dass er die Kinder nicht unter sich begrub, sondern sie mit seinem Körper vor dem Aufprall schützte, aber zu mehr reichte es nicht. Die beiden lebenden Bündel entglitten seinen Armen und rollten ein Stück weit davon, seltsamerweise gaben sie nicht den mindesten Laut von sich.
»Falsche Antwort«, sagte Pjotr.
Das Hubschraubergeräusch war näher gekommen. Torben schätzte, dass die Maschine in zwanzig oder höchstens dreißig Sekunden landen würde. Spätestens in diesem Moment würde Pjotr ihn erschießen.
»Ich werde Ihnen sagen, wie ich die Sache sehe«, fuhr Pjotr fort. »An diesen Kindern ist etwas Besonderes. Etwas ungeheuer Wichtiges. Ich weiß nicht, was, und um ehrlich zu sein, kann ich es mir nicht einmal vorstellen, aber sie müssen verdammt wertvoll sein.«
Wertvoller, als er sich auch nur vorstellen konnte, selbst jetzt. Torben sagte nichts, und wozu auch? Nichts, was er nun noch hätte sagen oder tun können, würde noch irgendetwas ändern. Er lag da und wartete auf den Tod. Sehnte ihn herbei wie niemals etwas zuvor.
»Sie werden mir verraten, was es ist«, fuhr Pjotr fort.
»Warum sollte ich das?«, murmelte Torben. »Sie bringen mich doch so oder so um.«
»Nur wenn ich muss«, behauptete Pjotr. »Ich will ganz ehrlich sein: Ich würde Sie nur ungern töten. Es ist viel einfacher, wenn ich Sie am Leben lasse.« Er deutete in die Richtung, aus der das lauter werdende Rotorengeräusch kam. »Es ist leichter, wenn Sie Ihren Freunden sagen, was geschehen ist und was ich möchte. Ich werde die Kinder mitnehmen.«
»Sie sind völlig wertlos für Sie«, murmelte Torben.
»Das mag sein«, antwortete Pjotr ruhig. »Aber nicht für Sie.«
»Sie … Narr«, sagte Torben leise. Er lauschte in sich hinein. Sein Knie war immer noch taub, er spürte nicht den geringsten Schmerz, aber er konnte fühlen, wie stark er blutete. Und da war etwas wie ein unangenehmes Kribbeln, das sich von seinem Knie ausgehend langsam in seinem Körper auszubreiten begann. »Sie haben ja keine Ahnung, worauf Sie sich einlassen. Mit wem Sie es zu tun haben. Diese Kinder sind … gefährlich.«
»Gefahr ist mein Beruf«, sagte Pjotr leichthin. »Also?«
Er spürte nun doch einen leichten Schmerz. Wenn auch nicht im Knie, aber nun in seiner rechten Hüfte, auf die er gefallen war. Er trug etwas Hartes in der Jackentasche, das auf seinen Knochen drückte.
»Ich könnte Ihnen jetzt auch noch das andere Knie zerschießen«, sagte Pjotr gelassen. »Aber ich werde es nicht tun. Ich werde Sie töten und die Kinder mitnehmen, oder Sie sagen mir, was ich wissen will, und ich lasse Sie am Leben. So haben Sie wenigstens die Chance, sie zurückzuholen.«
Torbens Blick fiel auf das winzige Bündel, das zwei oder drei Meter entfernt auf dem Dach lag. Ein weniger als handflächengroßes, blasses Gesichtchen sah ihm daraus entgegen. Winzige, wissende Augen, die direkt auf den Grund seiner Seele blickten. Der Schmerz in seiner Hüfte schien für einen Moment stärker zu werden und dann erinnerte er sich auch, was dort auf seinen Knochen drückte: Es war die Waffe, die er im Kreißsaal eingesteckt hatte. Mühsam wälzte er sich auf den Rücken, um Pjotr anzusehen. Seine rechte Hand bewegte sich wie zufällig zu seiner Jackentasche und hielt einen Moment davor inne. Trotzdem natürlich nicht unauffällig genug. Pjotr entging die Bewegung nicht und er musste wissen, was in Torbens Tasche war. Aber er zeigte sich kein bisschen beunruhigt. Ganz im Gegenteil schien er sogar wieder zu lächeln. »Was wollen Sie?«, fragte Torben. »Geld?«
»Was sonst?«, fragte Pjotr.
»Geld?«, fragte Torben noch einmal ungläubig. »Sie … Sie unglaublicher Narr! Sie haben ja keine Ahnung, was auf dem Spiel steht!«
»Es geht immer nur um Geld«, behauptete Pjotr achselzuckend. Er schwenkte die Uzi herum und richtete sie nun auf Torbens Gesicht. »Also?«
Statt zu antworten, zog Torben die Waffe aus der Jackentasche und zielte damit auf den Russen. Er war fest davon überzeugt, dass Pjotr ihn erschießen würde, noch bevor er die Bewegung auch nur halb zu Ende gebracht hatte, aber der Söldner verzog nur geringschätzig die Lippen.
»Sie müssen sie entsichern«, sagte er. »Der kleine Hebel an der Seite. Sie müssen ihn nach oben schieben, sonst funktioniert das Ding nicht.«
Der Helikopter war jetzt so laut geworden, dass es nur noch Sekunden dauern konnte, bis die Maschine auf dem Dach aufsetzte. Torben schob den Sicherungshebel nach oben und Pjotr erschoss ihn immer noch nicht.
»Jetzt haben wir ein Problem, nicht wahr?«, fragte der Russe ruhig. »Entweder erschießen Sie mich oder ich Sie. Haben Sie den Mut abzudrücken? Es ist gar nicht so leicht, wie die meisten sich das vorstellen. Und aus dieser Entfernung auch eine ziemliche Schweinerei.«
»Warum tun Sie das?«, fragte Torben. »Das … das ist doch Wahnsinn!«
»Vielleicht will ich herausfinden, was Ihnen diese Kinder wert sind«, antwortete Pjotr. »Sie können sich nicht damit herausreden, dass Sie ihr Leben verteidigen müssen. Ich werde ihnen nichts tun. Ich liebe Kinder, wissen Sie? Ich würde ihnen kein Haar krümmen. Aber ich werde sie mitnehmen.« Er legte den Zeigefinger um den Abzug seiner Waffe. »Sind Sie bereit, für sie zu töten? Einer von uns wird schießen, wenn der Hubschrauber aufsetzt. Ich überlasse Ihnen die Entscheidung, wer es ist.«
»Sie sind wahnsinnig«, flüsterte Torben. »Völlig wahnsinnig!« »Nein«, antwortete Pjotr. »Ich bin ein Verbrecher. Sagen Sie nicht, das hätten Sie nicht gewusst.«
Das Dröhnen der Helikoptermotoren hatte mittlerweile eine Lautstärke erreicht, die Pjotrs Worte fast verschluckte. Noch wenige Sekunden. Was sollte er tun? Was sollte er nur tun? Gib mir ein Zeichen, Herr, flehte Torben in Gedanken. Bitte, Gott, zeig mir, was ich tun soll! Aber der Himmel schwieg.
Die Sekunden dehnten sich zu Ewigkeiten, aber schließlich wuchs das Rotorengeräusch zu einem ohrenbetäubenden Dröhnen an und ein gelb und weiß lackierter Rettungshelikopter setzte keine zwanzig Meter entfernt von ihnen auf dem Dach auf.
Ein einzelner Schuss peitschte durch die Nacht.
Kapitel 1
Das Firmament hatte Feuer gefangen und der Himmel hatte alle seine Schleusen geöffnet und probte für eine neue Sintflut. Beides war seit Wochen nichts Besonderes und beides stimmte nicht wirklich, aber es kam der Wahrheit immerhin nahe genug, um unerschöpflichen Stoff für Schlagzeilen und aus dem Boden gestampfte pseudowissenschaftliche Sendungen im Privatfernsehen herzugeben, und beides interessierte Rachel im Moment nicht die Bohne. Alles, was sie im Augenblick wirklich interessierte, war die Frage, wie zum Teufel sie die knapp anderthalb Kilometer nach Hause zurücklegen sollte, ohne dabei bis auf die Knochen durchnässt zu werden und sich höchstwahrscheinlich die schlimmste Erkältung ihres Lebens einzuhandeln.
Rachel belegte sich in Gedanken mit einer ganzen Anzahl ebenso fantasievoller wie wenig damenhafter Bezeichnungen, zog fröstelnd die Schultern zusammen und versuchte einen Blick in den Himmel hinauf zu werfen, nach Möglichkeit, ohne dass ihr der Regen dabei wie eine eiskalte, nasse Hand ins Gesicht klatschte. Es funktionierte nicht. Das Wartehäuschen war nach dem gleichen universellen Gesetz erbaut, nach dem sämtliche Bushaltestellen auf der ganzen Welt errichtet wurden, und das besagte, dass die offene Seite immer dem Wind zugewandt war, ganz egal, aus welcher Richtung er gerade kam. Und das prächtige Farbenspiel, mit dem der Himmel die Menschen wenigstens zum Teil für den seit drei Wochen anhaltenden Dauerregen entschädigen sollte, verbarg sich hinter tief hängenden, fast schwarzen Wolken. Es war bitter kalt. Das sollte es nicht sein. Die großen Ferien hatten vor einer Woche begonnen. Es war Hochsommer. Die Leute waren bereits im Urlaub oder heftig mit Kofferpacken und anderen Urlaubsvorbereitungen beschäftigt, und auch wenn es erst halb sieben Uhr morgens war – sie sollte nicht in Kostüm und Trenchcoat an einer Bushaltestelle stehen und vor Kälte mit den Zähnen klappern.
Ein Wagen fuhr vorüber und Rachel unterbrach ihren Gedankenfluss für einen Moment, um ihn zu begutachten. Möglicherweise war es ja jemand, den sie kannte und der sich ihrer erbarmen und sie nach Hause fahren würde. Vielleicht auch jemand, der sie nicht kannte und der sich ihrer trotzdem erbarmte.
Statt jedoch abzubremsen, wurde der Wagen wieder schneller und Rachel trat mit einer raschen Bewegung in den zweifelhaften Schutz des Wartehäuschens zurück, um nicht zusätzlich von der hochgewirbelten Wasserfontäne durchnässt zu werden. Sie verbrachte weitere zehn Sekunden damit, die ausgestorben daliegende Straße beiderseits der Bushaltestelle vergeblich nach einem Anzeichen von Leben abzusuchen, gab dann ein leises, resigniertes Seufzen von sich und nahm mit der rechten Hand ihren Koffer auf. Mit der anderen schlug sie den Kragen des Trenchcoats hoch und trat mit einem entschlossenen Schritt in den Regen hinaus. Es nutzte ihr nichts, mit dem Schicksal zu hadern und sich selbst Leid zu tun. Der Regen würde für die nächsten achtundvierzig Jahre oder so wahrscheinlich nicht mehr aufhören und mit Bekannten war es irgendwie wie mit dieser Bushaltestelle: Sie ließen einen immer im Stich, wenn man sie wirklich brauchte. Und anderthalb Kilometer waren schließlich auch nicht so weit.