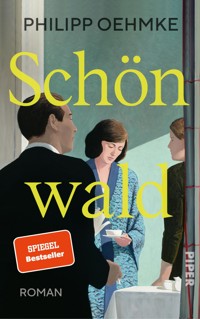9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Über dreißig Jahre deutsche Rockgeschichte «Hier kommt Alex», «Alles aus Liebe», «Zehn kleine Jägermeister» oder «Tage wie diese» – wer kennt sie nicht, die großen Hits der Toten Hosen? Diese Band hat Geschichte geschrieben. Ihr Aussehen war zum Davonlaufen. Ihr Benehmen nicht akzeptabel. Ihre Musik dröhnte. Vier von fünf konnten kein Instrument spielen. Wie konnte aus diesen Typen die erfolgreichste Rockband Deutschlands werden? Herbst 2013: Die Toten Hosen haben das erfolgreichste Jahr ihrer Geschichte hinter sich, sie haben mehr Platten verkauft als jemals zuvor, sie haben auf ihrer Tournee vor mehr Menschen gespielt als je eine andere Band in diesem Land. Als Punks gründeten sie ihre Band und spielten für eine Minderheit. Heute ist ihre Musik überall zu hören und auch in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Doch das wollten sie eigentlich nie. Die Band hat sich in den letzten 30 Jahren verändert, alle Mitglieder sind inzwischen über fünfzig Jahre alt – aber auch Deutschland hat sich verändert. In ihrem Buch weichen sie schwierigen Fragen nicht aus: Sie erzählen ihre persönliche Geschichte, berichten von ihren Anfängen und ihrem sagenhaften Aufstieg, erinnern sich an ihre Kindheit und Jugend, berichten von ihren Abenteuern, Kämpfen und Abstürzen und geben unerwartete Einblicke in das Innenleben einer Rockband. Ein Buch über das Erwachsenwerden, über große und kleine Lebenskrisen und über eine große, aber komplizierte Freundschaft. Ein ehrliches Porträt. Ein faszinierendes Stück Zeitgeschichte. «Man zieht sich ganz langsam aus. Plötzlich steht man nackt da. So ist das mit diesem Buch. Trotzdem fühlt es sich irgendwie gut an, wie in einer Therapie …» (Campino) «Ich hoffe, dass zumindest meine Familie, insbesondere meine Kinder und die Polizei, diese Biographie nie zu Gesicht bekommen …» (Kuddel) «Ich habe Dinge über uns erfahren, die ich so zumindest noch nicht wusste. Wahrscheinlich geht es den anderen genauso.» (Andi) «Es geht um mehr als nur ein paar Anekdoten. Man kann hinter die Kulisse sehen, wenn man einfach mal wissen will, wie eine Band funktioniert, egal ob man was mit den Toten Hosen anfangen kann oder nicht.» (Breiti) «Philipp really reminded me of how much I dislike those bastards … but don't quote me on that.» (Vom)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Philipp Oehmke
Die Toten Hosen
Am Anfang war der Lärm
Über dieses Buch
Über dreißig Jahre deutsche Rockgeschichte
«Hier kommt Alex», «Alles aus Liebe», «Zehn kleine Jägermeister» oder «Tage wie diese» – wer kennt sie nicht, die großen Hits der Toten Hosen? Diese Band hat Geschichte geschrieben.
Ihr Aussehen war zum Davonlaufen. Ihr Benehmen nicht akzeptabel. Ihre Musik dröhnte. Vier von fünf konnten kein Instrument spielen. Wie konnte aus diesen Typen die erfolgreichste Rockband Deutschlands werden?
Herbst 2013: Die Toten Hosen haben das erfolgreichste Jahr ihrer Geschichte hinter sich, sie haben mehr Platten verkauft als jemals zuvor, sie haben auf ihrer Tournee vor mehr Menschen gespielt als je eine andere Band in diesem Land.
Als Punks gründeten sie ihre Band und spielten für eine Minderheit. Heute ist ihre Musik überall zu hören und auch in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Doch das wollten sie eigentlich nie. Die Band hat sich in den letzten 30 Jahren verändert, alle Mitglieder sind inzwischen über fünfzig Jahre alt – aber auch Deutschland hat sich verändert.
In ihrem Buch weichen sie schwierigen Fragen nicht aus: Sie erzählen ihre persönliche Geschichte, berichten von ihren Anfängen und ihrem sagenhaften Aufstieg, erinnern sich an ihre Kindheit und Jugend, berichten von ihren Abenteuern, Kämpfen und Abstürzen und geben unerwartete Einblicke in das Innenleben einer Rockband. Ein Buch über das Erwachsenwerden, über große und kleine Lebenskrisen und über eine große, aber komplizierte Freundschaft. Ein ehrliches Porträt. Ein faszinierendes Stück Zeitgeschichte.
«Man zieht sich ganz langsam aus. Plötzlich steht man nackt da. So ist das mit diesem Buch. Trotzdem fühlt es sich irgendwie gut an, wie in einer Therapie …»
(Campino)
«Ich hoffe, dass zumindest meine Familie, insbesondere meine Kinder und die Polizei, diese Biographie nie zu Gesicht bekommen …»
(Kuddel)
«Ich habe Dinge über uns erfahren, die ich so zumindest noch nicht wusste. Wahrscheinlich geht es den anderen genauso.»
(Andi)
«Es geht um mehr als nur ein paar Anekdoten. Man kann hinter die Kulisse sehen, wenn man einfach mal wissen will, wie eine Band funktioniert, egal ob man was mit den Toten Hosen anfangen kann oder nicht.»
(Breiti)
«Philipp really reminded me of how much I dislike those bastards … but don’t quote me on that.»
(Vom)
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, November 2014
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Dirk Rudolph
ISBN 978-3-644-02701-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Der Anruf
Vorgärten
Schwerstarbeit
Düsseldorf
Ehemaligentreff
Gründerzeit
1000
Wendepunkte
Blaue Stunde
Grenzbereich
Endspiel
Abbildungen
Bildnachweis
Dank
Die Toten Hosen – Diskographie
Alben:
Singles/EP:
DVDs:
Der Anruf
ANDI: Da schluckst du, klar. An dem Morgen, an dem ich gesehen habe, dass Volker Kauder von der CDU «Tage wie diese» singt, fand ich das natürlich nicht toll. So was will man nicht.
KUDDEL: Ich versuche, diesen Gedanken von mir zu schieben, dass mich das nervt. Aber irgendwie nervt es mich doch. Mir wäre es lieber gewesen, wenn die CDU das nicht gespielt hätte, und die anderen Parteien auch nicht, klar. Du guckst in einen hässlichen Spiegel.
CAMPINO: Im Grunde ist doch nichts weiter passiert, außer dass wir ein Liedchen hatten, das sich verselbständigt hat. Das von den Leuten geliebt wurde, scheißegal ob das von den Toten Hosen war oder nicht. Und die CDU weiß doch, wo wir stehen. Das Gegenfeuer, das konnten sie ja schon spüren, sonst hätte die Merkel auch nicht bei mir angerufen und sich entschuldigt.
BREITI: Aber es hätte ja gereicht, wenn die Sekretärin anruft. Ich stelle mir vor, die Merkel hat einen ziemlich vollen Terminkalender und möglicherweise echt wichtige Sachen zu tun. Und dann ein Telefontermin mit Campino von den Toten Hosen: Der passt dann da noch rein?
VOM: Who’s Volker Cow-da?
Am Abend des 22. September 2013, Deutschland hatte gerade eine neue Regierung gewählt, bekamen die Toten Hosen um zehn Minuten nach neun ein Problem.
Die Christlich Demokratische Union, kurz: die CDU, hatte an diesem Tag einen triumphalen Wahlsieg eingefahren und Kanzlerin Angela Merkel mit 41,5 Prozent der Wählerstimmen die absolute Mehrheit nur knapp verpasst.
Aber das war natürlich nicht das Problem der Toten Hosen.
Das Problem bestieg um kurz nach neun die Bühne des Berliner Konrad-Adenauer-Hauses, der Zentrale der CDU, wo die Partei eine Wahlparty veranstaltete. Man war ausgelassen, die Kanzlerin simulierte auf der Bühne ein paar wiegende Tanzschritte und schlug mit weit ausholenden Bewegungen immer wieder die Hände zusammen. Neben ihr stand Ursula von der Leyen, der Generalsekretär Hermann Gröhe sprang um sie herum, selbst Heiner Geißler war wie ein Gespenst aus den Achtzigern kurz auf der Bühne aufgetaucht.
«Morgen wird wieder gearbeitet», hatte die Botschaft von Merkels Siegesansprache vorsorglich gelautet, aber nun drohte ihr der Abend doch zu entgleiten. Schon während ihrer Rede hatte Hermann Gröhe hinter ihrem Rücken Grimassen geschnitten, sodass sie sich ein paarmal umdrehen und ihn taxieren musste. Gröhe hatte sich danach eine kleine Deutschlandfahne besorgt, er wollte mit ihr, Besoffski-Grinsen im Gesicht, das Fähnchen schwenkend, über die Bühne schreiten, aber sie nahm ihm die Fahne weg.
Dann kam Volker Kauder, ihr Fraktionsvorsitzender. Oje, er hatte es geschafft, sich irgendwo ein Mikrophon zu besorgen. Eine Tanzkapelle spielte die ersten Takte eines Liedes an. Merkel erkannte das Lied nicht, später erfuhr sie, dass es «Tage wie diese» hieß und von den Toten Hosen war. Kauder hob das Mikrophon Richtung Mund, begann zu singen. Die Bundeskanzlerin guckte ihren Fraktionschef interessiert bis irritiert von der Seite an – konnte das gut enden, was der da veranstaltete? – und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.
Die Tagesthemen hatten an jenem Abend 5,9 Millionen Zuschauer. Gut eine Stunde später sahen diese Menschen, wie die CDU zur Musik der Toten Hosen feierte. Ein Land im Unionstaumel. Es war beinahe wie vor dreißig Jahren, 1983, als die Toten Hosen gerade ihr erstes Album Opel-Gang veröffentlicht hatten und die Deutschen Helmut Kohl mit 48,8 Prozent zum Kanzler wählten. Die Toten Hosen sangen damals Lieder wie «Hofgarten» mit Zeilen wie «Ficken, Bumsen, Blasen / alles auf dem Rasen», und niemand spielte sie auf irgendwelchen Wahlfeiern. Stolz, ganz bewusst standen sie außerhalb des gesellschaftlichen Konsenses und fühlten sich dort wohl.
Am Tag nach der Septemberwahl 2013 war der Kauder-Clip überall im Internet. Die Kommentare, die er hervorrief, richteten sich gegen Kauder, gegen die CDU, aber auch gegen die Toten Hosen. Sie, die ehemaligen Punkrocker, hätten sich endgültig verraten: ein neuer Beweis für einen alten Vorwurf.
Natürlich hätte jeder wissen können, dass die Toten Hosen das nicht gewollt hatten. Im Gegenteil, schon in den Wochen vor der Wahl war das Lied immer wieder auf Wahlkampfveranstaltungen sowohl der CDU als auch der SPD zu hören gewesen. Die Band hatte sich öffentlich dagegen gewehrt und doch nicht verhindern können, dass Menschen das Lied zu allen möglichen Anlässen spielten. Jetzt, nach dreißig Jahren, landeten sie einen Hit wie nie zuvor; «Tage wie diese» hatte sich, nachdem es im März 2012, also schon anderthalb Jahre vor der Bundestagswahl, erschienen war, 800000-mal verkauft und stand sechs Wochen auf Platz eins der Hitparaden. Das Lied lief in Fußballstadien, in Bierzelten, auf Hochzeiten, Beerdigungen und auf Radiosendern, die die Toten Hosen bislang ignoriert hatten.
Schon im Sommer 2012, während der Fußball-Europameisterschaft, hatte sich Oliver Bierhoff, Teammanager des deutschen Nationalteams, aus der Ukraine bei Campino gemeldet. Ob die Toten Hosen sich vorstellen könnten, im Falle eines Finaleinzugs (daraus wurde nichts) die Mannschaft im EM-Quartier in der Ukraine zu besuchen und «Tage wie diese» am Abend zuvor zur Motivation der Spieler live vorzutragen?
Campino schrieb an seinem fünfzigsten Geburtstag in sein Tagebuch: «Das darf nicht wahr sein: An Tagen wie diesen halte ich zum ersten Mal zum deutschen Team. Eine erstaunliche Erfahrung. Aber überall singen die Leute dieses Lied. Was sollte ich dagegen haben?»
Nichts! Oder doch? Allerdings implizierte die Frage, dass man durchaus etwas dagegen haben konnte.
Campino, Andi, Breiti und Kuddel (Vom, dem englischen Schlagzeuger, war es ein bisschen egal) wollten nichts dagegen haben. Sie wollten nicht verkrampfen, nicht jetzt, nicht im Jahr ihres größten Triumphes. Sie glaubten schließlich, dass sie sich erfolgreich therapiert hatten von jener Ruhm- und Erfolgsverspannung, mit der sie jahrzehntelang gekämpft hatten. Punkrock, so hatte es Campino einmal ausgedrückt, hatte für vieles Rezepte, nur für eines nicht, für den Umgang mit Erfolg, Reichtum und Ruhm.
Verkrampft, hat Breiti einmal erklärt, seien sie oft genug gewesen. Im Laufe von zwanzig Jahren, seit den frühen Neunzigern, hatten sie lernen müssen, mit ihrem Erfolg und ihrer Rolle als Rockstars, mit Wetten-dass..?-Auftritten, Goldenen Schallplatten und Echoverleihungen klarzukommen, weshalb sie der Union nun nicht die Genugtuung gönnen wollten, sie auch nur für eine Millisekunde aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und so war die Band wieder in einem Dilemma gefangen, das sie schon kannte. Sie meinte, es überwunden zu haben. Die Toten Hosen versuchten, den Vorfall zu vergessen.
Drei Tage nach der Bundestagswahl, an einem Mittwochmittag, klingelte im Büro der Band das Telefon. Die Toten Hosen führen ihren eigenen Laden, Jochens Kleine Plattenfirma, genannt JKP, er liegt auf einem Industriehof im Düsseldorfer Stadtteil Flingern. Eine Sekretärin der Bundeskanzlerin war am Telefon. Frau Dr. Angela Merkel, sagte die Stimme aus dem Kanzleramt, wolle bitte den Herrn Campino sprechen. Ob der da sei.
Ratlosigkeit.
Die Titanic?
Vielleicht will sie einen Plattenvertrag, mutmaßte die Assistentin Dani Wigbels, die den Anruf entgegengenommen hatte.
Keiner dachte an den Kauder-Vorfall.
JKP-Geschäftsführer Patrick Orth informierte den Manager Jochen Hülder, der wieder Campino anrief und Campino kurz darauf die anderen Bandmitglieder. Die Maschine der Toten Hosen hatte sich in Bewegung gesetzt.
Keiner war begeistert.
Angela Merkel bekam Campinos Nummer erst einmal nicht.
Die Toten Hosen wären nicht die Toten Hosen, wenn sie nicht zunächst diskutieren, abwägen, erörtern, beraten, streiten würden. Das machen sie seit dreißig Jahren so. Und auch in diesem Fall. Nicht alle waren dafür, dass die Kanzlerin einfach bei einem von ihnen anrief.
Im internen Gefüge verstehen sich die Toten Hosen als demokratische Institution. Jeder hat eine Stimme, jeder wird gehört, jeder kann theoretisch ein Veto einlegen, und dann wird meistens so lange diskutiert, bis Campino sich durchsetzt. Der Produzent der Toten Hosen, Vincent Sorg, der bei den Aufnahmen im Studio viele Entscheidungsfindungen der Band miterlebt hat, nannte es einmal so: «Die Toten Hosen sind die bestfunktionierende Scheindemokratie der Welt.»
Und Campino sagte jetzt: «Wenn die Kanzlerin mich sprechen will, höre ich mir das an und lasse mich nicht verleugnen.»
Am nächsten Tag klingelte Campinos Mobiltelefon. Donnerstag, vier Tage nach der Bundestagswahl. Angela Merkel hatte da zwar noch keine Idee für eine Koalition – Sondierung mit den Grünen, Gespräche mit den Sozialdemokraten, man kann ja alles noch sehen –, aber erst mal mit Campino reden. Der war auf dem Weg ins Düsseldorfer Stadion, wo er einen Spot zur Prävention von Rückenmarksverletzungen drehen sollte. Es ging ihm nicht gut. Er hatte ein dickes Knie, angeschwollen wie ein Luftballon, Meniskusriss links. Beide Achillessehnen waren angerissen. Die Konzerte der letzten Wochen – Konstanz, Baden-Baden, Mannheim – hatte er nur unter Qualen durchgestanden. Schmerzmittel. Physiotherapie. Aquajogging bis nachts um halb vier im Hotel.
«Büro der Bundeskanzlerin, einen Moment, ich verbinde.»
Campino, der seit drei Jahrzehnten sein Leben in kleinen schwarzen Tagebüchern festhält, notierte später den Verlauf des Telefonats.
Angela Merkel sagte: «Lieber Herr Campino, ich rufe an, weil wir ja am Wahlabend so auf Ihrem Lied herumgetrampelt sind. Keine Angst, es soll nicht die nächste CDU-Hymne werden. Aber Sie haben da so ein schönes Lied geschrieben.»
Campino hatte befürchtet, dass es um «Tage wie diese» gehen würde.
Merkel fuhr fort: «Bei den Wahlkampfveranstaltungen haben wir es ja dann nicht mehr gespielt, nach Ihrem Einspruch. Aber generell, bei Siegesfeiern, hatten Sie gesagt, Sie hätten nichts dagegen.»
Campino erklärte der Kanzlerin, der Gesangsvortrag sei wirklich bescheiden gewesen, aber niemand sei länger beleidigt. Er gratulierte ihr zum Wahlsieg, anstandshalber.
Aber Angela Merkel war noch nicht fertig.
«Ihre Fans waren so sauer, das ist auf Ihrer Facebook-Seite ja richtig explodiert.» Es ist erstaunlich, was eine Bundeskanzlerin alles mitbekommt. «Und ja», so Merkel weiter, «das war eine tolle Wahl. Besonders freue ich mich über den Erfolg unter den Jungwählern!»
Jungwähler, so stellte man es sich wohl bei ihr im Kanzleramt vor, das müssen Tote-Hosen-Fans sein. Und wenn man es sich mit dem Herrn Campino, den Toten Hosen und deren Fans verdirbt, dann verdirbt man es sich womöglich auch mit den Jungwählern.
War das die Rechnung, die man im Kanzleramt aufgemacht hatte? Oder wollte Angela Merkel dem Sänger der Toten Hosen tatsächlich nur ausrichten, dass er ein sehr schönes Lied geschrieben habe?
Am Handy blieb ein konsternierter Campino zurück. «Es war ein Gemisch aus Staunen und Entsetzen. Entsetzt, dass die nichts anderes zu tun hatte, als mich anzurufen. Gerührt, dass sie auf eine humorvolle Art, locker, sich da so erklärt.»
Es war nicht das erste Gespräch zwischen dem Tote-Hosen-Sänger und der Bundeskanzlerin. Fast zwanzig Jahre zuvor, im Januar 1994, als Merkel im Kabinett Kohl noch Frauen- und Jugendministerin war, bevor sie im selben Jahr zur Umweltministerin avancierte, hatte der Spiegel den seinerzeit noch berufsjugendlichen Campino zu Merkel geschickt, damit er sie über die Jugend befrage und alles, was damit zusammenhing. Für Campino bedeutete das in dieser Zeit vor allem Alkohol, Suff und Exzess. Danach befragte er sie, und Merkel berichtete von dem ausschweifendsten Moment ihres Lebens, der Abiturfeier.
Beim Telefonat hatte Merkel gleich im ersten Satz an das Interview von damals angeknüpft. «Erinnern Sie sich noch an unser schönes Interview?» Campino erinnerte sich, aber, nein, das war kein schönes Interview gewesen, jedenfalls nicht für Merkel. Liest man es heute, erkennt man, wie sehr sich das Land verändert hat. Natürlich würde sich die Bundeskanzlerin heute nicht mehr über den Schwips auf ihrer Abiturfeier ausfragen lassen, natürlich wäre Campino heute zu höflich, sie wegen ihrer mangelnden Rauscherfahrung zu verhöhnen, aber vor allem würden eine Regierungschefin und ein Rocksänger heute nicht mehr als Vertreter zweier völlig unterschiedlicher Planeten erscheinen.
Willkommen in einem neuen Deutschland. In diesem Deutschland kommt es vor, dass selbst ein CDU-Fraktionsvorsitzender einen Tote-Hosen-Hit zum Besten gibt und eine Kanzlerin am Telefon etwas von einem «schönen Lied» säuselt. Das ist so. Wir sollten uns damit abfinden. Und dieses neue Deutschland möchte bitte die Toten Hosen in seiner Mitte haben und zusammen mit ihnen «Tage wie diese» singen. Dagegen ist erst mal nichts einzuwenden. Kunst will gesehen, Lieder wollen gehört werden.
Doch das Projekt, das die Toten Hosen vor mehr als dreißig Jahren begründeten, baute auf Abgrenzung nicht nur dem bundesdeutschen Gesellschaftskonsens gegenüber, sondern auch weiten Teilen der Punkbewegung, deren Regeln sie nicht befolgten und deren Uniformität sie sich nicht unterwarfen:
Der Wille, absolut bescheuert auszusehen.
Der Altkleidersammlung- und Schlafanzughosen-Look.
Die Glorifizierung von Alkohol, Exzess und Zerstörung.
Die Faszination für Tradition und Brauchtum.
Und weil diese Widersprüchlichkeit den Toten Hosen mühelos und authentisch gelang, weil die Menschen ihnen glaubten, hat es die Band bis ganz nach oben getragen. Bloß – wie authentisch kann Abgrenzung dort noch sein? Wäre es glaubwürdiger, die neue Rolle in der Mitte der Gesellschaft anzunehmen, egal ob man sie jemals angestrebt hat oder nicht?
Mit diesem Spagat leben die Toten Hosen seit einiger Zeit, und wie kompliziert seine Auswirkungen sind, zeigt sich bei solchen Anlässen wie dem Anruf der Kanzlerin. Wie Campino, Andi, Breiti, Kuddel und Vom, inzwischen alle Anfang fünfzig, ihn hinbekommen, davon hängt ab, wohin es von dort oben aus für sie noch gehen kann. Oder ob er auf Dauer zu groß wird.
Keine drei Wochen nach dem Merkel-Anruf spielten die Toten Hosen die beiden Abschlusskonzerte ihrer «Der Krach der Republik»-Tournee, die sie anderthalb Jahre zuvor mit kleinen Wohnzimmerauftritten bei Fans begonnen hatten. Dann kam Rock am Ring, kamen immer größere Hallen und schließlich eigene Open-Air-Festivals mit 25000 oder auch 50000 Zuschauern pro Abend. Der Abschluss fand im Düsseldorfer Fußballstadion statt. Der Manager der Toten Hosen, Jochen Hülder, hatte am Spätnachmittag einen VW-Bus geschickt, der mich bis in den Bauch des Stadions hineinfuhr.
Ein Security-Mann der Toten Hosen, ein Mitglied der Rockergang Black Devils, geleitete mich durch die Katakomben. Es fielen einem die Rolling Stones ein, die 1969 bei einem Konzert in Altamont die Hells Angels als Sicherheitsdienst angestellt hatten, was jedoch schiefging, als ein Angel einen schwarzen Stones-Fan erstach. Aber anders als die Hells Angels gehören die Black Devils, soweit ich verstanden hatte, zu den guten-bösen Rockerclubs. Die Toten Hosen arbeiten mit ihnen schon seit Jahrzehnten zusammen, und bis zu seinem Tod vor ein paar Jahren postierte sich vorne an der Bühne immer Manfred Meyer, ein Black Devil. Unzählige Male konnte ich beobachten, wie er mit größter Ruhe, geradezu Zuneigung das Chaos in den ersten Reihen sortierte.
Vor mehr als fünfundzwanzig Jahren, im Sommer 1988, hatte ich zum ersten Mal eine Show der Toten Hosen gesehen. Zusammengedrückt stand ich in einer der vorderen Reihen in einer kleinen Halle in Bonn, der klitschnasse Sänger sprang von der Bühne über meinen Kopf hinweg ins Publikum, die Halle war von einer Wucht ergriffen, als gäbe es kein Morgen mehr. All das löste ein großes Glück in mir aus. Der Schriftsteller Rainald Goetz hatte ein ähnliches Erlebnis schon zwei Jahre zuvor, 1986, in Hirn so beschrieben: «Da war doch alles, wonach man sich sehnt, Jugend, Power, ultimative Bühnenaktion, rasender Drive. Campino weiß, dass er derzeit der genialste Sänger Deutschlands ist, arbeitet bei jedem Auftritt an der Zementierung und Verbreitung dieser Wahrheit und ist zugleich in Panik vor seinem eigenen Genie, das dafür sorgt, dass ihn jetzt schon Menschen meiner Sorte unsterblich finden.»
Was sind das bloß für Typen?, fragte ich mich damals. Anscheinend betrunken, lieferten sie einen unglaublichen Einsatz, sprangen, fielen, wälzten sich. Ständig sah es danach aus, als würde sich gleich einer verletzen. Trotzdem schafften sie es, ihre Lieder zu spielen. Die handelten davon, dass sie immer Punks bleiben wollten, auch wenn sie mal sechzig sein würden; dass man besser nichts Sinnvolles mit seinem Leben anstellen, sondern seine Zeit verschwenden sollte. Sie handelten von Pferdewetten, Straßenschlachten mit der Polizei und einem Schnaps, von dem ich noch nie gehört hatte, der Bommerlunder hieß und den man am besten zusammen mit einem Schinkenbrot genoss. Überhaupt waren Alkohol und Drogen ein starkes und wiederkehrendes Motiv in den kurzen Erzählungen der Liedtexte. Und die Bandmitglieder tranken auf der Bühne selbst ziemlich viel aus kleinen grünen Bierdosen. Sie kippten auch reichlich Bier in offene Münder im Publikum. Zwischen den Zugaben verschwanden die Musiker hinter der Bühne; erst später, als ich die Band kennenlernte, erfuhr ich, dass gelegentlich dort Speed auf sie wartete. Das war es, was dafür sorgte, dass die Typen nicht von der Bühne kippten.
Die Bandmitglieder trugen die merkwürdigste Kleidung, die man sich vorstellen konnte. Viel Viskose. Schlaghosen. Stars-and-Stripes-Hemden. Farben sollten sich, bitte schön, beißen. Es gab 1988 keine Moderichtung, die so etwas vorgesehen hatte.
Vor den Toten Hosen hatte an jenem Abend noch eine andere Band gespielt, die einen fast genauso bescheuerten Namen trug: Die Goldenen Zitronen. Deren Sänger nannte sich nicht Campino, sondern Schorsch Kamerun, und er und die anderen trugen die gleichen Klamotten aus der Altkleidersammlung.
Ich versuchte, das alles ironisch zu sehen, wusste aber nicht genau, wie. Ich war vierzehn. 1988 war Punk seit fast zehn Jahren vorbei. Eigentlich hätte man sich fragen müssen, was man hier überhaupt machte. Sollte man nicht eher zu den Beastie Boys gehen, die gerade in New York den Punkrock zusammen mit Hip-Hop neu erfunden hatten? Oder wenigstens Public Enemy hören mit ihrem aggressiven politischen Rap oder eine der Bands vom SST-Label, die immerhin eine kalifornisch modernisierte Version von Punk anboten?
Aber das Geile war, schon 1982, im Gründungsjahr der Toten Hosen, war Punk im Grunde nicht mehr da. Man hätte also nicht mehr oder weniger verpasst, wäre man ein paar Jahre früher dort gewesen. Wir waren alle zusammen zu spät. Erst heute begreift man, dass es um eine solche Zeitgenossenschaft bei den Toten Hosen eben nie ging, der Band wohnte von Anfang etwas Größeres inne, etwas Wichtigeres als der Versuch, den richtigen Soundtrack zur richtigen Zeit zu machen. Damals, 1988 in Bonn, stand die Band unmittelbar vor ihrem Durchbruch. Heute bilde ich mir ein, man hätte das geahnt. Diese Show war so stimmig und kam mit einer dermaßen selbstverständlichen großen Geste daher, dass man damit eigentlich nur berühmt werden konnte.
Vier Alben hatten die Toten Hosen bis dahin veröffentlicht. Nur das letzte, eine Sammlung von Punkrockversionen deutscher Schlager, hatte es überhaupt in die Hitparaden geschafft, wenn auch nur auf Platz 47.
Ganz oben standen Mitte der achtziger Jahre Purple Schulz und Peter Maffay, BAP und Marius Müller-Westernhagen, aber das war selbst für einen Jungen in der beginnenden Pubertät schon eine Parallelwelt. Keinen meiner Freunde interessierte das.
Doch jeder kannte die Toten Hosen, zumindest schien es mir so. Ihr erstes Album hatte einen merkwürdigen Titel, Opel-Gang. Es war 1983 veröffentlicht worden, Punk war erlahmt, war verkniffen politisch geworden, verkrampft ambitioniert oder schlicht verstumpft – und hier kam Deutschlands erste richtige Punkplatte. Natürlich hatte es Vorläufer gegeben. Drei Jahre zuvor hatten Fehlfarben Monarchie und Alltag herausgebracht, aber die Vorläufer (Male, Mittagspause, Abwärts) waren entweder ziemlich obskur oder, wie Fehlfarben, schon gar nicht mehr richtig Punk. Nun also: die erste richtige Punkplatte, die man auch als Vierzehnjähriger verstand. Sie hatte sich im besten Sinne so angehört wie Punk vor sechs Jahren in England. Sie hatte eine wahnsinnige Wucht. Bela B. von den Ärzten, der zeitweilig größten und erbittertsten Konkurrenz der Toten Hosen, erzählte mir einmal, er und sein Bandkollege Farin Urlaub hätten in ihrer gemeinsamen Wohnung in Berlin auf dem Boden gesessen, die von Bela frisch gekaufte Opel-Gang eingelegt und mit großem Respekt vernommen, was da in Düsseldorf produziert worden war.
Und die Band hatte Ideen. Ein Jahr später, 1984, erschien das zweite Album, Unter falscher Flagge. Es begann mit der Titelmelodie von Spiel mir das Lied vom Tod, und der damals in jedem Kinderzimmer bekannte Hörspielsprecher Hans Paetsch erzählte vor einem der Songs die Geschichte von den «halbtoten Hosen», die auf den Weltmeeren herumirrten – natürlich auf der Suche nach einer Schnapsinsel. Die Lieder hingen thematisch zusammen und waren (das weiß ich jedoch erst heute) musikalisch sauberer eingespielt. Wie auf Opel-Gang enthielt auch dieses Album mit «Liebesspieler» einen unvergessenen Hit.
Damenwahl, das dritte Album, wieder nur anderthalb Jahre später, im Sommer 1986. Jetzt klangen Die Toten Hosen erstmals etwas anders. Campino sang richtig, die Stücke waren ein bisschen langsamer, im Sound cleaner, und es gab abermals den einen unvergessenen Hit, «Wort zum Sonntag». Den Toten Hosen, das erfuhr ich erst jetzt von ihnen, hat am Ende Damenwahl nicht besonders gut gefallen, sie waren sogar unzufrieden, denn das Album wirkte ihnen zu glatt, zu produziert. Zu sehr wollten sie zeigen, was sie als Band alles draufhatten. Und Kuddel hat es sich bis heute nicht verziehen, dass er Campino damals zwingen wollte, endlich sauber zu singen.
Die Platte schließt mit einer Version des Karnevalsschlagers «Das Altbierlied». Es ist, glaube ich, wirklich das Fürchterlichste, was die Toten Hosen je aufgenommen haben, aber damals lief es bei uns zu Hause, in meinem Zimmer, rauf und runter, und noch immer kann ich den Text auswendig.
Dann die Kurskorrektur, nur ein Jahr später, 1987, unter dem Pseudonym Die Roten Rosen. Es erschien die bisher härteste Platte der Band: Campinos Stimme ist wieder heiser und rau, der Sound kantig, schnell. Die Toten Hosen spielten Coverversionen von deutschen Schlagern aus den frühen Sechzigern. Wenn ich das heute schreibe, klingt es ein bisschen schrecklich, aber das war es nicht. Die Schlager waren gut, sie hatten unglaublich komische Texte, und die Toten Hosen zeigten, wie irreal, abstrus und sogar böse die Lieder sind, sobald sie nur ein wenig anders gespielt werden. Damals kannte ich nicht einen einzigen dieser Schlager, und die Interpretationen der Toten Hosen sind bis heute eigenständig und wunderbar. Es war wahrscheinlich die wuchtigste Platte einer deutschen Band, die es bis dato gab, ein Schnellschuss, die Produktion kostete 5000 Mark, sie hatten dafür noch nicht einmal ihren Produzenten Jon Caffery ins Studio geholt.
Ein halbes Jahr nach dem Konzertbesuch in Bonn erschien «Hier kommt Alex», und wieder ein gutes Jahr später hatten sie mit Auf dem Kreuzzug ins Glück ihr erstes Nummer-1-Album. Viele meiner Freunde wandten sich von den Toten Hosen ab, die Zeit schien vorbei, wir tanzten zu WestBam, hörten Westküsten-Hip-Hop, manchmal lief sogar Grunge, und ab Mitte der Neunziger Britpop. Selbst Weggefährten wie die Goldenen Zitronen, die gerade noch als Vorband fungiert hatten, distanzierten sich von jener Musik, die zeitweise mit dem fast schon zum Schimpfbegriff verkommenen Wort «Fun-Punk» belegt wurde. Stattdessen begannen sie mit interessanter, hysterischer, künstlerisch-komplizierter Avantgardemusik, die toll, aber bis heute so gut wie unhörbar ist. Sie hätten keine Lust mehr, sagten die Goldenen Zitronen, Konzerte wie die Toten Hosen zu spielen, da kämen Bundeswehrsoldaten und Oberlippenbartträger, das sei Proll-Entertainment.
Die Toten Hosen machten weiter – und wurden ihr eigenes System. Überlegungen über Zeitströmungen, Bewegungen, Popkultur, Punkrock, was, wann, wo schoben sie mit Wucht und guter Laune weg. Sie brauchten keinen Referenzrahmen mehr.
Das Konzert in Bonn war mir fast surreal vorgekommen. Seitdem interessierten mich die Toten Hosen. Meinten die das ernst, waren die wirklich so? Oder war alles eine Show wie bei Ozzy Osbourne, der Plastikfledermäusen den Kopf abbiss? Gedanken eines Vierzehnjährigen.
Ein paar Monate später, noch immer das Jahr 1988, wartete ich an einem Dienstagabend vor dem Bühneneingang des Schauspielhauses in Bad Godesberg. Die Toten Hosen spielten damals in einer Theateradaption des Anthony-Burgess-Romans A Clockwork Orange mit: Sie mussten ja wohl irgendwann aus diesem Eingang herauskommen. Ich wollte wissen, ob man mit denen überhaupt normal reden kann, der Abgleich der Kunstfiguren mit den realen Menschen, ein gängiger naiver Popreflex.
Und nach einer Dreiviertelstunde tauchten Andi und Campino auf. Campino hatte seine Haare gefärbt, in einem Orangeton, und hielt eine grüne Bierdose in der Hand. Sie luden mich zu einer Pizza in der Godesberger Innenstadt ein. Wir tranken Bier. Man konnte ganz normal reden. So habe ich die Toten Hosen kennengelernt.
Nun, im Oktober 2013, würde es also die letzten beiden richtigen Tote-Hosen-Konzerte geben für wer weiß wie lange. Beide Abende waren seit Monaten ausverkauft, 45300 Tickets für jeden Auftritt. Damit hatten die Toten Hosen auf dieser Tour vor rund 1,1 Millionen Menschen gespielt, was in Deutschland noch keine Band geschafft hat. Viele Millionen Euro hatten sie auf diese Weise umgesetzt, aber da die Toten Hosen ihre Konzerte komplett selbst veranstalteten – oder besser: weil ihnen die Agentur gehört, die die Konzerte ausrichtet –, müssen am Ende von den Einnahmen die Kosten abgezogen werden, für mehr als hundert Leute, die Tag für Tag arbeiteten, auf und hinter der Bühne, damit die Anlage funktionierte, die Security, die Trucks, die Nightliner genannten Schlafwagenbusse, die gemieteten Hallen, die Hotels, das Essen.
Der Moment, wenn man in der Garderobe ankommt, ist immer heikel, nie weiß man, ob man eigentlich stört (wahrscheinlich schon), ob die Band nur zu höflich ist, um einen rauszuschmeißen. Bevor ich auch nur meine Jacke ablegen konnte, hatten Andi oder Campino bereits gefragt, ob ich etwas trinken wolle. Ich bejahte, bis mir einfiel, dass von der Band vor der Show keiner einen Schluck Alkohol trinkt und man dann nur blöd allein mit seiner Flasche Bier herumsteht. Die meisten Bands auf diesem allerhöchsten professionellen Rockniveau lassen niemanden in ihre Garderobe, außer dem Tourmanager, dem Physiotherapeuten und, vielleicht, wenn es sich um eine jüngere Band handelt, dem Drogendealer. Wie ich die Toten Hosen jetzt dort sitzen sah, erschien es aufs Neue unwahrscheinlich, dass sich ausgerechnet diese fünf völlig unterschiedlichen Typen zusammengefunden und sich bis heute nicht zerstritten hatten.
Da saß Michael Breitkopf, genannt Breiti, an diesem Abend neunundvierzig Jahre alt, Rhythmusgitarrist mit dem unerschütterlich coolen Aussehen eines Kabelfernsehtechnikers. Schon seit Stunden hatte er nichts mehr gegessen, weil er sich sonst beim Auftritt träge fühlen würde. Auf den ersten Blick war es schon sehr erstaunlich, dass Breiti sich in diese Band verirrt hat, nur einmal in seinem Leben hat er sich die Haare gefärbt (blond), das war Mitte der achtziger Jahre gewesen, danach nie wieder. Er gilt als der Korrekte, der Analytische. Wann immer man Campino oder Andi nach einer Jahreszahl oder einem Detail aus der Vergangenheit fragt, bekommt man die Antwort: «Keine Ahnung, da musst du Breiti fragen.» Breitis kritische Blicke sind gefürchtet, seine Ernsthaftigkeit irritiert die anderen manchmal. Jahrelang war er fast am Verzweifeln, weil Campino stets zu spät kommt, er glaubt, dass er ein paar Wochen seines Lebens mit Warten auf ihn verschwendet hat; er hat versucht, ihn zu erziehen, aber es inzwischen aufgegeben. Breiti ist die Spezialkraft für die politischen Fragen, die die Band beschäftigen: Unterschriftensammlungen für Pro Asyl, Zusammenarbeit mit Oxfam, Antirassismus-Kampagnen, all das politisch Korrekte, das den Toten Hosen manchmal vorgeworfen wird: Das ist Breitis Welt (und er macht sich viele Gedanken darüber, wie es für eine Rockband möglich ist, sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren, ohne dass es unglaubwürdig, peinlich oder uncool wirkt – was immer eine große Gefahr ist). Aus seiner Tasche schaut gewöhnlich eine Süddeutsche Zeitung heraus. Er ist ein sehr präziser Rhythmusgitarrist, sagen die anderen über ihn, aber mit Schwächen im Chorgesang, und Melodien fallen ihm eher selten ein. In diesem Moment übte Breiti auf der Gitarre noch ein paar Stellen, bei denen er sich heute Abend auf keinen Fall verspielen wollte.
Ihm gegenüber, auf dem Sofa, hatte sich Andreas von Holst niedergelassen, genannt Kuddel, ebenfalls neunundvierzig, Leadgitarrist. Wegen Kuddel hätte sich die Band einmal fast aufgelöst. Er hatte den Überblick verloren über die Mengen Alkohol, die er trank, die Mengen Kokain, die er schnupfte, und die Mengen Fünfmarkstücke, die er in Spielautomaten warf. Ohne Kuddel jedoch wäre es mit der Band nicht weitergegangen: Er ist der einzige prädestinierte Musiker von den fünfen, er sagt, er könne nichts anderes als Musik, er wisse nicht, was aus ihm geworden wäre ohne die Band.
Ein zweites Mal erschütterte er das Gleichgewicht der Band, als er es sich erlaubte, mit siebenundzwanzig Vater zu werden. Da hatte die Band gerade ihr erstes Nummer-1-Album gehabt, man steckte tief im Sog aus Drogen, Verantwortungslosigkeit und Erfolgswahn, und ausgerechnet da wollte einer Vater werden? Heute hat Kuddel zwei erwachsene Kinder, wohnt zurückgezogen in der Eifel, und auf die Finger der linken Hand hat er sich den Namen seiner Frau tätowieren lassen.
Andreas Meurer, genannt Andi, einundfünfzig, Bassist, kam gerade von einem Tischtennismatch zurück in die Garderobe. Er hatte gegen Gerd gespielt, den Busfahrer, die Band geht nie ohne eigene Tischtennisplatte auf Tour. Als die Toten Hosen gegründet wurden, hatte er noch nie ein Instrument in der Hand gehalten. Er nahm sich den Bass, das schien am einfachsten. Von den vier Saiten schraubte er erst einmal zwei ab, da er sie im Verdacht hatte, sich seinen Fähigkeiten in den Weg zu stellen. Es ist nicht unbedingt seine Virtuosität am Instrument, die ihn für die Band unverzichtbar macht: Der Botschafter der Band, der nach außen Campino ist, heißt nach innen Andi. Er ist ihr Verkehrsknotenpunkt, jederzeit ansprechbar für jeden, er kümmert sich um Verträge, Finanzen, Cover, Videos, er hat auf alles ein Auge. Wer wissen will, was sich bei den Toten Hosen gerade tut, sollte Andi fragen. Andi färbt seine Haare immer noch blond-orange und gelt sie nach oben zu Stacheln.
Auf dem Boden in der Garderobe lag Stephen Ritchie, genannt Vom, neunundvierzig. Auf Englisch riss er Witze über die anderen, spielte auf dem iPad das Computerspiel Angry Birds. Vom ist erst 1999 zu den Toten Hosen gestoßen. Er ist ihr dritter Schlagzeuger, hat vorher in ziemlich vielen englischen Punkbands gespielt, aber auch bei den Neo-Glamrockern Doctor & the Medics, mit denen er 1986 den Nummer-1-Hit «Spirit in the Sky» hatte. Als ein volles Mitglied der Toten Hosen ist er aber nicht – anders als die vier Gründungsmitglieder – an den Umsätzen der Band beteiligt, sondern bekommt ein Gehalt. Er ist nah dran, aber eben doch nicht Teil jener verschworenen Gruppe, die die anderen bilden. Den Eigenheiten, die eine solche Gruppe zwangsläufig entwickelt, begegnet Vom mit Spott und Ironie. Er ist nicht besonders groß und nicht besonders kräftig, seine Züge sind weich. Wenn man ihn von weitem sieht, hält man ihn für wesentlich jünger, als er tatsächlich ist.
Campino selbst, in Wirklichkeit Andreas Frege, einundfünfzig, war schon nicht mehr in der Garderobe zu sehen. Er verbringt vor jedem Auftritt viel Zeit beim Physiotherapeuten, lässt sich massieren und macht Aufwärmübungen. Auf ihm lastet die größte Verantwortung. Er ist der Frontmann, nur er. Es gibt Bands, die haben mehrere Frontmänner, die Beatles hatten vier, die Stones haben immerhin zwei, die Toten Hosen haben Campino. Er muss fast drei Stunden über die Bühne sprinten und dabei schreien. Wenn ihm die Stimme wegbricht, wird Kuddel einspringen; wenn ihm die Kraft, die Laune oder die Inspiration wegbrechen, wird man das merken. Deswegen verzeihen ihm die anderen, wenn er mal launisch, unzuverlässig, ungeduldig oder verletzend ist. Auf diese Tournee hatte Campino sich monatelang mit mehreren Stunden Sport am Tag vorbereitet.
Der englische Konzertfilmregisseur Paul Dugdale war für das Wochenende mit zwanzig Kameraleuten aus London angereist und sollte die beiden letzten Auftritte filmen. Sonst arbeitet Dugdale für Coldplay und die Rolling Stones, die er bei ihrem Hyde-Park-Konzert 2013 erstaunlich vital hat wirken lassen. Das hatte Campino Hoffnung gegeben. Wenn Dugdale selbst die auf die achtzig zugehenden Stones hatte spritzig aussehen lassen, dann würde ihm das ja vielleicht auch mit einem verletzten Campino gelingen. Seit Wochen machte sich Campino Gedanken: Was ist, wenn das Knie durchknallt? Es war geschwollen. Die Achillessehne angerissen. Die Stimmbänder eh immer am Anschlag. Er hatte versucht, den Filmemacher zu überreden, ihn schon am ersten Abend komplett abzufilmen, dann hätte man die Bilder im Kasten, falls das Knie nicht hielt. Aber das ging nicht.
Also hatte Florian Cordes, der Physiotherapeut der Band, seit Jahren auf jeder Tour dabei, das Quick-Change-Zelt, in dem man sich während der Auftritte umkleiden, abtrocknen und erfrischen konnte, in ein halbes Lazarett verwandelt, um im Notfall Erste Hilfe leisten zu können. Eine Trage war aufgebaut, Verbände und Schmerzmittel waren bereitgestellt. Auch Peter Schäferhoff, Mannschaftsarzt des 1. FC Köln und der Kölner Haie, war hinter der Bühne zu sehen. Er hatte Campino schon mehrmals operiert, und er würde ihn bald wieder operieren müssen.
Auch die komplette Mannschaft von Fortuna Düsseldorf war erschienen, aus dem Gewusel der Menschen hier hinter der Bühne stachen sie in ihren Profifußballer-Outfits hervor. Wie immer hatten die Toten Hosen die Spieler eingeladen. Sie sind Familie. Und nie hört sich «Tage wie diese» in einem Fußballstadion richtiger an als bei ihrem Club, den die Toten Hosen in einer Mischung aus Treue und Verbohrtheit seit Jahrzehnten unterstützen (von 2001 bis 2003 trugen die Spieler sogar das Bandemblem, einen Totenkopf, auf ihren Trikots, nachdem die Toten Hosen den Verein durch eine Finanzspritze von einer Million Mark vor dem Konkurs gerettet hatten). Am Vorabend des entscheidenden Relegationsspiels im Mai 2012 war die Band sogar zu den Spielern ins Hotel gefahren und hatte dort nur für sie «Tage wie diese» gespielt. Am nächsten Tag gewann Düsseldorf gegen Hertha BSC, stieg in die Bundesliga auf, und die Spieler sangen das Tote-Hosen-Lied die ganze Nacht.
In der Garderobe stand auch Kiki Ressler, neunundvierzig Jahre alt, an dessen Hals sich furchterregende Tätowierungen hochwinden, und redete, wie so oft, vom Theater, von Herbert Fritschs grandios inszeniertem Stück Murmel Murmel in der Berliner Volksbühne. Ressler, ein ehemaliger Punk, der mit sechzehn von zu Hause in Ostwestfalen ausriss und im Berliner Club SO36 bei einem der ersten Tote-Hosen-Konzerte überhaupt an der Kasse saß, leitet heute die Veranstaltungsfirma, genannt Kikis Kleiner Tourneeservice.
Durch die Gänge rannte, ein Walkie-Talkie in der Hand, Patrick Orth, Geschäftsführer von Jochens Kleiner Plattenfirma, der Mann, der sich bei den Toten Hosen ums Tagesgeschäft kümmert, obwohl er mit seinem rasierten Schädel und dem langen ZZ-Top-Bart eher aussieht wie der Manager einer kalifornischen Hardcore-Band. Von Patrick ist zu lernen, wie viele unsichtbare Probleme es bei einer solchen Rockgiganten-Operation gibt, Probleme, die es von der Band fernzuhalten gilt.
Und am Ende eines Gangs, vertieft in ein Gespräch mit dem gerade neu ernannten WDR-Intendanten Tom Buhrow, lehnte, das Rauchverbot im Stadion lustvoll ignorierend, Jochen Hülder, sechsundfünfzig, Spiritus Rector und Manager der Band, der mit einer Mischung aus Spinnerei, Chuzpe und solidem Ruhrgebiets-Entrepreneurship die Band in den Anfangsjahren wirtschaftlich über Wasser gehalten, auf Kurs gebracht und schließlich hochprofitabel gemacht hat. In Düsseldorf wirkte es zeitweise so, als hätte Hülder seine Finger überall drin: Clubs, Restaurants, Stadtzeitschriften oder selbst wenn es darum ging, eine Plakatierungsfirma ins Leben zu rufen. Wahrscheinlich ist das der Grund dafür, dass man in der deutschen Musikindustrie immer wieder auf Leute trifft, die bei der Nennung des Namens Hülder entweder ehrfürchtig erstarren oder einen schmerzvollen Gesichtsausdruck bekommen. Wie den vier Gründungsmitgliedern gehört ihm ein Fünftel des Geschäfts an den Toten Hosen.
An diesem Abend kam noch etwas zu der normalen Betriebsamkeit hinzu, eine merkwürdige Mischung aus Glückseligkeit und Erleichterung, aber auch eine gewisse Trauer. An diesem Abend endeten offiziell die letzten anderthalb Jahre, die vielleicht unglaublichsten der Bandgeschichte: Nummer-1-Album, Nummer-1-Single, und jetzt warteten da draußen 45300 Menschen. Die letzten anderthalb Jahre hatten der Band wieder eine Perspektive gegeben; nachdem schon eine Exit-Strategie in der Schublade gelegen hatte, wie sie sich Schritt für Schritt würdig würde zurückziehen können, war jetzt vorstellbar, dass man das hier vielleicht doch machen kann, bis man sechzig ist.
Erleichterung deshalb, weil man die Tour geschafft, sie körperlich durchgestanden hatte. Man würde wieder Zeit haben, die Kinder zu sehen, zum Arzt zu gehen, die Waschmaschine reparieren zu lassen.
Andererseits Abschiedsschmerz und all das, was immer auch Angst macht: Die ersten Tage nach einer Tour sind komisch. Das Rockstar-Ich schrumpft und schrumpft, und nach einigen Wochen geht man zum Milchholen in Düsseldorf-Derendorf und kann sich unmöglich noch vorstellen, wie man das gemacht hat: Rockstar sein. «Ich wüsste jetzt nicht mehr, wie das geht, da rauszugehen auf so eine Bühne. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe», sagte Campino drei Monate nach jenem Abend, als wir inmitten eines Haufens frisch gewaschener, ungefalteter Wäsche müde bei ihm im Wohnzimmer saßen und mit einem Glas Rotwein einen Roger-Moore-James-Bond guckten.
Ein paar Minuten vor dem Auftritt beginnt ein merkwürdiges Ritual. Andi, Breiti, Campino, Kuddel und Vom laufen gebückt hintereinander im Kreis, hauen ihrem Vordermann auf die Schulter. Dann macht die Schlange halt. Andi raunt ein, zwei Sätze mit seiner tiefen Stimme, es wird durchgezählt, jeder flüstert eine Nummer, man versteht sie kaum. Plötzlich ein lautes «Hey!». Wieder von vorn. Da toben 45000 im Stadion, warten auf die Hosen – und die vollführen ein Stammesritual?
Draußen läuft schon «You’ll Never Walk Alone», die Liverpool-Hymne, danach kommt das Intro für das Konzert, eine Minute noch.
Andi, Breiti, Campino, Kuddel und Vom stehen hinter dem Vorhang, lauschen: Wie ist die Stimmung? Singen alle mit? Die Toten Hosen lassen ihre Fans nicht warten, sie beginnen immer um Punkt neun mit ihrem Konzert, sie sind eine pünktliche Band. Auch wichtig: auf die Bühne rennen, nicht schlendern.
Dann läuft Breiti los.
Er kann die 45000 schon sehen. Jubelgeschrei wie ein Düsenjet. Bloß nicht nachdenken. Die ersten Akkorde von «Ballast der Republik». Das Adrenalin strömt aus, alles läuft schneller, man registriert jedes Detail im Publikum. Wie sind die Leute drauf, wie kommt der Sound an, wie ist er auf der Bühne? Passen Gefühl, Bewegung und Spiel zusammen, stimmt das Tuning von der Gitarre? Gleich auf die Akzente in der Strophe von «Ballast der Republik» achten, alles muss auf dem Punkt sitzen.
Aber Kuddel – was macht Kuddel da? Er steht noch immer hinter der Bühne, Rory, sein Gitarrenroadie, hat ihm gerade die Gibson Les Paul umgehängt. Renn los, Alter! Kuddel bleibt jedoch unbeweglich stehen. Er schließt die Augen. Wird ihm schummrig? Zehn Sekunden, zwanzig Sekunden, komm! Er atmet langsam ein und aus, in seinem Kopf spielt er den Gig an. Jetzt. Vom, die Haare rot und schwarz, hinter seinem Schlagzeug, sieht aus wie ein Derwisch. Seine Arme fliegen hoch und runter, als zöge sie ein Puppenspieler an Fäden.
Niemand beherrscht es wie Andi Meurer, mit seinem Instrument, den Fuß aufstampfend, quer über die Bühne zu fegen, vielleicht wird er sich später wieder, das Instrument in die Luft haltend, rücklings ins Publikum werfen.
Campino kommt als Letzter. Er sprintet förmlich in die ersten Akkorde hinein, versucht, irgendetwas da draußen zu fokussieren, Freude über die lachenden Gesichter. Gesichter, so weit er sehen kann. Jetzt versuchen, schon beim Laufen voll durchzuziehen, alles zu geben. Von A bis Z. Wo ist der Blechhase? Er denkt an ein Windhundrennen. Wenn der Blechhase auf seiner Schiene rausschießt, die Schranke hochgeht und die Hunde hinterherhetzen. Wie sie möchte er sein.
Das erste Stück ist geschafft. In Breitis Kopf herrscht immer noch Terror: der Anfang von «Altes Fieber». Alle Arme oben, ein unglaubliches Bild, kalt läuft es einem den Rücken herunter, nicht ablenken lassen, die Töne in der Strophe sauber treffen, nicht zu laut, nicht zu leise, möglichst gleichmäßig. Bin ich fit? Bin ich heiser? Was macht die Narbe vom Muskelfaserriss, ist der rechte Unterarm noch überanstrengt, oder werde ich die schnellen Achtel bei «Bonnie & Clyde» locker spielen können? Machen die Leute auf den Rängen schon mit, der dicke Typ da vorne, ist der aggro oder einfach nur gut drauf?
Eine Show der Toten Hosen handelt, Abend für Abend, von der totalen körperlichen Verausgabung und von der Freude und Energie, die dadurch entstehen. Sie handelt davon, der Gleichförmigkeit des Lebens mit schierer Wucht entgegenzutreten. Sie ist eine Lektion in Hundertprozentigkeit und eine Ächtung der Halbherzigkeit.
Es gibt Leute, die sich heute erinnern, wie vor fünfundzwanzig Jahren, als die Toten Hosen nicht mehr als fünf Nicht-Musiker mit einer Idee und ungeheurer Vitalität waren, Campino in Düsseldorf herumlief und überzeugt gewesen sei, sie würden die größte und lauteste deutsche Rockband werden.
Campino sagt, er könne sich daran nicht erinnern, er hält es sogar für ausgeschlossen, das je geglaubt zu haben. Im Nachhinein denken sich Menschen oft alles Mögliche aus, nur weil es eine schöne Erzählung ergibt.
Aber Erinnerungen sind, auch darum wird es in diesem Buch gehen, nur bedingt zuverlässig. Der norwegische Schriftsteller Karl-Ove Knausgaard schreibt in seinem gerade erschienenen gigantischen Erinnerungswerk Leben, das Gedächtnis sei «keine verlässliche Größe im Leben, aus dem einfachen Grund, dass für das Gedächtnis nicht die Wahrheit am wichtigsten ist».
Was immer Campino damals geglaubt hat – Tatsache ist, die Toten Hosen wurden die größte deutsche Rockband. Und sie haben das Gefühl, dass sie das verpflichtet.
So ist die Show ein Versprechen, dass sich fünf Männer durch Selbstüberwindung und Disziplin knapp drei Stunden lang für jeden einzelnen Zuschauer zerreißen. Die Zuschauer erwarten das auch. Sie danken es der Band mit Verehrung.
Die Toten Hosen haben für diese Abende bis zum letzten Moment geübt. Noch nachmittags, beim Soundcheck, studierten sie Übergänge zwischen den Liedern ein, und vor dem Auftritt, beim Warmspielen, hatten sie sich Stücke vorgenommen, die am Abend vorher nicht so gut geklappt hatten. Sie spielten sie wieder und wieder.
Immer noch irritiert es Vom Ritchie, wie oft und ausgiebig diese Deutschen üben. Muss man wirklich zwanzig Jahre lang jeden Tag «Hier kommt Alex» einstudieren, damit man es nicht vergisst?
Ja, muss man. Okay, vielleicht nicht jeden Tag.
Es gehe darum, haben die deutschen Mitmusiker ihrem englischen Schlagzeuger erklärt, das Beste, das absolut Beste abzuliefern.
Die Band spürt eine Verantwortung. Nicht nur an diesem einen Abend alles richtig zu machen, sondern auch an jedem anderen Tag. Das richtige politische Engagement in der richtigen Dosis auf der richtigen Plattform (für Zuwanderung, gegen Rassismus, gegen Nazis, für gerechtere Güterverteilung), die richtigen öffentlichen Auftritte (in diesem Jahr, nach langer Diskussion, Wetten, dass..?, sonst eher alles absagen), die richtigen Konzertpreise (34 Euro, obwohl man sicher wie andere Bands dieser Größe 64 Euro nehmen könnte) – und natürlich wünschen sie sich auch die richtigen Fans. Und da war wieder das Problem. Wie vermittelt man den Fans aus den Anfangsjahren, dass sich zwischenzeitlich auch Menschen für die Toten Hosen begeistern, mit denen man keine Gemeinsamkeiten haben möchte? Wie zum Beispiel Helene Fischer, die auf ihren Konzerten «Tage wie diese» singt, übrigens eine interessante Umkehrung der Verhältnisse: Früher haben die Punkbands Schlagersänger gecovert und damit verärgert. Heute covern Schlagersänger, siehe Heino, schamlos die ehemaligen Punkbands, die sich dagegen genauso hilflos zu wehren versuchen wie seinerzeit die Schlagersänger.
Popmusik, seit sie Mitte der fünfziger Jahre mit Chuck Berrys Song «Maybellene» begann, funktionierte am besten, wenn sie ein Gegenüber, einen Gegner hatte, an den sie sich wenden konnte: die Eltern, die Hausbauer, später die Hippies, die Rockstars selbst, die Regierenden, die Beflissenen, die zu Authentischen, die zu Künstlichen und so weiter. Heute ist dieses Gegenüber weitgehend verlorengegangen. Fünfundvierzig Jahre nach Achtundsechzig hört jeder irgendwie alles.
Das ermöglichte den Toten Hosen einerseits ihren Erfolg, andererseits ist es eine Herausforderung an die eigene Identität. Auch wenn sie sich allmählich als Rockstars akzeptieren, ist die Band in ihrem Kern ein weltanschauliches Projekt geblieben, entstanden aus Liebe zur Musik, aus Lust und dem Willen, etwas Neues auf die Beine zu stellen, aus Verwunderung darüber, dass es seltsamerweise klappt, ohne musikalische Kenntnisse eine Gruppe zusammenzuhalten. Aber die Idee wurde auch geboren aus Unbehagen und Unverständnis, Spott, vielleicht sogar aus Wut über die westdeutsche Kleinbürgerlichkeit, Kleinheit, Provinzialität, Stille und Ängstlichkeit, unter der die Bandmitglieder aufwuchsen – ein Gefühl, für das diese drei Buchstaben C-D-U die stärkste und platteste Metapher waren.
Die vier Originalmitglieder der Toten Hosen wurden in den frühen sechziger Jahren geboren, Campino und Andi 1962, Kuddel und Breiti 1964. Letztere wohnten mitten in Düsseldorf, Andi und Campino in einem Vorort. Ihre Väter waren im Krieg gewesen, gründeten Familien und bauten nebenbei die neue Bundesrepublik mit auf; sie wurden Richter (Campino), Anzeigenleiter bei Axel Springer (Andi) oder Justiziar bei einer Versicherung (Kuddel).
Es waren Väter, die sich, nachdem sie ihre jungen Jahre an Fronten und in Gefangenschaft verbracht hatten, Ruhe, Überschaubarkeit und Disziplin wünschten. Das wollten ihre Söhne eher nicht. Sie begannen, ihren Eltern Chaos, Exzess und Lautstärke vorzuleben. Und formten daraus eine Band.
Das ist die Grund-DNA der Toten Hosen, die sie bis heute und trotz aller Lebensstil-Anpassungen nicht aufgegeben haben. Am Wahlabend des Jahres 2013 waren sie für einen Moment wieder da, von wo aus sie gut dreißig Jahre zuvor aus ihren Elternhäusern aufgebrochen waren, bei diesen drei Buchstaben: C-D-U.
Deswegen sprach Andi davon, dass man das nicht gut fand, Kuddel von einem hässlichen Spiegel und Campino vom Gegenfeuer, das sofort kommen musste.
Vorgärten
BREITI: Ich glaube, bei uns ist keiner zu Hause damit totgeschmissen worden, wie man seine Gefühle ausdrückt und so. Allein die Art, wie ich das jetzt wieder sage, leicht ironisch, deutet ja schon darauf hin. Und das ist bei uns allen anscheinend so. Frag Campino, was bei dem zu Hause los war. Frag Andi, was bei dem zu Hause los war. Ich jedenfalls bin von Gefühlen nicht erdrückt worden.
CAMPINO: Das war ein Sonntagmorgen. Ich hatte Musik angemacht und meine Anlage – ich hatte inzwischen eine eigene Anlage durch Ferienarbeit erspart – voll aufgedreht und ging erst mal duschen. Mein Vater kam in das Zimmer und sah, dass ich nicht drin war, regte sich über den Krach auf und zog den Stecker raus. Da ist bei mir eine Sicherung rausgeflogen. Ich schrie: «Ey, bist du bescheuert? Die Platte! Wenn die kaputt ist!» Daraufhin hat sich eine Rangelei ergeben. Wir haben uns geschubst. Dabei ist die Duschraumtür rausgeflogen. Und er rief: «Mein Sohn hat mich geschlagen! Aus dem Haus!» Da musste ich das Haus verlassen.
ANDI: Mein Vater kam nach fünf Jahren Gefangenschaft aus dem Krieg nach Hause. Aus seiner Sicht bauten er und seine Generation dieses Land auf. Sie sorgten dafür, dass es nach vorne ging. Und sicherten den Kindern eine Zukunft. In seinen Augen habe ich ihm natürlich gesagt: Das ist mir alles scheißegal.
KUDDEL: Meine Eltern waren nicht begeistert, dass ich mit der Schule aufgehört habe. Aber andererseits haben sie auch eingesehen, dass es keinen Sinn mehr hatte.
Andreas Meurer, der Bassspieler, war am Morgen bei seiner Mutter in der Betreuungseinrichtung gewesen, nun, als er die Tür zu seinem Haus in der Düsseldorfer Innenstadt öffnet, hält er einen vergilbten, angerissenen Zettel in der Hand, den er mir reicht. Es ist ein Dokument der Kriegsgefangenschaft seines Vaters, ausgestellt von den Alliierten.
Helmuth Meurer, Nowosibirsk, 1944 bis 1949, Sibirien.
Auf der Karte findet sich der Vermerk: «Nicht NSDAP».
Andi wusste, dass sein Vater nicht in der Partei der Nationalsozialisten war, doch es sei gut, sagt er, das hier noch einmal so zu lesen.
Ich frage ihn, ob er sich das vorstellen könne: Sein Vater, ein junger Mann, der mit dreiundzwanzig nach fünf Jahren Gefangenschaft aus Sibirien zurückkehrt?
Andi blickt zu Boden.
«Der hat da wenig drüber erzählt, wie so viele. Manchmal, manchmal hat er erzählt aus dem Lager und wie er dort, dadurch dass er ganz gut Russisch konnte, zuständig dafür war, das Brot abzuholen. Da warst du ja schon höhergestellt, irgendwie.»
Es ist einer der müden Tage Anfang 2014. Das vorerst letzte Konzert der Toten Hosen liegt drei Monate zurück, richtig erholt hat Andi sich noch nicht. Im Moment ist Bandpause, und bald sollte man vielleicht über eine neue Platte nachdenken, wovor jeder von ihnen spürbar Respekt hat.
Nach anderthalb Jahren, in denen man seine Abende regelmäßig vor den Augen und Händen und mit dem Jubelgeschrei von 12000, 15000, manchmal auch 45000 Menschen verbracht hat, kann so ein Morgen daheim in Düsseldorf zäh sein.
Nicht, dass es nichts zu tun gäbe. Im Maschinenraum der Toten Hosen rattert es auch, wenn der Dampfer im Hafen liegt. So muss der bei den Abschlusskonzerten gedrehte Film des Engländers Paul Dugdale fertiggestellt werden, und Andi ist dafür zuständig, weil er, der Kunst- und Architekturfan, innerhalb der Band die AG Video/Film/Cover leitet. Seinetwegen hatten die letzten beiden Singles der Toten Hosen Coverbilder von dem Fotografen Andreas Gursky, einem engen Freund der Band, und dem Maler Gerhard Richter, der, zweiundachtzigjährig, sofort bereit war, sein Gemälde «Seestück (See-See)» zur Verfügung zu stellen.
Andi fährt in diesen Tagen im Sommer 2014 häufig zu seiner Mutter ins Betreuungsheim nach Mettmann, einer Kreisstadt vor den Toren Düsseldorfs, wo er und Campino aufgewachsen sind. Die beiden haben sich im Hockeyclub kennengelernt, als sie vierzehn waren.
Von da an waren sie zu zweit im Kampf gegen das Vorstadt-Deutschland, wobei Campino einen entscheidenden Vorteil hatte: Er ging in Düsseldorf zur Schule, weil Campinos Vater die Lehrer am Mettmanner Konrad-Heresbach-Gymnasium für Kommunisten hielt. Er hatte gehört, dass dort im Unterricht Texte von Ulrike Meinhof gelesen würden.
Helmuth Meurer mochte den neuen Freund seines Sohnes zunächst, der aus gutem Hause stammte, aus Metzkausen, dem besseren Teil von Mettmann auf der anderen Seite der B 7. Kaum zu glauben, dass der Vater dieses vorlauten Jungen, der wie sein Sohn Andreas hieß, Richter war. Ziemlich bald erteilte er ihm jedoch lebenslanges Hausverbot: Helmuth Meurer kam eines Nachmittags nach Hause, er arbeitete beim Verlag Axel Springer, wo er sich für Nordrhein-Westfalen um den Anzeigenverkauf der damals superkonservativen Welt kümmerte. An der Haustür traf er auf seinen Sohn Andi. Der, ohnehin immer sehr blass, hatte sich die Haare pechschwarz gefärbt und ließ sie gen Himmel streben. Er sah aus wie eine Wasserleiche. Helmuth Meurer begann laut auf seinen Sohn einzureden. Andi schrie zurück, und was machte da der neue Freund, der andere Andreas? Versuchte, sich zusammenzureißen, und platzte dann doch mit ungeheuerlichem Gelächter heraus. Das reichte.
Dieser Andreas dürfe sein Haus nie wieder betreten, bestimmte Helmuth Meurer, und sein Sohn antwortete, dann betrete er dieses auch nicht mehr. Andi zog am selben Abend aus, um die Ecke zu Horst Zimpel, einem Freund, dessen Vater auf Weltreise war.
Zwei Wochen später kehrte Andi zu seinen Eltern zurück, doch das Hausverbot für den Freund blieb bestehen. Erst an Helmuth Meurers sechzigstem Geburtstag, als der andere Andreas längst Campino hieß, Sänger in der Band seines Sohnes war und diese auf seinem Geburtstagsfest spielte, versöhnten sie sich, und Helmuth Meurer hob das Hausverbot auf.
«Wahrscheinlich muss man es so betrachten», sagt Andi. «In dem Alter, in dem ich mir die Haare färbte, ist mein Vater in den Zweiten Weltkrieg gezogen.»
In den Gesprächen für dieses Buch, in Gesprächen über die Band und ihre Voraussetzungen, über Brüche, Erfolge und Niederlagen, tauchte irgendwann die Frage auf, wie sich die Perspektive der Eltern auf die Welt in dem Werk und Auftreten der Toten Hosen spiegeln. Wie sehr das, wofür die Toten Hosen seit gut dreißig Jahren stehen, zusammenhängt mit den Lebensentwürfen der Kriegs-, Nachkriegs- und Aufbaugeneration. Wie sich die Linien der deutschen Geschichte im Schaffen der Band wiederfinden. Kurz, es ging um die Frage, wie zwangsläufig deutsch das Projekt «Die Toten Hosen» ist. Als ich Campino am nächsten Tag mit dieser Frage konfrontiere, ist er nicht begeistert: «Deutsch, ich weiß nicht.»
Ich bitte ihn und Andi Meurer, mit mir nach Mettmann zu fahren.
Mettmann liegt fünfzehn Kilometer östlich von Düsseldorf, dazwischen befindet sich das Neandertal. Wir kurven in Campinos kleinem Dieselauto durch die Felder. Frühlingswetter. Kaum einer ist unterwegs, niemand nimmt uns wahr.
Ein unauffälligeres, egaleres Auto als das des Sängers der Toten Hosen kann man nicht fahren, abgesehen von dem Wappen des Liverpool FC auf der Heckscheibe mit dem «Liver Bird», einer Kreuzung aus Adler und Kormoran.
Das Radio ist leise gedreht, die Fenster offen, Campino fährt, und Andi, der hinten auf der Rückbank sitzt, hört nicht auf, Erstaunliches über das Neandertal zu erzählen, wo nicht nur der Urmensch gelebt habe, sondern auch die Düsseldorfer ihre Wochenenden verbrachten, als es hier noch Kalkstollen gab. Inzwischen sind die meisten abgetragen, und auch Mettmann hat den Glanz der frühen Sechziger verloren, als überall Aufbruchsstimmung herrschte.
Wobei wir, sagt Campino, wenn wir von Mettmann reden, eigentlich Metzkausen meinen. Metzkausen sei der Vorort derjenigen, die es nach dem Krieg zu etwas Wohlstand gebracht haben.
Andi wohnte an der Grenze zu Metzkausen, in einem weißen Reihenendbungalow, Sechziger-Jahre-Moderne, ein Haus, das zum Ausdruck brachte: «Wir wollen es anders machen.» Bescheiden, transparent, funktional. Helmuth Meurer hatte es gebaut. Andi erinnert sich, wie der Bauträger pleiteging und sich mit dem Geld der Meurers davonmachte. Sein Vater habe sich dann mit Nachbarn zusammengetan, die ein ähnliches Schicksal erlebten, gemeinsam wurden die Häuser fertiggestellt. So sei das damals gewesen.
Wenn man sich die Siedlung heute anschaut, wirkt sie wie ein Denkmal. Das Flachgeduckte und Vorortige dieser Wirtschaftswunder-Häuser, Bauwerke aus einer Zeit, als sich Deutschland neu erfand, scheint wie die Demutsgeste eines Landes, das den Größenwahn des Dritten Reichs zumindest äußerlich gern ungeschehen gemacht hätte. Der Historiker Golo Mann notierte in den späten fünfziger Jahren: «Von Dostojewski wird erzählt, er hätte nie besser gearbeitet als nach seinen Orgien am Spieltisch oder seinen epileptischen Anfällen. Von den Deutschen gilt Ähnliches: Sie arbeiteten wirtschaftlich nie erfolgreicher als nach ihren Kriegen und bei weitem am erfolgreichsten nach Hitlers Krieg.» Während die Arbeitersiedlungen von Duisburg-Rheinhausen oder Gelsenkirchen-Buer den Motor der neuen Bundesrepublik bildeten, wo geschweißt, gedengelt, gebohrt und malocht wurde, zählte Metzkausen zu jenen Orten, in denen eine neue Zivilgesellschaft entstand. Beamte, Angestellte des öffentlichen Diensts, Ärzte, Bürokraten – sie gehörten zur Keimzelle eines Staats, der die Provinzstadt Bonn zur Hauptstadt machte; ein Staat, der darüber diskutierte, ob er je wieder Streitkräfte haben sollte. Ein von den Alliierten kontrolliertes Land, das nicht die Kraft oder den Willen besaß, die alten Nazis aus den Ämtern zu jagen; ein Land, dessen Selbstbewusstsein gegen null ging und dessen Protagonisten als Soldaten, Flakhelfer, Flüchtlinge oder Kriegsgefangene vermutlich Furchtbares erlebt hatten, über das sie in der Regel mit niemandem sprachen. Erst später, als diese erste Generation der Bundesrepublik alt wurde, stellte sich heraus, dass die verweigerte Auseinandersetzung mit dem Erlebten nicht nur die eigene Seele beschädigt hatte, sondern manchmal auch die ihrer Kinder. Dabei ging es in den wenigsten Fällen um Scham und Schuld, dafür waren diese meist in den zwanziger Jahren geborenen Eltern zu jung. Es ging um die Auseinandersetzung mit dem Erlittenen, in der Gefangenschaft, bei Vergewaltigungen, bei anderen Demütigungen des Kriegsverlierers – und es ging um die Gewissheit, an dieser Katastrophe mit Namen Zweiter Weltkrieg Anteil zu haben. Zurückgucken: besser nicht, in der Vergangenheit könnte das Böse und Schmerzhafte lauern. Lieber nach vorn blicken, immer weiter nach vorn, Lebenswege anschieben, Aufbauarbeit leisten, Kinder zeugen. Leise sollte dieses Land sein, freundlich, harmlos. Es sollte schön anzusehende Vorgärten haben.
Und während wir durch die Straßen mit den Reihenbungalows fahren, wird mir schlagartig klar, dass die Idylle irgendwann eine Abwehrbewegung hervorbringen musste – gegen das Vorgartige, gegen das Gefühl- und Sprachlose, gegen das Heimelige, Geordnete, Bescheidene, das entstanden war. Und genau diese Abwehrbewegung macht den Kern der Toten Hosen aus. Auch wenn Breiti und Kuddel direkt aus Düsseldorf kommen: Gegen dieses Mettmann, dieses Wiederaufbau-Deutschland, das man heute noch sehen kann, gegen den hier herrschenden Willen, alles richtig zu machen, gegen die demonstrative Bescheidenheit – ich bin mehr und mehr überzeugt, dass gegen all dies zu sein bis heute im Werk der Toten Hosen zu finden ist.
Nur fünf Minuten weiter, auf der anderen Seite der B 7, in Metzkausen, wo sogar ein paar richtige Villen stehen, befand sich das Haus der Familie Frege mit ihren sechs Kindern.
Ein paar hundert Meter bevor wir es erreichen, hält Campino das Auto an. In einem Hauseingang hat er eine ältere Frau entdeckt, die er kennt und begrüßen möchte. Er springt aus dem Auto, bewegt sich im Laufschritt die Einfahrt hoch, der Frau entgegen. Andi und ich bleiben im Wagen sitzen, beobachten, wie sie stutzt. «Ach! Andreas! Äh, Campino! Ich darf doch Andreas sagen?» Campino sagt, klar, zögert ein wenig, küsst schließlich die alte Dame etwas unbeholfen auf beide Wangen. Sie unterhalten sich kurz, dann kommt Campino zurück und sagt zu Andi: «Das war die Mutter von Markus. Kennst du den noch? Das war mein Sandkastenfreund.» Andi nickt.