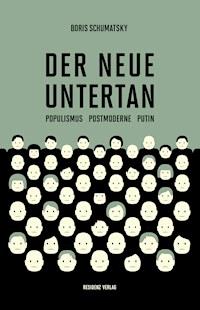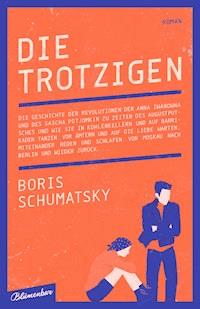
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Beginn einer neuen Zeit. Ein ganzes Land zwischen Revolution und Konterrevolution. In Berlin und in Moskau wird die Welt neu geordnet. Mittendrin Anna und Sascha: ein junges Paar, das seiner Liebe nicht traut. Es ist kompliziert, denn Wirklichkeit und Täuschung sind schwer zu unterscheiden, vor allem in Zeiten des Aufruhrs. »Die Trotzigen« ist ein großes Epos und eine sehr moderne Liebesgeschichte, mit außergewöhnlichem Blick fürs Detail und das große Ganze. So wurde der Fall des Eisernen Vorhanges noch nicht erzählt. Moskau, August 1991. Alexander »Sascha« Potjomkin wird durch das Klingeln des Telefons geweckt. Es ist seine Mutter, die ihm erklärt, dass die Welt, wie er sie kennt, nicht mehr existiert. Vor Saschas Fenster rollen Panzer über den Leninprospekt. Er ist Dolmetscher und sieht sein Heil in der Flucht nach Berlin. Für Saschas bayerische Freundin Anna Iwanowna hingegen ist das Moskau im Umsturz die freieste Stadt der Welt. Nach einer gemeinsamen Nacht, verlässt sie ihn, und Sascha macht sich mit seinem Kumpel Denis auf nach Berlin. Doch dort ist die große Freiheit, von der in Moskau noch alle träumen, längst passé. Zwei Jahre später, als wieder ein Putsch Moskau erschüttert, begegnen sie sich erneut, und Anna macht eine unerwartete Entdeckung. Langsam reift in ihnen die Einsicht, dass ihnen niemand die Last abnehmen kann, selbst zu entscheiden, wie sie leben wollen. Mit Schumatsky ist es nie langweilig. Er hat in einem Buch mehr zu sagen, als der ganze russische Schriftstellerverband in den letzten zwanzig Jahren. Ich habe es in einer Nacht verschlungen. Wladimir Kaminer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Der Beginn einer neuen Zeit. Ein ganzes Land zwischen Revolution und Konterrevolution. In Berlin und in Moskau wird die Welt neu geordnet. Mittendrin Anna und Sascha: ein junges Paar, das seiner Liebe nicht traut. Es ist kompliziert, denn Wirklichkeit und Täuschung sind schwer zu unterscheiden, vor allem in Zeiten des Aufruhrs.
»Die Trotzigen« ist ein großes Epos und eine sehr moderne Liebesgeschichte, mit außergewöhnlichem Blick fürs Detail und das große Ganze. So wurde der Fall des Eisernen Vorhanges noch nicht erzählt.
Mit Schumatsky ist es nie langweilig. Er hat in einem Buch mehr zu sagen, als der ganze russische Schriftstellerverband in den letzten zwanzig Jahren. Ich habe es in einer Nacht verschlungen. Wladimir Kaminer
Moskau, August 1991. Alexander »Sascha« Potjomkin wird durch das Klingeln des Telefons geweckt. Es ist seine Mutter, die ihm erklärt, dass die Welt, wie er sie kennt, nicht mehr existiert. Vor Saschas Fenster rollen Panzer über den Leninprospekt. Er ist Dolmetscher und sieht sein Heil in der Flucht nach Berlin. Für Saschas bayerische Freundin Anna Iwanowna hingegen ist das Moskau im Umsturz die freieste Stadt der Welt.
Nach einer gemeinsamen Nacht, verlässt sie ihn, und Sascha macht sich mit seinem Kumpel Denis auf nach Berlin. Doch dort ist die große Freiheit, von der in Moskau noch alle träumen, längst passé. Zwei Jahre später, als wieder ein Putsch Moskau erschüttert, begegnen sie sich erneut, und Anna macht eine unerwartete Entdeckung. Langsam reift in ihnen die Einsicht, dass ihnen niemand die Last abnehmen kann, selbst zu entscheiden, wie sie leben wollen.
Boris Schumatsky
Die Trotzigen
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
I. Der Antrag
----- Das Telefon gewährleistet nicht die Vertraulichkeit des Gesprächs -----
----- Die Partisanin -----
----- News Pub. Der Nataschismus mit menschlichem Gesicht -----
----- Was passiert, wenn man in Moskau einen Mercedesstern abbricht -----
II. Ein Putsch, und alle gehen hin
----- In weiblicher Handschrift -----
----- No Pasarán -----
----- Putana -----
----- Spazierfahrt mit einem BTR-60-Schützenpanzer -----
III. Wunderbare Anarchie
----- Der Judenpass: Abhärtungstraining für Zuwanderer -----
----- Die DDR-Babys -----
----- Homosexualitätstest -----
----- Kakerlaken im Kopf -----
----- Freiheit für Foucault -----
----- Betreten des Kohlenkellers auf eigene Gefahr -----
IV. Die Hochzeit
----- Zu wenig zum Sterben -----
----- News Pub. Vieles wiederholt sich, aber nicht immer als Farce -----
----- Angriff der Rotbraunen -----
----- Barbie auf den Barrikaden -----
----- So enden die russischen Leidenschaften -----
----- Das Weisse Haus brennt -----
Danksagung
Über Boris Schumatsky
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Für I.
I.Der Antrag
----- Das Telefon gewährleistet nicht die Vertraulichkeit des Gesprächs -----
»Dieser Apparat steht hier seit dem Krieg«, sagt die Inspektorin mit violetter Dauerwelle, »niemand kam je daran vorbei.« Sascha liegt festgeschnallt in einem Untersuchungssessel, nasse Saugnäpfe kleben an seinen Schläfen, Kabel laufen zum Messgerät. Er muss einen Homosexualitätstest machen. Anna Iwanowna beugt sich über ihn, die rosa Lippen leicht geöffnet, ihr Atem ist heiß. »Nein«, will er noch sagen, »ihr kriegt mich nicht«, doch ein grüner Punkt blinkt bereits auf dem Monitor, das Papierband kriecht aus dem Kurvenschreiber, und eine Krankenschwester erklärt: »Fertig. Kann losgehn.« Von Anna Iwanowna ist jetzt nur noch der Kopf zu sehen, aber es ist nicht ihr Kopf, sondern eine Glatze mit Pickeln und einem Muttermal.
Eine Hand, breit und knochig, liegt schwer auf Saschas Brust. Der Kahlkopf beugt sich noch tiefer herunter und küsst ihn langsam auf den Hals, genau auf das Grübchen über dem Schlüsselbein. Die Zeiger des Kurvenschreibers schlagen aus. Die Inspektorin beobachtet Saschas Reaktion. Trockene Lippen wandern langsam nach oben, schon berühren sie Saschas zusammengepressten Mund. Endlich klingelt’s. Es ist vorbei. Die Inspektorin murmelt: »Ausgemustert«, und der Kerl, der ihn geküsst hat, schluchzt plötzlich mit hoher, gebrochener Stimme: »Saschenka, leb wohl, auf Nimmerwiedersehn!« Dann reißt die Krankenschwester die Vorhänge auf, und ins Zimmer fällt helles weißes Licht.
Schon lange klingelte das Telefon. Ohne vom Bett aufzustehen, griff Sascha zum Hörer, nahm ihn aber nicht ab. Er wartete, bis es noch mal klingelte. Anna Iwanowna, wenn sie es denn war, würde jetzt auflegen. Sie ließ nie so lange klingeln. Da, wo sie herkommt, hält man das für aufdringlich. Sascha wartete zur Sicherheit noch ein weiteres Klingeln ab, dann ging er ran. Es war seine Mutter.
»Wach auf, du lebst jetzt in einem anderen Land«, sagte sie. »Heute Nacht ist Gorbatschow abgesetzt worden.«
Die Mutter erzählte in einem fort weiter, und Sascha hielt den Hörer weg von seinem Ohr. Sie schien schon wieder einen Anfall ihrer demokratischen Hysterie zu haben: Kaum sagt jemand etwas gegen Gorbatschow, ruft sie gleich »Militärputsch«. Aus dem Hörer tönte es »Gorbatschow«, »Ausnahmezustand« und wieder »Gorbatschow«, bis Sascha klar wurde, dass der Typ, der ihn soeben geküsst hatte, Michail Sergejewitsch Gorbatschow gewesen war. Der Präsident trug im Traum keine Brille, aber das Muttermal war da. Gorbatschow schluchzte beim Abschied wie ein altes Weib. Anna Iwanowna aber würde höchstens feuchte Augen bekommen, sollte sie erfahren, dass Sascha sie verlassen wolle.
»Du hast mich aus einem Alptraum geholt«, sagte Sascha zu seiner Mutter.
»Der kann nicht so schlimm gewesen sein wie der Alptraum, in dem wir jetzt leben.«
»Ich habe geträumt, dass ich Anna Iwanowna verlasse.«
»Halt! Man darf böse Träume nicht erzählen, sonst werden sie wahr. Was willst du jetzt tun?«
»Weiterschlafen.«
»Du glaubst mir nicht, ja? Hör zu, als ich’s hörte, wollte ich mich noch vor Ladenöffnung beim Bäcker anstellen, bevor alles ausverkauft ist. Aber ich war spät dran. Ich gehe also rein, und stell dir vor: Mehr Verkäuferinnen als Kunden, keine Schlangen, die Leute verlassen mit vollen Taschen das Geschäft, und aus dem Ladenradio hört man ständig: das Staatliche Notstandskomitee GeKaTschePe, krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit des Genossen Gorbatschow. Ich habe nichts gekauft. Sie wollen, dass wir denken, alles sei wieder wie in guten alten Zeiten, die Läden voll wie bei Breschnew und Stalin. Glaubst du mir jetzt? Und mach niemandem die Tür auf.«
»Niemand weiß, dass ich hier wohne.«
»Und deine Vermieterin, deine Nachbarn? Sie haben überall Spitzel. Wenn sie kommen, machst du die Tür nicht auf. Versprich mir das.«
Sascha hatte am Abend die Vorhänge nicht zugezogen. Sein Bett und er darin waren vom Haus gegenüber bestens einzusehen, aus jedem Fenster der drei oberen Etagen.
»Ich fahre sowieso nach Berlin«, sagte er zu seiner Mutter, »und wenn ich zurück bin, wird hier alles wieder seinen Gang gehen.«
»Du darfst nicht zurückkommen.«
»Ich muss jetzt mal«, antwortete Sascha, »ich rufe zurück.«
Er stand auf und machte die Vorhänge zu. Als er den Wasserhahn im Bad aufdrehte, kam nur ein kurzes Zischen aus der Leitung. Das Warmwasser war abgestellt. Sascha zog sich, ohne zu duschen, an. Die Fernwärmeleitungen wurden jeden Sommer repariert, und Saschas Bezirk kam immer im August an die Reihe. Dann stellte man ihm das Warmwasser für mehrere Wochen ab. Anna Iwanowna, in deren Land so etwas vermutlich nur nach Naturkatastrophen vorkam, fand es süß, dass die Russen einander zum Duschen besuchten. Im Juni, als es in Anna Iwanownas Wohnung kein Warmwasser gegeben hatte, hatte sie ihn besuchen müssen. Nach der Dusche kam sie barfuß aus dem Bad, in ein großes Handtuch gewickelt, und Sascha wickelte sie gleich im Flur wieder aus. Im Juli hatte die Mutter in seiner Küche gesessen, das Gesicht vom Baden gerötet, und über Gorbatschow schwadroniert.
Sascha machte die Vorhänge wieder auf, da summte die Klingel. Irgendjemand war schon an seiner Wohnungstür. Jemand, der sich unten an der Sprechanlage nicht melden musste, einfach so ins Haus reinkam. Post, Gas, Miliz. Oder hatte seine Mutter etwa recht, und »sie« waren bereits unterwegs, um Leute abzuholen? Leute wie seine Mutter ließen sich gerne verhaften, aber er? Wen interessierte schon Sascha Potjomkin.
»Machen Sie auf!«, rief eine Männerstimme hinter der Tür. Sollte der Militärkommissar herausgefunden haben, wo sich Sascha versteckte, würde er ihm die Miliz mit dem Einberufungsbefehl ins Haus schicken. Macht man denen nicht auf, treten sie die Tür ein und verprügeln denjenigen, der sie nicht hereingelassen hat. Dann bringen sie den Verweigerer zum Militärkommissariat. Da kommt man erst nach zwei Jahren wieder raus, als Krüppel oder im Zinksarg.
»Du bist zu Hause!«, rief die Stimme, »mach auf.« Die Post war es jedenfalls nicht.
Sascha entriegelte das Schloss, und sofort drückte jemand von außen gegen die Tür. Durch den Spalt sah Sascha einen Arm mit rötlichen Härchen. Sascha sagte nichts, der Mann vor der Tür schwieg auch. Er atmete schwer. Er war kein Milizionär. Es gibt keine Bullen mit nackten Oberarmen. Sascha riss die Tür ganz auf und machte einen Schritt über die Schwelle nach vorn, so dass der Mann vor der Tür zurückweichen musste. Sein Schädel war rasiert, die T-Shirt-Ärmel waren bis zur Schulter hochgekrempelt. Er war einen ganzen Kopf kleiner als Sascha. Im Neonlicht der Leuchtröhren, die auch tagsüber im Treppenhaus brannten, erschien die Kopfhaut des Kerls leichenblass, der Schädel unförmig, Rasierkratzer glühten darauf. Hinter ihm war das Treppenhaus leer. Dort lauerte niemand.
»Sind Sie alleine?«, fragte Sascha dennoch, statt die Tür gleich zuzumachen. Irgendwo hatte er diesen Kerl schon mal gesehen, vielleicht bespitzelte er ihn schon länger.
»Hör mal, ich sitze wirklich in der Patsche wegen heute Nacht«, er fasste Sascha an der Hand, sah kurz hoch, ließ sie sofort wieder los und sprach weiter: »Halt dich fest, ich muss dir was erzählen.«
»Ich weiß bereits, was passiert ist.«
»Einen Dreck weißt du! Hey, es geht nicht um Politik, das ist ernst. Sag, wie heißt du?«
Seine Augen waren zusammengekniffen. Eine ordentliche Alkoholfahne hatte er auch. Sascha nannte dem kleinen Alki einen Namen: »Michail.«
»Wowa. Ich heiße Wladimir, aber alle sagen Wowa zu mir. Sehr angenehm. Also, ich brauche Geld. Hundert Dollar.«
Sascha versuchte, die Tür zuzuziehen, aber der Kerl hielt sie fest.
»Es ist nicht, wie du denkst, Mischa. Hör mir doch einfach zu!«
Er stammelte etwas von Hektolitern Spiritus.
»Was machst du eigentlich, wenn du nicht säufst?«, riss Sascha ihn aus seinem Delirium. »Arbeitest du für die Bullen, Wowa?«
»Sehe ich so aus? Komm, kannst du einem Menschen nicht einfach glauben?«
»Ich glaube, du solltest weniger trinken.«
»Ich bin Fahrer«, versuchte Wowa seinem Nachbarn zu erklären, »ich trinke nicht.« Was für ein Pech, dass von allen Nachbarn nur dieser Michail zu Hause war, der sich immer zur Seite drehte, wenn man zusammen im Aufzug stand. Leider hatte Wowa keine andere Wahl, als im eigenen Treppenhaus um Kohle zu betteln. Was tut man, wenn man plötzlich so viel Geld braucht, wie man in einem Monat verdient und auch noch das Telefon abgestellt ist? Heutzutage bist du nichts ohne Telefon. Er sagte: »Komm, Mischa, nur bis heute Abend. Wenn du nur wüsstest, was für eine Riesenkacke heut Nacht passiert ist!«
Am Abend zuvor hatte Wowa den Auftrag bekommen, einen bereits vollbeladenen LKW in die Vorstadt Mitino zu fahren. Ausladen, Unterschrift, Computer einladen, Unterschrift, Träger bezahlen und tschüs, Feierabend. Der Chef hatte nicht darüber gesprochen, was in seinem Laster geladen war. Lebensmittel, hatte Wowa gedacht, Fleischkonserven. Er dachte, er müsse nachts fahren, weil das Zeug morgens in den Handel kommen solle. Der Chef aber hatte ihn so spät losgeschickt, weil nachts weniger kontrolliert wurde. Ohne nachzuzählen, hatte er ihm die Rubelchen in die Hemdtasche gesteckt und gemeint, das würde für die Träger dicke reichen, die müssten nur fünf Tonnen abladen und dann die Computer einladen, die eh so gut wie nichts wogen. Wowa fuhr los, als es dunkel wurde. Die Stadt war jedoch voller Bullen. Es waren mehr als an einem normalen Tag, mehr als während eines Staatsbesuchs. Streifenwagen parkten an jeder Kreuzung, die Verkehrsbullen standen überall am Straßenrand. Zu dritt oder zu zweit führten sie Stichkontrollen durch. Sie trugen die Gummiknüppel, die Gorbatschow vor kurzem eingeführt hatte, aber einer hatte immer ein Sturmgewehr umhängen. Kaum hatten sie Gorbatschow in den Arsch getreten, winkten die Bullen schon wieder mit Kalaschnikows.
»Ich habe keine Zeit«, sagte dieser hochnäsige Mischa und zog plötzlich wieder an der Tür, diesmal aber ohne Kraft. Dabei suchte er das leere Treppenhaus mit den Augen ab.
»Was glotzt du so?«, entfuhr es Wowa, »da ist niemand! Oder trennst du dich nur von deinen Groschen, wenn man dir ein Messer an den Hals hält? Ich an deiner Stelle würde vor mir Schiss haben. Also, hast du die Kohle? Hab nichts zu verlieren nach heute Nacht.«
Erst hatten ihn die Bullen weiterfahren lassen, weil auf seinem LKW »Lebensmittel« stand. In Mitino angekommen, sah er an einer Ampel seine Nachbarin Lena stehen. Mit weißen Reflexionsstreifen auf der Uniform und mit einem Verkehrsstab in der Hand. Er hatte sie in der letzten Zeit immer wieder vor dem Hauseingang getroffen, sie ging jeden Abend mit ihrem Schäferhund spazieren. Lena war gerade geschieden worden, er auch. Sie arbeitete als Sekretärin beim Milizrevier Mitino. Er nannte sie »Genossin Leutnantin«. Nun stand sie auf der Straße. Ihm war klar, etwas Besonderes musste passiert sein, und er, ein neugieriger Trottel, hielt hinter der Kreuzung an. Lena und er quatschten ein Weilchen miteinander am Straßenrand, als dieser Arsch von einem Hauptmann auf sie zukam, salutierte und mit starkem kaukasischem Akzent nach seinen Papieren verlangte. Da war die Sache eigentlich schon gelaufen. Der Hauptmann fragte nur noch: »Ist der Royal das, was ich denke?«
Plötzlich machte sein Nachbar den Mund auf. »Ich muss weg«, jammerte er wie ein Kindergartenbengel mit voller Hose, »wie lange wollen wir noch hier rumstehen?«
»Bis ich die Kohle hab.«
Sonst gab es niemanden, der Wowa helfen konnte. Lena auch nicht. Der Hauptmann hatte sich wahrscheinlich schon ausgemalt, wie er Lena nach dem gemeinsamen Einsatz ficken würde, und als er gesehen hatte, wie sie mit einem Bekannten sprach, wie sie dabei lachte, ist er eifersüchtig geworden. Der Schwarzarsch beschlagnahmte alles. Lena konnte ihn letztlich nur überreden, die Ware für hundert Grüne freizugeben.
Das war die Lage. Am Milizrevier 5 des Stadtbezirks Mitino stand nun ein Laster mit fünfzig Hektolitern Äthanol in Einliterflaschen. Was werden zweihundert Bullen nach einer schweren Nachtschicht tun, wenn sie ein Etikett sehen, auf dem Trinkspiritus Royal. Hergestellt in Deutschland steht? Wenn also Wowa bis zehn Uhr morgens, und das war schon in anderthalb Stunden, kein Geld vorbeibrachte, würde die Miliz von Mitino eine Woche lang besoffen sein, und er selbst seinem Chef erklären müssen, warum er statt mit einer Ladung Computer mit einem Beschlagnahmt-Stempel auf dem Lieferschein zurückkommt. Für diese Computer waren der Firma Neuwagen versprochen worden und für die noch etwas Besseres. Die ganze Kette, an deren Ende die Firma vielleicht einen Eisenbahnwaggon Nickel nach Deutschland liefern und damit zehnfachen Profit machen sollte, war also auseinandergerissen. Heutzutage wurde man für weniger umgelegt.
Die Treppenhauslampe spiegelte sich in den Brillengläsern seines Nachbarn, man konnte seine Augen nicht sehen.
»Aber eigentlich ist es mir schnuppe, ob du mir glaubst oder nicht«, sagte Wowa. »Gib mir einfach die Kohle.«
»Willst du mir etwa drohen?«, fragte Mischa.
»Was stammelst du rum wie dein Gorbatschow vor dem Politbüro? Nachbarn sollten sich gegenseitig helfen, stimmt’s oder nicht?«
»Wohnst du auch hier?«
»Klar, in diesem Stock, gegenüber auf dem Treppenflur, Wohnung 137. Siehst du die Tür, wo unten das zweite Schloss fehlt? Mit Klebeband zugeklebt? Das ist meine. Komm schon.«
Mischa starrte auf die kaputte Tür, als hätte er sie noch nie gesehen, und sagte: »Übermorgen bin ich in Berlin …«
»Übermorgen bist du im Arsch!« Wowa hatte nun die Schnauze gestrichen voll. »Wach endlich auf, Mann! Langsam kotzt mich das an.«
Ihm war wirklich übel. Seit Stunden nichts gegessen, keinen einzigen Brotkrümel, und blöderweise hatten der Hauptmann und er jeweils einen Schluck aus der Royal-Flasche genommen. Wowa hatte noch immer diesen ekligen Spiritusgeschmack im Mund, dabei hatte das gemeinsame Trinken den Bullen keinesfalls besser gestimmt. Mit einem Russen hätte es perfekt funktioniert, man hätte einen zusammen getrunken, man wäre sich dabei nähergekommen, und nach einer Weile hätte sich das Problem in Luft aufgelöst. Aber wie alle Schwarzärsche hatte der Hauptmann nicht gewusst, wie man Wodka trinkt, der Royal war ihm zu stark gewesen. Er hatte genauso eine angewiderte Fratze geschnitten wie jetzt sein Nachbar.
»Sag mal, Mischa, bist du überhaupt Russe? Oder bist du etwa Deutscher? Ich meine, ich habe nichts gegen Deutsche, ich hatte in der Schule Deutsch, und ich habe bei euch in der DDR sogar gedient: ›Gut Schnaps, Wodka mehr gut.‹ Ich hab gesehen, dass dich oft Deutsche besuchen.«
»Ist das vielleicht verboten?«
»Jetzt werden sie es wieder verbieten, du weißt ja, wie es früher war: ›Unerlaubter Kontakt zum Ausland, Artikel soundso, fünf Jahre mit Vermögenseinzug‹, aber ich werde einen Nachbarn nie verpfeifen.«
»Nur zu. Ich bin Dolmetscher. Das sind alles meine Kunden.«
»Ein super Job! Übrigens, es kommt immer wieder eine zu dir, die ihren Kopf so rasiert hat, so wie bei mir, aber mit einem Schopf. Glückwunsch, ein klasse Mädchen, wir haben uns kennengelernt. Die hat Humor. Wie hieß die noch gleich? Anna Iwanowna. Wie die Zarin. Lustig, was?«
»Ja«, sagte Sascha. Es war typisch für seine Noch-Freundin, sich in Moskau mit dahergelaufenen Säufern zu verbrüdern, was ihr in Deutschland wohl nie in den Sinn gekommen wäre. Sascha schwieg. Sein Nachbar fragte:
»Wie lange brauchst du, um einhundert Bucks zu verdienen?«
»Einen Tag.«
»Was bist du mir für einer, Mischa, sei doch ein Mann und keine verfickte Schwuchtel! Warst du überhaupt bei der Armee? Das merkt man dir an, weißt du, und das sag ich dir als dein Nachbar, es hätte deinem Charakter gutgetan. Wer sich vom Kollektiv absondert, den ficken sie dort so lange, bis ihm sein ganzer Egoismus ausgetrieben wird. Das sagt unser Militärkommissar, er ist mein Kumpel.«
Also hatte Sascha recht. Mochte dieser Kerl auch wirklich sein Nachbar sein, er stank aus dem Mund doch wie ein richtiger Milizzuträger.
»Hast du bei der Armee auch welche verprügelt?«, fragte Sascha.
»Ich war Fahrer in einer Transporttruppe, dort waren wir alle«, er legte seine Hände ineinander, »so dick! Ich hab sogar einen General gefahren. Weißt du was? Das, was ich an einem Tag verdiene, das hätte ich einem Nachbarn einfach geschenkt.«
»Du kriegst hundert Rubel von mir, und dann will ich dich nie wieder sehen, verstanden?«
»Ich verstehe dich nicht, Michail, warum bist du glitschig wie ein herausgezogener Schwanz? Was bist du für ein Mensch? Heißt du vielleicht Moischa?«
»Schön wäre es. Wenn ich Jude wäre, würde ich längst in Deutschland herumspazieren.«
»Stimmt, uns Russen wollen sie nicht. Hilfst du mir?«
»Hundert Rubel«, wiederholte Sascha. Der Typ trat Sascha fast schon auf die Zehen. Er murmelte zusammenhangslos, »Michail, Nachbar …« Er packte Sascha wieder am Handgelenk.
»Lass los. Sofort.«
Der Kerl schüttelte den Kopf. »Das ist es, weswegen man euch Jidden nicht mag, genau das …«
»Halt endlich die Klappe. Warte hier«, erwiderte Sascha. Er ging ins Wohnzimmer und holte ein Bündel Dollarscheine, das er dem Kerl in die Hand drückte. Der Kahlkopf fing an nachzuzählen.
»Eigentlich«, sagte er, »hättest du mich in die Wohnung bitten können, statt mich wie einen verdammten Bettler vor der Tür stehen zu lassen. Aber danke. Du kennst mich ja nicht. Ich werde die Kohle schon heute Abend zurückzahlen.« Der kleine Mann plapperte glücklich weiter: »Vielleicht trinken wir einen zusammen, wenn ich dir die Bucks vorbeibringe? Ich kann dir ein paar Geschichten erzählen, du wirst dir vor Lachen in die Hose machen.«
»Schmeiß das Geld einfach in den Briefkasten.«
Sein Nachbar sah ihn an wie geohrfeigt. Er taumelte zurück, hielt sich an der Wand fest und blieb ein paar Schritte vor der Tür stehen. Gleich würde er versuchen, Sascha eine mit der Stirn aufs Kinn zu geben, aber Sascha war zu groß für ihn und könnte ihn leicht wegstoßen, mit beiden Händen gegen die Brust, so dass er richtig hinknallen würde mit seinem rasierten Schädel. Der Boden im Treppenhaus war mit Fliesen ausgelegt, von denen viele fehlten, und manche waren lose oder rissig.
Der Nachbar stand schweigend da, die Scheine in der Hand, und schaute Sascha in die Augen. Plötzlich sagte er auf Deutsch: »Eins, zwei, drei, vier, Pioniere heißen wir. Ich mache heute Klassendienst.«
Da der Kerl immer noch keine Anstalten machte zu gehen, zog Sascha die Tür mit einer kurzen Bewegung zu.
Der nicht ausgefüllte Antrag auf die Erteilung eines Besuchervisums steckte schon seit Tagen in seiner Erika-Schreibmaschine, die er aus der DDR mitgebracht hatte. Sascha tippte seinen Namen ein und vertippte sich gleich beim »A«. Luft holen, konzentrieren, es holte ihn schon niemand ab. Noch gestern hatte Sascha gedacht, mit dem Antrag habe er Zeit. Sein Termin bei der Botschaft war erst in zwei Wochen, doch jetzt war das viel zu lange hin. Nächstes Mal würde er vielleicht nicht mit ein paar Dollar davonkommen.
Sascha nahm den Telefonhörer in die Hand. Bei der Botschaft spielte Barockmusik, ewig lang, dann meldete sich ein Mann. Sascha erkundigte sich, ob er schon morgen kommen könne.
»Wo haben Sie diese Rufnummer her?«, fragte der Mann.
»Ich dachte, dort wäre die Auskunft der deutschen Botschaft.«
»Sind Sie Deutscher? Diese Rufnummer ist nur den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland vorbehalten. Wie haben Sie diese Nummer in Erfahrung gebracht?«
Sascha hatte die Nummer von Anna Iwanowna, aber die Botschaft durfte das nicht erfahren. Anna Iwanowna bekam über die Botschaft ihre Post, und sollte er sie verraten, würde man ihr diesen Gefallen nicht mehr tun.
Botschaften übernehmen immer das Schlimmste von ihren Gastländern. Jedes Mal wenn Sascha die für Russen bestimmte Nummer anrief, wimmelte man ihn ab, als wäre er einer von der Sorte seines Nachbarn.
»Die Musik, die man hört, wenn man Sie anruft, das ist Haydn, richtig?«, sagte Sascha. »Ich wäre Ihnen für eine schlichte Auskunft sehr verbunden. Darf ich meinen Antrag auf ein Besuchervisum morgen einreichen?«
»Damit Sie ganz in Deutschland bleiben? Mir ist schon klar, warum Sie es so eilig haben.«
»Mir ist das bedauerlicherweise nicht klar.«
»Schalten Sie Ihren Fernseher ein.«
»Ich schaue nie fern.«
»Mir können Sie nichts vormachen, natürlich wissen Sie, was los ist. Alle wissen das. Aber in den Anträgen gibt das niemand als Reisegrund an. Da lesen wir immer etwas anderes. Sie beabsichtigen, Ihr Besuchervisum für ein Asylgesuch zu missbrauchen. Sie können sich die Mühe mit dem Antrag sparen.«
Sascha legte den Hörer vorsichtig neben dem Telefon ab. Die Stimme des Mannes verstummte, dann kam das Besetztzeichen. Sascha ging zum Fernseher.
Die Vermieterin hatte ihm einen vorsintflutlichen schwarzweißen Rekord-67 mit drei Programmen überlassen. Die Programme schaltete man mit einem Drehknopf um, der aber fehlte. Aus dem runden Loch ragte nur ein Eisenstift mit flacher Spitze. Die Vermieterin hatte mit Hilfe einer Flachzange umgeschaltet. Die Flachzange auf dem Fernseher war Sascha bei der Wohnungsbesichtigung als Erstes aufgefallen. Bei seinen Eltern zu Hause sah es nämlich genauso aus: Ein uralter Rekord, ein fehlender Schalter, eine Flachzange. Die ersten Rekord-Fernseher hatte es bereits in seinem Geburtsjahr gegeben, und seitdem wurden sie jahrzehntelang mit denselben brüchigen Programmschaltern ausgestattet.
Ihre Flachzange hatte die Vermieterin mitgenommen, und ohne sie konnte Sascha das Programm nicht umschalten. Aber auch um den eingestellten Kanal überhaupt reinzubekommen, musste er mit dem Daumen fest gegen den Eisenstift drücken. Die alte Kiste empfing dennoch entweder nur Bild oder nur Ton zu schwarz-weiß flimmernden Streifen. Erst wenn er so stark drückte, dass ihm sein Daumen weh tat, erschien hinter dem rauschenden Schneesturm ein etwas dunklerer Fleck, ein dicker Weihnachtsbaum oder ein Kopf und Schultern. Sascha drückte und zog am Stift, bis aus dem Bildrauschen eine Frauenstimme kam: »Sperrstunde«, »Schluss mit der zügellosen Propaganda von Sex und Gewalt«. Kurz füllte sich der Bildschirm wieder mit Schneerauschen, dann verschwand auch der Ton. Sascha schlug mit der Handfläche auf den Fernseher, schließlich konnten Schwarzweiß-Fernseher nicht explodieren. Nur aus sowjetischen Farbfernsehern kam manchmal Rauch, sie spuckten Funken, die Röhren platzten, und Tausende Splitter fielen auf die Wohnzimmerteppiche. Man musste Mitleid mit Anna Iwanowna haben: Sie kommt für ein ganzes Jahr nach Moskau, sie will helfen, macht ein Praktikum bei den Bürgerrechtlern, sie verteilt Lebensmittelpakete aus Deutschland, dann kommt sie von einem ihrer ersten Tage bei Memorial nach Hause, und ihr Fernseher explodiert.
Die Wohnung hatte Sascha für sie gefunden. Damals wusste er noch nicht, wie Anna Iwanowna tickte, bisher hatten sie nur eine kurze Romanze gehabt, zwei Wochen während Anna Iwanownas erster Studienreise nach Moskau. Als sie im Jahr darauf wiederkam, fürchtete er, sie würde sich bei ihm einquartieren, nach dem Motto: »Pennen kann ich doch erst mal bei dir, oder?« Aber das ist nicht die Art dieser Anna Iwanowna. Sie nennt sich Feministin, sie will unabhängig sein. Und obwohl Feministinnen sich nicht von Männern helfen lassen, hatte sich Anna Iwanowna sehr gefreut, als Sascha sie am Flughafen abholte und in die neue Wohnung brachte. Die Vermieterin war auch da, eine Intelligenzlerin, die aufgeregt ihre Verzückung über die deutsche Mieterin kundtat. Sie fand es besonders süß, dass sie einen russischen Vornamen hatte. Anna Iwanowna errötete. Dann sagte Sascha, dass sie russische Vorfahren hätte. Anna Iwanowna fuhr ihn auf Deutsch an, wieso er einen solchen Schmarrn erzähle?! Zur Vermieterin sagte sie nur »Spassibo«, und diese quasselte weiter über die Vorzüge von deutschen Mietern. Die Deutschen würden die Küche sauber halten und nichts aus der Wohnung klauen, weder die Kristallschüsseln noch den Kühlschrank oder den Farbfernseher Rubin. Sie würden ihre Wohnung auch nicht »vollscheißen wie die Schwarzen«. Solche betagten gebildeten Damen sind dem einen oder anderen derben Ausdruck manchmal besonders zugeneigt. »Fotze« klingt aus ihrem Mund trotzdem wie »Fresko«. »Schwarze« nannte die Vermieterin alle Leute aus dem Süden. Für die sibirischen Nenzen oder Tschuktschen hatte sie die Bezeichnung »Schlitzaugen«, die Bergbewohner aus dem Kaukasus nannte sie »Viecher«. Anna Iwanowna musste sich das mit freundlicher Miene anhören. Schließlich sagte sie: »Ich komme selbst aus dem Süden, aus den Bergen.« Die Vermieterin wechselte das Thema. Sie hatte für ihre Einzimmerwohnung mit Küche und Bad zuerst hundert Dollar pro Monat verlangt. Doch Sascha drückte die Miete auf hundert DM: »Die Germanen mögen ordentlicher als Schwarzärsche sein«, sagte er, »aber sie sind geizig.«
Anna Iwanownas ersten Tag in Moskau verbrachten sie zusammen, ihre Koffer ließen sie unausgepackt in der Wohnung und spazierten den ganzen Tag durch Moskau. Auf den Bürgersteigen lag noch Schnee. Anna Iwanowna drehte sich jedes Mal um, wenn sie eine von diesen dicken alten Frauen in orangefarbenen Westen überholten, die Sand auf den Schnee streuten.
»Endlich Geschlechtergerechtigkeit«, kommentierte Sascha.
»Nein. Ihre Westen, sie fallen auf«, erwiderte sie, »weil alles hier so blass ist.«
Stundenlang gingen sie von Geschäft zu Geschäft. In einem Laden war gerade Milch im Angebot, sonst nichts, in einem anderen nur Salz, aber es fand sich fast in jedem etwas, das sie kaufen konnten, manchmal bloß Streichhölzer oder Kernseife. Der sowjetische Mangel musste für Anna Iwanowna ein Kulturschock gewesen sein, aber sie hielt sich gut, sie freute sich über den Schnee und den Sonnenschein und den alten Trolleybus, es war ihre erste Fahrt in einem Bus mit elektrischer Oberleitung.
In einer Bäckerei kauften sie ein frisches Schwarzbrot, blieben gleich draußen vor der Tür stehen, Sascha riss ein Stück von der knusprigen Rinde ab und reichte es ihr. Danach knabberten sie die Rinde einfach mit den Zähnen ab. Die Schwarzbrotrinde begeisterte Anna Iwanowna sogar mehr als die Fahrt mit dem Trolleybus. Aber über die Mädchen, die ihnen auf der Straße entgegenkamen, schüttelte sie nur den Kopf: Miniröcke bei minus zehn Grad. Sie sagte: »Je weiter nach Osten, desto kürzer die Röcke.«
Sascha widersprach ihr nicht. Ihre Lippen waren an diesem Tag sehr kalt. Am Abend aßen sie bei ihr Salzkartoffeln, am nächsten Morgen fuhr Sascha nach Hause, er hatte eine Übersetzung zu erledigen, und am Abend wollte er mit Denis und Max ins News Pub, das vor kurzem aufgemacht hatte. Stattdessen musste er wieder zu Anna Iwanowna. Sie heulte am Telefon, sie hatte nicht gewusst, dass Fernseher explodieren konnten.
Sein Rekord summte, hatte aber weiterhin weder Ton noch Bild. Auch draußen hinter der Fensterscheibe ließ sich nicht erkennen, wie schlimm es mit dem Putsch tatsächlich war: Alles grau, trübes Wetter, fast schon herbstlich. Der Telefonhörer lag noch immer neben dem Apparat. Es war sein neues Telefon aus Deutschland, mit Tasten statt einer Wählscheibe und einer elektronischen Anzeige für die Nummern der Anrufer. In Moskau erschienen darauf nur rote Achten. Seine Mutter hatte sicherlich schon mehrmals vergeblich versucht, ihn zu erreichen, und machte sich jetzt Sorgen. Tatsächlich ging sie, als Sascha die Rufnummer seiner Elternwohnung wählte, gleich beim ersten Klingeln ran.
»Es ist schlimmer, als ich dachte«, sagte sie. »Du musst weg. Morgen kann es zu spät sein.«
Die Mutter wollte aber nicht sagen, was noch passiert war, sie wiederholte nur: »Was für ein Glück, dass du Anna Iwanowna hast! Sie kann dir mit dem Visum helfen.«
»Sag mir einfach, was passiert ist«, bat Sascha, aber die Mutter wollte es nicht am Telefon sagen. Sie suchte zweideutige Formulierungen, die man später notfalls verdrehen könnte.
»Wurde jemand verhaftet? Deine Larissa wieder?«, fragte Sascha.
»Keine Namen!«, unterbrach ihn seine Mutter, »nicht am Telefon! Bitte nicht am Telefon.«
Früher hatten die Eltern jedes Mal wenn Gäste bei ihnen waren, die Wählscheibe des Telefons bis zum Anschlag gedreht und mit einem Bleistift blockiert. Das Telefonkabel führte direkt, ohne Steckdose, in die Wand, und sie dachten, der KGB würde sie sogar belauschen, wenn der Hörer aufgelegt war. Nur die festgehakte Wählscheibe könne das Abhören verhindern. Daran glaubten sogar die Kollegen von Saschas Mutter, Ingenieure aus dem Forschungsinstitut für elektronische Rechenmaschinen. Später installierten sie Telefonsteckdosen und zogen den Stecker schon heraus, wenn sie ausländische Sender hörten. Der Vater vergaß meistens, das Telefon wieder anzuschließen, und Saschas Mitschüler beschwerten sich, bei ihm erreiche man ja nie jemanden.
Seit frühester Kindheit kannte Sascha den Aufdruck in der Mitte der Wählscheibe: Achtung! Das Telefon gewährleistet nicht die Vertraulichkeit des Gesprächs. Damals dachte er, das stehe auf allen Telefonen in der Sowjetunion. Später erzählte ihm die Mutter, dass die Wählscheibe mit dem Aufdruck das Geschenk einer Bekannten sei. Larissa, eine Freundin der Mutter, fand Gefallen daran, mit Sascha zusammen, der noch gar nicht lesen konnte, die grellroten Buchstaben zu entziffern: Ver-trau-lich-keit. Das fette Ausrufezeichen hatte Sascha besonders fasziniert, zugleich machte es ihm ein bisschen Angst.
»Benutzt du eigentlich immer noch euer altes Agententelefon? Das Kabel muss doch längst ganz verdreht und verdreckt sein, weil ihr beim Telefonieren so gern die ganze Wohnung abschreitet. Ich kann dir bald ein schnurloses Telefon aus Deutschland schicken«, sagte er zu seiner Mutter.
Alla ging nicht darauf ein. In der Tat war das Telefon alt geworden. Von dem Wort Achtung! war die rote Farbe längst abgegangen, und die in durchsichtigen Kunststoff gepressten Buchstaben waren kaum mehr zu entziffern. Die Wählscheibe mit der Abhörwarnung hatte ihr Larissa zum Dreißigsten geschenkt. Saschenka, damals noch sehr klein, hatte sich hinter Allas Rücken versteckt, weil Larissa, die keine eigenen Kinder hatte, ständig über den Jungen herfiel. Sie wollte ihm das Lesen beibringen.
Larissa war mit ihrer Wählscheibe aufgetaucht, als alle anderen Gäste bereits am Tisch saßen. Noch im Flur begann sie mit ihrem Geschenk anzugeben, erzählte, was sie alles dafür riskiert habe.
Die Wählscheibe stammte aus dem Forschungsinstitut für elektronische Rechenmaschinen, an dem Alla ebenfalls arbeitete und wo sie erst kurz zuvor und durch viel Vitamin B eine Einstellung für Larissa organisiert hatte. Erst am heutigen Tag, erzählte Larissa, sei es ihr gelungen, die Wählscheibe mit der Warnung vom Telefon ihres Chefs abzuschrauben und gegen eine normale auszutauschen. Danach musste sie die geklaute Wählscheibe aber auch noch durch das Eingangsportal des Instituts schmuggeln. An zwei pensionierten Gulagwärtern vorbei, die in alle Handtaschen reinschauten und stichprobenweise Leibesvisitationen durchführten.
Eigentlich waren es bloß ehemalige Milizionäre, und Alla selbst war nur zweimal am Ausgang durchsucht worden, aber die Sache war trotzdem heikel. Zwar wurde man nicht mehr wegen Sabotage des sozialistischen Aufbaus eingesperrt, aber gefeuert hätten sie Larissa auf jeden Fall. Sie war ganz rot, als sie im Flur stand, Schweißtropfen hingen auf ihrer Stirn, aber statt ihren Pelzmantel abzulegen, erzählte sie aufgeregt weiter: »Ich hab das Ding in meiner Unterwäsche versteckt. Ausgezogen haben mich die Wächter zum Glück nicht.«
Endlich legte Larissa Mantel und Schal ab. Sie knöpfte den Kragen ihrer Strickjacke weit auf und holte aus ihrem überdimensionierten BH die Plastikwählscheibe. Mit ernster Miene überreichte sie Alla das Geschenk, das von ihren Brüsten noch warm war. Dann ging sie zum Tisch. Alla musste noch einen Stuhl für sie besorgen, einen Kinderstuhl aus Saschenkas Zimmer, weitere Sitzmöbel besaßen sie nicht.
Larissa verschwand fast völlig unter dem Tisch, und der hochgewachsene Igor Walischwili, ein galanter Kaukasier, bot ihr seinen Stuhl an. Larissa lehnte ab, sie sagte, dass sie große Männer über alles in der Welt liebe. Ihr selbst gehe es auch auf dem Kinderstuhl hervorragend, denn für sie zähle sowieso nur das Eine: Von »den Unseren« umgeben zu sein. Sie rief in die Runde: »Wurde das Telefon schon ausgesteckt, meine Damen und Herren?« Seit ein paar Monaten redete sie auch Unbekannte auf der Straße so an, um das Sowjetvolk vom Gebrauch des bolschewistischen »Genossen« zu entwöhnen.
»Ich will euch etwas sagen«, begann sie, stemmte sich mit dem Busen gegen die Tischkante, hob ihr Glas Apfelsaft – sie trank schon damals nie etwas Stärkeres – und brachte einen Trinkspruch auf die Zeiten aus, »wenn wir unsere Telefone nicht mehr mit Bleistiften abhörsicher machen müssen«, und »wenn du«, sagte sie zu Alla, »meine Wählscheibe von deinem Telefon abnimmst!« Alle stießen an, alle lachten. Damals lachte man noch über das, was Larissa sagte.
Im Telefonhörer knackte und zischte es, und Saschenkas Stimme wurde bis zur Unverständlichkeit verzerrt. Entweder hörten sie nun wieder ab, oder das Kabel hatte sich überdehnt, wie es oft passierte, wenn man mit dem Hörer zum Fenster ging.
Auf der Straße sah man eine Kolonne Panzer, die über den Wernadskiprospekt ins Zentrum fuhr. Grau und riesig, wie in einem Fernsehfilm über die Schlacht um Moskau. Die Sowjetsoldaten, eine Handvoll Jungs mit ausrangierten Gewehren aus dem Ersten Weltkrieg, stellen sich den faschistischen Tigern in den Weg. Alle bis auf einen sterben. Die Panzer kehren um. Und sechzig Jahre später brechen sie durch, da rollen sie durch die Straßen, als gehörte die Stadt ihnen.
»Sind bei euch auch …«, fragte sie Saschenka, und just in diesem Moment knackte es wieder ohrenbetäubend in der Leitung. Die letzten beiden scherten aus der schwarzgrauen Panzerkolonne aus, steuerten zum Straßenrand und hielten direkt unter dem Fenster an. Mit einer Raupenkette fuhren die riesigen Kriegsmaschinen auf den Rasen.
»Fährt bei euch auch die Raupentechnik, Saschenka?«
»Ich schau gleich«, antwortete er, »ich ruf dich zurück.«
»Ich bleibe dran.«, gelang es Alla noch zu sagen.
----- Die Partisanin -----
Aus Saschas Küchenfenster im 6. Stock war ein längeres Stück vom Leninprospekt mit einer Kreuzung zu sehen. An der roten Ampel wartete ein Bus, hinter ihm drei Panzer, und weiter hinten noch einige Lastwagen. In den letzten Jahren war die Armee mehrmals in Moskau einmarschiert, zuletzt vor ein paar Monaten. An diesem Tag war er mit Anna Iwanowna im News Pub verabredet gewesen, aber sie hatte Schiss vor den Panzern bekommen und war zu Hause geblieben. Eigentlich waren es lediglich gepanzerte Mannschaftstransporter. Alle dachten, es sei ein Putsch, aber am nächsten Tag sprach man offiziell von einer Truppenübung. Heute waren keine Mannschaftstransporter, sondern echte Kampfpanzer gekommen, mit scharfkantigen Kettenraupen, buckligen Drehtürmen und langen Kanonen. Ein schwarzer Wolga überholte die Laster und Panzer auf der Mittelspur und stellte sich ganz vorne an der Ampel an. Die Panzer sahen neben dem Bus klein und flach aus, ihre Geschützrohre guckten in unnatürlich steilem Winkel nach oben, wie bei den Spielzeugpanzern in Saschas Kindergarten. Dort hatte es ein Set klobiger Militärfahrzeuge aus Holz gegeben, alle mit schwarz angemalten Rädern, Raupenketten oder Turmluken. Fast alle Kanonenrohre waren abgebrochen.
Die Jungs in der Vorschulgruppe hatten sich über Fragen gestritten wie: Welche Waffen mehr Feuerkraft besäßen und bei welcher Waffengattung sie später den Militärdienst leisten würden. Die Raketenfans prügelten sich mit den Panzersoldaten, und sie alle lachten über Sascha, weil er nicht wusste, was ein Jet war. Zu Hause erklärte ihm sein Vater, Jets gäbe es nicht nur bei den Luftstreitkräften. Am nächsten Tag schlug Sascha vor, Aeroflot zu spielen. Keiner wollte mitmachen, und Kirill sagte sogar, das sei ein Spiel für Mädchen. Sascha baute aus den Stühlen einen Passagierjet der Aeroflot. Der Pilotensitz war auf dem vordersten Stuhl. Später kam Vera zu ihm und sagte, sie sei die Stewardess. Vera war dünn, flachsblond und eine solche Giftziege, dass niemand mit ihr etwas zu tun haben wollte. Nachdem Sascha nun aber mit Vera gespielt hatte, schlossen die anderen Kinder auch ihn aus.
Sascha ging vom Küchenfenster weg und trank aus der Tasse, die seit gestern Abend auf dem Tisch stand, einen Schluck bitteren alten Tee. Die Tasse hieß Heldenstadt Smolensk. Auf einer anderen stand mit altslawischer Schrift geschrieben: Die Schlacht um Moskau. Das ganze Geschirr seiner Vermieterin war so. Über Tassen mit Wappen von Heldenstädten hatte sein Vater einmal gesagt: »Es würgt einen, aber trinken muss man trotzdem.« Die Tassen hatten sie auch in Saschas Kindergarten, nur kleiner. Einmal hatte die Erzieherin von der jungen Partisanin Soja Kosmodemjanskaja erzählt. Die Deutschen zwangen Soja, barfuß durch den Schnee zu laufen, sie begossen sie mit eiskaltem Wasser, aber sie verriet das Militärgeheimnis nicht. Vor dem Mittagsschlaf schlug Vera vor, Partisanen zu spielen. Soja Kosmodemjanskaja wollte sie natürlich selbst sein, und Sascha musste den deutschen Offizier spielen.
»Schlag mich«, befahl sie. Sascha traute sich nicht, Vera wie ein Deutscher ins Gesicht zu schlagen, und schubste sie bloß leicht gegen die Brust.
»Du Blödmann!«, fauchte Vera, »hierhin darf man Frauen nicht schlagen!«
Im Schlafraum waren die Betten durch einen Gang getrennt, auf der einen Seite die Jungs, auf der anderen die Mädchen. Vera schlief gegenüber von Sascha. Als sich die Kinder zum Mittagsschlaf hinlegten, hantierte Vera unter der Decke herum, dann flüsterte sie Sascha zu: »Schau her!« Vera stand auf ihrem Bett, eingewickelt in ihre Decke, dann schlug sie sie langsam einen Spaltbreit zurück. Noch im Bett hatte Vera das Nachthemd ausgezogen und stand jetzt nur in Unterhose vor Sascha. Wie Soja Kosmodemjanskaja vor den Deutschen. Ihre Brust war ganz gewöhnlich, sie sah genauso aus wie seine. Sascha zog schnell sein Hemd aus und sagte: »Ich bin auch Partisan!«
»So spielen wir nicht!«, zischte Vera. »Entweder bist du Faschist, oder ich spiel nicht mit!«
»Dann soll dich jemand anderes foltern«, antwortete Sascha. Vera zog sich, ohne ein Wort zu sagen, an, ging zur Erzieherin und verpetzte ihn. Die rief Sascha sofort in ihr Zimmer. Sie erlaubte ihm nicht einmal, sein Hemd wieder anzuziehen.
»Wer von euch beiden hat angefangen, über Soja Kosmodemjanskaja Späße zu machen?«, fragte sie immer wieder. Sascha schwieg, hielt die Arme vor der nackten Brust verschränkt und klammerte sich mit den Händen an seinen Schultern fest. Kalt war ihm nach wie vor, aber dafür nicht ganz so peinlich zumute. Die Erzieherin sagte: »Frierst du? Stell dir mal vor, wie es damals für Soja war, im Winter auf dem Schnee.«
»Wir haben uns das Spiel zusammen einfallen lassen«, sagte Sascha.
»Vera sagt aber, du warst es.«
»Vera ist eine Spionin! Und eine Hure noch dazu.«
Wegen des Wörtchens »Hure« wurde sein Vater zur Leiterin des Kindergartens bestellt. Als er nach Hause kam, sagte er noch in der Tür stehend: »Selber schuld, wieso gibst du dich mit so einer ab?«
Nach dieser Geschichte spielte Vera mit Kirill, über den die Erwachsenen sagten: »Der wird mal ein Schönling.« Damals war Sascha erst sechs, und seitdem klappte es bei ihm irgendwie nie mit den Partisaninnen. Mit keiner einzigen.
»Das Komitee«, hörte Sascha eine Frauenstimme aus dem Zimmer. Der Rekord war von alleine angesprungen, aber er spuckte nur einzelne Wörter aus: »unsere Heimat«, dann »hohe Spiritualität« – es war höchste Zeit, den Visumantrag fertig zu machen.
Alle Fragen im Formular waren Fangfragen, aber die richtige Antwort lag fast immer auf der Hand: Sind/waren Sie vorbestraft? Oder: Leiden Sie an einer Form von Lepra, Tuberkulose, Syphilis? Nicht so leicht durchschaubar war aber die Frage nach den Kontakten in Deutschland. Sascha ließ dieses Antragsfeld unausgefüllt. Würde er da reinschreiben »Anna Spiller, Willibald-Alexis-Str. 35, 1000 Berlin 68«, bekäme er nie ein Visum. Die Botschaft würde ihm unterstellen, er beabsichtige, seinen weiblichen Kontakt zu heiraten, um in Deutschland zu bleiben. Im Prinzip wäre das wohl besser für ihn. Wegen russischer Partisaninnen kriegte man ohnehin nur einen auf den Deckel.
Sein Vater hatte Sascha nur einmal geschlagen – nachdem er Vera einen Heiratsantrag gemacht hatte. Als sie nach dem Mittagsschlaf draußen im Garten spielten, kam Vera auf ihn zu und flüsterte, ob er wisse, wie man küsst. Als Sascha nickte, holte Vera etwas aus der Jackentasche und sagte: »Ich gebe dir das, wenn du es mir zeigst.« Es war eine Süßigkeit: die Praline Bären im Kiefernwald. Sascha steckte sie ein und küsste Vera auf die Stirn.
»Bist du blöd? So küssen nur die Kleinen!«
Sascha küsste sie auf die Lippen. Vera presste ihre fest zusammen.
»Lass uns heiraten«, sagte Sascha, »dann können wir bestimmt besser küssen.«
»Ich werde Kirill heiraten!«, antwortete Vera, »mit dir wollte ich nur küssen lernen, du gefällst mir nicht.«
Kirill hatte zu ihr gesagt, er wolle mit ihr nicht mehr spielen, weil Vera nicht küssen könne. Und sie konnte es wirklich nicht. Aber das hätte Sascha ihr nicht sagen sollen, vor allem weil hinter seinem Rücken andere Kinder standen. Sie lachten, Vera heulte.
An diesem Tag flüsterte sie allen Mädchen in der Gruppe etwas zu, und keine wollte mehr mit Sascha spielen. Die Erzieherin las ihnen ein Buch über die Kindheit Lenins vor. Der kleine Wolodja und seine Mitschüler erklärten einem Jungen den, wie es hieß, Boykott. Wenn der Junge die anderen zum Beispiel fragte, welches Fach sie als Nächstes hätten, antwortete ihm niemand. An die Tafel schrieb man: »Kein Wort zu den Petzen!« Lenin schaute zur Seite, wann immer ihm der Junge über den Weg lief.
Vera rief dazwischen: »Wir machen’s mit dem genauso!« Sie zeigte auf Sascha. Aber die anderen hoben noch am gleichen Tag den Boykott auf. Als Erster sprach Kirill mit Sascha, dann alle anderen Jungs. Die Mädchen blieben hart. Am Nachmittag lernten sie im Musikunterricht Mal ne Birke, mal ne Esche, mal ne Weide überm Fluss. Als die Eltern sie nach und nach abholten, sangen die Zurückgebliebenen, was jedem einfiel: Trickfilmlieder oder Im Garten sind alle Geräusche verstummt, alles hier steht still, tam tam tam tam. Die Melodie kannte jeder, weil sie als Pausensignal alle Viertelstunde im Radio lief. Sascha war so erleichtert über das Ende des Boykotts und wollte auch etwas singen. Er stimmte die Pausenmusik an, die er am besten kannte: Ta-ra ra-ra-ra, ta-ra ra-ra-ra, hier ist die Deutsche Welle Köln.
Für die Auslandssender hatte sein Vater zwei Sammelnamen, »Stimmen« oder »Feinde«. »Ich geh mal hören, was uns die Feinde erzählen«, hatte Saschas Vater nach dem Abendessen immer gesagt. Er stellte seine Spidola-10 auf das Fensterbrett und zog die Antenne ganz aus. Die Eisenbetonplatten ihres Hauses schirmten die Kurzwellen ab, und der Empfang war sogar am Fenster miserabel. Vaters »Stimmen« konnte man durch das Dröhnen von Störsendern kaum verstehen. Sascha kam es vor, als liege er im Zahnarztsessel und in seinem Mund würde gebohrt werden, zh-zh-zh. Vater machte sich dabei Sorgen, der KGB könnte die ausgezogene Antenne von draußen sehen. Jedes Mal wenn im dunklen Wohnzimmer die »Stimmen« und Störsender brummten, wartete Sascha auf die Milizionäre in ihren blauen Uniformen, die seinen Vater und ihn abholen würden, weil sie beide Männer waren. Auch zur Armee werden ja nur Männer eingezogen.
Als Sascha den Jingle der Deutschen Welle im Kindergarten sang, schlug ihn plötzlich eine Hand ins Gesicht. Sein Vater, der gekommen war, um ihn abzuholen. Die Mädchen lachten. Auch in der Schule und später hörte er von ihnen immer nur, »du gefällst mir nicht«. »Weil du ein Muttersöhnchen bist«, sagte Katja in der Zweiten. Sascha verbot daraufhin seiner Mutter, ihn zur Schule zu bringen, aber das half nichts. »Wenn ich deine Brille sehe, muss ich an das Gebiss meiner Oma denken, das sie nachts ins Wasserglas legt«, sagte Ira aus der Neunten, in die Sascha übrigens überhaupt nicht verliebt war. Im ersten Semester an seinem Fremdspracheninstitut erklärte Mascha, er solle sich »mit dem Gequatsche zum Teufel scheren«. – »Warum bist du so grob, Mascha?«, fragte Sascha. »Weil wir Russen grob sind.« So redeten die Mädchen alle mit ihm, aber nur die russischen. Sie lachten über Sascha wie die Partisaninnen über einen gefangenen SS-Mann.
Der Hörer lag immer noch neben dem Telefon, aber seine Mutter war nicht mehr da. Sascha hörte das Freizeichen und legte auf. Sofort klingelte es wieder. Er ging ran, und bevor seine Mutter etwas sagen konnte, erzählte ihr Sascha, dass er gerade keine Zeit habe, sie solle es ihm nicht übel nehmen, er müsse noch seinen Visumantrag ausfüllen: »Wegen dieser Panzer, wegen des absurden Visums muss ich mich jetzt entscheiden: Heirate ich Anna Iwanowna oder nicht. Keine Zeit fürs Telefon.«
Die Antwort kam nicht gleich.
»Du scheinst also bereits zu wissen, was passiert ist«, sagte Anna Iwanowna auf Deutsch. Diesmal stellte sie sich nicht wie üblich mit ihrem Zarinnen-Namen vor, fügte nur hinzu: »Ich bin’s.«
»Ja«, sagte er. »Hallo.«
»Und was hast du nun vor? Ich meine nicht, mit dem Heiraten.«
»Ich bin später mit Max im News Pub verabredet. Außerdem versuche ich seit heute Morgen, den Visumantrag auszufüllen, aber es klingelt ununterbrochen. Ein Telefontag. Alle quatschen, nichts passiert.«
»Mich hat mein Vater angerufen. Er hat Beziehungen zur Botschaft in Moskau, er will, dass sie mich ausfliegen. Ich muss mich entscheiden.«
»Dann entscheide dich, Adelheid.« Saschas Stimme klang, als grinste er dabei. Adelheid wurde sie nur von ihrem Vater genannt, obwohl – oder möglicherweise gerade weil – er ganz genau wusste, wie sie diesen Namen hasste: »Adelheid, wir müssen uns unterhalten.« Als sie von Bayern nach Berlin zog, stellte sie sich den neuen Berliner Freunden als Anna vor, sie ließ ihren Namen auch im Personalausweis ändern. Hier in Moskau kam noch Iwanowna dazu. Nur Sascha wusste von der blöden Adelheid. Sie schwieg, sie würde nichts sagen, bis er sich entschuldigt hatte.
»Sorry«, sagte er endlich, »lass uns besser zur Sache kommen. Und Sache ist hier nicht Putsch.«
Über den Staatsstreich wusste Anna nur das, was ihr Vater erzählt hatte: Abkehr von Gorbatschows Reformen, Panzerkolonnen und Soldaten in der Stadt. Mehr wusste der Vater aber nicht zu berichten, anscheinend hatte er bloß ein paar Bilder im Fernsehen aufgeschnappt. Dennoch redete er so, als hätten seine internationalen Geschäftspartner ihr Insiderwissen mit ihm geteilt.
Als sie zehn war und Heidi hieß, hatte sie die Nonnen verlassen und war auf eine normale Schule in München gegangen. Ihr Vater sagte: »Ich hoffe nur, du kommst mit deinen neuen Mitschülern klar. Einige kommen aus ganz anderen Verhältnissen oder gar nicht aus Deutschland.« Tatsächlich lernte Heidi an der neuen Schule Jewgeni kennen, den ersten Russen in ihrem Leben. Eigentlich war er kein richtiger Russe, deswegen ging es damals auch wieder auseinander.
Vom Beginn des Schuljahres bis zu den Weihnachtsferien nahm Heidis Klasse ein einziges Buch durch: Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Sie behandelten es in allen drei Fächern, die Frau Böckl unterrichtete: Deutsch, Geschichte, Geographie. »Unsere Lehrerin für das rosa Kaninchen«, nannte Jewgeni sie.
An einem gemeinsamen Großprojekt über die Judenverfolgung hatten die fünften Klassen schon im Schuljahr davor gearbeitet, ehe Heidi dazukam. Ihre Mitschüler hatten von zu Hause Sachen mitgebracht, die sie ins KZ mitnehmen würden. Die Vitrinen mit Teddybären und Tischtennisschlägern standen im Flur, alle mit den Namen der Schüler versehen. Einige von Heidis Klassenkameraden meinten, dass es nun an der Zeit sei, sich mit etwas anderem als Juden zu beschäftigen. Sie erwiderte: »Wir dürfen nicht vergessen, was unsere Vorfahren getan haben.« In den nächsten Tagen war sie für alle ein »Opfer«. Nur nicht für Jewgeni. Er kam auf sie zu und sagte, er sei Jude. Jewgeni kam aus der Sowjetunion und sah irgendwie überhaupt nicht jüdisch aus. Er trug einen billigen Norwegerpulli und irgendwelche No-Name-Turnschuhe. Nach der Schule gingen sie oft zusammen zum S-Bahnhof. Einmal lud er sie ein, ihn zu besuchen, aber ihr Vater verbot es. »Dein Vater scheint sehr streng zu sein«, sagte Jewgeni, »wie die Väter bei uns.«
»Deiner auch?«
»Meiner nicht, aber die anderen sind streng. Dort, wo ich herkomme.«
Heidi erzählte ihm, dass die Freundin ihres Vaters sie schlug. Sie festband und verprügelte. Jewgeni antwortete, man hätte ihn zu Hause nie geschlagen, nur auf der Straße. Dort, wo er herkomme.
»Mein Vater hat gesagt«, erzählte Heidi, »dass du Russe bist.« Jewgeni ging nie in die Synagoge, und er hatte wirklich nichts von den jüdischen Kindern aus dem Geschichtsbuch mit den riesigen Augen. Seine Augen waren ganz gewöhnlich, sie sahen fast so aus wie ihre. Jewgeni überlegte, schließlich sagte er: »Russe? Nicht ganz.«
Sie blieben vor dem S-Bahnhof stehen. Vor der Treppe zum Bahnsteig hatte vor kurzem ein türkischer Kiosk aufgemacht, dort gab’s Döner für eine Mark fünfzig. Der Sohn des Besitzers hatte Heidi einmal erklärt, wie man einen Muslim von einem Deutschen unterscheiden kann. Beziehungsweise einen Juden von einem Deutschen.
»Wenn du wirklich Jude bist, dann musst du doch beschnitten sein. Ich glaube, du erzählst Märchen.«
Jewgeni antwortete nicht. Er machte oft irrsinnig lange Pausen, genauso wie Sascha jetzt am Telefon. Wahrscheinlich blätterte Sascha gerade in seinem Visumantrag, sie glaubte, durch den Hörer das Rascheln von Papier zu hören. Heidi pfiff in den Hörer und rief: »Hey! Bist du noch da? Frag mich, was ich vorhabe.«
Sascha schwieg, er atmete laut aus. Auch bei Jewgeni war sie immer diejenige gewesen, die das Schweigen nicht aushielt. Als es fast schon Zeit war, auf den Bahnsteig zu gehen, schlug sie Jewgeni vor: »Wenn du mir keine Märchen erzählst, lass uns doch ein Stückchen zusammen gehen.« Sie wartete darauf, dass Jewgeni zumindest nachfragte, wozu oder wohin, aber er sagte nichts, beobachtete einen Typen, der an seinem Kebab kaute. Bald sollte ihre Bahn kommen, oder seine. Jewgeni fuhr nur eine Station stadteinwärts, und sie musste ganz raus aus der Stadt, bis zum Endbahnhof. Der Vater hatte ein Haus am See. Heidi sagte prompt: »Im Park kann uns niemand sehen, da kannst du es mir ja zeigen.«
Wortlos ging Jewgeni durch den S-Bahn-Bogen Richtung Park, so langsam, dass Heidi ihn überholen musste. Sie ging vor, bog in eine kleine Allee ab, lief weiter, bis sie einen geeigneten Ort fand. Sie zwängte sich durch die Zweige hindurch zu einer freien Stelle mitten im Gebüsch. Sie drehte sich um. Jewgeni war ihr gefolgt. Es stank nach Pisse. Heidi sagte: »Los, zeig’s mir. Erzähl mir keine Märchen.«
Jewgeni stand einfach da. »Du erzählst Märchen, wenn du behauptest, dass deine Stiefmutter dich schlägt.« Er verstummte mitten im Satz, machte kehrt, ging. Am nächsten Tag wollte sie Jewgeni eigentlich sagen, ja, du bist wirklich Jude, Entschuldigung, aber irgendwie vergaß sie es doch. Jewgeni konnte tagelang schweigen. Heidi hatte dafür keine Geduld. Erst viel später blieb Jewgeni nach Unterrichtsschluss im Schulflur stehen und betrachtete das Porträt von Brecht. Heidi ging an ihm vorbei. Sein Pulli hatte hinten kein Muster.
Sascha wartete, aber Anna sagte lange nichts – dann: »Sollen wir das Telefonat beenden?«
Bevor sie auflegen konnte, hakte Sascha ein: »Ich sollte dich doch fragen, was du vorhast.«
»Nur zu. Frag mich.«
»Hör mal, bist du etwa eingeschnappt? Ich habe lediglich gesagt, dass wir nicht nur heiraten sollten, damit ich mein Visum bekomme. Ist bei dir alles in Ordnung?«
»Klar. Halb so wild. Hab mich gerade geduscht. Der Teekessel kocht auf dem Herd. Panzer fahren durch die Stadt. Du meinst also, es passiert nichts, was dich aus der Fassung bringen könnte, Cowboy?«
»Haben dir deine Bürgerrechtler eingeredet, dass alles so furchtbar wichtig ist?«, fragte Sascha.
»Sie wollen nicht, dass ich heute zu Memorial komme. Sie haben mich um halb sieben angerufen, sie können nicht ausschließen, dass das komplette Team abgeholt wird. Deswegen sollen die ausländischen Mitarbeiter zu Hause bleiben. Was meinst du, würden die Putschisten auch Westler verhaften?«
»Ich an deiner Stelle würde zu Hause bleiben.«
»Wann fliegst du eigentlich nach Berlin?«
»Nicht sofort. Kann ja sein, dass sie mich nicht wieder hier ins Land lassen. Also muss ich unbedingt noch einiges erledigen. Ich hoffe, du verstehst das.«
»Ja. Was zum Beispiel?«
Sascha konnte natürlich nicht sagen, er müsse, bevor er mit Moskau abschließen könne, noch eine russische Partisanin finden, auch nur für eine Nacht. Er schwieg, und Anna Iwanowna fügte nach einer Pause hinzu: »Ich helfe dir gerne.«
»Das ist kein Telefongespräch.« Sascha fiel nichts Besseres ein.
»Sollen sie mithören, ist mir scheißegal«, antwortete Anna Iwanowna. »Und weißt du, was ich mache? Gut, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich fahre jetzt zu Memorial. Sie werden sich nicht trauen, eine Deutsche festzunehmen. Und wenn ich dabei bin, vielleicht lassen sie dann sogar die Russen in Ruhe. Jetzt muss ich los. Poka.«
Anna Iwanowna wartete, aber er sagte nicht tschüs. Dann fuhr sie fort: »Mach dir keine Sorgen, im schlimmsten Fall heirate ich dich einfach. Und vielleicht komme ich bald auch nach Berlin.«
»Hoffentlich«, sagte Sascha, dann hörte er nur das Besetztzeichen. Auf dem Tisch lag noch immer der unausgefüllte Visumantrag.
Wie lautet der Mädchenname Ihrer Mutter? Um das zu beantworten, musste Sascha die Mutter anrufen. Sie sagte es ihm, und sie wollte es nicht dabei belassen: »Was siehst du jetzt am Leninprospekt, nur Autos?«
»Nein, nicht nur Autos«, antwortete Sascha, »ich habe dort gerade einen … blauen Trolleybus gesehen!«
»Wahrscheinlich«, sagte seine Mutter, »habe ich bei dir einen großen Fehler gemacht. Habe dir einfach zu wenig erzählt, und jetzt nimmst du mich nicht ernst.«
»Natürlich nehme ich dich ernst. Okay, bei uns fahren auch Panzer. Aber morgen werden sie wie letztes Mal sagen, es sei eine Truppenübung gewesen.«
»Dir kann man nichts anhaben, ja? Irgendwann erzähle ich dir, was sie Larissa angetan haben.«
Saschenka fragte nicht nach, und er war auch noch zu jung, um alles zu erfahren. Als Larissa damals bei ihrer Geburtstagsfeier einen Trinkspruch auf die geklaute Wählscheibe ausgebracht hatte, waren alle amüsiert. Später schoben sie die Tische an die Wand, machten das Oberlicht aus und tanzten zu Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Larissa blieb zuerst auf ihrem Kinderstuhl sitzen, schließlich stand sie auf und studierte Allas Bücherregale.
Alla versuchte mit Igor so etwas wie einen Rock’n’Roll, und nachdem Igor sie plötzlich in die Luft gehoben hatte, baute sich Larissa vor ihr auf. »Wir müssen reden«, erklärte sie. Also musste Alla mit ihr in die Küche gehen. Larissa kam dicht an sie ran und atmete ihr ins Gesicht. Sie roch nach Schokoladentorte. Sie sagte: »Ich muss dir etwas gestehen. Ich habe noch nie, wirklich noch nie Das Inselbuch gelesen.« Sie wolle es so gerne ausleihen, nur für eine einzige Nacht, sie wisse nicht, wen sie sonst fragen könne …
Alla ging mit Larissa in Saschenkas Zimmer. Dort holte sie aus seinem Kleiderschrank, aus dem Stapel Sommersachen, den abfotografierten Archipel Gulag. Doch ehe Larissa das Buch einstecken konnte, knallte es. Es war, als hätte jemand alles genauestens für einen Skandal arrangiert: Larissa steht im Flur mit einem Stapel Fotopapier in der Hand, und Igor kommt just aus dem Bad. Er lächelt fast verlegen, er sieht das Fotopapier, sein Lächeln verschwindet, Igor sagt: »Halt, meine Damen! Wird hier etwa der Samisdat verbreitet?« Larissa, Das Inselbuch fest an die Brust gedrückt, zieht sich rückwärts, mit geöffnetem Mund und ohne einen Laut von sich zu geben, ins Wohnzimmer zurück, und dort schreit sie, was das Zeug hält: »Genossen!« Vor lauter Aufregung denkt sie nicht mehr an ihre Damen und Herren, »Genossen, unter uns ist ein Spitzel!«
Das Fotopapier für den Archipel Gulag hatte Alla in drei verschiedenen Läden gekauft. Die Negative hatte Igor irgendwo besorgt. Dafür konnte man sieben Jahre bekommen. Saschenka stellte sich vor Larissa, richtete seine Wasserpistole auf sie und spritzte ihr einen dicken Wasserstrahl ins Gesicht. Larissa rannte in den Flur zurück, sie riss ihren Pelzmantel von der Garderobe, und mit dem Fotopapierstapel und dem riesigen Mantel in den Armen lief sie aus der Wohnung, ohne die Eingangstür zuzumachen. Alla musste sich bei Igor entschuldigen, sie versicherte ihm, dass Larissa zwar ein bisschen einfältig sei, sie aber nie jemanden verpfeifen würde. Als Larissa plötzlich für ein paar Monate verschwand, fragte Saschenka kein einziges Mal nach ihr. Allerdings fragte er stets, wann Onkel Igor wiederkomme. Igor war aus ihrem Haus ausgezogen, er wohnte bei seiner frisch Vermählten.
»Hast du Anna Iwanowna schon angerufen?«, fragte Alla ihren Sohn. »Das Mädchen weiß vielleicht von nichts.«
»Wenn du sie Mädchen nennst, wird sie dich hassen. Sie ist kein Mädchen, sie ist Feministin.«
»Warum sagst du so etwas, Saschenka? Anetschka ist eine reizvolle junge Frau. Ruf sie einfach an. Sie sollte heute zu Hause bleiben. Du auch.«
»Ich treffe heute Freunde im News Pub. Beruhige dich doch, es ist kein Militärputsch.«
»Bitte tu mir einen Gefallen, Saschenka«, sagte Alla, bevor sie auflegte, »schalt den Fernseher an. Du hast doch einen Fernseher?«
Das Bild war wieder da. Eine Sprecherin bewegte stumm die Lippen, ihre hochgesteckte Dauerwelle passte kaum in den Fernseher. Sie nannten so ein Ding »Permanent«, und sie fuhren alle darauf ab: die Kindergartenleiterinnen, die Ärztinnen bei der Einberufungskommission und die Stationsschwestern in der Psychiatrie. Und Larissa trug, seit sie sich für eine wichtige Dissidentin hielt, auch ein Permanent, aber nicht ein violettes wie eine Parteisekretärin, sondern ein rotbraunes. Mutter hatte Naturlocken.
Plötzlich verschwand die Sprecherin vom Bildschirm, stattdessen ertönte kurz ihre Stimme: »Fortbestand der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.« Ins Rauschen mischte sich auf einmal Streichmusik. Als der Ton erneut ausfiel, erschien auf dem Bildschirm aber kein Orchester, sondern mehrere sich drehende Ballerinen in Weiß. Der Schwanensee von Tschaikowsky, wie es unten auf dem Bildschirm in verschnörkelter Schrift stand.
Einmal hatte Sascha von seinem Kinderbett aus mitgehört, dass Musik im Fernsehen nicht einfach Musik sei. Onkel Igor hatte das seiner Mutter erzählt. Warum werde am Tag des Sieges mehrmals der Alexandrow-Chor mit Dem heiligen Krieg im Fernsehen gezeigt? Warum nicht ein anderes von den unzähligen Siegesliedern? »Ich kann’s dir erzählen, Allotschka«, sagte Onkel Igor. Er schlief manchmal in Mutters Bett, nachdem Vater ausgezogen war. Onkel Igor erzählte, das Staatsteleradio der Sowjetunion habe Listen von Musikstücken für verschiedene Anlässe. Auf der Liste Nummer Zwei seien hauptsächlich Klavierstücke. Sie würden übertragen, wenn eine Regierungserklärung sich verzögert und eine Pause überbrückt werden muss. Wenn man also eine Nocturne von Chopin hört, wird bald ein Politbürobeschluss vorgelesen. Schwanensee steht auf der Liste Nummer Fünf. Sie wird gesendet, während das Politbüro noch entscheidet, ob der Parteichef schon gestorben ist. Als Sascha an diesem Abend noch bei den Erwachsenen gesessen hatte, hatte Onkel Igor ihm ins Ohr geflüstert, er habe einmal Menschenfleisch probiert. Onkel Igor war kein jüngerer wissenschaftlicher Mitarbeiter wie alle, er war Geologe und Entdecker. Das Menschenfleisch hatte er während einer Expedition im Pazifischen Ozean gegessen. »Ein Stück Pobacke«, flüsterte er Sascha ins Ohr. Es habe wie Huhn geschmeckt. Am nächsten Morgen sagte die Mutter zu Sascha, dass nicht alles, was Igor erzählte, ernst gemeint sei. Also wusste Sascha nicht, was er von Igors Musiklisten halten sollte. Doch der Schwanensee wurde in den nächsten Jahren tatsächlich immer wieder gesendet: Breschnew, Andropow, Tschernenko – und jetzt auch Gorbatschow.
Als Sascha ihn zum letzten Mal gesehen hatte, sah Michail Sergejewitsch Gorbatschow schon ziemlich angeschlagen aus. Es war vorletztes Jahr in Berlin gewesen, das nur noch wenige Monate die Hauptstadt der DDR bleiben sollte. An diesem Tag hatte ihn Mareike ins Stadtzentrum geschleppt. Ein paar Tage zuvor hatte sie sich im Städteexpress neben ihn gesetzt und erzählt, sie arbeite im Kino. Als Schauspielerin, dachte Sascha. Sie war schön wie ein Filmstar. Aber er hätte seine Deutschkurse nicht schwänzen sollen, denn Mareike arbeitete lediglich an der Kinokasse. Kurz vorm Ostbahnhof küsste Mareike Sascha auf den Mund, er dachte, sie würde ihn nach Hause mitnehmen, aber Mareike wollte »erst gemeinsam eine Runde drehen«. Ihr machte es nichts aus, dass die ganze Innenstadt wegen der Staatsfeierlichkeiten wie leergefegt war. Entlang der Straße Unter den Linden standen auf beiden Seiten lediglich kleine Gruppen von Aktivisten, sie winkten mit roten Fähnchen und riefen nicht sehr laut »Gorbi«.
»Fähnchenwinken vertrage ich nicht. Lass uns zu dir gehen«, sagte Sascha.