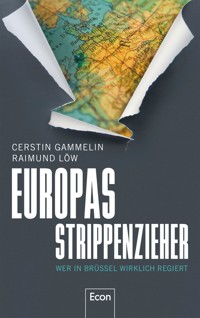18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach dem Mauerfall wurde in den West-Parteien angenommen, in den neuen Bundesländern gäbe es schnell dieselben politischen Schlachten zu schlagen. Dass den Menschen dort andere Themen wichtig sein könnten, wurde ausgeblendet. Damit war eine Entfremdung vorprogrammiert. Der Ossi wurde geboren, jene Menschen, die die Erfahrung einer harten Transformation verbindet. Doch die damals 15- bis 25-Jährigen haben sich durchgeschlagen und stellen heute selbstbewusst Forderungen. Sie wollen mitreden, von der Besetzung von Chefposten an Universitäten bis zu den politischen Entscheidungen. Deshalb werden im Superwahljahr 2021 jene Parteien reüssieren, die die Menschen im Osten und ihre Transformationserfahrungen ernst nehmen. Cerstin Gammelin entwickelt sieben Thesen, die den Einfluss der ostdeutschen Wähler auf das gesamtdeutsche politische Gefüge belegen. Nach 1998 und 2002 werden auch dieses Mal die Wahlen im Osten entschieden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Unterschätzten
Die Autorin
Cerstin Gammelin, geboren 1965, war vom Mauerfall und dem gesellschaftlichen Wandel so fasziniert, dass sie sich nach ihrem Maschinenbau-Diplom an der TU Chemnitz dem Journalismus zuwandte. Nach Stationen bei der Financial Times Deutschland und DIE ZEIT wurde sie für die Süddeutsche Zeitung 2008 Europa-Korrespondentin in Brüssel und ist seit 2015 Vize-Redaktionsleiterin der Parlamentsredaktion in Berlin. Sie ist Co-Autorin des Spiegel-Bestsellers Die Strippenzieher und von Europas Strippenzieher.
Das Buch
Eine Frau aus dem Osten als Kanzlerin, und dann noch 16 Jahre? Bundesweit Recycling und flächendeckend frühkindliche Betreuung, Medizinische Versorgungszentren und vollzeitarbeitende Mütter? Kenia-Koalitionen und ein moderierender Politikstil? Cerstin Gammelin, selbst DDR-sozialisiert, findet viele Anzeichen für eine Emanzipation des Ostens, ja gar eine »Veröstlichung« der Bundesrepublik. Sie hat sich umgeschaut zwischen Greifswald und Erzgebirge und viele Gespräche geführt: mit den Regierenden der neuen Länder, mit Unternehmern, Kreativen, Wissenschaftlern, Menschen wie du und ich. Die Unterschätzten bürsten die Geschichte gegen den Strich und streiten dafür, dass die Realität im Land neu erzählt wird: nicht vom Westen aus gedacht, sondern paritätisch. Die bestehenden Ungleichheiten im Osten müssen beendet werden durch Förderung von Eigentum und eine gerechte Steuerpolitik sowie eigene Eliten in Wirtschaft und Wissenschaft, Kultur und Behörden.
Cerstin Gammelin
Die Unterschätzten
Wie der Osten die deutsche Politik bestimmt
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Alle Rechte vorbehaltenE-Book Konvertierung powerded by pepyrus.comISBN: 978-3-8437-2581-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Vorbemerkung
Vorwort
Die wilden 90er
Von der Macht eines ungelösten Widerspruchs
Vom Kinderwagen zur Stereoanlage
Wer die Ostdeutschen sind
Berlin als Symbol des westlichen Selbstverständnisses
Die Pandemie als andere Wiedergängerin der Wende
Generation Umschulen
Ostdeutschland ist anders als Osteuropa
Fehlstellen
Die junge bürgerliche Generation West
Generationenablösung Ost
Laboratorium Ost
Der neue Politikstil
Moderne Teilhabe
Deutsch-deutsche Annäherung
Das neue Selbstbewusstsein
Die neue politische Augenhöhe
Ost und West als Resonanzböden in der Pandemie
Kenia – Das Laboratorium im Laboratorium
Wer weiß denn so was?
Der Quizmaster aus Thüringen
Die Geburt des Ostdeutschen in Bischofferode
Aus dem Nichts auf 360 Mitarbeiter
Erzählsalons im Experiment Ost
Junge Generation Aufklärung
Erst reden, dann gründen
Besser raus aus der Nische
Vorsprung Ost
Der Osten als Reformtreiber
Von der Bonner zur Berliner Republik
Die neue Kehrtwende – Nachmachen ist Mist
Die Impulse aus dem Osten
Hehe, und wie weit wir Frauen waren
Frauen in Technik
Auch unterschätzt: Milieus vermischen durch Bildung
Angela Merkel, die am meisten Unterschätzte
Vom »Mädchen« zur mächtigsten Person im Land
Orientierung
Fremdheit
Kairos und Kindergärten
Macht und Pragmatismus
Unbeirrt
Verwandlung
Über Milieus hinweg
Zusammenhalten
Frage zum Abschied
Die Frage des Eigentums
Die Partys der Anderen
Re-Start ohne Kapital
Ost – West – Schulden
Reparaturarbeiten
Der Fehler im Einigungsvertrag
Neu erfinden ohne Kapitalbasis
Korrekturen und Visionen
Vorkaufsrecht
Genossenschaften als Variante der Purpose-Bewegung
Das Modell Mietkauf
Erbfolgen
Politische Steuerungsmacht
Von der Macht einer Minderheit
Die Reform der Gewerbesteuerverteilung
Wenn das Recht auf Veto gezogen wird
Die Notfallklausel im Grundgesetz
Die Rolle der Medien: Wer spricht, der bleibt
In der Blase
Aufstand in der Blase
Zu drei Viertel ausgeleuchtet
Wer forscht, findet
Wer schreibt, der bleibt
Macht, Markt und Medien
Vom Versuch eines Neustarts
Von der politischen Macht einer Minderheit
Das Zünglein an der Waage
Die Grünen und der Osten
Schröder – keiner war wie er. Wie man im Osten gewinnen kann
Scholz – Russland, Frieden und Polikliniken
Was zur Einheit fehlt
Nachholbedarf bei Eliten
Danke
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Vorbemerkung
Widmung
Gewidmet meiner weitverzweigten Familie
Vorbemerkung
In diesem Buch werden die Begriffe Ostdeutschland und Westdeutschland verwendet, ebenso Osten und Westen. Diese Begriffe dienen als Hilfskonstruktionen, um wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Unterschiede zwischen den Regionen herauszuarbeiten. Ostdeutschland und Westdeutschland sind, anders als die Begriffe suggerieren mögen, keine monolithischen Blöcke, sondern Regionen, reich an Traditionen und Unterschieden. Die dort lebenden Menschen sind – auch untereinander – unterschiedlich und individuell. Saßnitz ist anders als Suhl oder Pirna oder Castrop-Rauxel oder Bad Kreuznach oder das Allgäu. Dennoch verlaufen Trennlinien durch Ost und West, sie markieren zwei Gebiete mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Im Osten wohnen überwiegend Menschen, die existenzielle Umbrüche erfahren haben und durch deren Bewältigung miteinander verbunden sind. Diese Erfahrungen haben viele als gravierend erlebt und über Erzählungen an ihre Kinder und Enkel weitergegeben. Zugleich sind 1990 durch den Einigungsvertrag und in der Zeit danach etwa durch die Treuhand Trennlinien gezogen worden, die gewichtige, die Lebensumstände bestimmende Dinge wie Eigentum und Vermögen, Stimmrechte und gesellschaftliche Diskursmacht betreffen. Sie leben diese Erfahrungen und Erzählungen über Generationen weiter fort.
Einige Gesprächspartner, die in diesem Buch zu Wort kommen, haben darum gebeten, ihren Namen nicht vollständig anzugeben oder zu ändern. Es war selbstverständlich, diesem Wunsch nach persönlicher Diskretion zu entsprechen.
Mit meinem Text sind alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen, auch wenn das nicht immer explizit vermerkt sein sollte.
Vorwort
Dies ist ein persönliches Buch. Ein Buch, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich es mal schreiben werde. Über Ostdeutschland? Echt jetzt?
Ich lebe länger unter wiedervereinten Bedingungen als mit Todesstreifen. Der Mauerfall hat mir Freiheiten gebracht, von denen ich kaum zu träumen gewagt hatte. Ich habe über Umwege meinen Traumberuf gefunden, nach der rechtselbischen Jugend gerne linksrheinisch gelebt und als Europa-Korrespondentin das Lebensgefühl im Westen unseres Kontinents erkundet. Ich bin fasziniert von diesem quirligen Europa und wie es immer wieder gelingt, verschiedene Kulturen von Lissabon bis Sofia an einem Tisch zu versammeln, um Kompromisse zu finden. Ich arbeite für eine überregionale Zeitung, deren Hauptredaktion in München sitzt. Ich habe großen Respekt vor allen, die an demokratischen Prozessen engagiert mitarbeiten. Aber Ost-Aktivistin? Sicher nicht.
Zugleich bin ich tief im Inneren bis heute glücklich und stolz darüber, dass 1989 so viele Menschen so mutig waren, offen gegen das Unrechtssystem zu rebellieren. Noch heute gibt es Momente, in denen mir krass unwirklich erscheint, was damals gelungen ist. Erst kam der Nachbar, mit dem man flüsternd in der Küche beratschlagte, ob man diesen Aufruf für das Neue Forum unterzeichnen sollte. Dann folgten die Demos, auf denen alle für etwas gekämpft haben und nicht gegen etwas. Es gab diese verbindende Zuversicht, etwas Neues zu wagen und dafür vieles zu riskieren, die Liebsten, das Leben. Noch heute berührt mich diese irre ur-demokratische Kundgebung am 4. November 1989, als vom Geheimdienstchef Markus Wolf bis zur Schriftstellerin Christa Wolf jeder, der reden wollte, auf einen Kleinlaster der Marke Barkas klettern konnte und sich das Mikrophon nehmen; als völlig Unbekannte anderen Unbekannten, Sympathisanten oder Gegnern zuhörten und gemeinsam darum rangen, wie es weitergehen sollte. Auf dem Alexanderplatz in Ost-Berlin schien es möglich zu sein, eine neue Gesellschaft bauen zu können, mit Reisefreiheit, freien Wahlen, selbstbestimmt. Man hätte die Welt umarmen können.
Dann übernahm der Markt. Fortan hatte alles einen Preis. Der Traum von Reformen, getragen von einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit, wurde von der Notwendigkeit verdrängt, ruckzuck zu lernen, wie man in einem kapitalistischen System (über)lebt. Die Gemeinschaft zerbröckelte, jeder hatte für sich damit zu tun, für sein Auskommen zu sorgen. Ich zählte zu den Glücklichen, denen der gerade erworbene Berufsabschluss anerkannt wurde. Maschinenbau hatte nichts Ideologisches an sich. Drehmomente, Festigkeiten und Strömungen basieren auf Naturgesetzen – die ja, wie sich später herausstellen sollte, auch in der Politik ihre Wirkung entfalten. Aus meiner Abiturklasse mussten viele neu anfangen. Wer Außenhandel studiert hatte, Ökonomie oder Lehramt, hatte plötzlich ein wertloses Diplom. Menschen aus dem Westen kamen in die Betriebe im Osten und lasen die Namen der Personen vor, die entlassen wurden. 1995 waren vier von fünf Ostdeutschen nicht mehr auf dem Arbeitsplatz, den sie 1990 gehabt hatten.1 In meiner Familie verloren fast alle ihren Job.
Das Virus hat diese Zeit wieder aufleben lassen in den Erinnerungen. Damals war alles ungewiss. Und auch in der Pandemie weiß niemand, wie es sein wird, wenn das Virus besiegt ist. Ob das überhaupt gelingt. Es drängen sich Parallelen zu den Neunzigerjahren auf, wie die Sorge um Arbeitsplätze oder der Wegfall des Alltags. Für viele Ostdeutsche fühlt es sich falsch an, dass die Bundeskanzlerin die Pandemie zur größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ausgerufen hat. Nie habe die Deutschen seither ein schwererer Schlag getroffen. Wirklich? Ja, im westlichen Teil Deutschlands hat es nach 1945 keine gravierenden Umbrüche mehr gegeben. Siemens, Bayer, Volkswagen und andere Unternehmen haben Generationen von Familien ein Auskommen ermöglicht; gute Einkommen, Farbfernseher, Italienurlaub und gar Weltreise schienen selbstverständlich zu sein. Dass aber die aus dem Osten stammende Kanzlerin keine Referenz hinbekommt auf die Umbrüche, die in ihrer Heimat in den vergangenen dreißig Jahren bewältigt wurden, das gibt so einen kleinen Stich. Die bundesdeutsche Wirtschaft ist 2020 um fünf Prozent eingebrochen? Waren es im Osten nicht dreißig Prozent? Eine Million Menschen haben jetzt den Job verloren? Musste sich damals nicht aus jeder Familie mindestens eine Person arbeitslos melden, die Hälfte der Entlassenen einen neuen Job lernen, sich auf die neue Karriereleiter kämpfen? In der Pandemie zahlt der Staat Hunderte Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen. Damals gab es für die Betroffenen weder KfW-Kredite noch Übergangsfristen. Das Startkapital der Ostdeutschen wurde abgewickelt und verscherbelt.
Schon als Europa-Korrespondentin war mir aufgefallen, wie schwer sich die Gründungsmitglieder der EU gelegentlich getan hatten, Beitrittsländer als gleichberechtigt zu akzeptieren. Formal war das natürlich gegeben, alle haben eine Stimme. Tatsächlich wurde aber oft erwartet, dass die Dazugekommenen den Erfahrenen folgten. Der Osten war die verlängerte Werkbank der westeuropäischen Industrie und der große Absatzmarkt für Konsumketten von Mediamarkt bis Brico.
Den europäischen Ost-West-Konflikt habe ich in der deutsch-deutschen Wohngemeinschaft wiedergefunden. Man lebt zusammen, mit gemeinsamer Küche, in der die Rezepte und Konzepte für das wiedervereinigte Land entstehen. Und geht sonst seiner Wege. Das gegenseitige Interesse ist überschaubar, stereotype Bilder sind unverwüstlich.
Angela Merkel wird im Herbst 2021 das Kanzleramt verlassen und auch ein Kapitel des Einigungsprozesses beenden. Man wirft der in Ostdeutschland sozialisierten Kanzlerin oft vor, sie habe keine Visionen gehabt. Womöglich aber war ihre größte Aufgabe, innerdeutsch gesehen, sowieso eine andere: Sie hat ermöglicht, dass sich das Land modernisiert, dass auch Dinge, die in der DDR schon mal funktioniert haben, in den gesamtdeutschen Alltag diffundiert sind. Das Problem aus ostdeutscher Sicht ist, dass sie es vermieden hat, diese auch beim Namen zu nennen und damit den Osten zum bundesdeutschen Maßstab zu machen. Warum eigentlich?
Dreißig Jahre nach der Wende hat eine Reflexion begonnen, in der endlich auffällt, dass gesamtdeutsche Entwicklungen gespiegelt werden an der Referenzgröße alte Bundesrepublik. Die politische Schwarz-Weiß-Fotografie dominiert – dass die Grautöne fehlen, ganz abgesehen von bunten Bildern, scheint kaum jemanden zu stören. Die medialen und politischen Multiplikatoren sind überwiegend westdeutsch sozialisiert, ihre intuitive Sicherheit, dass der Westen die Norm ist und der Osten die Abweichung, spiegelt sich nicht nur in Beiträgen über Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, sondern generell in der immer wieder aufgeworfenen Frage, wie der Osten tickt. Und wie tickt der Westen?
Ich habe beschlossen, dieses Buch zu schreiben, weil es an der Zeit ist, die Debatte offen, bunt und auf Augenhöhe zu führen. Man sollte an den Stereotypen rütteln, weil die Mitbestimmung und Repräsentation der Ostdeutschen in demokratischen Prozessen und in der Wirtschaft organisiert werden muss. Weil die strukturellen Defizite des Einigungsvertrags ausgebügelt werden müssen, um die Demokratie weiter zu verankern. Der Osten besteht nicht nur aus Nazi-Nestern, Stasi-Überwachung oder Ostalgie. Es überwiegt deutlich das Leben dazwischen. Das Leben der übergroßen Mehrheit, die jeden Tag morgens aufsteht und abends noch in den Spiegel schauen kann, deren Alltag genauso lustig, fröhlich oder trist sein kann wie anderswo. Das mag manchen langweilig erscheinen, aber tatsächlich sind diese Menschen zwischen den politischen Rändern die Träger der Demokratie. Das sind drei Viertel der Gesellschaft. Es rächt sich politisch und gesellschaftlich, wenn sie nicht im großen Diskurs vorkommen.
Und, sind wir nicht alle müde von den alten Diskussionen und den vielen Studien? Die Bundesregierung könnte das Papier für jeden weiteren Armuts- und Reichtumsbericht sparen, wenn sie, statt darin vor der Gefahr der Ausgrenzung der Ostdeutschen zu warnen, diese Ausgrenzung zu beseitigen hülfe. 133 Abteilungsleiter aus den westlichen Ländern arbeiten in Bundesministerien, vier aus dem Osten. Keine Bundesbehörde im Osten wird von einem Ostdeutschen geleitet. Der Ossi schweigt verdruckst und verkrümelt sich, weil er meint, sowieso untergebuttert zu werden. Und der Westen vermeidet, die eigene Reformunfähigkeit zu reflektieren. Es läuft nicht rund in der Familie. Besonders schwierig macht den Familienkrach, dass er mit einer Pandemie und einem Superwahljahr zusammenfällt, mit der Bundestagswahl als Höhepunkt Ende September 2021.
Der Ausgang ist so offen wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die Kanzlerin tritt nicht wieder an, das Virus wird nicht bezwungen sein, die Berichterstattung ist zuweilen hart und aufgeregt polarisierend. Die Wählerbindung der traditionellen Volksparteien wird überall schwächer. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ist der große politische Gegner die AfD. Das hat auch mit den Neunzigern zu tun. »Ich sehe in der Mehrheit der östlichen AfD-Wähler vor allem abgewiesene Liebhaber und sitzengelassene Bräute des Westens«, sagt der Schriftsteller Ingo Schulze.2 Sie seien bereit gewesen, alles aufzugeben für den Westen, ohne Ehevertrag zu vertrauen. Der Vertrag zum Beitritt sei dann allerdings kühl ausgefallen, »der Angehimmelte, der alles wusste und konnte (…), behandelte einen ganz anders, als er es versprochen hatte«.
Rein rechnerisch sind die Bürger im Osten eine kleinere Gruppe. Nordrhein-Westfalen hat allein mehr Einwohner als die fünf neuen Länder zusammen. Die Zahl der Wähler ist jedoch nicht allein entscheidend. Ausschlaggebend ist, ob von diesen Regionen Veränderungen ausgehen können, die das ganze Land beeinflussen. Nach dem Mauerfall ist Helmut Kohl dank des Ostens Kanzler geblieben. Gerhard Schröder hat hier die entscheidenden Stimmen geholt. Der Osten ist ein Seismograf für bundesdeutsche Entwicklungen. Er bestimmt nicht, wer Kanzler oder Kanzlerin wird. Aber gegen ihn kann kaum eine/r Kanzler/in werden.
Ob sich die Parteien gut vorbereitet haben? SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz weist stolz einen Wohnsitz in Potsdam vor – einer Stadt, die westlicher erscheint als manche Stadt im alten Bundesgebiet. CDU-Chef Armin Laschet schlägt den Bogen vom Kohlebergbau im Ruhrgebiet in die Lausitz, wird damit aber ebenso wenig überzeugen können wie mit Versprechen, abgelegenen Dörfern des Erzgebirges oder im Thüringer Wald eine Bahn- oder Bus-Haltestelle zu spendieren. Wer sich die Zeit nimmt und von Berlin nach Greifswald mit dem Zug fährt, eine Doppelstock-Regionalbahn, sieht viele neue Haltestellen aus glänzenden Stahlrohren und Glas, die vor vernagelten backsteinernen Bahnhofsgebäuden stehen, die vor sich hin bröckeln. In der Stadt Anklam fällt vor der Bahn-Haltestelle die neue, moderne Zuckerfabrik auf. Und auch eine gemauerte alte Halle, »VEB Zuckerproduktion«, ist in riesigen Buchstaben noch zu lesen. Allenthalben schimmert Unverarbeitetes durch. Die Grünen legen in den neuen Ländern überraschend zu – aber ob das so bleibt?
Bei der Recherche ist aufgefallen, dass die meisten Gesprächspartner, ehemalige Mitschüler aus Freiberg, ostdeutsche Regierungschefs und Regierungschefinnen, einstige Wahlkämpfer, aktive Politiker in Bund und Ländern, Ökonomen, Soziologen, Wissenschaftlerinnen, fast darauf gewartet haben könnten, dass mal jemand nachfragt. Über den Osten und den Westen hat jeder was zu sagen, Erlebtes wie Genervtes oder Fröhliches. Was da alles zum Vorschein kommt!
Aus diesen Gesprächen, kombiniert mit Recherchen und eigenen Erfahrungen, ist eine persönliche Streitschrift entstanden. Lasst uns streiten, wie der Osten die gesamtdeutsche Politik beeinflusst. Wie Strukturen, die mit der Wiedervereinigung geschaffen wurden, aufgebrochen werden können. Dieses Buch soll auch ein Angebot sein für Leser und Leserinnen in den alten Ländern, einzutauchen in den östlichen Landstrich zwischen Darß und Fichtelberg.
»Die Unterschätzten« spiegelt auch das Lebensgefühl der Generation wider, die zum Mauerfall 10 bis 25 Jahre alt waren, die in die Welt zogen und zurückgekehrt sind und sich jetzt sicher genug fühlen, über den Osten reden zu können – ohne als »Ost-Pocke«3 abgetan zu werden. Die deutsche Geschichte ist unvollständig, solange die Geschichten aus und über Ostdeutschland nicht erzählt sind, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Rede zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit gesagt. Voilà.
Berlin, im Juni 2021Cerstin Gammelin
Die wilden 90er
Vom Aufbruch ins Ungewisse, ungewöhnlichen Wegen und ergriffenen Chancen: Ostdeutsch sein heißt improvisieren, wieder aufstehen, mehr Augenzwinkern und ein Gespür für Zwischentöne.
Von der Macht eines ungelösten Widerspruchs
An Ostern 2021 erreicht mich eine E-Mail mit dem Betreff: »Erinnerung an alte Zeiten. Mein Name ist Jens S., wir waren mal in einer Seminargruppe und haben in Chemnitz Werkstofftechnik studiert.« Ah, wie lange ist das her? Munter schreibt er weiter, er habe ein abwechslungsreiches Arbeitsleben hinter sich, er habe ja schon immer reisen wollen, also habe er als frisch diplomierter Maschinenbauingenieur umgeschult auf Reisekaufmann und sei schließlich bei einer Bank gelandet. Willkommen, denke ich. Wieder einer, der nach den Irrungen und Wirrungen angekommen ist. Wieder einer, der seine Geschichte loswerden will.
Und dann fällt mir auf, wie abstrakt dieser Lebenslauf klingt. Und wie selbstverständlich. Ganz anders, als es sich damals angefühlt hat, als alles durcheinander war. Die Neunzigerjahre waren turbulent, unsicher, chancenreich und voller Risiken zugleich. Man hat sich Dinge getraut, weil man jung war und zuversichtlich. Hier soll erzählt werden von oftmals Unterschätzten und darüber, dass es von dramatisch bis kurios in den Nachwendejahren viele Entwicklungen gab. Wie aus dem Nichts Chancen entstanden und manche davon beim Schopfe gepackt wurden. Und dass manches schwieriger zu bewältigen war, als es hätte sein müssen.
Es waren aber auch die Jahre, in denen die innerdeutsche Debatte endgültig in ein seltsames Fahrwasser geraten ist. Es waren ja die DDR-Bürger, von denen ausreichend viele mutig vorangegangen waren und die noch mehr mitgezogen und irgendwann die Mauer eingerissen und sich bewusst auf den demokratischen Weg gemacht hatten – und die wurden plötzlich als Verlierer wahrgenommen? Bis heute ist dieser Widerspruch weder ausreichend thematisiert noch aufgelöst worden. Stattdessen hat sich so ein verstocktes Beharren breitgemacht. Die einen meinen, mit ihrem Steuergeld seien die wenn nicht blühenden Landschaften, aber doch neuen bunten Marktplätze im Osten finanziert worden. Die anderen weisen auf verlorene Jobs hin und fragen provokativ nach, wem denn die Häuser mit den bunten Fassaden gehören. Eben! Es ist überfällig, dass hier eine neue Debatte beginnt, denn sie hilft, diesen Widerspruch in der jüngeren deutschen Geschichtsschreibung aufzulösen, den Rechtsnationale mit ihren ostdeutschen Verlierergeschichten und deren Geschichten gegen das vermeintliche westdeutsche Establishment für sich auszuschlachten versuchen. Der AfD-Slogan »Vollende die Wende« hätte nicht diese Anziehungskraft, würden die Erzählungen der Ostdeutschen über die Jahre nach dem Mauerfall auch als Erfahrungsberichte betrachtet. Und würden die sensiblen Antennen von Generationen wahr- und ernst genommen, die schon mal erfahren haben wie Stimmungen entstehen, die zu Umbrüchen führen können. Was da so zu erzählen wäre?
Vom Kinderwagen zur Stereoanlage
Es passiert ja gelegentlich, dass man in die Stadt geht, um einen Mantel zu kaufen und mit Schuhen heimkommt. Vielleicht hat es kein passendes Modell gegeben oder man war einfach an diesen Schuhen vorbeigekommen und musste sie einfach kaufen. Es sind »Fehlkäufe« wie diese, die mich jedes Mal an jenen erinnern, der am 10. November 1989 unerwartet alle Sachen im Schrank nutzlos machte und zum Symbol für meine ersten Schritte in das neue System wurde.
In der Nacht, in der in Berlin die Mauer fiel, träumte ich von einem Kinderwagen. Ich lebte in Neuruppin, eine gute Autostunde nordwestlich von Berlin. Wir waren am Abend sehr früh schlafen gegangen, weil wir noch in der Nacht aufbrechen wollten nach Berlin, zum Centrum-Warenhaus am Alexanderplatz, wo für den 10. November 1989 eine Lieferung Kinderwagen angekündigt war. Ich war jung, im neunten Monat schwanger und brauchte einen Kinderwagen. Die aber gehörten in der DDR zur Mangelware, also zu den Gütern, die es nur im Tausch gegen andere rare Dinge gab oder sehr selten im Laden – wie an jenem 10. November 1989. Vier Wochen vor dem Geburtstermin wollten wir am Alexanderplatz ganz vorne in der Schlange stehen, um eine Chance zu haben. Schweigend fuhren wir in der nächtlichen Dunkelheit über Pankow rein nach Berlin, Hauptstadt der DDR. Als wir an einer roten Ampel halten mussten, glaubte ich für einen Moment, noch zu träumen. Da stand ein Mann an der Fußgängerampel, der so in eine breit aufgeschlagene bunte Zeitung vertieft war, dass er gar nicht bemerkte, dass das Licht längst auf Grün gesprungen war.
Der Mann las Bild.
Schlagartig bin ich wach. Die Bild, in aller Öffentlichkeit. Hat er keine Angst, vor der Polizei, vor Denunziation? Irgendwas stimmt da nicht. Wir schalten das Radio ein. Die Mauer ist offen? Kein Irrtum? Das müssen wir selbst sehen. Der Kinderwagen? Ach, später! Wir fahren zur Friedrichstraße, Tränenpalast, ein Polizist will den blauen DDR-Ausweis sehen und drückt einen pfenniggroßen Stempel oben auf die erste Seite neben dem Passbild. Und schon stehen wir inmitten aufgekratzter Menschen auf dem S-Bahnsteig, von dem die Züge rüberfahren.
Wir können jetzt sofort in den Westen fahren! Wahnsinn. Aber: Es ist auch ein komisches Gefühl dabei. Ich schaue meinen dicken Bauch an. Dürfen wir wieder zurück? Und wo sollten wir überhaupt hinfahren? Wir hatten ja keine Ahnung, was sich hinter den S-Bahn-Stationen jenseits des Todesstreifens verbirgt. Wald? Stadt? Siedlungen? Wir gehen die Stationen durch, halt, Wedding, da hatte doch Ernst Thälmann gewohnt, der im KZ ermordete KPD-Führer. Etwas Vertrautes. Wir steigen im Wedding aus, gehen die Treppen hoch – und sehen Menschen mit Hotdogs, bunte Schaufenster, Leuchtreklame, das also ist der Westen. Im Rathaus gibt es 100 DM. Für jeden. Der da, sagt der Mann am Schalter und zeigt auf meinen Kugelbauch, grischt noch nüschtt, der iss ja noch nüsch da.
Wir halten 200 DM in den Händen. Und jetzt? Karstadt im Wedding nimmt uns die Entscheidung ab. Wir kaufen eine komplette Stereoanlage mit Boxen und Plattenspieler für 189 DM. Noch heute sehe ich uns mit den Kisten wieder zur S-Bahn eilen, es war inzwischen mittags, wer wusste schon, wie lange die Mauer offenbleiben würde.
Zurück am Bahnhof Friedrichstraße spricht uns ein japanisches Fernsehteam an. Ich trage den hellblauen Anorak meines Mannes, damit der Bauch hineinpasst, Schwangerschaftsklamotten gibt es ja kaum. Wir sind wegen des suchenden Blicks, der Kleidung und auch der Kisten unverkennbar Ossis, die im Westen einkaufen waren. Perfekt für die Fernsehleute. Sagen Sie uns, wo Sie herkommen? Also, aus Neuruppin. Der Fragesteller reagiert leicht genervt. Nein, wo Sie jetzt gerade herkommen, bitte noch mal. Ich stelle mich also gerade hin, Kamera an: Wir kommen aus dem Wedding und haben eine Stereoanlage gekauft. Loriot in echt.
Es berührt mich heute, wie naiv und verletzlich wir im grellen Licht der Westscheinwerfer ausgesehen haben müssen. Im Erdkunde-Unterricht hatten wir die Kohlereviere von Kansk-Atschinsk durchgenommen. Ich kannte die russische Stadt im Südwesten der Region Krasnojarsk im Kohlebecken; ich wusste, dass man die Elemente des Doppelnamens vertauscht hatte, um nicht zweimal K nacheinander sprechen zu müssen, so klingt der Name melodischer. Die Stadtbezirke West-Berlins dagegen waren absolutes Neuland für mich. Unser Leitmotiv im Leben sollte der gesetzmäßige Sieg des Sozialismus sein. Und siegen lernen hieß, von der Sowjetunion lernen – und nicht die andere Seite von Berlin zu kennen.
Es war der erste Schritt in das neue System – und schon war klar, dass wir irgendwie yesterday waren. Was wir wussten, wollte niemand mehr wissen. Es war okay, aber nutzlos, sich in sowjetischen Kohlerevieren auszukennen. Viel Wissen und Fähigkeiten waren über Nacht obsolet geworden. Wie oft hatten Großeltern ausgekundschaftet, wann Kaufhäuser Warenlieferungen erwarteten und sich dann rechtzeitig angestellt, um Frottee-Handtücher oder einen Samtpullover zu ergattern. Das geduldige Schlangestehen war nicht mehr gefragt, ganze Tagesabläufe, Routinen und Fertigkeiten waren plötzlich passé.
Vor allem aber ließen wir uns verführen, mitreißen vom Konsumangebot. Klar, wir brauchten einen Kinderwagen. Aber dann stand da diese Stereoanlage, mit Plattenspieler. Dieser so unnötige wie übermütige Kauf symbolisierte, dass unser Leben auf dem Kopf stand. Fortan waren wir beschäftigt, die Nerven zu behalten.
Wer die Ostdeutschen sind
In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Februar 2021 den Begriff »Ossi« für Ostdeutsche definiert: »Ich scheue mich auch nicht zu sagen, ich habe eine ostdeutsche Identität. Das stößt bei dem einen oder anderen ein bisschen auf, so eine Liebe zur DDR. Nein, das ist es nicht, ich bin sehr froh, dass dieses Unrechtssystem beendet ist. Aber die Erfahrungen in dieser Diktatur, die Erfahrungen danach, das ist eben etwas, was uns verbindet. Was uns auch stark macht. Von daher habe ich kein Problem zu sagen, wir sind auch Ostdeutsche.«4 Kretschmers Definition schließt nachwachsende Generationen mit ein, denn auch nach dem Mauerfall sind die Erfahrungen im Osten des Landes spezifisch und werden auch transgenerational weitergegeben. Sie ist zudem treffender als die Einteilung nach Geburtsjahren oder -orten.
Wichtig ist, dass die Ostdeutschen diese Identität weder erfinden noch haben wollten. Die Bürger in den neuen Ländern haben sich zur frühen Wendezeit nie als Ostdeutsche definiert. Diese Kohorte hat sich erst einige Jahre nach der Wiedervereinigung begonnen herauszubilden, als die Menschen im Osten sich bewusst wurden, dass ihre Lebensverhältnisse und Erfahrungen nicht kompatibel waren mit denen der Bürger in den westlichen Regionen – und auch nicht mit den aus dem Westen kopierten Strukturen. »Die Spezies ›ostdeutsch‹ ist erst ein Ergebnis von suboptimal gelaufener Binnenkommunikation in Deutschland und vieler Sorgen, die nach der Wiedervereinigung kamen«, meint der sachsen-anhaltische Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Wenn ich heute E-Mails von Lesern bekomme als Reaktion auf Artikel mit ostdeutschen Themen, steht oft der Name darunter und, mit Komma getrennt, »Ossi«. Es berührt und erschreckt mich zugleich.
Die DNA des Ostdeutschseins ist in den Verträgen und dem Ablauf der Wiedervereinigung angelegt worden. Diese wurde im Sinne der Übernahme der DDR durch die BRD vollzogen, die zugleich scharfe Trennlinien zwischen Ost und West manifestierte; bei den Löhnen, der Verteilung des Steueraufkommens, beim Eigentum und der medialen Hoheit von westdeutschen Verlagen und Sendeanstalten sowie Stimmrechten, etwa in der Verfassung. Damals wurden die Bund-Länder-Beziehungen neu geregelt, ohne dass die neuen Länder hätten mitreden können. Sie waren noch gar nicht gegründet. Die Trennlinien sind mit den Jahren sichtbarer geworden. Sie tragen dazu bei, dass das Land mental und gesellschaftlich geteilt wahrgenommen wird. Jene Bürger, die sich durch Umbrucherfahrungen verbunden fühlen und die anderen, die sich in der BRD seit 1949 als Deutsche gefühlt haben. Reiner Haseloff kann den Befund mit Studien untermauern: »Wir machen seit vielen Jahren unseren Sachsen-Anhalt-Monitor. Da wird auch die Identifikation mit abgefragt: Fühlst du dich als Harzer oder als Anhalter oder Deutscher oder Europäer? Und in den ersten Jahren gab es die Spezis Ostdeutscher überhaupt nicht. In der neuesten Version ist sie nach der regionalen Abfrage die mit der höchsten Punktzahl. Noch vor Sachsen-Anhalt, wo wir Gott sei Dank auch bei 76 Prozent sind«. Wie man da rauskommt, ist klar: Verschwinden die Trennlinien, löst sich auch die Klassifizierung nach Ost und West auf. Wie man diese Linien verschwinden lassen kann, darum geht es in diesem Buch.
Berlin als Symbol des westlichen Selbstverständnisses
Berlin spielt eine herausgehobene Rolle im Prozess der Vereinigung. Die Mauer als symbolische Trennlinie ist verschwunden, an der ehemaligen Grenze kann man heute entlangspazieren oder -joggen. Mitte der Neunzigerjahre bin ich aus Neuruppin nach Charlottenburg gezogen, ich hatte genug von den Wirren im Osten und wollte dahin, wo es feste, funktionierende Strukturen zu geben schien. Also Charlottenburg, im Westteil Berlins. Es war nett, gediegen, freundlich – aber irgendwie fehlte mit der Zeit etwas. Und als es eine schöne Wohnung in Mitte gab, also in dem Stadtteil, der vielleicht am meisten vermischt und bunt ist in Berlin, zog ich zurück in den Osten, ohne den Westen verlassen zu müssen. Es fühlte sich richtig an. Die Bundeshauptstadt ist ja auch das Symbol für ein Paradoxon. Einerseits liegt sie im Osten des Landes. Gleichzeitig wird sie den alten Ländern zugerechnet. Dass die Stadt Berlin geteilt war und geographisch im Osten liegt, scheint oft kein Grund zu sein, sie auch dort zu verorten und als sechstes neues Bundesland zu zählen.
Ist das nicht ein Irrtum? Ich frage an bei dem Macher des Einigungsvertrags (»Da bin ich heute noch stolz darauf, dass das meine Idee war«) und Präsidenten des 19. Bundestags Wolfgang Schäuble (CDU). Er ist gerade zu Hause in Offenburg und erholt sich auf der Terrasse in der Sonne; man plaudert am Telefon entspannt über Regierungskoalitionen, die erstmals in den neuen Ländern erprobt wurden, Kenia beispielsweise und Rot-Rot-Grün. Ist der Osten nicht ein einziges Demokratie-Lab? Ein Vorreiter und Seismograf für politische Entwicklungen?
Schäuble widerspricht. Man dürfe das jetzt nicht übertreiben mit der demokratischen Innovationskraft des Ostens. »Wir haben Rot-Rot-Grün auch in Berlin«. Ja, sicher, antworte ich erstaunt. Berlin hätte ich jetzt mal Ostdeutschland zugeschlagen. Damit hat Wolfgang Schäuble nicht gerechnet. »Ich bitte Sie«, sagt er. »Die ehemalige Frontstadt. Unsere Bundeshauptstadt. Hier war der Umgang mit der Linkspartei noch mal schwerer als in den neuen Ländern«. Es ist ein fröhliches kleines Geplänkel zwischen Ost und West. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Wolfgang Schäuble es gar nicht so lustig findet. Insbesondere seinem Einsatz ist es ja zu verdanken, dass sich im Juni 1991 nach einer hoch emotionalen Debatte im Bonner Wasserwerk eine Mehrheit im damaligen Bundestag für den Umzug der deutschen Hauptstadt nach Berlin ausgesprochen hatte. Dass er die deutsche Hauptstadt aber dem Osten zuschlagen soll, das geht ihm dann doch zu weit. Berlin ist immer noch das gefühlte Bollwerk der Demokratie im Osten.
Wie alle anderen hat auch ein Wolfgang Schäuble, 1942 geboren und seit 1972 ununterbrochen für die CDU Abgeordneter des deutschen Bundestags, sein Weltbild. Dieses kann man launig finden. Oder gestrig. Oder ideologisch. Die Reaktion des erfahrensten Politikers im Bundestag lässt das Beharrungsvermögen erahnen, das bis hoch in die Spitzenpositionen in Verwaltungen und Politik noch anzutreffen ist und leicht ins Grundsätzliche gleitet. »Ein Stück weit ideologisch« zu sein, räumt Schäuble selbst ein.
Aber die realen Umstände in Berlin sind nun mal andere. Wenn man davon ausgeht, dass die alten Länder bereits vor dem Mauerfall existierten, dann sind die neuen Länder diejenigen, die nach der Wiedervereinigung entstanden sind. Da sich das heutige Land Berlin erst nach dem Mauerfall gebildet hat, ist es also zweifelsohne neu.
Die Pandemie als andere Wiedergängerin der Wende
Viele Menschen haben ein paar Jahre lang gar nicht mehr so nachgedacht darüber, wie sie mit und nach der Wende lebten. Dass es jetzt wieder passiert, liegt auch an der Pandemie, die wie ein Verstärker der damaligen Erfahrungen wirkt. Die Wiedervereinigung bewirkte, dass scheinbar Banales vorbei war. Der tägliche Arbeitsweg – war weg (genau wie der Job selbst). Alte Freunde auch, die in den Westen gingen und die Datsche am See, weil der Alteigentümer zurückkam, der einst in den Westen geflohen war. Und jetzt in der Pandemie? Die Auswirkungen auf den Alltag sind sehr ähnlich. Die Eltern oder Großeltern oder Freunde besuchen, ein Konzert, ein Restaurant – unmöglich. Viele Ostdeutsche fühlen sich an das Leben in der Wendezeit erinnert, empfinden aber die Einschränkungen heute als weniger drastisch. Ich habe für dieses Buch mit einigen früheren Mitschülerinnen gesprochen, mit denen ich bis zur 8. Klasse in der Maxim-Gorki-Schule in Freiberg gelernt habe. Alle haben sehr viel zu erzählen, wollen aber nicht alle mit ihrem Klarnamen auftauchen. Die Stimmung sei politisch zu aufgeheizt, als dass sie erkannt werden wollten. Die Stimmen hier im Buch sind ein Querschnitt durch die Klasse. Meine ehemalige Mitschülerin Tina A., die jetzt in einer sächsischen Großstadt lebt, sagt: »Corona erinnert mich an die Wende. Und ich finde, wir sollten jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. So schlimm sind die Einschränkungen nicht. Ich brauche nicht das gesamte Angebot an Südfrüchten jeden Tag, ich komme auch mal mit einer Gurke aus. Ich komme mit den eingeschränkten Einkaufsmöglichkeiten klar. Ich mag übermäßigen Konsum nicht. Weihnachten habe ich es sogar genossen, dass es nicht so viel Blingbling gab. Was ich vermisse, sind das Kino und die Freunde.«
Es ist manchmal irritierend, dass in der Pandemie leidenschaftlich debattiert wird über Einschränkungen und Ausfälle, die vor 30 Jahren in der Nachwendezeit kaum eine Nachricht wert waren, obwohl Millionen Menschen sie durchmachen mussten, etwa abgebrochene Ausbildungen, nicht abgeschlossene Studien, neue Schulfächer. Aus dieser Erfahrung heraus wissen die transformationserfahrenen Ostdeutschen, dass durcheinandergewirbelte Dinge wieder in eine Ordnung finden können. Und deshalb sieht das, was gelegentlich als Misere, Totalversagen der Politik oder GAU beschrieben wird, oft wie ein Krisenbonsai aus, setzt man es ins Verhältnis zu Ereignissen in der Vergangenheit wie den Umbrüchen nach der Wende oder dem Zweiten Weltkrieg. Ja, die Bildungspolitiker haben in der Pandemie dramatisch viel falsch gemacht.5 Es wäre rückblickend zu vermeiden gewesen, dass Kinder während der Pandemie so wenig gelernt haben und sie besser ein Schuljahr wiederholen sollten. Man kann diese Rückstände aber aufholen, lebensverändernd müssen sie in den meisten Fällen nicht sein. Angesichts des Umstands, dass in Diktaturen die Jugend niemals frei war, ihren Traumberuf zu erlernen oder die Welt zu erkunden oder dass nach der Wende einige Millionen Menschen im Erwachsenenalter neue Abschlüsse machen mussten oder anderswo auf der Welt Kinder in Flüchtlingslagern leben, relativiert sich das Drama zu Hause.
Wolfgang Schäuble sieht die Ostdeutschen in der Pandemie im Vorteil. Weil sie Erfahrungen mitbringen, die man im Westen nicht kennt. Das stimmt – zur Hälfte. Umbrüche erlebt zu haben heißt ja nicht, dass man schon wieder voll ins Risiko gehen mag. Die Menschen befürchten vor allem, dass sie erneut in eine passive Rolle gedrängt werden könnten, fremdbestimmt. Tina A. sagt zu diesem Szenario: »Die Leute haben Angst um ihre Zukunft, sie wissen, wie es zu Wendezeiten war. Die Arbeitsplätze sind weggefallen damals und jetzt geht ein bisschen die Panik um, dass es in ein paar Monaten wieder um meine Existenz gehen könnte und um meinen Job. Am Wochenende sind wir mit dem Rad rumgefahren, auch in ein kleines Dorf. Da war eine kleine Eisdiele, da steht jetzt ein Schild, zu verkaufen, die wird es also nicht mehr geben. Wir sind die Generation, die es schon mal erlebt hat, wie es ist, wenn Firmen zusammenbrechen. Auch solche, die eine Existenzberechtigung hatten und trotzdem abgewickelt oder verkauft wurden. Und jetzt bei Corona kann es auch welche treffen, die vorher gesund waren«.
Generation Umschulen
Weil die alte Bundesrepublik die Regeln des neuen Systems vorgegeben hatte und man diese im Osten zügig verstehen musste, fühlten sich die damals 18 bis 30 Jahre alten Jungen weniger als Generation des Aufbruchs denn als Generation Umschulen. Hinzu kam anfänglich auch eine Scheu, offen mit der Herkunft umzugehen. Viele, die weggegangen sind und in den Westen übersiedelten, mussten mit dem Gefühl fertig werden, weder zur einen noch zur anderen Seite zu gehören. Das beste Beispiel dafür ist wohl Angela Merkel. Der CDU-Politikerin habe immer der Stallgeruch gefehlt, ist in der Union zu hören. Sie ist keine von uns, hört man im Osten. Seit 2019 ist zu beobachten, dass mehr Ausgereiste in die neuen Länder zurück- als wegziehen. Es mag romantisch verklärt sein, aber es hat auch einen Touch von Wärme, heimzukommen nach den Abenteuern.