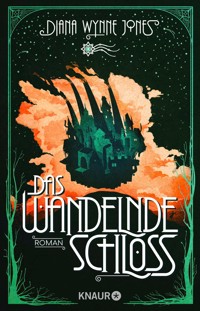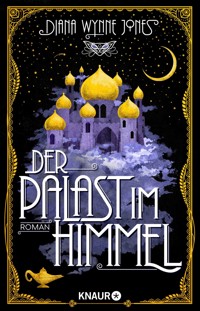9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein außergewöhnlicher Roman über Kindsein, Geschichten, Magie und die Macht der Fantasie. Eines Tages erkennt Polly Whittacker, dass sie zwei Erinnerungen hat. In einer ist ihr Leben trostlos, langweilig und öde. In der anderen Erinnerung gibt es da jemanden, den charmanten, etwas schusseligen Musiker Tom Lynn. Mit ihm schreibt sie Briefe, tauscht Bücher und denkt sich Geschichten und Abenteuer über mutige Heldinnen und wilde Bestien aus. Tagträume, die sich langsam einen Weg in die Realität bahnen. Wie nur konnte sie ihn vergessen? Mithilfe eines gestohlenen Gemäldes erkennt Polly, dass Toms Leben in Gefahr ist. Nur, wenn sie ihre gemeinsamen Geschichten durchschaut, kann sie ihn retten. »Die verborgene Geschichte des Tom Lynn« ist ein Fantasy-Roman voller Magie und Geheimnissen – und höchst ungewöhnlichen Tagträumen. »Eines der besten Bücher seit langem. Eine Reminiszenz an Tolkien und T.S. Eliot.« The Bulletin of the Tolkien Society Lust auf mehr magische und märchenhafte Geschichten? Von Diana Wynne Jones sind folgende Titel auf Deutsch erschienen: - »Das wandelnde Schloss« (Howl-Saga 1) - »Der Palast im Himmel« (Howl-Saga 2) - »Das Haus der tausend Räume« (Howl-Saga 3) - »Fauler Zauber«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Ähnliche
Diana Wynne Jones
Die verborgene Geschichte des Tom Lynn
Roman
Aus dem Englischen von Wolf Harranth
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Ein außergewöhnlicher Roman über das Kindsein, Geschichten, Magie und die Macht der Fantasie.
Eines Tages erkennt Polly Whittacker, dass sie zwei Erinnerungen hat. In einer ist ihr Leben trostlos, langweilig und öde. In der anderen Erinnerung gibt es da jemanden, den charmanten, etwas schusseligen Musiker Tom Lynn. Mit ihm schreibt sie Briefe, tauscht Bücher und denkt sich Geschichten und Abenteuer über mutige Heldinnen und wilde Bestien aus. Tagträume, die sich langsam einen Weg in die Realität bahnen. Wie nur konnte sie ihn vergessen? Mithilfe eines gestohlenen Gemäldes erkennt Polly, dass Toms Leben in Gefahr ist. Nur, wenn sie ihre gemeinsamen Geschichten durchschaut, kann sie ihn retten.
Inhaltsübersicht
I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
II
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
III
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
IV
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Coda
Coda
I
Für alle Zeit
1
Ein tiefer Schlaf kam über mich,
da stürzte ich vom Pferd.
Tam Lin
Polly seufzte und legte das Buch aufgeschlagen hin. Ihr war, als habe sie es schon einmal gelesen, irgendwann. Bevor sie die Beine aus dem Bett schwang und mit dem Packen weitermachte, schaute sie zu dem Bild hinauf, das über dem Bett hing. Wieder seufzte sie. Es hatte eine Zeit gegeben, vor einigen Jahren, da hatte sie das Bild betrachtet und es wundersam gefunden. Damals schien es ihr, als würden aus der dunklen Bildmitte unheimliche Gestalten auftauchen – kräftige, unheimliche Gestalten in vollem Lauf –, immer mindestens vier, die angerannt kamen, um die Flammen im Vordergrund zu löschen. Manchmal ließen sich die Gestalten ganz deutlich erkennen. Dann wieder verdeckte sie der aufsteigende Rauch. Gelegentlich war sogar ein Pferd dabei. Nicht jetzt.
Was sie jetzt und hier sah, war nichts weiter als ein auf neunzig mal sechzig Zentimeter vergrößertes Farbfoto, brennende Heuballen in einem Feld, aufgenommen in der Abenddämmerung. Das Feuer hatte sich wohl rasch ausgebreitet, denn in der Luft hing Rauch, und auch den Schierling im Vordergrund hüllten Rauchschwaden ein. Aber es gab keine Menschen auf dem Bild. Was Polly früher für Menschen gehalten hatte, waren unverkennbar nur die dunklen, klumpigen Umrisse der schwarzen Hecke hinter dem Feuer. Außer dem Fotografen war bestimmt niemand auf jenem Feld gewesen. Jedenfalls, fand Polly, hatte er diesen Glücksfall geschickt genutzt. Das Bild übte eine magische Wirkung aus. Es hieß Feuer und Schierling.
Noch einmal seufzte Polly und wollte endgültig vom Bett klettern. Das war eben die Strafe fürs Erwachsenwerden: Man sah Dinge wie diese Fotografie nur noch als das, was sie wirklich waren. Und gleich würde Oma kommen und »bloß gesagt haben wollen, dass man nicht mit den Schuhen auf der Bettdecke …« – und dass Mr Perks und Fiona morgen früh auf keinen Fall warten würden, bis Polly fertig gepackt hatte.
Warum konnte der Gedanke an ein weiteres Jahr im College Polly nicht wenigstens ein bisschen fröhlicher stimmen?
Ihre Hand stieß an das Buch. Polly stand nun doch nicht auf.
»Und wer ein Buch mit aufgeschlagenen Seiten hinlegt, ruiniert es«, würde Oma sagen. Es ist doch nur ein Taschenbuch, Oma.
Es hieß Hirngespinste – Erzählungen, herausgegeben von L. Perry. Eine Sammlung übernatürlicher Geschichten. Damals hatte Polly zunächst fasziniert danach gegriffen, nicht zuletzt, weil das Bild auf dem Umschlag dem Feuer-und-Schierling-Foto so ähnlich sah: Rauch in der Abenddämmerung; und davor ein dunkelblauer schirmförmiger Strauch. Aber dann, erinnerte sie sich jetzt, hatte sie die Erzählungen gelesen und allesamt eher schwach gefunden. Eines freilich war seltsam: Polly hätte schwören können, dass das Buch früher einen anderen Titel gehabt hatte! Und, ja doch, hatte nicht eine Geschichte tatsächlich Feuer und Schierling geheißen?
Polly nahm das Buch wieder zur Hand und legte den Finger zwischen die Seiten, um nicht die Stelle zu verlieren, an der sie vorhin aufgehört hatte: Doppelzeit, eine Erzählung, in der jemand in die eigene Kindheit zurückkehrte und den Lauf der Dinge so beeinflusste, dass sein Leben beim zweiten Mal eine andere Wendung nahm. Jetzt fiel ihr auch wieder ein, wie die Sache ausging: Der Mann hatte zuletzt zwei Erinnerungen, und das Ganze war schlecht konstruiert. Polly machte sich nichts daraus, dass sie die Seite nun doch verblättert hatte, und sie suchte stattdessen jene Geschichte, die ihrer Meinung nach Feuer und Schierling geheißen hatte. Seltsam, es gab sie nicht! Sollte sie das alles nur herbeigeträumt haben?
Sie dachte sich oft etwas aus, das ihr dann völlig realistisch schien. Noch seltsamer war, dass gut die Hälfte der Erzählungen fehlte, an die sie sich noch zu erinnern glaubte – trotzdem erkannte sie auch alle jene wieder, die das Buch jetzt enthielt. Für einen Augenblick kam sie sich beinahe vor wie der Mann von Doppelzeit mit seiner zweifachen Erinnerung. Wie präzise, mit allen Details, musste sie als Kind geträumt haben!
Polly fand die richtige Stelle nun doch wieder, weil das Buch dort ein wenig aufklaffte, und wollte es schon flach auf die zerknautschte Bettdecke legen, hielt aber plötzlich inne. Hatte wirklich Oma etwas dagegen, dass man ein Buch so behandelte? Oma las doch kaum.
»Ach, wenn schon, warum mache ich mir darüber so viele Gedanken?«, fragte sich Polly laut. »Und wo ist eigentlich das andere Foto – das gestohlene?«
Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass ihr etwas abhandengekommen war, und das bedrückte sie so sehr, dass sie hätte weinen können. Warum stimmten ihre Erinnerungen auf einmal nicht mehr mit den Tatsachen überein?
»Angenommen, es waren einmal Tatsachen«, sagte sie. Ihre Hand lag immer noch auf dem Buch. Von frühester Kindheit an hatte es ihr Spaß gemacht, sich etwas auszudenken. Und eine solche Gewohnheit legt man auch mit neunzehn nicht leicht ab. »Angenommen, mir geht es wirklich so wie dem Mann in der Geschichte, und irgendetwas ist geschehen, das meine Vergangenheit verändert hat.«
Das war nur als Trostpflaster gemeint, als ein Tagtraum, der ihr hinweghelfen sollte über die seltsame, grundlose Unruhe, von der sie immer stärker beherrscht wurde. Aber plötzlich sprang sie aus diesem Tagtraum wie ein weißer Blitz eine Gewissheit an, ganz so, wie auf dem Foto gelegentlich jene vier – oder mehr – Gestalten hinter dem Feuer hervorgesprungen waren. Polly schaute zu dem Bild hinauf, als erwarte sie, die vier wiederzusehen. Da war nichts. Nur eine Hecke mit menschenähnlichen Schattenklumpen. Und auch von der blitzartigen Gewissheit war nichts mehr zu spüren.
Stattdessen war Polly jetzt auf eine beklemmende, nagende Weise misstrauisch geworden: Etwas in ihrer Vergangenheit war anders gewesen, und dass sie sich nicht mehr daran erinnern konnte, hatte sie selbst verschuldet.
Wie sollte sie aber herausfinden, was es gewesen war? Ihr Leben hatte doch nur aus einer glatten Abfolge ganz gewöhnlicher, schon halb vergessener Ereignisse bestanden: in der Schule und daheim, Glück und Unglück, Spaß mit Freunden – und aus unersichtlichem Grund fiel ihr jetzt ein, dass sie einmal von Butter triefende ofenwarme Hörnchen gegessen hatte. Abgesehen von dieser seltsamen Sache mit dem Buch gab es nicht den geringsten Anhaltspunkt für etwas Ungewöhnliches.
»Wenn da nichts war, gibt es eben auch nichts zu erinnern«, philosophierte sie vor sich hin. »Und natürlich auch nichts, womit ich beginnen könnte.« Doch das fand sie eigentlich erschreckend.
Ohne auf ihre schmutzigen Schuhe zu achten, hockte sie sich wieder aufs Bett, die feucht gewordene Hand auf dem Buch. Auch der offene Koffer auf dem Boden war vergessen. Polly richtete den Blick nach innen, auf ihre so erschreckend gewöhnlichen Erinnerungen: eine Kleinstadt in den Cotswolds, London, ein Einkaufszentrum, ein Pferd …
»Das ist absurd, ich hatte doch nie was mit Pferden zu schaffen«, sagte sie. »Nein, so geht das nicht. Ich muss weiter zurück. Bis zu dem Punkt, bevor alles anfing – oder nicht anfing.«
Wie alt war sie damals? Zehn? Was hatte sie zu der Zeit gemacht? Mit wem war sie befreundet gewesen?
Freundinnen. Da hatte sie ja ihr Stichwort. Über eine Zeitspanne von neun Jahren tauchte verschwommen die Gestalt von Nina auf, damals Pollys beste Freundin. Die dicke, heitere Nina. Polly war von Nina so hingerissen gewesen, dass Oma sich überreden ließ und Nina mitkommen durfte, als Polly zum ersten Mal bei Oma einzog. Das musste etwa um jene Zeit gewesen sein, als Pollys Eltern anfingen, von Scheidung zu reden. Und als Hero und Leander Pollys Lieblingsbuch war.
Polly legte den Kopf in den Nacken. »Die Trauerfeier!«, sagte sie.
2
Ihr Mädchen mit dem goldnen Haar,
schlagt es euch aus dem Sinn,
in Carterhaugh des Wegs zu gehn,
denn dort ist Jung-Tam Lin.
Tam Lin
Wer Polly nicht kannte, hätte damals meinen müssen, sie habe Nina nur zur Freundin gewählt, weil sie sich so vorteilhaft von ihr unterschied. Nina war ein großes, dickes Mädchen mit kurzen Locken, einer Brille und lautem Lachen. Polly hingegen war klein und außerordentlich hübsch; das Schönste an ihr waren wahrscheinlich die langen, seidig blonden Haare. Und doch bewunderte und beneidete Polly Nina maßlos, sowohl um ihr Aussehen als auch um ihre freche, fröhliche Art. Polly würgte damals jeden Tag eine komplette Packung Kekse hinunter, um so dick zu werden wie Nina. Und stundenlang drückte und rieb sie hingebungsvoll an ihren Augen herum, weil sie dann vielleicht auch eine Brille brauchen würde oder wenigstens jenen rosigen Blick bekam, mit dem Nina in die Gegend starrte, sobald sie die Brille abnahm. Polly weinte, als ihr die Mutter verbot, sich die Haare so kurz wie Nina zu schneiden. Sie fand ihre eigenen Haare abscheulich. Sobald sie bei Oma eingezogen war, »vergaß« sie mit größtem Vergnügen, sich die Haare zu bürsten.
Polly und Nina hatten die halbe Nacht in Omas Gästezimmer getuschelt und gealbert. Und Polly war froh, den heimlichen Wortgefechten ihrer Eltern entkommen zu sein und der plötzlichen verlogenen Stille, sobald Polly ins Zimmer kam. Warum glaubten sie, dass ausgerechnet Polly nicht merken würde, dass es Streit gegeben hatte? So etwas bemerkte doch jeder. Bei Oma konnte sich Polly erholen, denn Oma war die Ruhe in Person. Und noch erholsamer fand Polly Ninas Witze – wenngleich sie dann am nächsten Morgen kaum die Augen aufbrachte. Überhaupt hatte Polly diesen ersten Tag bei Oma wie einen einzigen Traum empfunden.
Es war ein stürmischer Herbsttag. In Omas Garten wirbelten die Blätter von den Bäumen. Nina und Polly sprangen fröhlich herum und haschten nach ihnen. Jedes im Flug gefangene Blatt, rief Nina, würde einen Glückstag garantieren. Nina ergatterte fünfunddreißig, Polly nur sieben.
»Nimm’s nicht so tragisch, das ist immerhin eine ganze Woche«, sagte Oma trocken, als die beiden angekeucht kamen, und sie gab ihnen Milch und Kekse. An Oma und an Kekse zu denken, das war für Polly immer eins. Oma hatte eine trockene, knusprige Art an sich, deren versteckte Würze sich erst hinterher zeigte. Auch ihre Küche roch irgendwie keksig, nach Nüssen und Butter, wie keine andere Küche.
Während Polly diesen Geruch in sich aufnahm, fiel Nina ein, dass heute Halloween war, der Tag, an dem man auf christliche Weise der Toten gedenkt und zugleich nach heidnischem Brauch mit allerlei Mummenschanz die bösen Geister vertrieb.
Nina hatte plötzlich die Idee, Polly und sie sollten sich als Hohepriesterinnen verkleiden, und sie verlangte lautstark nach wallenden schwarzen Gewändern.
»Mit Nina im Haus wird’s keinen Augenblick langweilig«, stellte Oma fest. Sie machte sich auf die Suche und trieb zwei alte schwarze Kleider und eine dunkle Gardine auf. Mit heiterem Gleichmut half sie den beiden, sich zu kostümieren, und wies ihnen dann energisch die Tür. »Raus mit euch, und zieht bei den Nachbarn eure Schau ab«, sagte sie. »Denen kann ein bisschen Wirbel nicht schaden.«
Eine Zeit lang stelzten Nina und Polly die Straße auf und ab. Nina sah auf den ersten Blick wie eine Nonne aus, und das Kleid presste ihr die Knie zusammen. Pollys Kleid war zwar sehr lang, stand ihr aber recht gut. Leider schienen die Nachbarn davon keine Notiz zu nehmen. Die großen Häuser – nur wenige waren so klein wie das von Oma – versteckten sich weitab von der Straße hinter Baumreihen, und keine Menschenseele ließ sich blicken, um die beiden Hohepriesterinnen zu bewundern; und das, obwohl Nina jedes Mal lachte und quietschte und schrie, wenn ihr Umhängetuch zu flattern begann.
Sie marschierten bis zu dem großen Haus am Ende der Straße und spähten durch die Gitterstäbe am Tor. Auf beiden Torpfosten war Hunsdon House in den Stein graviert. Dahinter lag eine lange, gekieste Auffahrt, die von welkem Laub gesprenkelt war, und auf ihr näherte sich langsam ein mit Blumen beladenes schwarz schimmerndes Leichenauto.
Bei diesem Anblick stieß Nina einen spitzen Schrei aus und rannte mit wehendem Kopfschmuck die Straße hinunter. »Halt einen Knopf fest! Halt einen Knopf fest, bis du ein Tier mit vier Beinen siehst!«
Sie liefen in Omas Garten, wo zum Glück Omas schwarz-weiße Katze Schokominz auf der Mauer lag. Somit war die Gefahr gebannt. Sie hatten wieder beide Hände frei.
»Und was machen wir jetzt?«, wollte Nina wissen.
Polly musste immer noch lachen. »Keine Ahnung«, sagte sie.
»Denk dir was aus. Was machen Hohepriesterinnen?«, fragte Nina.
»Weiß ich nicht«, sagte Polly.
»Doch, das weißt du«, beharrte Nina. »Lass dir was einfallen – oder ich spiele nie wieder mit dir.«
Damit drohte Nina immer. Bei Polly wirkte das unweigerlich. »Hm, sie – sie schreiten in einer feierlichen Prozession und fordern Menschenopfer.«
Nina lachte schrill und selig. »Haben wir getan! Haben wir getan! Unsere Leiche liegt sogar schon im Sarg! Und weiter?«
»Na ja«, überlegte Polly. »Jetzt müssen wir warten, ob die Gottheiten unser Opfer annehmen und – he, ich hab’s! Während wir ahnungslos warten, werden wir von der Polizei wegen Mordverdacht verfolgt.«
Das gefiel Nina. Sie lief und flatterte in den hintersten Winkel des Gartens und schrie, dass die Bullen hinter ihr her seien. Als Polly sie eingeholt hatte, wollte Nina eben über die Mauer in den Nachbargarten klettern.
»Was soll denn das?« Polly konnte vor Lachen kaum sprechen.
»Ich fliehe natürlich vor der Polizei, bevor sie mich schnappt«, sagte Nina. Unter lautem Kichern gelang es ihr, die Mauer zu erklimmen. Dabei riss knallend ihr schwarzes Kleid entzwei.
»Oh, ein Schuss!«, schrie sie. »Fast hätten sie mich erwischt!« Sie schwang die Beine über die Mauer, ließ sich fallen und verschwand. Morsches Holz krachte. »Komm nach!«, rief sie. »Wenn du drüben bleibst, bin ich nicht mehr deine Freundin.«
Wie üblich genügte die bloße Drohung. Polly wusste zwar, dass ihr Nina nicht wirklich die Freundschaft aufkündigen würde – aber ein bisschen fürchtete sie sich doch davor. Vor allem aber war Polly damals noch so brav und angepasst, dass sie ohne Ninas ständige Herausforderungen kaum abenteuerlustig geworden wäre.
Jetzt hatte sie einen Vorwand. Tapfer turnte sie über die Mauer und landete auf einem Werkzeugschuppen.
Und von da an entwickelte sich der Vormittag endgültig zu einem Traum – zu einem reichlich verrückten Traum noch dazu. Nina und Polly kletterten von Garten zu Garten. Einige waren ordentlich und gepflegt und boten keine Deckung, da mussten sie rasch hindurchlaufen, andere waren überwuchert und voller Verstecke, in denen man eine Weile lauern konnte. Dann wieder hing irgendwo Wäsche, und während jemand reihenweise Unterhosen von der Leine nahm, stahlen sich Polly und Nina hinter schlappenden Betttüchern vorbei, immer kurz davor, laut loszuprusten. Sie hatten Angst, sich zu verraten und entdeckt zu werden – und zugleich fühlten sie sich traumwandlerisch sicher. Zwischendurch verloren sie ihren Gardinen-Kopfschmuck, hasteten aber weiter, unfähig – ohne eigentlich zu wissen, warum – anzuhalten oder umzukehren. Im vielleicht zehnten Garten ließ sich Nina eine Begründung einfallen: sie höre Autos, daher müsse eine Straße in der Nähe sein.
Also liefen sie noch wilder als zuvor über eine Reihe vermoderter Schuppendächer, die unter ihren Füßen ächzten und splitterten, und sprangen von der letzten Mauer – in einen Wald, wie sie meinten. Nina rannte auf den Waldrand zu, und für ein paar Sekunden verlor Polly sie aus den Augen.
Als Polly ins Freie trat, kam sie jedoch nicht auf eine Straße, sondern auf Kies. Der zog sich seitlich einer Hausfront entlang. Eine Tür stand offen, und Polly erspähte dahinter, auf dem Flur, doch tatsächlich Nina!
Die traut sich was, musste sie zugeben. Erst fehlte ihr der Mut, Nina zu folgen. Aber noch immer fühlte sie sich wie im Traum. Und weil sie sich hinterher keine Vorwürfe von Nina machen lassen wollte, lief auch sie auf Zehenspitzen über die freie Fläche, dass die Kiesel spritzten – hinein ins Haus, in einen seltsamen Geruch nach Bohnerwachs und Parfüm. Vorsichtig schlich sie den Flur entlang.
Hier war es nun endgültig wie im Traum. Der Flur mündete in eine große Halle, an deren Rückwand weiß lackierte Treppen jeweils zu einer Galerie emporführten, die sich über alle vier Seiten erstreckte. Und viele riesige, bunt bemalte chinesische Vasen standen herum, jede so groß, dass einer von Ali Babas vierzig Räubern darin Platz gefunden hätte.
In der Halle wurde Polly von einem Herrn empfangen. Wie in Träumen üblich, schien er sie erwartet zu haben. Er gehörte wohl zum Personal, denn er trug einen Frack und balancierte ein Tablett mit Gläsern. Als er auf sie zukam, duckte sich Polly unwillkürlich, als wolle sie fliehen. Der Mann sagte aber nur: »Orangensaft gefällig? Für Sherry ist die Dame vielleicht noch eine Spur zu jung.« Er hielt ihr das Tablett hin.
Polly fühlte sich wie eine Königin. Sie streckte die nicht mehr ganz saubere Hand aus und nahm sich den Orangensaft. Im Glas schwammen ein Eiswürfel und eine Scheibe von einer richtigen Orange. »Besten Dank«, sagte sie gemessen und königlich.
»Die Tür dort links, Miss«, sagte der Butler.
Polly gehorchte. Sie spürte, dass man das offenbar von ihr erwartete. Und irgendwie spürte sie natürlich auch, dass das nicht gut möglich sein konnte, wusste aber keinen Ausweg aus dieser seltsamen Situation. Das klickende Glas gegen die Brust gepresst, betrat Polly in ihrem langen schwarzen Kleid wie eine Königin einen großen, mit Teppichen ausgelegten Raum. Er wirkte im flackernden Tageslicht ein wenig schäbig und überladen mit bequemen Ledersesseln, die in losen Reihen angeordnet waren.
Eine Menge Leute standen herum, hielten Weingläser und unterhielten sich leise. Sie waren alle in Schwarz gekleidet, sahen sehr würdig aus und schenkten Polly keine Beachtung. Lauter Erwachsene. Nina war nicht da. Das hatte Polly auch nicht wirklich erwartet. Wie das in Träumen so üblich war, war Nina eben auf einmal verschwunden. Oder hatte Polly vorhin Nina mit jener Frau verwechselt, die beim Fenster stand und ebenfalls ein geschlitztes schwarzes Kleid trug? Deutlich hob sie sich von dem grün dämmernden Garten dahinter ab und wandte sich gemessen an einen hochschultrigen Mann mit Brille. Hier war überhaupt alles sehr gemessen und steif.
»Ich würde es dir sehr verübeln, wenn du das tätest«, hörte Polly die Frau zu dem Mann sagen. Es war nur ein höfliches Murmeln, klang aber wie eine von Ninas Drohungen, bloß wesentlich unfreundlicher.
Hinter Polly traten weitere Leute ein. Sie machte ihnen Platz, setzte sich in einen der harten, steifen Sessel der letzten Reihe, balancierte noch immer vorsichtig ihr Glas mit dem Orangensaft. Sie saß da und schaute zu, wie sich der Raum mit murmelnden Traumgestalten in Schwarz füllte. Sie war nicht mehr das einzige Kind. Da war jetzt auch ein Junge in grauem Anzug, ebenso würdig wie die anderen und ziemlich alt – mindestens vierzehn, wie Polly dachte. Er nahm keine Notiz von ihr. Das tat hier niemand, nur der Mann mit der Brille. Die Brillengläser blitzten Polly zu, als er unsicher herüberblinzelte, während die Frau auf ihn einredete.
Plötzlich schien es einen Szenenwechsel zu geben. Ein geschäftiger, imposant wirkender Herr durchmaß den Raum und übernahm den Vorsitz. Die Gespräche verstummten, alle Gäste schauten sich nach einem freien Sessel um und nahmen rasch Platz. Das Zimmer war erfüllt vom leisen Ächzen der Polsterungen – und dem lauten Tapsen des hochschultrigen Mannes, der sich umständlich den Weg bahnte. Alle starrten ihn feindselig an. Er krümmte sich ein wenig – kein Wunder, dachte Polly, wenn man so angestarrt wird – und hockte sich schließlich unweit von Polly nahe der Tür auf einen der Plätze.
Ritsch-ratsch riss der imposante Herr einen großen Umschlag auf, offenbar ein Dokument. »Und nun, meine Damen und Herren, wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte, werde ich das Testament vorlesen.«
Du lieber Himmel, dachte Polly. Das Gefühl, in einen Traum geraten zu sein, war plötzlich verflogen, und die Eiswürfel in ihrem Glas klirrten, als Polly erkannte, wo sie sich befand und was sie getan hatte. Dies hier war Hunsdon House, vor dem sie und Nina vorhin dem Leichenwagen begegnet waren. Jemand war gestorben, und sie war mitten in die Trauerfeier geplatzt. Und weil sie ein schwarzes Kleid trug, hatte niemand bemerkt, dass sie nicht dazugehörte. Sie fragte sich, wie die Leute reagieren würden, falls man sie doch entdecken sollte. Einstweilen saß sie bloß da, bemühte sich, das Glas still zu halten, damit die Eiswürfel nicht klirrten, und lauschte dem Rechtsanwalt, der vorlas, welche Verfügungen Mrs Mabel Tatiana Leroy Perry in ihrem Letzten Willen getroffen hatte, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte und so weiter – lauter Dinge, die nicht für Pollys Ohren bestimmt waren.
Je länger Polly der monotonen Stimme des Rechtsanwalts folgte, umso deutlicher wurde ihr bewusst, dass es hier um höchst private Familienangelegenheiten ging. Sie spürte, wie die stummen Zuhörer bei der Nennung jedes einzelnen Gegenstands mit den unterschiedlichsten Gefühlen reagierten, mit Empörung, Wut, gekränktem Stolz und hin und wieder mit unverhüllter Befriedigung. Empörend fand man offensichtlich, dass so vieles an »meine Tochter, Mrs Eudora Mabel Lorelei Perry Lynn« ging. Selbst was zunächst scheinbar für andere Leute bestimmt war, zum Beispiel »für meinen Cousin Morton Perry Leroy« oder »für meine Nichte, Mrs Silvia Nuala Leroy Perry«, wurde aufgrund umständlicher Erklärungen zuletzt doch wieder dieser Mrs Perry Lynn zugesprochen. Befriedigt zeigte man sich bei den seltenen Ausnahmen, wenn tatsächlich jemand anderer – wie Robert Goodman Leroy Perry oder Sebastian Ralph Perry Leroy – etwas bekam.
Polly fragte sich allmählich, ob es nicht sogar ungesetzlich war, dass sie da mitlauschte. Sie versuchte, nicht hinzuhören, was ihr nicht allzu schwerfiel, denn das meiste war ziemlich langweilig, aber sie fühlte sich dabei immer unbehaglicher.
Am liebsten hätte sie sich fortgeschlichen. Zur Tür war es nicht weit. Das wäre mühelos zu schaffen gewesen, hätte nicht der Mann von vorhin den Platz dicht neben ihr und gleich beim Ausgang blockiert. Sie linste zur Tür, überlegte, ob sie sich nicht trotzdem davonstehlen sollte – und ausgerechnet in diesem Moment linste der Mann zu ihr herüber, wahrscheinlich, weil er sich über Pollys Anwesenheit wunderte. Polly wandte hastig den Kopf ab, starrte wieder nach vorn und tat so, als höre sie aufmerksam der Verlesung des Testaments zu. Trotzdem spürte sie seine Blicke auf sich. Die Eiswürfel in ihrem Glas schmolzen. Im Testament ging es jetzt um die schrecklich langweilige Erörterung »einer zu schaffenden Stiftung«.
Der Mann neben der Tür stand auf. Unwillkürlich, als würde ihr Kopf an Schnüren gezogen, schaute sie zu ihm hin, und er schaute noch immer zu ihr her, nur zu ihr. Seine Augen hinter der Brille erwiderten ihren Blick, übten einen seltsamen Sog aus, und er deutete mit dem Kopf zur Tür. »Komm mit raus!«, sagte der Blick, und dann, höflich, aber bestimmt: »Kommst du, bitte?«
Für einen Aufpasser war er fair. Polly nickte. Vorsichtig stellte sie das Glas mit dem lauwarm gewordenen Orangensaft auf dem freien Sessel neben sich ab und stand auf. Der Mann hielt ihr nun die Hand entgegen, wie um sich zu versichern, dass Polly ihm nicht entwischte. Schicksalsergeben legte Polly ihre Hand in die seine. Die war groß, riesig. Die langen Finger falteten sich um ihre Hand, bis sie darin fast verschwunden war. Er zog sie hinter sich her, und die beiden glitten durch die Tür in die Halle mit der Treppe und den umlaufenden Galerien.
»Wolltest du deinen Saft nicht mitnehmen?«, fragte der Mann. Das Gebrabbel des Rechtsanwalts verebbte im Hintergrund.
Polly schüttelte stumm den Kopf. Offenbar hatte sie die Sprache verloren. Am anderen Ende der Halle führte ein Durchgang in einen Raum, in dem der Butler jetzt Weingläser auf dem großen Esstisch verteilte. Polly wollte den Mann herbeirufen, er sollte bestätigen, dass er sie in den Saal geschickt hatte, aber sie brachte keinen Laut hervor. Die große Hand zog sie weiter, in den Flur, durch den Polly das Haus betreten hatte. Noch im Gehen schaute sie sich ein letztes Mal in der grandiosen Halle um. Ob sie wohl in eine der großen Ali-Baba-Vasen schlüpfen und sich darin verstecken konnte, bis alle fort waren? Doch da war Polly bereits im Windfang des Seitenausgangs, die Tür stand offen, und dahinter ragten die windzerzausten Bäume auf. Von der Stimme des Rechtsanwalts war hier nichts mehr zu hören.
»Wird es dir im Freien in diesem dünnen Kleid nicht zu kalt?«, erkundigte sich der Mann, der ihre Hand hielt, höflich.
Wer so höflich gefragt wird, muss antworten. Polly fand ihre Stimme wieder. »Nein, nein«, sagte sie. »Ich habe darunter was Richtiges an.«
»Sehr klug«, sagte der Mann. »Dann können wir ja in den Garten gehen.«
Als sie aus der Tür traten, wickelte ihr der Wind das schwarze Kleid um die Beine und ließ ihr Haar zur Seite flattern. Den Haaren des Mannes konnte er wenig anhaben, die klebten auf altmodische Weise glatt am Kopf; da blies der Wind nur ein paar farblose Locken hoch und blähte die schwarze Anzugjacke auf. Der Mann bibberte. Polly hoffte, er werde sie fortschicken und gleich wieder ins Haus gehen. Aber offenbar wollte er ganz sicher sein, dass sie das Grundstück verließ. Er wandte sich nach rechts. Der Wind schlug ihnen nun voll entgegen.
»So ist es besser«, sagte der Mann. »Hätte ich bloß eine Möglichkeit gefunden, auch Seb, den armen Jungen, loszueisen. Ich hab doch gesehen, dass er sich genauso gelangweilt hat wie du. Aber er war nicht so schlau, sich nahe genug an die Tür zu setzen.«
Polly schaute erstaunt zu dem Mann hinauf. Er lächelte auf sie herab. Polly erwiderte hastig das Lächeln, dann hielt er sie vielleicht für schüchtern. Sie drehte den Kopf wieder in den Wind und überlegte. Der Mann glaubte also, dass sie tatsächlich zu der Trauergesellschaft gehörte. Er wollte wohl bloß nett zu ihr sein. »Es war doch langweilig, nicht wahr?«, sagte sie.
»Entsetzlich«, sagte er und ließ ihre Hand los.
Jetzt hätte Polly davonrennen müssen. Und sie hätte es auch bestimmt getan – sagte sie sich, als ihr die Szene neun Jahre später wieder einfiel –, wäre der Mann tatsächlich bloß ein freundlicher Aufpasser gewesen. Aber sein Tonfall verriet, dass er die Trauerfeier noch langweiliger gefunden hatte als sie. Und Polly musste daran denken, wie feindselig die vermeintliche Nina vorhin mit ihm gesprochen hatte. Und sie dachte an die bösen Blicke der anderen Gäste, als er nicht gleich einen freien Platz gefunden hatte. Polly erkannte, dass er sich absichtlich in die Nähe der Tür gesetzt hatte, und sie wusste auf einmal – wahrscheinlich ohne es im Grunde zu begreifen: Wenn sie jetzt fortrannte, würde er zur Feier zurückkehren müssen. Sie hatte ihm den Vorwand geboten, sich davonzustehlen.
Daher blieb sie. Sie stemmte sich gegen den Wind, um mit dem Mann Schritt zu halten, vorbei an zerzausten, verhutzelten Rosen, aus denen ihnen weiße Blütenblätter entgegenwirbelten.
»Wie heißt du?«, fragte er.
»Polly.«
»Und weiter?«
»Polly Whittacker«, sagte sie unüberlegt. Zu spät wurde ihr klar, dass als richtiger Name bei dieser Totenfeier ausschließlich Leroy oder Perry galt. Oder Perry Leroy oder Leroy Perry. So hießen die Leute, die im Testament bedacht worden waren. Polly musste ihren Fehler irgendwie wiedergutmachen. »Ich wurde nämlich nur adoptiert. Ich gehöre eigentlich zum anderen Zweig der Familie.«
»Hab ich mir gleich gedacht«, sagte er. »Bei diesen Haaren …«
»Und von welchem Zweig der Familie kommen Sie?«, erkundigte sich Polly rasch und gekünstelt, um ihn von weiteren Fragen abzuhalten. Sie haschte nach einer flatternden Strähne und kaute eifrig daran.
»Oh, von gar keinem«, sagte er. »Die Verstorbene war die Mutter meiner Ex-Frau, daher fühlte ich mich zum Kommen verpflichtet. Aber ich bin hier das fünfte Rad am Wagen.« Polly war erleichtert. Er hatte sich ablenken lassen. Er sagte: »Ich heiße Thomas Lynn.«
»Auch beides Familiennamen?«, fragte Polly zweifelnd. »Die da drinnen sind ja alle doppelt gemoppelt.«
Das brachte ihn zum Lachen. Er kicherte los, beherrschte sich aber rasch wieder, als schäme er sich, bei einer Trauerfeier zu lachen. »Nein, nein, nur die zweite Hälfte.«
»Mr Lynn also«, sagte Polly. Sie gingen jetzt über halb verfallene Treppenstufen hinunter. Polly ließ sich die Haare ins Gesicht wehen. Langes Haar hatte auch Vorteile. So konnte sie ihn unauffällig betrachten. Er war groß und hager und zog beim Gehen die Schultern hoch, sodass sein runder, farbloser Kopf zu klein wirkte – aber das konnte an der Perspektive liegen: Er war so hochgewachsen, dass er Polly nicht nur überragte, sondern sein Kopf sogar ziemlich weit weg war. Wie eine riesige Schildkröte, dachte Polly. Die Brille verstärkte diesen Eindruck noch. Sie passte zu diesem freundlichen, aber nichtssagenden Gesicht. Pollys Beurteilung fiel positiv aus; sie fand Mr Lynn nett.
»Mr Lynn«, fragte sie, »was tun Sie am liebsten?«
Der Schildkrötenkopf schwang überrascht herum. »Das wollte ich gerade dich fragen!«
»Ertappt!«, sagte Polly und lachte zu ihm hinauf. Ihre Mutter, wäre sie hier gewesen, hätte sie nun mit einem dieser langen strafenden Blicke bedacht. Aber Polly musste ja verhindern, redete sie sich ein, dass sich Mr Lynn fragte, wie Polly zu dieser Trauerfeier gekommen war. Außerdem fand sie Mr Lynn sympathisch. Also sagte sie, während sie und Mr Lynn sich zwischen zwei ausgedehnten Hecken ungestutzter grauer Lavendelsträucher durchzwängten: »Am liebsten – abgesehen von laufen, schreien, Späße machen und raufen – bin ich jemand anderer.«
»Jemand anderer?«, fragte Mr Lynn. »Wer denn, zum Beispiel?« Das klang neugierig und verwirrt.
»Ich erfinde zum Beispiel Heldinnen und stelle mir dann vor, dass ich zu ihnen gehöre.« Der Schildkrötenkopf wandte sich ihr höflich zu. Polly merkte, dass er nichts begriff. Fast hätte sie ihm erzählt, dass sie – etwa als Hohepriesterin Polly – von der Polizei verfolgt worden war und sich auf der Flucht in die Trauerfeier verirrt hatte. Aber das wagte sie dann doch nicht und sagte stattdessen: »Ich werde es Ihnen erklären. Stellen Sie sich vor, dass Sie eigentlich nicht Sie sind. In Wirklichkeit sind Sie jemand ganz anderer.«
»Wer denn?«, fragte Mr Lynn gehorsam.
Es wäre besser gewesen, er hätte es gemacht wie Nina und gedroht, ihr die Freundschaft aufzukündigen, falls sie ihm nicht auf der Stelle alles verraten würde. Ihre Erfindungsgabe musste herausgefordert werden, sonst versagte sie. Polly fielen nur ganz gewöhnliche Dinge ein.
»Sie besitzen eine Eisenwarenhandlung«, begann sie ziemlich ratlos. Und um das wenigstens ein bisschen aufzuwerten, fügte sie hinzu. »Eine prima Eisenwarenhandlung in einer hübschen Kleinstadt. Und Sie heißen in Wirklichkeit Thomas Piper. Piper, weil das an den Pfeifer erinnert. ›Thomas war des Pfeifers Sohn, der spielte die Flöte seit Jahren schon …‹ Kennen Sie das Lied?«
Mr Lynn lächelte. »Seltsamer Zufall, mein Vater hat tatsächlich Flöte gespielt. Das war sogar sein Beruf. Also gut, ich verkaufe Nägel und Abfalleimer und Herdbürsten. Was noch?«
»Wärmflaschen und Spaten und Töpfe«, sagte Polly. »Jeden Morgen hängen Sie das Zeug über der Ladentür auf und dekorieren den Gehsteig mit Schubkarren und Gießkannen.«
»Damit die Passanten mit den Schienbeinen dagegenknallen können, verstehe«, sagte Mr Lynn. »Weiter! Bin ich mit meinem Los zufrieden?«
»Nicht sehr«, sagte Polly. Er spielte so gut mit, dass ihre Erfindungsgabe allmählich wieder funktionierte. Die Lavendelsträucher schirmten den Wind ab, und das tat wohl. »Sie langweilen sich ein bisschen, aber das macht nichts, denn Sie führen den Laden bloß, damit die Leute glauben, Sie hätten nichts weiter zu tun. In Wirklichkeit sind Sie ein heimlicher Held, sehr stark und unsterblich …«
»Unsterblich?«, sagte Mr Lynn überrascht.
»Na ja, fast«, sagte Polly. »Sie können Hunderte Jahre alt werden, solange Sie nicht jemand im Kampf tötet. Ihr richtiger Name lautet – hm – Tan Coul, und ich bin Ihre Assistentin.«
»Bist du das auch in meinem Laden oder nur, wenn ich als Held auftrete?«, fragte Mr Lynn.
»Nein. Ich bin, was ich bin«, sagte Polly. »Ich bin ein Heldenlehrling. Ich begleite Sie bei jedem Einsatz.«
»Dann musst du in meiner Nähe wohnen«, gab Mr Lynn zu bedenken. »Wo befindet sich mein Laden? Hier in Middleton? Muss wohl so sein, damit ich dich jederzeit rufen kann, wenn es was zu tun gibt.«
»Nein, Sie sind in Stow-on-the-Water«, sagte Polly entschieden. So stellte sie sich das vor. War sie erst einmal in Fahrt geraten, ergaben sich die Dinge von selbst.
»Das ist unpraktisch«, sagte Mr Lynn.
»Nicht wahr?«, gab Polly zu. »Aber wenn Sie wollen, komme ich zu Ihnen und helfe im Laden aus. Ich tarne mich also auch in Ihrem gewöhnlichen Leben als Ihr Lehrmädchen. Nehmen wir an, ich habe herausgefunden, wo Sie wohnen, habe Middleton verlassen und bin meilenweit gereist, um in Ihrer Nähe zu sein.«
»So ist es besser«, sagte Mr Lynn. »Außerdem musst du dich älter machen, damit man dich nicht zur Schule schickt. Aber für eine wahre Hilfsheldin ist das bestimmt kein Problem. Wie nennst du dich bei unseren Einsätzen?«
»Hero«, sagte Polly. »Den Namen gibt es wirklich«, beharrte sie, als er seinen Schildkrötenkopf senkte und sie zweifelnd anblickte. »Ich nehme an, das ist eine Abkürzung für Heroine. Und Heroine bedeutet, glaube ich, Heldin. Hero heißt jedenfalls die Frau in dem Buch, das ich eben lese. Jede Nacht schwimmt einer nur ihretwegen übers Meer.«
»Die Geschichte kenne ich«, sagte Mr Lynn. »Es überrascht mich, dass auch du sie kennst.«
»Ich nenne mich natürlich nur zum Spaß so«, erklärte Polly. »Weil ich aus diesem Buch eine Menge über Helden gelernt habe.«
»Wie man sieht«, sagte Mr Lynn mit leisem Lächeln. »Wir müssen aber noch eine Menge weiterer Details klären. Zum Beispiel …«
Sie hatten unterdessen die graue Hecke verlassen und waren auf eine kleine Rasenfläche mit einem leeren Wasserbecken geraten. Ein brauner Vogel flog auf, strich dicht übers Gras hinweg, als sie kamen, und krächzte hell und scharf. Ein Windstoß fegte durch das dürre Laub auf dem Betonboden des künstlichen Teiches, und ein Sonnenbalken legte sich quer über den Rasen.
»Zum Beispiel …«, sagte Mr Lynn und verstummte abrupt.
Der Sonnenstrahl hatte das leere Becken erreicht. Für den Bruchteil einer Sekunde täuschte das Licht einen Wasserspiegel vor – als wäre der Teich gefüllt, als könne man bis auf den Grund sehen, wo sich helle Sonnenkringel tummelten; und Polly hätte schwören können, dass sich das dürre Laub für diesen kurzen Augenblick in einen grünen, wuchernden Pflanzenteppich verwandelte. Dann glitt der Sonnenbalken weiter und ließ wieder das leere Betongeviert zurück. Polly merkte, dass auch Mr Lynn dieses Phänomen beobachtet hatte; warum sonst war er plötzlich verstummt?
»Helden bekommen solche Sachen zu sehen«, sagte sie, für den Fall, dass ihn dieser Vorgang beunruhigt hatte.
»Wahrscheinlich.« Er nickte nachdenklich »Bestimmt sogar. Muss wohl so sein, da wir beide ja Helden sind. Aber jetzt wieder zu uns. Verrate mir, was geschieht, wenn uns der Ruf zu einer Heldentat erreicht. Ich stehe im Laden und verkaufe Nägel. Wir schnappen uns jeder eine Säge – oder, besser noch, eine Axt – und sausen los. Wohin? Was machen wir?«
Polly überlegte, während sie am Teichbecken vorbeigingen. »Wir ziehen los und töten Riesen und Drachen und andere Ungetüme«, sagte sie.
»Wo? Weiter oben an der Straße, im Supermarkt?«, fragte Mr Lynn.
Polly merkte, dass er von ihrer Antwort wenig hielt. »Ja, warum nicht? Oder fällt Ihnen was Besseres ein?«, fuhr sie ihn an, als sei er Nina. »Ich weiß genau, dass wir solche Helden sind und nicht jene Typen, die größenwahnsinnige Wissenschaftler unschädlich machen. Aber ich weiß längst nicht alles. Warum denken Sie sich nicht auch mal was aus, wenn Sie doch so schlau sind? Oder wissen Sie wirklich nicht, wie man so tut, als ob?«
»An sich schon«, sagte Mr Lynn und bog für Polly zuvorkommend einen feuchten Zweig zur Seite. »Ich habe das nur seit Jahren nicht mehr gemacht. Was das betrifft, muss ich von dir lernen. Ich wäre viel lieber auch bloß ein gewöhnlicher Heldenlehrling. Wäre das nichts für mich? Du könntest zufällig dazukommen, wenn ich meinen ersten Riesen töte – und vielleicht habe ich es nur dir zu verdanken, dass er mich nicht zu Brei zerquetscht.«
»Meinetwegen«, gestand ihm Polly großzügig zu. Er wirkte so unterwürfig, dass es ihr leidtat, ihn angefahren zu haben.
»Ich danke dir«, sagte er, als hätte sie ihm tatsächlich eine Gunst erwiesen. »Das bringt mich zu einer anderen Frage. War mir mein geheimes Heldenleben eigentlich schon als unauffälliger Eisenhändler bewusst?«
»Am Anfang nicht«, sagte Polly, während sie noch überlegte. »Zuerst waren Sie bloß erschrocken und dachten, Sie hätten Wahnvorstellungen. Aber Sie haben sich rasch daran gewöhnt.«
»Am Anfang war ich völlig durcheinander und habe eine Menge verpatzt«, stimmte Mr Lynn zu. »Wir mussten beide erst durch Erfahrung lernen. Ja, so wird es gewesen sein. Nun gut, jetzt zu meinem Alltag als Eisenhändler in Stow-on-the-Water. Lebe ich allein?«
»Nein, sobald ich dazustoße, wohne auch ich dort. Aber da ist natürlich noch Ihre Frau, Edna …«
»Nein«, sagte Mr Lynn. Er sagte es leise und ruhig, als habe ihn jemand gefragt, ob noch Butter im Haus sei, und er habe daraufhin im Kühlschrank nachgeschaut und keine gefunden. Aber Polly spürte, dass er ihren Vorschlag absolut ablehnte.
»Sie muss aber da sein«, wandte sie ein. »Zumindest ist da jemand – und ich weiß, dass sie Edna heißt –, die Sie herumkommandiert und Ihnen das Leben vermiest und Sie für blöd hält und mit dem Geld knausert und Ihnen die ganze Arbeit aufhalst …«
»Meine Vermieterin«, sagte Mr Lynn.
»Nein«, sagte Polly.
»Also dann meine Schwester«, sagte Mr Lynn. »Wie wär’s mit einer Schwester?«
»Über Schwestern weiß ich nichts«, musste Polly widerwillig zugeben.
Sie schlenderten durch den verwilderten Garten und diskutierten das Problem. Schließlich erkannte Polly, dass sie bei Edna einlenken musste, und ließ sie nun doch seine Schwester sein. Mr Lynn hatte ziemlich hartnäckig darauf bestanden. Bei den meisten anderen Fragen war er zum Nachgeben bereit gewesen, dieses eine Mal aber nicht.
»Muss ich wirklich Drachen töten?«, fragte er ziemlich unglücklich, als sie von irgendwoher zum Haus zurückkamen.
»Ja«, sagte Polly. »Dazu sind Helden wie wir da.«
»Aber die meisten Drachen haben einen bemerkenswerten Charakter – außerdem handeln sie wahrscheinlich aus guten Gründen, nur kennen wir die nicht«, erwiderte Mr Lynn. »Und soweit ich weiß, nehmen Drachentöter meist ein schlimmes Ende.«
»Seien Sie kein Feigling«, sagte Polly. »Der heilige Georg zum Beispiel hat kein schlimmes Ende.«
»Ich bin alles andere als ein heiliger Georg«, sagte Mr Lynn. »Der trug keine Brille.«
Das stimmte, obwohl sich Polly den heiligen Georg immer so groß und hager wie Mr Lynn vorgestellt hatte. Der schaute aber so unglücklich drein, dass Polly ein wenig nachgab. »Also meinetwegen heben wir uns die Drachen für den Schluss auf, wenn wir schon ordentlich trainiert haben.«
»Das ist eine gute Idee«, sagte Mr Lynn dankbar. »Und jetzt komm mal hier rüber. Ich möchte dir etwas zeigen, das wird dir gefallen.«
Er stemmte sich gegen die Windböen und ging über den Rasen voran zum Haus. Drei Treppenstufen aus Stein führten zu einer geschlossenen Tür. Die Treppe wurde von zwei niedrigen steinernen Säulen flankiert, auf denen jeweils eine steinerne Vase stand. Mr Lynn streckte die Arme aus und legte seine Hände auf beide Vasen. So stand er da, in seiner typischen gebückten Haltung, und fragte: »Schaust du mir auch wirklich zu?«
Wie Samson, dachte Polly. Wie Samson, ehe er den Tempel niederreißt.
»Ja«, sagte sie. »Was gibt’s?«
»Pass auf!« Mr Lynns Hand bewegte sich auf der rechten Vase. Die Vase begann sich leise ächzend zu drehen. Zweimal, dreimal kreiste sie schwerfällig um ihre Achse. Jetzt erst sah Polly, dass in den Bauch der Vase Buchstaben eingraviert waren.
»L-E-Z-E-I-T«, las sie.
»Und noch einmal aufgepasst!«, sagte Mr Lynn. Seine linke Hand brachte die andere Vase zum Kreisen. Die bewegte sich leichter. Für einige Sekunden war sie bloß ein steinerner grauer Schemen. Dann quietschte sie, wurde langsamer, hielt mit einem Ruck an. Wieder waren Buchstaben zu sehen.
»F-Ü-R-A-L«, las Polly. »FÜR AL-LEZEIT. Was hat das zu bedeuten?«
Mr Lynn drehte beide Vasen. Die eine kreiste langsam, schleifte ächzend, die andere schnurrte rasch im Kreis. Beide hielten exakt zugleich an.
FÜRALLE sagte die linke, ZEIT die rechte.
Wieder drehte Mr Lynn an den Vasen. Diesmal lauteten die Inschriften ZEIT und FÜRALLE.
»Ah, jetzt hab ich’s kapiert!«, rief Polly. »ZEIT FÜR ALLE. Das ist toll!« Sie trat einen Schritt zur Seite, um die Buchstaben besser zu erkennen. Dabei fand sie heraus, dass die linke Vase noch immer FÜRAL sagte und, als Polly den Blickpunkt wechselte, die rechte LEZEIT. Auf beiden Vasen stand dasselbe: FÜRALLEZEIT, aber die Buchstaben waren rundherum so angeordnet, dass man nie alle zugleich sehen konnte. Um sich davon zu überzeugen, ging Polly einmal um jede Vase herum und duckte sich dabei unter Mr Lynns Armen durch.
»Richtig«, sagte Mr Lynn. »Auf jeder Vase steht FÜRALLEZEIT.« Er brachte sie abermals zum Kreisen, die langsam ächzende und die rasch schnurrende, und diesmal kam dabei ZEITFÜRZEIT heraus. »Helden bekommen solche Sachen zu sehen«, sagte er.
»Das ist offenbar eine Art Zauberspruch«, sagte Polly, um ihm eine Freude zu machen.
»Unbestreitbar.« Es klang, als wolle nun er ihr eine Freude machen.
Und beide zugleich schauten sich um. Polly wusste nicht, warum. Hinter ihnen stand der Junge von der Trauerfeier und wirkte trotz des Windes glatt und geschniegelt. Vielleicht hatte er vorhin verächtlich geschnaubt. Jedenfalls wirkte er vorwurfsvoll.
»Oh, hallo, Seb«, sagte Mr Lynn. »Schnappst du also doch noch ein bisschen frische Luft?«
»Nur, weil die Sache mittlerweile gelaufen ist«, fauchte der Junge.
»Ja? Dem Himmel sei Dank«, sagte Mr Lynn.
Statt darauf zu reagieren, machte der Junge stumm kehrt und ging. Polly meinte auf Mr Lynns Gesicht einen Anflug von Gekränktsein zu erkennen.
»So was von widerlich und mies!«, rief Polly so laut, dass es der Junge hoffentlich noch gehört hatte. Aber er bog unbeeindruckt um die Ecke des Hauses und verschwand, bevor Polly zu Ende gesprochen hatte. »Ist der auch mit Ihnen verwandt?«
»Hinlänglich entfernt – er ist der Sohn von Laurels Vetter«, sagte Mr Lynn. Er rührte sich nicht vom Fleck und starrte dem Jungen so geistesabwesend und unglücklich nach, dass sich Polly unbehaglich fühlte. Aber als er dann auf sie herabschaute, wirkte er wieder vergnügt. »Ich glaube, wir können uns ins Haus zurückwagen«, sagte er. »Wie ich höre, darf ich mir ein paar Bilder der alten Dame aussuchen. Hilfst du mir dabei?« Er streckte ihr lächelnd die Hand entgegen.
Beinahe hätte Polly sie ergriffen. Dann wich sie einen Schritt zurück. Mr Lynn stand unbeholfen mit ausgestrecktem Arm da, das Lächeln erstarb auf seinem Gesicht und wich einer erstaunt-ratlosen Miene, als kränke er sich jetzt sogar mehr als vorhin über den unfreundlichen Seb. »Was ist los?«, fragte er.
Das bewirkte, dass sich Polly nun ebenso schäbig wie unehrlich vorkam. »Ich gehöre gar nicht zur Verwandtschaft«, gestand sie spontan. Sie war schamrot geworden, ihre Wangen brannten. »Ich bin nur irrtümlich hier. Weil ich glaubte, Nina ist drinnen und stellt wieder einmal was an.«
»So etwas Ähnliches hatte ich mir gedacht«, sagte Mr Lynn ziemlich traurig. »Du kommst also nicht mit?«
»Nur – nur, wenn Sie es wollen«, sagte Polly.
»Du würdest mir einen großen Gefallen erweisen«, sagte Mr Lynn. Er hielt ihr noch immer die Hand hin.
Polly nahm sie, sehr erleichtert, dass die Wahrheit endlich heraus war, und wie zuvor Seb gingen sie außen ums Haus herum.
»Mein erster Riese erwartet mich also in Stow-und-so-weiter im Supermarkt«, sagte Mr Lynn, als sie um die Ecke bogen.
»Er ist klein und unauffällig«, schwächte Polly ihm zuliebe ab.
Sie hatten die Vorderfront des Hauses erreicht. Auf dem großen gekiesten Vorplatz parkten Autos. Das mussten jene Autos gewesen sein, die sie und Nina gehört hatten, als sie die Straße in der Nähe glaubten. Polly fragte sich, wo Nina jetzt sein mochte, war aber so in ihrem eigenen Abenteuer gefangen, dass sie keine Zeit hatte, sich um Nina zu sorgen. Aus der offenen Eingangstür von Hunsdon House traten vereinzelt Gäste, alle schwarz gekleidet und mit Trauermiene, und schlenderten über den Kies. Einige wollten offenbar nur frische Luft schnappen, andere stiegen in ihre Autos und fuhren fort.
Polly und Mr Lynn standen nun vor dem Portal. »Auch ein kleiner Riese würde in die Lokalpresse kommen«, sagte Mr Lynn. »Was erzählen wir den Reportern?«
»Überlassen Sie die Interviews getrost mir«, sagte Polly großspurig.
Vielleicht hatten die Leute an der Tür diesen seltsamen Wortwechsel mitgehört. Vielleicht ernteten Polly und Mr Lynn deshalb so unfreundliche Blicke, als sie sich durch das Gedränge in die große Halle durchkämpften. Einige Gäste stellten sich blind, andere sagten brummig: »Hallo, Tom!«, und musterten Polly mit hochgezogener Braue, ehe sie sich abwandten. Aber da hatte Polly schon begriffen, dass es für diese Reaktionen andere Gründe gab. Die Menschen hier, das spürte Polly irgendwie, gehörten zum maßgebenden, engsten Familienkreis. Wer von ihnen Mr Lynn überhaupt zur Kenntnis nahm, strafte ihn bestenfalls mit einem abfälligen Blick, ehe er ihm den Rücken kehrte. Noch ehe sie den halben Weg zur Treppe hinter sich hatten, verstand Polly, warum Mr Lynn sie mit ins Haus gebeten hatte.
Der einzige Mensch, der Mr Lynn anredete, war Polly auf Anhieb unsympathisch. Er ließ seinen Gesprächspartner mitten im Satz stehen, drehte sich nach ihnen um und starrte Mr Lynn und Polly durchdringend an. Es war ein großer, untersetzter Mann mit schweren, dunklen Tränensäcken unter den Augen.
»Schleichst dich wie üblich davon, was, Tom?«, erkundigte er sich gönnerhaft. Das war ganz eindeutig nicht annähernd so freundlich gemeint, wie es klang.
»Nein, Morton, wie du siehst, bin ich noch immer hier«, sagte Mr Lynn und zog, wie zur Entschuldigung, den Kopf ein.
»Dann treib dich nicht draußen herum«, sagte der Mann, »oder du handelst dir ernsthafte Schwierigkeiten ein.« Er lachte, als hätte er einen Witz gemacht. Es war ein tiefes, kehliges Lachen. Unheilvoll, dachte Polly. Der Mann wandte sich, immer noch lachend, ab.
»Hiergeblieben, verstanden? Laurel hat mich gebeten, dir das auszurichten«, sagte er noch, ehe er sein Gespräch mit dem anderen Gast fortsetzte.
»Danke«, sagte Mr Lynn und zerrte Polly weiter durch die Halle.
Der Butler trat ihnen am Fuß der Treppe höflich in den Weg. »Pardon«, sagte er, »werden Sie und die junge Dame zum Essen bleiben?«
»Ich weiß noch nicht, ob …«, begann Mr Lynn, unterbrach sich und schaute einigermaßen missmutig auf Polly hinunter. Offenbar hätte er fast vergessen, dass sie nicht hierhergehörte. »Nein«, sagte er. »Wir werden in wenigen Minuten aufbrechen.«
Der Butler sagte: »Verbindlichsten Dank, Sir«, und ging.
Polly konnte gut verstehen, dass sich Mr Lynn nicht an die unverblümte Anweisung halten wollte, die ihm der Mann vorhin gegeben hatte. »Wer war das?«, fragte sie flüsternd, während sie die Treppe hochstiegen.
»Ein Butler, was sonst?«, sagte Mr Lynn.
»Aber nein, ich meine natürlich den mit den schwarzen Knollenaugen«, flüsterte Polly.
Das brachte Mr Lynn zum Lachen. Er japste los, beherrschte sich aber schuldbewusst gleich wieder. »Ach, der! Das ist Sebs Vater, Morton Leroy. Er und Laurel werden wahrscheinlich demnächst heiraten. So, da drinnen sind die Bilder.«
Polly hatte gehofft, dass sie die Treppe bis ganz nach oben steigen würden, um alle Galerien herum bis ins Dachgeschoss. Das hätte ihr die Chance gegeben, mehr von Hunsdon House zu sehen. Aber das Zimmer, in das Mr Lynn sie jetzt führte, zweigte bereits im Zwischengeschoss beim ersten Treppenabsatz ab.
Der Raum war klein und wirkte leer. Druckstellen im Teppich verrieten, wo hier noch bis vor Kurzem Möbelstücke gestanden hatten. Die Bilder lehnten links und rechts in Stapeln an der Wand.
»Wenn ich mich recht entsinne, waren einige sehr schöne darunter«, sagte Mr Lynn. »Wie wär’s, wenn wir zunächst alles, was in die engere Wahl kommt, unter dem Fenster aufstellen? Angeblich darf ich mir sechs Stück aussuchen.«
Polly merkte bald, dass die Bilder an der linken Seite bei Weitem interessanter waren. Sie ließ Mr Lynn die anderen Stapel allein sortieren, kniete sich auf den Boden, kippte jeweils den obersten Rahmen nach vorn, stützte ihn mit Brust und Kinn ab und blätterte, was dahinter stand, wie ein dickes Buch durch. In einem Stapel entdeckte sie zwischen Heiligen vor rissigem Goldgrund ein Bild mit viel Grün und Sonnenschein und altmodisch gekleideten Leuten, die im Wald ein Picknick machten. Der nächste Stapel enthielt die seltsam verzerrte Ansicht eines Rummelplatzes, ein sehr schönes chinesisches Pferdebild und eines in Rosa und Blau mit zwei traurigen Harlekinen am Meer. Polly trug diese Bilder sofort zur Fensterwand. Das oberste Bild auf dem dritten Stapel gefiel ihr ebenfalls, ein schwer zu erkennendes modernes Durcheinander, Leute, die Geige spielten. Gleich dahinter war ein großes blau-grünes Bild, Feuer bei Sonnenuntergang; aufsteigender Rauch umhüllte das ausladende Gerippe eines Strauches im Vordergrund. Polly stieß einen entzückten Schrei aus.
Mr Lynn sagte zwischendurch: »Ich kann mich kaum noch an die Hälfte dieser Bilder erinnern. Schau dir das da an! Ist es nicht grauenhaft?«
Polly wandte den Kopf und ließ sich ein längliches Format in Brauntönen zeigen, eher gezeichnet als gemalt, auf dem eine Nixe einen leblosen Mann unters Wasser zerrte. »Scheußlich«, bestätigte sie. »Die Gesichter sehen blöd aus. Und der Mann hat einen zu langen Körper.«
»Finde ich auch«, sagte Mr Lynn. »Aber vielleicht behalte ich es nur so zum Spaß. Erklär mir, wieso du irrtümlich ins Haus geraten bist.«
Polly stand auf und trug vorsichtig die Geigenspieler und das Rauchbild zur Fensterwand. »Nina hat angefangen«, sagte sie. »Aber ich habe dann mitgemacht.« Und sie erzählte die Sache mit den Hohepriesterinnen, und wie sie aus Omas Garten in all die anderen geklettert waren. »Dann mussten wir uns hinter den Laken auf der Wäscheleine verstecken«, sagte sie eben, als sich Mr Lynn plötzlich aufrichtete und hastig über die Hosenbeine strich.
»Oh, hallo, Laurel«, sagte er.
In der Tür stand die Frau, von der Polly gedacht hatte, es sei Nina.
Aus der Nähe kam sie Polly ziemlich hübsch vor, und ihr schwarzes Kleid war sichtlich teuer. Ihr Haar sah recht ungewöhnlich aus, hell, fließend, es konnte ebenso gut grau wie überhaupt farblos sein. Irgendwie schloss Polly aus alldem und vor allem aus der falschen Liebenswürdigkeit, die diese machtbewusste Frau ausstrahlte, dass sie diejenige war, die fast alles im Haus geerbt hatte. Und aus der steifen Haltung, in der Mr Lynn dastand, schloss Polly, dass Laurel außerdem seine Ex-Frau war. Wie konnte sie diese Frau bloß mit Nina verwechselt haben?
»Tom, hat dir denn niemand gesagt, dass ich dich überall gesucht habe?«, fragte Laurel. Noch ehe Mr Lynn Gelegenheit fand, den Kopf zu schütteln – er hätte sie angelogen, stellte Polly interessiert fest –, streiften Laurels Augen erst die Bilder, dann Polly. Polly zuckte zusammen, als dieser Blick sie traf. Laurels Augen waren hell wie ihr Haar, aber mit schwarzen Kreisen darin, als würde Polly in einen tiefen Tunnel schauen. Und sie waren auch gefühllos wie ein Tunnel, darüber konnte Laurels freundliche Miene nicht hinwegtäuschen.
»Vergiss bei der Wahl der Bilder nicht, Tom«, sagte Laurel, immer noch zu Polly gewandt, »dass du nur von denen da etwas mitnehmen darfst.« Das Licht ließ die Ringe an ihren Fingern in allen Farben aufleuchten, als sie mit einer brüsken Handbewegung zur rechten Wand wies. »Die anderen sind zu wertvoll und müssen in der Familie bleiben.«
Dann machte sie auf dem Absatz kehrt, ging hinaus auf die Galerie und nahm Mr Lynn kurzerhand mit. Sie zogen die Tür halb zu. Polly blieb beim Fenster stehen und schnappte Wortfetzen von dem auf, was die beiden draußen besprachen. Erst war das Laurels süße, helle Stimme: »… fragen uns alle, wer dieses Kind ist, Tom.« Worauf Mr Lynn etwas murmelte, das wie »… um sie kümmern« klang. »Konnte sie nicht einfach zu Hause lassen …« Das schien Laurel nicht zu gefallen, denn Mr Lynn fügte hastig hinzu: »… bald wieder fort. Ich muss den Zug erreichen.« Eines war jedenfalls klar: Mr Lynn verschwieg Laurel geschickt, wer Polly war und wie sie ins Haus geraten konnte.
Polly lehnte sich an die Fensterbrüstung, schaute zu den Autos auf dem gekiesten Vorplatz hinunter und überlegte. Ihr war mulmig zumute. Sie hatte nichts dabei gefunden, ins Haus zurückzukehren, als Mr Lynn sie darum gebeten hatte. Nun wusste sie, dass das falsch gewesen war. Mr Lynn musste sich dafür mühsam eine Ausrede einfallen lassen. Laurel konnte einem Angst einjagen. Polly hörte sie draußen mit Mr Lynn zanken. Aus ihrer Stimme klang Zorn, ein leises, helles Klirren – wie vorhin das der Eiswürfel im Glas. »Doch, Tom, das bist du, ob dir das nun gefällt oder nicht.« Und ein wenig später: »Weil ich dir das sage, natürlich.« Und wieder etwas später: »Du warst schon immer ein Narr, aber das ist keine Entschuldigung.«
Als Polly das hörte, mischte sich in ihre Angst auch Wut. Laurel war trotz ihrer süßen Stimme ein tyrannisches Ekel. Polly schlenderte zur anderen Wand, zu den Bildern, die Mr Lynn haben durfte. Wie erwartet, waren die nicht annähernd so gut wie jene an der linken Wand. Die meisten waren sogar unmöglich. Während draußen auf der Galerie der Streit weiterging, trug Polly auf Zehenspitzen die Bilder unter dem Fenster zu denen an der rechten Wand, bis alle, die sie bisher ausgesucht hatte, dort lehnten, und stellte dafür ein paar andere Bilder, die einigermaßen brauchbar aussahen, unters Fenster. Und um wieder für eine ungefähr gleiche Verteilung zu sorgen, nahm sie einige schreckliche Bilder von rechts und brachte sie nach links. Nun war alles völlig durcheinandergemischt. Als Mr Lynn ins Zimmer zurückkam, kniete Polly kunstbeflissen an der rechten Wand und versuchte, ihr schlechtes Gewissen durch die Betrachtung eines Bildes zu besänftigen, das Die Wache hieß und einen jungen Ritter zeigte, der vor einem Altar betete.
»Glauben Sie, dass das ein Heldenlehrling ist?«, fragte sie Mr Lynn.
»Ach, nein. Stell es wieder zurück«, sagte er. »Findest du es denn nicht kitschig?«
»Ein bisschen schon«, räumte Polly bereitwillig ein und schaute heimlich zu, wie Mr Lynn mit der Auswahl fortfuhr, während sie umständlich Die Wache wegräumte.
So also war sie zu Feuer und Schierling gekommen. Als Mr Lynn die Stapel auf seiner Seite durchsah, entschied er sich für sämtliche Bilder, die Polly ursprünglich ausgewählt hatte.
»Ich wusste gar nicht, dass dieses hier auch dabei war«, sagte er, und: »Oh, an das Bild kann ich mich erinnern!« Das bunte Gewimmel mit den Geigenspielern sagte ihm besonders zu. Als er zum Feuer bei Sonnenuntergang kam, lächelte er. »Diese Fotografie scheint mich zu verfolgen. Als ich noch hier wohnte, hing sie über meinem Bett. Mir hat immer gefallen, wie der Umriss des Schierlings mit dem dieses Baumes in der Hecke übereinstimmt. Da«, sagte er und drückte Polly das Bild in die Hand. »Du kannst es haben.«
Polly war überwältigt. Sie hatte noch nie ein Bild besessen. Auch hatte sie nicht erwartet, von ihrem ungehörigen Betragen auch noch zu profitieren. »Soll das heißen, dass ich es behalten darf?«, fragte sie.
»Aber natürlich«, sagte Mr Lynn. »Ich fürchte, es ist nicht besonders wertvoll, aber du wirst sehen, es wird dir ans Herz wachsen. Nimm es statt einer Lebensrettungsmedaille.«
Polly wollte sich bedanken, aber Mr Lynn fiel ihr ins Wort: »Komm, wir gehen. Deine Oma macht sich bestimmt schon Sorgen um dich.«
Mr Lynn musste das Bild gemeinsam mit seinen fünf eigenen tragen. Es stieß nämlich beim Gehen gegen Pollys Beine, und sie hatte Angst, das Glas zu zerbrechen.
Die anderen Gäste der Trauerfeier saßen mittlerweile beim Essen. Als Polly mit Mr Lynn durch die Halle eilte, hörte sie Messer und Gabeln klappern. Polly war erleichtert. Wäre ihnen Laurel jetzt über den Weg gelaufen, hätte sie sofort bemerkt, dass Mr Lynn lauter falsche Bilder mitnahm.
Als Polly neben Mr Lynn die winddurchwehte Straße entlangtrottete, sagte sie plötzlich und wusste selbst nicht, warum: »Wenn ich als Ihre Ladenhilfe in der Eisenwarenhandlung arbeite, gebe ich mich für einen Jungen aus. Sie tun dann so, als würden Sie das nicht merken.«
»Meinetwegen«, sagte Mr Lynn. »Solange das nicht bedeutet, dass du dir deine wunderschönen Haare abschneidest.«
Die wunderschönen Haare flatterten Polly ins Gesicht und in den Mund. »Sie sind nicht wunderschön«, sagte sie böse. »Ich hasse sie. Sie machen mich verrückt, und ich will sie abschneiden.«
»Pardon«, sagte Mr Lynn. »Schon gut. Es sind ja deine Haare.«
Polly war ohne ersichtlichen Grund gereizt. »Müssen Sie denn immer gleich nachgeben? Kein Wunder, dass jeder Sie herumkommandiert!« Sie hatten Omas Garten erreicht. »Jetzt dürfen Sie mir mein Bild geben«, sagte sie hochnäsig.
Mr Lynn reichte es ihr wortlos, aber auch er wirkte hochnäsig. Sie schwiegen, gar nicht wie Freunde; in ihr Schweigen blies der Wind und raschelten die Blätter.
Offenbar hatte Oma nach Polly Ausschau gehalten. Als sich Polly das Bild unter den Arm klemmte und mit einiger Mühe das Gartentor entriegelte, knallte die Haustür auf. Zuerst kam Schokominz heraus, machte einen Buckel, richtete den Schwanz auf und ergriff seltsamerweise vor Mr Lynn die Flucht. Dann kam Oma angesegelt – wie eine ziemlich klein geratene Herzogin.
»Kommt rein, und zwar beide, wenn ich bitten darf«, sagte sie. »Ich möchte erfahren, wo Polly gewesen ist.«
Polly und Mr Lynn tauschten statt hochnäsiger nun schuldbewusste Blicke aus. Demütig folgten sie Oma ins Haus und in die Küche. Dort saß Nina vor einem halb leer gegessenen Teller und starrte ihnen mit großen Augen und vollem Mund entgegen. Sie verlagerte die ganze Ladung in die Backe und sagte, nicht ohne Mühe: »Wo warst du?«
»Jawohl«, sagte Oma scharf wie ein Pfefferkuchen. »Das würde mich auch interessieren.« Sie musterte Mr Lynn ausgiebig und durchdringend.
Mr Lynn klemmte sich den unbequemen Bilderstapel unter den anderen Arm. Seine Brillengläser blitzten verlegen. »In Hunsdon House«, gestand er. »Sie … äh, sie kam hereinspaziert. Da war nämlich heute eine Trauerfeier. Sie … äh, sie wirkte ziemlich verloren auf mich, als das Testament verlesen wurde, aber weil sie Schwarz trägt, habe ich nicht gleich bemerkt, dass sie eigentlich nicht dazugehörte. Und dann, fürchte ich, habe ich sie auch noch ein bisschen aufgehalten, weil ich sie bat, mit mir ein paar Bilder auszusuchen.«
Oma machte die Augen schmal, ließ ihren Blick über Mr Lynns hagere Gestalt im dunklen Anzug und die schwarze Krawatte wandern und fand dabei vermutlich eine Menge heraus.
»Ja«, sagte sie, »ich habe den Leichenwagen gesehen. Die Tote war eine Frau, nicht wahr? Und die junge Dame hier ist also in die Trauerfeier geplatzt? Und Sie wollen mir einreden, dass Sie sich um Polly gekümmert haben, Mr – wie war doch gleich Ihr Name?«
»Er hat sich wirklich um mich gekümmert, Oma!«, rief Polly dazwischen.
»Lynn«, sagte Mr Lynn. »Sie war mir eine große Hilfe, Mrs – wie war doch gleich Ihr Name?«
»Whittacker«, knurrte Oma. »Ich bin Ihnen natürlich sehr dankbar, falls Sie Polly von Dummheiten abgehalten haben …«
»Ich habe gut auf sie aufgepasst«, sagte Mr Lynn.
Oma brachte ihren Satz zu Ende, als wäre ihr Mr Lynn nicht ins Wort gefallen. »… Mr Lynn, aber was hatten Sie dort zu suchen? Sind Sie Kunsthändler?«
»Aber nein«, sagte Mr Lynn ziemlich verwirrt. »Die Bilder da haben bloß Liebhaberwert. Es sind Andenken, die mir die alte Mrs Perry in ihrem Testament vermacht hat. Ich verstehe sehr wenig von Malerei – ich bin eigentlich Musiker …«
»Was für ein Musiker?«, fragte Oma.
»Cellist«, sagte Mr Lynn. »In einem Orchester.«
»In welchem Orchester?«, forschte Oma unerbittlich weiter.
»Bei den Britischen Philharmonikern«, sagte Mr Lynn.
»Und wieso waren Sie dann bei dieser Trauerfeier?«, wollte Oma wissen.
»Aus familiären Gründen«, erläuterte Mr Lynn. »Ich war mit Mrs Perrys Tochter verheiratet – wir haben uns Anfang des Jahres scheiden lassen …«
»Verstehe«, sagte Oma. »Verbindlichen Dank, Mr Lynn. Haben Sie schon gegessen?« Obwohl das alles andere als einladend klang, wusste Polly, dass Oma ihren Widerstand aufgegeben hatte. Sie war etwas erleichtert. Die Art und Weise, in der Oma Mr Lynn verhört hatte, war ihr äußerst unangenehm gewesen.
Aber Mr