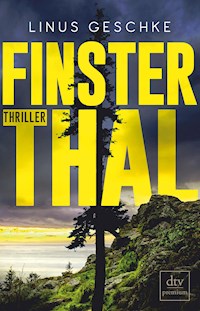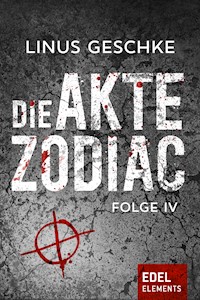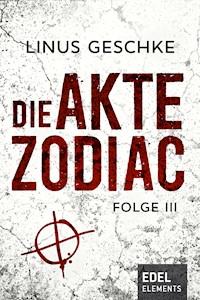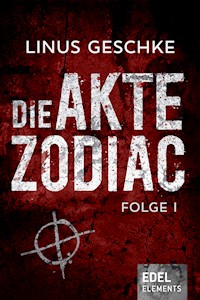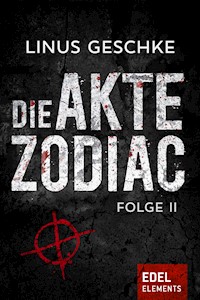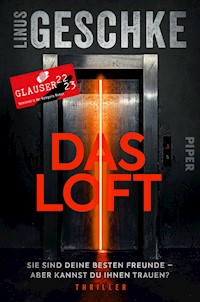4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Du siehst sie nicht, du hörst sie nicht, und doch teilen sie dein Leben. Sie verbergen sich auf dem Dachboden oder im Keller deines Hauses, ohne dass du es bemerkst. Sie kommen erst heraus, wenn du das Haus verlässt. Dann bedienen sie sich an deinem Essen und plündern deinen Kühlschrank, putzen sich mit deiner Zahnbürste die Zähne und tragen deine Kleidung. Sie durchwühlen deine Schränke und Regale, stöbern in Kisten und Truhen. Sie erkunden all deine Geheimnisse, keine dunkle Wahrheit bleibt vor ihnen verborgen. Sie sind deine verborgenen Mitbewohner, und eines solltest du auf gar keinen Fall tun: sie verärgern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für meine Mutter
Du hast mir alles an Liebe gegeben.
Ich gab dir viel zu wenig zurück.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Redaktion: Lars Zwickies
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: plainpicture/Ingrid Michel
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Eine Woche zuvor
Du
Buch Eins
Die Lebenden
Gegenwart
Sven
Sechs Tage zuvor
Sven
Gegenwart
Franziska
Fünf Tage zuvor
Franziska
Sven
Franziska
Sven
Franziska
Du
Franziska
Sven
Franziska
Du
Gegenwart
Tabea
Vier Tage zuvor
Tabea
Sven
Du
Sven
Franziska
Tabea
Franziska
Sven
Du
Franziska
Tabea
Du
Sven
Du
Franziska
Tabea
Sven
Tabea
Du
Buch Zwei
Die Toten
Gegenwart
Marco
Ein Tag zuvor
Marco
Franziska
Tabea
Marco
Sven
Franziska
Marco
Sven
Franziska
Du
Sven
Marco
Tabea
Du
Tabea
Du
Tabea
Du
Franziska
Tabea
Marco
Franziska
Tabea
Sven
Du
Tabea
Du
Marco
Tabea
Du
Tabea
Der Tag danach
Sven
Acht Monate später
Du
Nachwort und Dank
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Eine Woche zuvor
Du
Es ist kalt, es ist Nacht, und vor einer Stunde hat der Wind stark zugenommen. Er weht vom Meer über Dünen und Felder hinweg, biegt Gräser und Halme, bricht sie aber nicht. Du schaust nach oben. Der Himmel ist bewölkt, nur ab und zu sieht man zwischen den Wolken auch Sterne funkeln. Die Lichter ganzer Ewigkeiten.
Zwischen den Dünen und der schmalen Küstenstraße wachsen ein paar unansehnliche Sträucher, und hinter einem davon hast du dich versteckt. Regungslos verharrst du und beobachtest das Haus, das auf der anderen Seite der Straße steht. Es ist ein altes Haus, groß und würdevoll, aber in keinster Weise protzig. Seine zweigeschossige Fassade ist weiß getüncht, die Fenster sind mit grünen Läden versehen und das Satteldach mit Reet bedeckt. Es fügt sich in die Landschaft ein, als sei es schon immer ein Teil von ihr gewesen.
Das nächste Gebäude ist zweihundert Meter entfernt, der nächste Ort anderthalb Kilometer. In dieser Gegend leben Menschen, die ihre Ruhe haben wollen. Menschen wie die Hoffmanns. Obwohl das Haus viele Zimmer hat, bewohnen es die Hoffmanns nur zu dritt: Mama, Papa, Kind, eine Familie wie aus dem Bilderbuch. Der Vater arbeitet als Journalist, die Frau in einem Tourismusbüro, und die siebzehnjährige Tochter Tabea steht kurz vor dem Abitur. Abgesehen von dem Haus ist sie der eigentliche Grund, warum du hier bist.
Noch ist es zu früh, um loszugehen, die Lichter sind gerade erst verloschen. Bevor du dein Versteck verlassen kannst, müssen die Hoffmanns erst noch die schmale Grenze überschreiten, die das Wachsein vom Schlaf trennt. Sobald sie tief und fest in ihren Träumen versunken sind, kannst du dich aus ihren Albträumen erheben.
Die stundenlange Warterei macht dir nichts aus, die Einsamkeit auch nicht. Um die aufkommende Langeweile zu vertreiben, breitest du das Innere des Hauses wie eine Landkarte in deinem Kopf aus. Du kennst jedes Zimmer, jeden Winkel und jeden potenziellen Unterschlupf. In den vergangenen Tagen hast du das Gebäude bereits ausgiebig erkundet – immer dann, wenn die Hoffmanns nicht daheim waren.
Wenn dieses Haus ein Neubau wäre, könnte es in Verbindung mit der modernen Einrichtung vielleicht kalt wirken, aber das ist es nicht. Es ist alt – es lebt. Die Augen, Ohren und Gefühle ehemaliger Bewohner haben es über die Jahrzehnte hinweg in ein Lebewesen verwandelt. Es atmet durch sie, nimmt Anteil an ihrem Leben und beobachtet geduldig, was neue Bewohner in ihm anstellen. Privatsphäre ist in solchen Häusern nur eine Illusion, das weißt du. Es gibt sie nicht, zumindest nicht wirklich. Alles, was dort geschieht, kann unsichtbare Spuren hinterlassen. Angst kann in die Mauern eindringen, Freude, das Lachen eines Kindes.
Der Schmerz der Eltern, wenn diesem Kind etwas geschieht.
Um deine kalt werdenden Muskeln zu lockern, machst du ein paar Dehnübungen, dann hältst du plötzlich inne. Auf der Landstraße nähern sich zwei Lichter, die schnell größer werden. Du gehst wieder in Deckung, kurz darauf zieht auch schon ein weißer Lieferwagen mit hoher Geschwindigkeit vorbei. Du schaust ihm hinterher, bis die Rücklichter in der Ferne verschwunden sind; zwei rote Glühwürmchen auf dem Weg nach Irgendwo.
Auch du wirst irgendwann weiterziehen. Weit weg, in ein anderes Land, auf einen anderen Kontinent. Sobald du hier fertig bist und das Haus und seine Bewohner dir gegeben haben, wonach du dich sehnst.
Doch das liegt noch in der Zukunft, entscheidend ist das Hier und Jetzt, und im Hier und Jetzt leistet dir nur der Wind Gesellschaft. Er vertreibt die wenigen Wolken und zerrt an der olivfarbenen Jacke sowie an dem schweren Rucksack, der über deinen Schultern hängt. Zehn weitere Minuten geht das so, zwanzig, dann schaust du dich ein letztes Mal um. Vor dir ist nur Dunkelheit, und hinter dir ist nur Dunkelheit. Es ist perfekt. Du gehst los.
Mit gleichmäßigen Schritten überquerst du die Küstenstraße und wendest dich dem schmalen Fußweg zu, der neben dem Haus auf die dahinterliegenden Felder führt. Auf diesem Weg kommst du geradewegs an einem kleinen Anbau des Hauses vorbei, einer ehemaligen Waschküche vielleicht. Anders als die anderen Türen des Hauses wurde die des Anbaus nie ausgetauscht oder modernisiert. Ein dummer Fehler, denkst du, aber vielleicht wollten die Hoffmanns ja, dass du kommst. Möglicherweise haben sie sich heimlich gewünscht, dass ihre kleine Familie Zuwachs erhält.
Als du dein Ziel erreicht hast, bleibst du stehen und lässt den Rucksack von den Schultern gleiten. Du nimmst heraus, was du brauchst, es ist nicht viel. Nach sieben Sekunden ist das einfache Schloss bereits geöffnet, nach drei weiteren stehst du im Warmen. Du schließt die Tür hinter dir und gibst dich dem erhabenen Gefühl hin, das dich immer überkommt, wenn du in ein fremdes Haus eindringst. Dem Adrenalin, das in solchen Momenten deine Blutbahn flutet. Dieses faszinierende Hormon aus den Nebennieren sorgt dafür, dass alles an dir effizient wird. Deine Atmung, deine Instinkte, jede einzelne Bewegung.
Ab jetzt gibt es für dich kein Zurück mehr, also entscheidest du dich, voranzugehen. Durch den Anbau in den Flur und von dort aus weiter in die Küche. Das schwache Mondlicht, das durch die Fenster fällt, genügt dir. Du weißt sowieso, wo alles steht; du kennst das Haus bereits, als ob es dein eigenes wäre.
Aus einem Hängeschrank über der Spüle holst du eine Packung Cornflakes. Du isst, bis du satt bist, dann stellst du die Packung wieder an genau die gleiche Stelle zurück. Jetzt musst du dich lediglich noch um deinen Durst kümmern. Im Kühlschrank findest du nur wenige Getränke, aber in der kleinen Vorratskammer direkt daneben stößt du auf mehrere Kisten Bier, Wasser und Apfelschorle. Das ist perfekt. Niemand wird morgen merken, dass zwei Flaschen fehlen.
Nachdem du die Getränke im Rucksack verstaut hast, bist du im Erdgeschoss fertig. Jetzt ist die Zeit gekommen, endlich deinen Unterschlupf für die nächsten Tage aufzusuchen. Um ihn zu erreichen, musst du auf Zehenspitzen die Treppe hochschleichen, die ins obere Stockwerk führt. Du setzt deine Schritte bedächtig, und die dritte Stufe lässt du aus, sie knarzt manchmal.
Am oberen Ende der Treppe schließt sich ein weiterer Flur an, von dem mehrere Zimmer abgehen. Tabeas Schlafzimmer und das der Eltern, außerdem ein Gästezimmer, eine Abstellkammer und zwei Bäder. Du legst das Ohr an die Tür des Elternschlafzimmers und lauschst, hörst ein leises Schnarchen und glaubst sogar, die Ausdünstungen ihrer Körper riechen zu können. Du lächelst. Wie einfach es jetzt wäre, sie ein für alle Mal aus ihren friedlichen Träumen zu reißen.
Doch das tust du nicht, noch nicht. Stattdessen schleichst du weiter, bis du vor dem Zimmer der Tochter stehst. Der Gedanke, dass sie hinter dieser Tür in ihrem Bett liegt, lässt dich zittern. Wenn du wolltest, könntest du die Tür jetzt öffnen, dich neben sie legen und sie mit den Armen umschlingen, aber so bist du nicht. Du willst sie, natürlich willst du das, aber nicht auf diese Weise.
Noch immer kannst du dein Glück nicht fassen, sie unter Millionen von Menschen gefunden zu haben. Tabea ist nicht Miriam, selbstverständlich ist sie das nicht, aber sie sieht aus wie sie, und das genügt. Fürs Erste zumindest.
In den letzten Jahren ist es immer nur um Miriam gegangen, auch wenn du dir das lange nicht eingestehen wolltest. Miriam ist eine Wunde, die sich tief in dein Herz gegraben hat, sich niemals schließt und ewig schmerzt. Wenn du an sie denkst, dann denkst du an Tage voller Freude und an Nächte voller Leidenschaft. Du denkst an ihre Küsse und Berührungen und an das, was ihr gemeinsam vorhattet. Du denkst an alles, nur an das Ende denkst du nie.
An die Schreie.
Das viele Blut.
Das ist zu grausam. Selbst für jemanden wie dich, der manchmal glaubt, die Grausamkeit erfunden zu haben.
Nur widerwillig löst du dich von der Tür, hinter der Tabea schläft, und schüttelst den Gedanken an sie ab wie ein nasser Hund die Wassertropfen. Du darfst nicht schwach werden, nicht jetzt. Schließlich hast du eine Aufgabe zu erledigen.
Die Rache ist dein, und jetzt, so kurz vor dem Ziel, willst du sie auch auskosten. In den nächsten Tagen wirst du dich voll und ganz den Hoffmanns widmen. Du wirst sie besser kennenlernen, ihre dunkelsten Geheimnisse sezieren und dein neues Wissen dann gegen sie einsetzen. Das bist du Miriam schuldig. Tabea ist nur ein Bonus.
Als du das Haus zum ersten Mal betreten hast, galt dein Hauptaugenmerk dem passenden Unterschlupf. Das Gästezimmer, das offenbar nie benutzt wurde, kam in Betracht. Der Keller auch. Doch der Dachboden schien dir am besten geeignet. Die dichte Staubschicht auf den Dielen und das Quietschen der Tür haben dir verraten, dass seit Monaten niemand mehr dort gewesen war. Er war perfekt, in jeder Hinsicht, und nachdem du die Entscheidung getroffen hattest, hast du die Türangeln bei deinem nächsten Besuch geölt. Natürlich hast du das, du denkst an alles.
Auch jetzt bewegt sich die Tür vollkommen geräuschlos in ihren Angeln, als du sie öffnest. Oben angekommen nimmst du den Rucksack ab und breitest die mitgebrachte Isomatte in einer Ecke auf dem Boden aus. Zusammen mit einem dünnen Schlafsack wird dies in den nächsten Tagen dein Nachtlager sein. Mehr brauchst du nicht, für alles andere sind die Hoffmanns zuständig. Sie werden dich mit Essen versorgen, mit frischer Kleidung und Getränken. Du wirst ihre Toilette benutzen und dich unter ihre Dusche stellen, wenn sie nicht da sind. Solltest du etwas brauchen, was die Hoffmanns nicht haben, kannst du das Haus jederzeit verlassen und es dir im nächsten Ort besorgen. Du hast genug Geld, über vierzigtausend Euro. Ein Hoch auf alle Hausbesitzer, denkst du, die ihre Ersparnisse nicht zur Bank bringen, weil sie eine leere Kaffeedose in der Küche für sicherer halten.
Müde kriechst du in den Schlafsack und schließt die Augen. Das lange Warten in der Kälte hat dich mürbe gemacht, der abklingende Adrenalinrausch tut das Übrige. Als der Schlaf kommt und seine Arme nach dir ausstreckt, lässt du dich hineinfallen. Es war ein guter Tag, und endlich bist du angekommen.
In ihrem Zuhause.
Buch Eins
Die Lebenden
Gegenwart
Sven
Mein Name ist Sven Hoffmann, und schon mit siebzehn wusste ich, dass ich lieber ein anderer wäre. Ich wusste nur nicht, wie das geht.
Jetzt, mit zweiundvierzig, bin ich verheiratet und Vater einer siebzehnjährigen Tochter, die auf den schönen Namen Tabea hört. Für Außenstehende sind wir eine perfekte Familie, und dennoch frage ich mich manchmal, wie zum Teufel ich hierhergekommen bin.
Was mit mir passiert ist, mit meinem Leben.
Ich habe es nicht gewollt, nicht auf diese Art zumindest. Weder den eintönigen Job bei einem Bremer Fernsehsender, für den ich Beiträge erstelle, über deren Inhalte andere bestimmen, noch die Ehe mit einer Frau, die ich zwar auf eine geschwisterliche Art noch liebe, aber nicht mehr begehre. Die Dinge haben einfach ihren Lauf genommen, fast ohne mein Zutun. So, als hätten fremde Mächte mit meinem Schicksal Karten gespielt, und die Asse wären bei jemand anderem gelandet.
Nichts in meiner Vergangenheit hat mich auf das Leben vorbereitet, das ich heute führe. Wie auch? Ich bin als Kind einer alleinerziehenden Mutter im Ruhrgebiet aufgewachsen, die einen schlecht bezahlten Job im Supermarkthatte. Wir konnten uns kein Auto leisten, und bis ich volljährig wurde, sind wir nur zweimal im Urlaub gewesen. Das erste Mal besuchten wir ein Feriendorf nahe der holländischen Küste, da war ich sechs, beim zweiten Mal verbrachten wir zehn Tage in Rimini. Dort, an der Adriaküste, hat es mir besser gefallen. Der Strand schien in meinen Kinderaugen endlos zu sein, genau wie das Gebilde aus dicht an dicht gestellten Sonnenliegen.
Wir hatten nur ein Hotel mit Frühstück gebucht, also gingen wir jeden Abend in einem der unzähligen Restaurants essen. Ich glaube, ich habe meistens Pizza Margherita bestellt, immer mit extraviel Käse, und Mutter hat mir jedes Mal lächelnd über den Kopf gestreichelt, während ich freudestrahlend mampfte. Irgendetwas muss sie auch gegessen haben, schon klar, aber wenn ich an diese Zeit zurückdenke, kann ich mich nur noch daran erinnern, dass sie mir beim Essen zugesehen hat.
In Essen-Rüttenscheid haben wir in einer kleinen Zweizimmerwohnung gewohnt, deren Balkon so winzig war, dass man nur zu zweit darauf stehen konnte. Von den beiden Zimmern war eins mein Reich, und in dem anderen, das auch als Wohnzimmer diente, hat meine Mutter auf einem ausklappbaren Sofa geschlafen. Abends saßen wir dann oft gemeinsam vor dem Fernseher, irgendeine Show im Fernsehen ansehend, wobei Mutter häufig parallel meine Socken stopfte, die vom Fußballspielen ganz löchrig waren. Sie hat mich auch stets ermahnt, die guten Sachen sofort auszuziehen, sobald ich nach Hause kam, damit sie geschont wurden und ich sie am nächsten Tag wieder tragen konnte. So war sie eben, pragmatisch und liebevoll. Eine Frau, die sich nur selten irgendwelchen Tagträumen hingab, und wenn, dann handelten diese bestimmt ausschließlich von meiner Zukunft. Von einem guten, geregelten Einkommen, das ich irgendwann als Dachdecker oder Mechaniker haben würde, wenn ich in der Schule nur fleißig genug wäre. Faulheit ist schon immer mein Hauptproblem gewesen, das wusste sie ebenso gut wie ich.
Umso größer war dann die Überraschung, als ich wider Erwarten sogar das Abitur schaffte. Meine Mutter konnte es nicht glauben, als sie das Zeugnis sah. Sie betonte ständig, dass ich der Erste in der Familie sei, dem dieses Kunststück gelungen wäre. Als Onkel Manfred uns kurz darauf besuchte, erzählte sie ihm freudestrahlend, dass ich jetzt Abitur hatte und eventuell sogar studieren wollte. Er sah mich daraufhin nur kritisch an und fragte, ob ich schwul sei.
Sein dämlicher Kommentar war mir egal, ich hatte meinen Weg gefunden. Wollte mit aller Macht raus aus dieser kleingeistigen Welt, in die mich ein ungnädiger Gott geschmissen hatte. Weg von Onkel Manfred und Tante Frieda, die oft sagte, dass unter dem Führer ja nicht alles schlecht gewesen sei, und die Horst Schimanski – den Helden meiner Kindheit – für einen Kommunisten hielt, der auf die Mattscheibe geschickt wurde, damit er die Jugend verderben konnte. Nur meine Mutter ragte aus dieser Familie heraus, auf sie lasse ich nichts kommen. Der einzige Lichtschein in einer verwandtschaftlich bedingten Finsternis.
Kurz darauf fand ich einen Studienplatz in Bochum und ein winziges Apartment, in dem es nur leicht nach Schimmel roch. Um mir die einundzwanzig Quadratmeter Freiheit leisten zu können, ging ich an fünf Abenden in der Woche kellnern. Immer im sogenannten Bermudadreieck, der berüchtigten Bochumer Partymeile. Das hatte zur Folge, dass ich viel zu selten für mein Studium lernte, aber die ungeheuerlichsten Sachen erlebte.
Schon früh merkte ich, dass ich anders war als meine Kommilitonen, die meist aus gutbürgerlichen Kreisen stammten. Vor allem mein unstillbarer Hunger unterschied mich von ihnen. Niemals wurde ich satt, ständig wollte ich mehr. Mehr Leben, mehr Sex, mehr Abenteuer. Ich konnte gar nicht genug davon bekommen, war geradezu süchtig danach. Vor allem nach den regelmäßig stattfindenden Studentenpartys, und auf einer dieser Partys lernte ich Franziska kennen.
Sie saß auf einem geblümten Sofa, ein wenig in die Ecke gedrückt, und wirkte, als sei sie an dem Geschehen im Raum nicht sonderlich interessiert. Ich setzte mich zu ihr, sprach sie an und ließ mich auch von ihrer einsilbigen Antwort nicht abschrecken. Wir haben dann den ganzen Abend miteinander gequatscht, später ein bisschen rumgeknutscht und anschließend Nummern ausgetauscht. Sie war schön, hatte lange, braune Haare und ein ebenmäßiges Gesicht mit Lippen, deren oberer Teil wie Vogelschwingen geformt war. Außerdem war sie reich. Das musste sie mir nicht sagen, das konnte man spüren. Sie hat einfach diese Form von Sicherheit ausgestrahlt, die nur Menschen ohne finanzielle Sorgen an sich haben. Keiner meiner früheren Freunde hat diese Sicherheit ausgestrahlt, und ich schon gar nicht.
Beim Abschied dachte ich noch, dass sie vollkommen anders war als alle anderen Frauen, die ich kannte. Alles an ihr war glatt, zu glatt; die Haare, die Haut, die Ausdrucksweise. Kein Makel, nirgends, eine fleischgewordene Mischung aus Vollendung und Langeweile. Warum ich sie dennoch ein paar Tage später angerufen habe, weiß ich nicht mehr. Vielleicht war es der Reiz, ein solches Wesen näher kennenzulernen, und ein bisschen verknallt war ich auch.
In den Wochen darauf haben wir uns regelmäßig getroffen und unseren Spaß gehabt, doch dann wurde sie schwanger, und das hat alles verändert. Im ersten Moment war ich geschockt, völlig verwirrt, aber dann hat Franziska geweint. Dieses Weinen hat einen Punkt in mir berührt, von dem ich nicht einmal wusste, dass es ihn gab. Ich habe sie anschließend in den Arm genommen, ihr über den Kopf gestreichelt und gesagt, dass ich sie liebe und dass wir das zusammen schon schaffen werden. Der erste Teil mochte gelogen sein, an den zweiten glaubte ich selbst. Ich fühlte mich ihr und dem ungeborenen Kind gegenüber augenblicklich verpflichtet, so war ich nun mal. Ein einfach gepolter Junge aus dem Ruhrgebiet, der aber instinktiv wusste, was richtig oder falsch war.
Zwei Monate später haben wir dann im Rahmen einer kleinen, aber feinen Feier geheiratet. Natürlich waren ihre Eltern auch dabei, und natürlich haben sie alles bezahlt, was sie auch jedem Gast gegenüber erwähnten. Die Höhenbergs, oder wie ich sie hinter vorgehaltener Hand spöttisch nannte: Herr Professor Doktor nebst Gemahlin.
Ich konnte die beiden vom ersten Moment an nicht ausstehen. Zum einen, weil sie meine Mutter bei der Feier kaum beachtet haben, sie geradezu von oben herab behandelten, während sie mir gleichzeitig versicherten, dass ich von nun an wie ein Sohn für sie wäre. Trotz ihrer geheuchelt schönen Worte haben sie mir dabei stets das Gefühl vermittelt, nicht gut genug für ihre Tochter zu sein, und vielleicht hatten sie damit auch recht. Es war aber nicht meine Schuld, ich hatte mir die Situation schließlich nicht ausgesucht und tat nur, was ich glaubte, tun zu müssen.
Obwohl die Hochzeit mit Franziska keine Liebesheirat war, ist sie rückblickend auch kein Fehler gewesen. Wir sind jetzt seit siebzehn Jahren verheiratet, und es gab schlechtere Ehen als unsere, viel schlechtere. Natürlich auch bessere, aber die sind selten.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir nach der Hochzeit im Ruhrgebiet bleiben würden, aber Franziska und ihre Eltern hatten andere Pläne. Gemeinsam drängten sie darauf, dass wir an die Nordsee ziehen sollten, nicht weit von dem Ort entfernt, aus dem Franziska stammt. Ihr Vater sagte, dass er sogar schon das richtige Haus für uns gefunden hätte. Teuer zwar, aber kein Problem, um die Finanzierung würde er sich kümmern. Man müsse nur schnell zuschlagen, meinte er, es sei eine einmalige Gelegenheit, außerdem wäre das Baby ja bald da.
Alles in mir hat sich gegen den Gedanken gesträubt. Ich bin ein Kind der Großstadt, und die Vorstellung, meine Zukunft in einem abgelegenen Küstenort verbringen zu müssen, klang alles andere als verheißungsvoll. Es fühlte sich einfach nicht richtig an, nichts davon, doch immer, wenn ich Franziska von meinen Bedenken erzählte, hat sie meine Aussagen abgeblockt, um dann sofort ihre Argumente vorzubringen. Irgendwann habe ich nachgegeben und mir gedacht, ich könne mir das Ganze ja wenigstens mal anschauen. Diesen Ort, aus dem sie stammte, und das Haus, das ihr Vater gefunden hatte.
Drei Stunden dauerte die Fahrt, und ich weiß noch, wie ich mich fühlte, als ich das Haus dann zum ersten Mal sah. Das hier … Das war nicht ich, nichts von alledem. Menschen wie ich wohnen nicht in solchen Palästen. Sie ertragen auch diese Weite nicht, überall nur Landschaft, brauchen andere Menschen um sich herum, das pulsierende Leben.
All das habe ich Franziska auf der Rückfahrt auch gesagt, aber es spielte keine Rolle mehr – sie hatte immer ein Gegenargument zur Hand. In den nächsten Tagen glichen unsere Diskussionen einem Boxkampf, bei dem die Treffer gleichmäßig verteilt sind und die Gegner irgendwann merken, dass es niemals enden wird, wenn nicht einer der beiden vorzeitig aufgibt. Und natürlich war ich derjenige. Vielleicht auch, weil es sich nicht gut anfühlt, mit jemandem zu streiten, der hochschwanger ist.
Stattdessen fing ich an, mir einzureden, dass Franziska mit ihren Argumenten wohl recht hatte. Für unser Kind würde es auf dem Land besser sein, für Franziska auch, so nah bei ihren Eltern. Und ich? Konnte mich ja immer noch mit dem Gedanken trösten, dass ich stets von einem anderen Leben geträumt hatte und es jetzt endlich bekam.
Glückwunsch!
Vier Wochen später zogen wir um, weitere fünf Wochen danach kam Tabea zur Welt. Mein Studium musste ich infolge des Umzugs natürlich aufgeben, aber Franziskas Vater besorgte mir eine gut bezahlte Stelle bei einem Bremer Fernsehsender, dessen Intendanten er vom Golfspielen kannte. Ein guter Job sei wichtig, meinte er, schließlich hätte ich jetzt ja eine Familie zu ernähren. Franziskas Vater lächelte, während er das sagte, aber es wirkte nicht so, als würde er Spaß machen.
Trotz des schlechten Starts liefen die ersten Jahre an der Nordsee besser als gedacht. Tabea entwickelte sich prächtig, der Job als fester freier Mitarbeiter war genau der richtige für mich, und Geld war jederzeit ausreichend vorhanden. Unser gemeinsames Leben war sorgenfrei, mein eigenes hingegen wurde fortan aber immer langweiliger. Es gab kaum noch Veränderungen, nur noch wenige Abenteuer und schon gar keine Herausforderungen mehr. Besonders bewusst wird mir das immer, wenn ich meine Tochter ansehe, die alles noch vor sich hat. Sagt man nicht, dass Kinder der Anblick eines Landes sind, in das man nie mehr zurückkehren kann?
Einst wollte ich so vieles erleben, aber von diesem nicht zu stillenden Hunger ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch Gedankenspiele, denen ich in den wenigen stillen Momenten nachgehe, die mir noch geblieben sind. Sie alle beginnen mit den immer gleichen Worten:
Was wäre, wenn …
Vielleicht sind dies die mächtigsten Worte der Welt, weil sie Gedankenspiralen auslösen, die nicht mehr aufzuhalten sind. Man kann sich ihnen ewig hingeben, sollte aber aufpassen, weil sie in den meisten Fällen zu nichts Gutem führen.
Was wäre, wenn ich mich nicht so früh gebunden hätte?
Was wäre, wenn mein Leben anders verlaufen wäre, selbstbestimmter?
Was wäre, wenn ich der geworden wäre, der ich immer sein wollte?
Die Antwort ist stets dieselbe – ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es da draußen mehr geben muss als das, was mir mein eintöniges Familienleben bietet. Eine unterschwellige Sehnsucht, die ich kaum benennen kann, ist zu meinem ständigen Begleiter geworden. Ein Verlangen nach Veränderung vielleicht, doch dieses Verlangen bleibt Jahr für Jahr unerfüllt. Das frustriert mich, und manchmal muss ich mich geradezu zwingen, die Dinge wieder wertzuschätzen, die ich habe.
Einen gesicherten Job.
Eine liebende Frau.
Eine fantastische Tochter.
Aber vielleicht ist heute ja mein Glückstag, zumindest ändert sich gerade alles. Ich starre ungläubig auf die Waffe am Boden, auf die Gestalt mit dem Messer in der Hand. Alles dreht sich, das muss das Ende sein. Ich spüre die Ohnmacht nahen und weiß nicht, ob ich jemals wieder aus ihr erwachen werde. Ob meine Frau dann noch lebt, meine geliebte Tochter.
Was wäre, wenn …
Sechs Tage zuvor
Sven
»Sven?«
Ich drehe mich um und sehe die Frau an, die ich vor siebzehn Jahren geheiratet habe. Franziska ist attraktiv, immer noch, und es vergeht kaum ein Tag, an dem ich ihretwegen nicht beneidet werde. Dank ihrer ebenmäßigen Gesichtszüge wirkt sie deutlich jünger, als sie es mit ihren vierzig Jahren ohnehin erst ist, und auch ihre Figur passt dazu. Franziska ist einen Meter zweiundsiebzig groß und wiegt achtundfünfzig Kilogramm; darauf ist sie stolz, ebenso wie auf ihre fast faltenfreie Haut. Kein einziges Tattoo befindet sich darauf, natürlich nicht, sie selbst ist das Gemälde.
Dann fällt mir ein, dass das Gemälde wohl immer noch auf eine Antwort wartet.
»Was denn?«
»Wir haben schon kurz vor zwei«, sagt sie. »Musst du nicht so langsam los? Ich dachte, die Pressekonferenz fängt bald an.«
»Entspann dich«, entgegne ich. »Ein bisschen Zeit habe ich noch.«
Sie verzieht das Gesicht, wie immer, wenn ich ihren Aufforderungen nicht mit dem nötigen Einsatz folge. So ist sie eben, unsere Familienmanagerin. Alles hat sie im Blick, jeden Termin und jede gesellschaftliche Verpflichtung. Hinter ihrer schön geschwungenen Stirn muss sich eine riesige Excel-Tabelle verbergen. Ich kenne sie so gut, nach all den Jahren vielleicht zu gut. Ich weiß, dass sie mich gleich vorwurfsvoll anschauen wird, weil ich nicht reagiere, also wende ich mich rechtzeitig ab, um ihrem strafenden Blick zu entgehen. Schaue stattdessen weiter durch das Wohnzimmerfenster hinaus in die Weite, von der es hier so viel gibt.
Durch das Fenster kann man nicht nur die vor dem Haus verlaufende Küstenstraße sehen, sondern auch die dahinterliegenden Dünen und einen kleinen Teil der Nordsee, die sich bleigrau bis zum Horizont erstreckt. Kein Schiff ist auf dem Wasser zu erkennen, nur Möwen kreisen umher, aber die sind ja immer da. Es ist unmöglich, auch nur zehn Meter am Strand entlangzugehen, ohne in ihre matschigen Hinterlassenschaften zu treten.
Ich könnte noch stundenlang hier stehen und einfach nur aufs Meer schauen, aber Franziska lässt mich nicht. Erneut treibt sie mich zur Eile an, und das Schlimme ist, dass sie damit auch recht hat. Ich sollte mich tatsächlich beeilen, wenn ich zu der anstehenden Pressekonferenz nicht zu spät kommen will. Dabei bin ich sicher, dass die Polizei auch heute nichts Neues zu verkünden hat.
Es ist bereits die dritte Pressekonferenz in vier Tagen, die wegen des vermissten Mädchens einberufen wird, obwohl es seit ihrem Verschwinden praktisch keine Neuigkeiten mehr gab. Dennoch sind Torge – der Kameramann, mit dem ich am häufigsten zusammenarbeite – und ich derzeit mit nichts anderem beschäftigt. Wir machen das, weil der Sender es so will, und der Sender will es, weil jeder Beitrag fantastische Einschaltquoten verspricht. Alles an dem Fall ist mysteriös, und die Zuschauer lechzen geradezu nach Informationen.
Ich kann sie verstehen, die Zuschauer.
Mir geht es ja genauso, wenn auch aus anderen Gründen.
Rebecca Sandtner ist vor fünf Tagen spurlos aus ihrem Elternhaus verschwunden. Die Siebzehnjährige, deren Eltern in Aurich ein Autohaus besitzen und die von Bekannten als erstaunlich reif für ihr Alter bezeichnet wird, hat in dieser Nacht weder Geld noch Papiere mitgenommen. Sie hat auch keine Nachricht hinterlassen, und ihr ebenfalls verschwundenes Handy ist seitdem ausgeschaltet geblieben, sodass schon bald die Möglichkeit einer Entführung im Raum stand. Die Eltern gerieten in Panik, und die Polizei wurde nervös – so, wie das bei potenziellen Entführungen immer der Fall ist.
Die anschließende Rekonstruktion der Ereignisse ergab, dass Rebecca am Vorabend ihres Verschwindens gegen 23 Uhr ins Bett gegangen war, nachdem sie mit ihren Eltern noch ferngesehen hatte. Anschließend schickte sie einer Freundin eine WhatsApp-Sprachnachricht, in der es um den Schulunterricht des darauffolgenden Tages ging. Dann schaltete sie das Licht aus. Als ihre Mutter sie am nächsten Tag wecken wollte, war das Bett leer.
Da es keine Spuren gibt, die das Gegenteil andeuten, geht die Polizei davon aus, dass das Mädchen das Elternhaus freiwillig verlassen hat. Wohin sie wollte und ob sie in jener Nacht mit jemandem verabredet war, bleibt ungewiss. Das Mädchen hat seit einem Jahr einen Freund, Yannick, der sich das Ganze allerdings auch nicht erklären kann. Er hat die fragliche Nacht in seinem Elternhaus verbracht, und die Polizei hat trotz intensiver Bemühungen keinen Hinweis darauf gefunden, dass er etwas mit Rebeccas Verschwinden zu tun haben könnte.
Das ist die Faktenlage, und sie sieht weiß Gott nicht gut aus. Die Polizei hat nichts, womit sie arbeiten kann, und alle bisherigen Ermittlungsansätze liefen ins Leere. Man kann nur eins mit Gewissheit sagen: Rebecca ist verschwunden. Einfach so, als hätte sie sich in ihrem Bett aufgelöst.
Unwillkürlich zucke ich zusammen, als Franziska ihre Hand auf meine Schulter legt. Ich drehe mich um und sehe ihr in die Augen. Ihr Gesichtsausdruck hat sich verändert. Sie schaut mich jetzt nicht mehr vorwurfsvoll an, eher unsicher, besorgt vielleicht.
»Du denkst an das Mädchen, nicht wahr?«
Ich nicke.
»Ich hoffe ja immer noch, dass sie nur von zu Hause ausgerissen ist und bald wieder auftaucht«, sagt Franziska. »Trotzdem möchte ich mir nicht vorstellen, was die armen Eltern gerade durchmachen. Ich meine … Wenn das eigene Kind verschwindet, das muss grausam sein!«
Ich gebe ein zustimmendes Geräusch von mir, was soll ich auch sagen? Ja, es ist schlimm, aber schlimme Dinge passieren nun mal – in den Jahren beim Sender habe ich genug davon mitbekommen. Das volle Programm aus Katastrophen halt, außerdem ist es auch nicht der erste Vermisstenfall, über den wir berichten. Ich weiß, was hinter den Kulissen abläuft, und ich kenne auch die Kriminalstatistiken.
Die meisten verschwundenen Menschen in Deutschland tauchen innerhalb der ersten vierundzwanzig Stunden wieder auf, der Großteil der anderen dann binnen drei Tagen. Sollte die vermisste Person auch dann nicht wieder zurück sein, nimmt die Wahrscheinlichkeit für ein Verbrechen mit jedem Tag zu, bis es irgendwann immer unwahrscheinlicher wird, dass diese Person überhaupt noch lebt.
All das weiß ich, und Franziska weiß es auch. Dennoch ist ihre Sicht auf die Welt eine völlig andere als meine. Nicht nur in diesem Fall, sondern ständig. Und das liegt vor allem an Franziskas Wesen. Sie ist ein Mensch, der geradezu zwanghaft an ein Happy End glauben will. Egal wie schlimm die Vorzeichen auch sein mögen. Wenn die Realität ihr dann hin und wieder einen Strich durch die Rechnung macht, reagiert sie auf solche Vorkommnisse völlig perplex. Überrascht, dass eine Welt wie diese tatsächlich existiert und sie darin leben muss.
»Vielleicht ist diese Rebecca ja wirklich nur weggelaufen«, wiederholt sie und sieht mich nach Zustimmung heischend an. »Manchmal machen Teenager so etwas doch. So selten ist das nicht. Warum geht jeder immer direkt vom Schlimmsten aus?«
»Vielleicht tun die meisten Menschen das, weil sie im Gegensatz zu dir Realisten sind.«
Sie zuckt zusammen, die Worte treffen sie wie ein Peitschenhieb. »Dann denkst du also auch, dass das Mädchen tot ist?«
»Keine Ahnung«, weiche ich aus und merke selbst, wie lahm das klingt. »Wir werden sehen.«
Ich habe den letzten Satz kaum ausgesprochen, als ich meine Worte auch schon bedauere. Ich sollte Franziska nicht so behandeln. Nicht so kurz angebunden reagieren, so gleichgültig. Das hat sie nicht verdient, niemand hat das, und dennoch tue ich es, ständig. Ich erzähle nichts mehr, ich berichte nur noch. Irgendwann auf unserer langen Reise muss mir der Wille abhandengekommen sein, sie vollumfänglich an meinem Leben teilhaben zu lassen. Ich glaube, dass sie das auch weiß. Zumindest hat sie sich in den letzten Wochen verändert, auch wenn ich den Grund für diese Veränderung nicht benennen kann.
Anstatt mich zu entschuldigen, werfe ich einen Blick auf die Uhr und sage, dass ich jetzt wirklich losmuss. Sie nickt nur und bleibt im Wohnzimmer zurück, während ich in den Flur gehe, um mir die Schuhe anzuziehen. Ich will gerade nach dem Autoschlüssel greifen, als ich mitten in der Bewegung innehalte. Der Schlüssel ist weg. Er liegt nicht mehr auf dem Sideboard hinter der Eingangstür, wo ich ihn immer deponiere, wenn ich nach Hause komme.
»Franziska?«, rufe ich.
»Was denn?«, kommt es aus dem Wohnzimmer zurück.
»Weißt du, wo mein Autoschlüssel ist?«
»Wahrscheinlich da, wo du ihn zuletzt hingelegt hast.«
»Da ist er aber nicht.«
»Hmm«, macht sie und kommt in den Flur. »Welche Hose hast du denn gestern angehabt?«
Dieselbe wie heute, denke ich. Dennoch befühle ich automatisch die Hosentaschen, leer, bevor ich auf das Schlüsselbrett an der gegenüberliegenden Wand schaue, an das Franziska und Tabea immer ihre Schlüssel hängen. Mitten unter ihnen: der des Jeeps. Ich schüttle den Kopf – Tabea vielleicht – und greife danach.
Als ich Franziska zum Abschied einen flüchtigen Kuss auf die Wange gebe, lächelt sie sanft. Kein böses Wort mehr wegen meines unsensiblen Verhaltens, kein Vorwurf. Auch das passt nicht zu ihr, normalerweise ist sie nachtragend. Sie leidet dann zwar eher still und heimlich, lässt mich dieses Leiden aber spüren. Durch Gesten, durch Blicke, ganz subtil.
Man kann ihr vieles nachsagen, aber nicht mangelnde Klasse. Obwohl sie zart und zerbrechlich wirkt, verfügt sie über jede Menge Kampfgeist. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie lange nach unserer verloren gegangenen Liebe gesucht hat, ich hingegen nach einem Ausweg.
Als ich das Haus verlasse, erstrahlt der Himmel über dem Meer in einem tiefen Blau. Nur ein paar vereinzelte Schäfchenwolken sind zu sehen und jede Menge Möwen, die darunter wie entflohene Gefühle kreisen.
Die Pressekonferenz ist ein kompletter Reinfall, zumindest aus unserer Sicht. Claudia Lüders, die zuständige Ermittlerin, fasst zunächst die bekannten Vorkommnisse zusammen, bevor sie die Bevölkerung um Mithilfe bittet. Es ist ein eindringlicher Appell; gerichtet vor allem an Rebeccas Freundinnen und verbunden mit der Ermahnung, dass dies der falsche Zeitpunkt sei, um aus falsch verstandener Loyalität irgendwelches Wissen für sich zu behalten.
Wirkliche Neuigkeiten dagegen hat sie nicht zu verkünden. Sie betont, dass man in jede Richtung ermitteln würde und keine Möglichkeit ausschließen könne, aber ihr Gesicht sagt etwas anderes. Es sieht müde aus, abgekämpft und leer. Als sie fertig ist, dürfen wir Pressevertreter noch ein paar Fragen stellen, auf die sie nur ausweichend antwortet. Kurz darauf stehen Torge und ich auch schon wieder vor der Tür der Polizeiinspektion.
»Und jetzt?«, will der gebürtige Däne wissen, nachdem er die Kameraausrüstung in seinen Kombi verladen hat. »Was machen wir?«
»Ich habe Hunger und Lust, ein paar Menschen zu sehen. Wie wär’s mit der Trattoria am Markt? Der Primitivo dort ist auch nicht schlecht.«
»Dann los«, sagt er, und wir machen uns zu Fuß auf den Weg.
Bis zum Marktplatz ist es nicht weit. Die Sonne scheint, es riecht durchdringend nach Frühsommer, und am Marktplatz stoßen wir auf ukrainische Straßenmusiker, die irgendein Volkslied spielen. Sie sind gut, richtig gut. Ich mag Musik, also schmeiße ich drei Euro in den vor ihnen liegenden Akkordeonkoffer, und auch Torge bleibt stehen. Er zögert kurz, dann grinst er und beginnt zu tanzen. Irgendwann klatscht er auch den Rhythmus mit, während ich nicht weiß, ob ich bei seinem Anblick lachen oder die Hand verschämt vor die Augen legen soll. Die Musiker entscheiden sich fürs Lachen, wenigstens ihnen scheint die Darbietung zu gefallen.
Ich mag Torge, aber ich habe nie verstanden, warum er so krampfhaft versucht, wie ein Jugendlicher zu wirken. Dabei geht es nicht nur um sein Verhalten, auch um die Kleidung oder die Wortwahl. Sobald er irgendeinen neuen Begriff aufschnappt, baut er ihn in seinen Wortschatz ein. Nicht weil er das wirklich cool findet – sondern einfach nur, weil er glaubt, so jünger zu wirken.
Als ich ihn einmal darauf angesprochen habe, meinte er nur, dass er nicht einer dieser Idioten sein will, die mit Ende dreißig schon wie ihre eigenen Väter wirken. Das ist ihm gelungen. Jetzt wirkt er wie einer dieser Idioten, die einfach nicht älter werden können.
»Du brauchst mich gar nicht so sonderbar anzuschauen«, sagt Torge, nachdem er die Tanzeinlage beendet hat. »Bin ich dir etwa peinlich?«
»Nicht mehr als an anderen Tagen«, grinse ich. »Ich wäre dir aber trotzdem dankbar, wenn wir jetzt einfach weitergehen könnten.«
In der Trattoria ist um diese Uhrzeit noch nicht viel los, sodass wir problemlos einen Tisch im Freien finden. Torge bestellt eine Pizza, ich entscheide mich für Cannelloni. Nachdem die Kellnerin die Bestellung aufgenommen hat, trifft mein Blick den seinen. Er schaut mich seltsam an, wirkt irgendwie besorgt.
»Was ist?«, frage ich.
»Nichts«, sagt er lahm.
»Für nichts guckst du aber ganz schön kritisch.«
»Okay«, gibt er sich geschlagen. »Ich finde, dass du heute echt fertig aussiehst. Was ist los? Gibt es mal wieder Stress mit Franzi?«
Franziska würde ausrasten, wenn sie wüsste, dass er sie Franzi nennt.
»Zu Hause ist alles okay«, lüge ich.
»Was ist es dann?«
»Keine Ahnung. Ich bin einfach nur müde.«
»Oh … Hattest du etwa Sex mit Franzi? Hat sie sich dabei mal bewegt?«
»Nein, das nicht«, sage ich und verdrehe die Augen.
»Wie jetzt? Sie hat sich nicht bewegt?«
»Doch, das heißt … Nein, wir hatten keinen Sex, obwohl ich nicht wüsste, was dich das angeht! Es war nur … In der letzten Nacht ist unser Fernseher mehrmals angegangen. Einfach so, ohne Grund. Irgendwann habe ich den Stecker rausgezogen, konnte dann aber nicht mehr einschlafen. Die Stunden fehlen mir jetzt wohl.«
Torge kneift die Augen zusammen. »Wie jetzt, der Fernseher ist angegangen? Von ganz allein?«
»Ja«, bestätige ich. »Dreimal.«
»Tabea vielleicht?«
»Die hat tief und fest geschlafen. Außerdem hat sie in ihrem Zimmer einen eigenen Apparat. Ich denke, dass das Teil einfach nur eine Macke hat. Morgen will ich in die Stadt und mich nach einem neuen umsehen.«
Bevor Torge antworten kann, kommt die Kellnerin und stellt das Essen auf den Tisch. Wir reden noch kurz über die Pressekonferenz und darüber, was man aus dem wenigen Material machen könnte, und nach dem Essen hat Torge die Geschichte mit dem Fernseher schon wieder vergessen. Er putzt sich den Mund ab, lehnt sich entspannt zurück und wendet sich umgehend dem nächsten Thema zu – seiner neuesten Eroberung, Tina oder Tanja.
Der gebürtige Däne hat ständig neue Partnerinnen, obwohl niemand aus unserem Bekanntenkreis versteht, wie er das hinbekommt. Torge ist nicht gerade ein Traum von einem Mann, kein klassischer Womanizer. An seinem Körper gibt es keine sichtbaren Muskeln, und wenn er T-Shirts trägt, ragen seine Arme wie Bindfäden aus den Ärmeln hervor. Den schütteren Haarwuchs versucht er unter einem Baseballcap zu verbergen, und im Sommer wird seine Haut nur kurzzeitig rot, um zwei Tage später wieder blass wie die eines Albinos zu sein.
Insgeheim glaube ich, dass die Gründe für seinen Erfolg in seiner Stimme zu finden sind, die so tief und dunkel wie der Marianengraben ist. Dazu verfügt sie über diesen skandinavischen Akzent, der in den Ohren vieler Frauen wohl unwiderstehlich klingt, irgendwie nach Hygge und so.
Während ich einen Rotwein trinke, gerät Torge über seine neueste Bekanntschaft regelrecht ins Schwärmen. Wie gut diese Tina oder Tanja doch aussieht, wie unkonventionell sie ist, wie gebildet. Irgendwann kommt er auch auf ihre sexuellen Vorlieben zu sprechen, er nimmt da kein Blatt vor den Mund. Ich höre seinen amourösen Schilderungen nur noch mit einem Ohr zu, befürchte aber, zukünftig keine Erdbeeren mehr essen können, ohne an diese Tina oder Tanja denken zu müssen.
»Das klingt doch prima«, sage ich, als er endlich fertig ist. »Vielleicht ist sie ja die Richtige für dich.«
Er zieht die kaum sichtbaren Augenbrauen hoch und sieht mich zweifelnd an.
»Wer weiß?«, schiebe ich nach, um ihn ein wenig zu provozieren. »Wenn ich ganz leise bin, glaube ich sogar, die Hochzeitsglocken schon läuten zu hören.«
Er lacht, und ich lache natürlich mit, weil wir beide wissen, dass das niemals passieren wird. Torge ist ein Mann für den aufregenden Sprint, nicht für die ermüdende Langstrecke. Er ist der festen Überzeugung, dass der Alltag der natürliche Feind der Liebe ist und dass kein Erlebnis mehr etwas Besonderes darstellt, wenn man es tagtäglich hat. Zum Glück teilen die meisten seiner Bekanntschaften diese polygame Haltung. Nicht auszudenken, welche Dramen sich sonst abspielen würden.
Die Erdbeerfrau scheint nicht nur seine diesbezügliche Sichtweise zu teilen, sondern auch über telepathische Kräfte zu verfügen, zumindest klingelt kurz darauf sein Handy. Den Antworten entnehme ich, dass sie ihn gerne sehen will, also signalisiere ich ihm, dass es okay ist, wenn er mich hier sitzen lässt und zu ihr fährt. Er formt mit Daumen und Zeigefinger das Okay-Zeichen, bei seinen nächsten Sätzen muss ich dann weghören. Auch ich habe so etwas wie ein Schamgefühl, obwohl Franziska da sicher etwas anderes behaupten würde.
»Ist das auch wirklich okay für dich?«, will er wissen, nachdem das Gespräch beendet ist. »Ich kann auch …«
»Alles gut«, versichere ich und nicke bekräftigend, bevor ich ihm zuzwinkere. »Wenn ich deine Aussagen richtig verstanden habe, scheint die Angelegenheit ja dringend zu sein.«
Sein Grinsen schneidet kleine Fältchen in die blasse Haut. »Danke, Mann, das ist echt nice! Wir sehen uns dann übermorgen, oder?«
»Das tun wir. Hab einen schönen Abend und viel Spaß.«
Als Torge aufsteht und geht, schaue ich ihm noch eine Zeit lang hinterher. Ich sehe seinen schmalen Rücken und die hängenden Schultern und weiß nicht, ob ich ihn in diesem Moment beneiden oder bedauern soll. Sein Leben ist, wie meines einmal war, aber dann ist etwas passiert.
Irgendetwas von mir – in mir – ist in den letzten Jahren verloren gegangen, und ich würde es nur zu gerne wiederfinden.
Es ist kurz vor Mitternacht, als ich mich endlich auf den Heimweg mache. Um diese Uhrzeit sind die Straßen schon recht leer, und nur wenige Fahrzeuge kommen mir entgegen. Die kleinen Dörfer entlang der Strecke wirken wie ausgestorben. Nur hinter wenigen Fenstern brennt noch Licht, und der einzige Mensch, der mir unterwegs begegnet, ist ein einsamer Mann, der mit seinem altersschwachen Schäferhund Gassi geht.
Die grellen Lichtkegel der Scheinwerfer reißen immer nur Details aus der Dunkelheit, beleuchten nie das große Ganze. Sie gleiten über akkurat gestutzte Hecken, streifen alte Bauernhäuser und hinter Bäumen liegende Scheunen. Es ist eine Gegend, in der Vergangenheit und Zukunft zum Jetzt verschwimmen. Wahrscheinlich hat es hier vor dreißig Jahren schon so ausgesehen, und vermutlich wird sich in den nächsten dreißig Jahren daran auch nichts ändern.
Die meiste Zeit bleibe ich unter dem Tempolimit und lasse den Jeep einfach nur dahingleiten. Ich will nicht nach Hause zu Franziska, will mich nicht ihren Fragen und der stummen Enttäuschung darüber aussetzen, dass ich ihr schon lange nicht mehr geben kann, wonach sie sich sehnt. Mein Verhalten ihr gegenüber ist ein freundschaftliches geworden, sie würde sich ein liebevolles wünschen, aber das packe ich nicht mehr.
Dennoch fahre ich weiter und weiter, als würde ich von einem unsichtbaren Magneten angezogen, obwohl ich in dieser Nacht lieber woanders wäre. Ich passiere kleine Wäldchen und unbeschrankte Bahnübergänge, bis ich irgendwann die Küstenstraße erreiche. Hier lasse ich das Seitenfenster halb nach unten gleiten, und salzige Meeresluft strömt herein. Vielleicht ist dieser Geruch das Einzige, was ich vermissen werde, wenn ich nicht mehr hier bin. Ihn und das Meer.
Als ich in den Rückspiegel schaue, sehe ich einen einsamen Lichtkegel hinter mir, wahrscheinlich ein später Motorradfahrer. Dann taucht schon wie aus dem Nichts rechts vor mir unser Haus auf. Ich bremse und biege auf die kurze Zufahrt ein, höre den Kies unter den Reifen knirschen. Als der Wagen steht, schalte ich den Motor aus, schließe meine Augen und lausche der Stille, dem leisen Knacken des sich langsam abkühlenden Motors. Fünf Minuten lang bleibe ich so sitzen, vielleicht auch zehn, aber als ich die Augen wieder öffne, ist das Haus immer noch da.
Unser Haus.
Jetzt, im Dunkeln, sieht es noch größer aus, als es ohnehin schon ist. Fast schon bedrohlich groß, und ganz sicher zu groß für uns. Im Erdgeschoss nutzen wir nur die Küche, das Wohnzimmer und mein Arbeitszimmer, im ersten Stock die beiden Schlafzimmer und Bäder und gelegentlich das Gästezimmer. Es gibt noch drei weitere Räume, die Franziska und Tabea eher als Abstellkammern betrachten, dazu den Keller und den riesigen Dachboden, auf dem seit Monaten schon niemand mehr war.
Ich habe das Haus damals nicht gewollt, und ich mag es immer noch nicht. Das Haus nicht, und diese Gegend schon gar nicht. Landschaftlich ist sie wunderschön, und dennoch fühle ich mich hier auch nach so vielen Jahren immer noch wie ein Fremder. Das liegt nicht an der Landschaft oder den Menschen hier, es liegt an mir. Man kann nichts lieben, auf das man sich nicht einlassen will.
Franziska und ich hätten damals im Ruhrgebiet bleiben oder nach Köln ziehen sollen, nach Hamburg oder nach München. Irgendwohin halt, wo die Dinge fifty-fifty gestanden hätten, nicht hundert Prozent Franziska, null Prozent ich. Doch damals war ich noch verliebt, so richtig, und man macht viele Dinge, die man später bereut, wenn man verliebt ist.
Ich kann nur hoffen, dass ich das, was ich bald tun werde, niemals bereue.
Seufzend steige ich aus dem Fahrzeug und gehe auf das Haus zu. Ich öffne die Tür, lege den Schlüssel aufs Sideboard und ziehe im Halbdunkeln die Schuhe aus. Um Tabea und Franziska nicht zu wecken, schleiche ich, so leise es geht, die Treppe hinauf, bis ich auf der Hälfte des Weges plötzlich stehen bleibe.
Irgendetwas stimmt nicht. Etwas ist anders als sonst.
Ich kann den Grund dafür nicht benennen. Es ist auch eher ein Gefühl, ein Flirren der Sinne. Ich schaue mich um, sehe aber nichts Ungewöhnliches. Dann schließe ich die Augen und atme ein. Jetzt kann ich riechen, was mich innehalten ließ. Ein ungewohnter Geruch hängt in der Luft, der schwache Duft eines Parfüms. Es dauert einen Moment, bis ich ihn erkenne – irgendetwas von Hermès, Franziskas Lieblingsmarke. Franziska parfümiert sich jedoch nie, wenn sie zu Hause ist. Sie tut das nur, wenn wir ausgehen, und auch dann nur zu besonderen Anlässen.
Ist sie etwa ausgegangen? Mit wem, wohin?
Vielleicht sollte ich jetzt eifersüchtig sein, aber das bin ich nicht. Nicht wirklich zumindest. Wenn Franziska ebenfalls eine Affäre hätte, würde mich das nicht umhauen. Es würde mich eher verwundern, weil es so gar nicht zu ihr passt. Franziska ist keine Frau, die Zuspruch oder Liebe in den Armen eines anderen sucht. Das ist sie doch nicht, oder?
Ohne darauf eine Antwort zu finden, schleiche ich die letzten Stufen hoch und dann den Flur entlang. Im Badezimmer schalte ich das Licht erst ein, nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen habe. Sofort fällt mein Blick auf einen Parfümflakon, der mit der Prägung von Franziskas Lieblingsmarke versehen ist. Der Flakon ist offen, die Schutzkappe liegt achtlos daneben. Auch solche Nachlässigkeiten passen nicht zu ihr, und ich überlege, ob sich Tabea vielleicht an dem teuren Zeug probiert hat. Sie ist jetzt siebzehn; gut möglich, dass sie einen neuen Freund hat, von dem wir nichts wissen.
Wenn das so wäre, dann wäre es okay für mich. Jeder Mensch hat seine kleinen Geheimnisse, und Tabea ist da sicher keine Ausnahme. Außerdem habe ich noch nie daran geglaubt, dass bedingungslose Offenheit das Fundament jeder guten Vater-Tochter-Beziehung ist.
Die meisten Väter, die das behaupten, verwechseln Offenheit mit Kontrolle. Sie meinen, ihren Kindern einen guten Dienst zu erweisen, indem sie ihnen heimlich nachspionieren und möglichst wenig Freiraum lassen. Das ist nie mein Weg gewesen, meine Vorstellung von Erziehung. Ich vertraue eher darauf, dass Franziska und ich Tabea das moralische Rüstzeug mitgegeben haben, auf das es im Leben ankommt. Jetzt ist sie alt genug, um es in gewissen Grenzen selbstbestimmt einzusetzen. Wenn sie wirklich einen neuen Freund hat, wird sie uns schon davon erzählen, sobald sie es für richtig hält.
Nachdem ich im Bad fertig bin, schalte ich das Licht wieder aus und taste mich durch die Dunkelheit ins Schlafzimmer vor. Meine Bettseite ist leer, auf Franziskas Seite kann ich unter dem Laken ihren Körper ausmachen. Sie schläft bereits, atmet ganz regelmäßig. Ich schlüpfe behutsam unter die Decke, beuge mich vor und schnuppere an ihrem Hals. Keine Spur von Parfüm, nur der Geruch von warmer, weicher Haut.
Bis vor Kurzem hat mir dieser Geruch wenigstens noch das Gefühl von Geborgenheit vermittelt; verbunden mit der Hoffnung, dass das, was da nebeneinander liegt, vielleicht doch noch zusammengehört. Aber auch solche Momente sind jetzt vorbei. Mittlerweile ist Franziska nur noch jemand, der neben mir im Bett liegt, während ich die Augen schließe und an eine andere denke.
An sie. Und zwar jede Nacht. Auch jetzt kommen und gehen die Gedanken, drehen sich um Lara wie um einen Fixstern. Das sollte nicht so sein, es ist nicht richtig, und dennoch fühlt es sich so verdammt richtig an. Die Bilder im Kopf, die sündigen Gedanken.
Mit ihnen schlafe ich ein, um dann mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen zu werden. Irgendetwas muss mich geweckt haben, ich weiß nur nicht, was. Im Zimmer ist es still, kein Laut ist zu hören, und nur ganz schwach fällt ein kaum wahrnehmbarer Lichtschein herein. Dort, wo die Tür einen Spaltbreit offen steht. Dahinter liegt der Flur. Der Schimmer muss Mondlicht sein, das durch das Flurfenster eindringt. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich die Tür aber zugemacht, als ich ins Bett ging. So wie jede Nacht, ich bin ein Gewohnheitstier.
Es ist seltsam, aber auch nicht so seltsam, dass ich deswegen aufstehen würde. Vielleicht musste Franziska mal zur Toilette, vielleicht habe ich die Tür einfach nur nicht richtig zugedrückt, weil ich sie nicht wecken wollte. Egal. Ich bin müde, will einfach nur weiterschlafen, aber in dieser Nacht ist mir keine Ruhe vergönnt.
Als ich fast schon wieder weggedämmert bin, höre ich etwas. Leise Schritte, die sich behutsam über den Flur bewegen. Sie kommen aus der Richtung, in der Tabeas Zimmer liegt, und bewegen sich auf die Treppe zu, die ins Erdgeschoss führt. Dann verstummen sie wieder, als ob die Person, die sie erzeugt hat, stehen geblieben wäre und nach irgendetwas lauschen würde.
Ein paar Sekunden nur, wenige Augenblicke des Luftanhaltens. Dann wenden sich die Schritte ab und entfernen sich. Obwohl ein sonderbares Gefühl im Bauch zurückbleibt, entspanne ich mich wieder. Es kann nur Tabea sein, denke ich. Wahrscheinlich ist sie ebenfalls wach geworden und gerade auf dem Weg in die Küche, um sich etwas zu trinken zu holen. Das tut sie manchmal, obwohl ich ihr immer sage, sie soll sich einfach eine Flasche Wasser neben das Bett stellen.