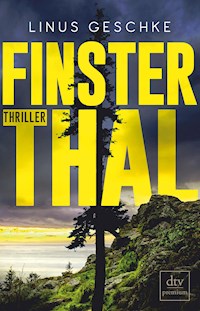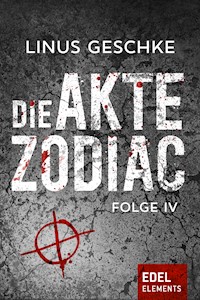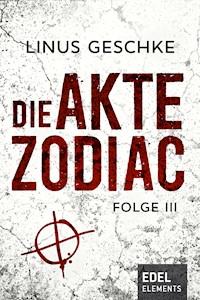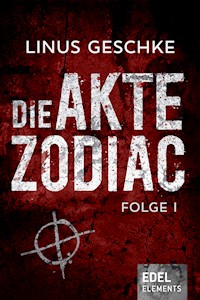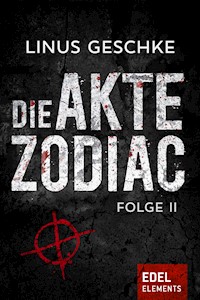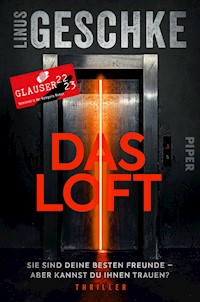10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Das Letzte, was sie hörte, war ein Schlaflied Herbst 1997: Auf dem Wilzenberg wird eine junge Frau tot aufgefunden, ermordet durch einen Stich ins Herz. Der Täter lässt nichts zurück außer einer Spieluhr, die »Hush little baby« spielt. Gegenwart: Jan Römer, Reporter für ungelöste Kriminalfälle, rollt mit seiner Kollegin Mütze das Verbrechen neu auf. Warum trug das Opfer trotz der Kälte nur ein dünnes rotes Kleid? Warum kann niemand etwas zu dem Gästehaus im Wald sagen, in dem die Frau damals arbeitete? Dann wird wieder eine Frau getötet. Auch neben ihrer Leiche wird eine Spieluhr gefunden. Und Jan Römer begreift, dass die Vergangenheit nicht tot ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Es ist ein Fall, der für die Rubrik Ungelöste Kriminalfälle wie geschaffen scheint: Im Herbst 1997 wurde die Leiche der 19-jährigen Sonja Risse auf dem Wilzenberg im Sauerland gefunden. Sie starb durch einen Stich ins Herz, war nur mit einem dünnen roten Kleid bekleidet, und alles, was der Mörder zurückließ, war eine Spieluhr, die »Hush, little baby« spielte.
Doch schon bei seinem ersten Besuch im Heimatort des Mädchens stößt der Kölner Journalist Jan Römer mit seiner Kollegin Stefanie »Mütze« Schneider auf Ungereimtheiten. Warum wird Sonjas Charakter von Zeitzeugen vollkommen unterschiedlich beschrieben? Was verbirgt ihre Mutter? Und warum will niemand über das geheimnisvolle Haus am Fuße des Berges reden, in dem Sonja gekellnert hat und das kurz nach ihrem Tod abgerissen wurde?
Als die beiden Journalisten endlich glauben, der Lösung näherzukommen, wird wieder eine Frau ermordet. Erneut lässt der Täter eine Spieluhr zurück. Jan Römer und Stefanie Schneider erkennen, dass die Vergangenheit nicht tot ist – am Wilzenberg ist sie noch nicht einmal vergangen, und die Geschehnisse um sie herum steuern unaufhaltsam auf eine Katastrophe zu.
Der Autor
Der 1970 geborene Linus Geschke arbeitet als freier Journalist für führende deutsche Magazine und Tageszeitungen, darunter Spiegel online und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Mit seinen Reisereportagen hat der gebürtige Kölner bereits mehrere Journalistenpreise gewonnen.
https//www.facebook.com/linusgeschke.de
LINUS GESCHKE
DAS
LIED DER
TOTEN
MÄDCHEN
KRIMINALROMAN
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1592-8
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Januar 2018
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: Trevillion Images / © Sandra Cunningham
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Geheimnisse sind nichts Abstraktes. Sie sind wie organische Wesen, die einen auf allen Wegen begleiten. Sie folgen uns zur Arbeit und zum Sport. Sitzen mit uns am Frühstückstisch oder beim Abendessen und ernähren sich von dem Schweigen, das sie umgibt. Werden größer und mächtiger, je länger die Stille andauert.
Wer sehr feine Ohren hat, kann sie sogar hören. Ein Wispern, eine dahingehauchte Andeutung, ein wissendes Lächeln.
Ab einem gewissen Punkt ist das, was sie verbergen, nicht mehr aufzuhalten. Dann platzt es heraus, wie ein Krebs, dem die bisherige Schale zu eng geworden ist. Dann verschlingen sie alles, was sich in der Nähe befindet.
Reißen es in den Abgrund.
Immer tiefer.
Für Pennywise und Cujo. Für Christine und den Revolvermann. Für all die unglaublichen Stunden, die ich mit Stephen King verbringen durfte.
PROLOG
Einige Menschen sterben, bevor ihre Zeit abgelaufen ist. Sie tun es, weil sie bei Glatteis zu schnell gefahren sind, beim Baden in eine Strömung gerieten oder durch einen Stromschlag dahingerafft wurden. Anderen wurde das Leben gewaltsam genommen, und als Überlebender bleibt man dann fassungslos zurück, stumm und verzweifelt und ewig mit der Frage konfrontiert, was man in den entscheidenden Momenten hätte anders machen können.
Ich zumindest frage mich das.
Ich frage mich, ob ich zu sorglos mit dem Leben und der Liebe umgegangen bin. Mit dir, mein Schatz. Dabei wollte ich doch die Fehler der anderen vermeiden, bei denen die erste große Liebe viel zu schnell zu Ende ging. Menschen machen Fehler, die sich erst im Nachhinein als solche entpuppen. Sie verletzen einander, betrügen einander und streifen umher, weil sie glauben, dass sich irgendwo noch etwas Besseres findet. Sie tun es, weil sie Narren sind und weil es unmöglich erscheint, dass der erste Versuch bereits der Volltreffer sein könnte.
Auch du warst so.
Leider.
Aber du musst dich dafür nicht erklären, alles ist gut jetzt. Ich habe dir verziehen. Hörst du diese Melodie im Wind? Ihre beruhigenden Klänge?
Hush, little baby, don’t say a word.
Papa’s gonna buy you a mockingbird.
Nein, natürlich hörst du sie nicht. Wie auch? Der Wald, der sich scharf vor dem Nachthimmel abzeichnet – du kannst ihn nicht mehr sehen. Der erdige, leicht torfige Geruch des Bodens – du kannst ihn nicht mehr riechen. Meine Stimme, die dir versichert, dass ich dich immer lieben werde – sie erreicht dich nicht mehr. Du bist nun gefangen in einer ewig währenden Dunkelheit, und dein Körper, den ich so begehrte, beginnt bereits abzukühlen. Wie blass du jetzt bist – ganz leichenblass, und dennoch unendlich schön.
Ich werde jetzt gehen und dich allein lassen, obwohl ich gerne noch geblieben wäre. Hier mit dir, auf dieser Bank, an unserem Teich. Vielleicht ist es dir kein Trost, aber ich weiß, dass ich dir bis an mein Lebensende hinterhertrauern werde. Selbst im Alter, wenn ich die Augen schließe, werde ich dein Gesicht noch vor mir sehen können, deinen Duft riechen, deine Stimme hören und wissen, wie es sich anfühlte, wenn wir uns berührten.
Für mich ist die Vergangenheit nicht tot.
Sie ist noch nicht einmal vergangen.
SCHMALLENBERG/SAUERLANDHERBST 1997
Niemand ging nachts auf den Wilzenberg, zumindest nicht allein. Tagsüber war er ein bei Touristen und Einheimischen beliebtes Ausflugsziel, aber das änderte sich schlagartig, wenn die Dunkelheit kam. Wenn die Bäume lebendig wurden und ihr Rauschen klang, als wollten sie jeden, der sich hierhin verirrt hatte, zur Umkehr zwingen.
Komm nicht näher!, riefen sie.
Kehre um, solange du noch kannst.
In der Nacht zeigte der Wilzenberg seine andere, böse Seite. Zahlreiche Legenden drehten sich um ihn. Unheimliche Geschichten, über die die Einheimischen tagsüber lachten und vor denen sie sich nachts fürchteten.
Auch Sonja wollte jetzt nicht hier sein, so kurz vor 22 Uhr. Am liebsten wäre sie losgerannt und ins Dorf zurückgekehrt, aber das ging nicht. Nicht, wenn sie den Mann treffen wollte, mit dem sie an dem kleinen Teich unterhalb des Gipfels verabredet war und der all ihre Ängste vertreiben würde.
Sie zitterte. Ihr Blick fiel auf die umliegenden Fichten, deren Spitzen sich dem Nachthimmel entgegenreckten wie die aufgerichteten Speere einer mittelalterlichen Armee. Auf den winzigen Teich, auf dem totes Laub wie Seerosen trieb. Auf den schwarzen Berghang hinter ihr, der bedrohlich und verlassen wirkte. Ansonsten war um sie herum nichts als Dunkelheit und Kälte. Eine heimtückische Kälte, die sich nur schleichend bemerkbar machte; hervorgerufen durch die unpassende Kleidung, die sie trug, und die Höhe, in der sie sich befand.
Ihr Herz klopfte, als sei es ein lebendiges Wesen, das den Körper verlassen wollte. Sie versuchte, ihren Pulsschlag wieder unter Kontrolle zu kriegen, indem sie sich nur auf ihre Atmung konzentrierte. Dabei hörte sie die Geräusche von Tieren, die durch das Unterholz streiften. Das Rauschen des Windes, der Blätter von den Ästen wehte. Sie fühlte sich verloren in einer unwirklichen Welt aus bewegten Schatten, die die Bäume im Mondlicht warfen.
Sie bereute, keinen wärmenden Pullover angezogen zu haben. Nur dieses rote Kleid, weil sie doch schön sein wollte, wenn sie ihm begegnete. Ihre Arme legten sich schützend um ihren Körper, um ihn zu wärmen. Vor ihrem Mund stieg bleicher Atem auf, als ob ihre Seele sich verflüchtigen würde.
Es knackte hinter ihr.
Aufgeschreckt fuhr sie herum. Vielleicht nur ein Tier auf der Suche nach Nahrung. Vielleicht nur ein Ast, der abgebrochen und zu Boden gefallen war.
Vielleicht aber auch …
Dann wurde es wieder still, und das einzige Geräusch, das an ihre Ohren drang, kam von dem Wind, der weiterhin durch die Bäume fuhr. Ihre Wipfel wiegten hin und her, vor und zurück, als wenn sie sie verspotten wollten. Sie fühlte sich plötzlich unendlich einsam, von der ganzen Welt verlassen. Wie das Mädchen in einem dieser Märchen, das im Wald ausgesetzt wurde, damit die umherstreifende Bestie es sich holen konnte.
Zitternd drehte sie sich um und richtete den Blick auf das 28 Meter hohe Gipfelkreuz, welches über dem Wilzenberg wie ein überdimensionierter Grabstein thronte. Sie wusste, dass direkt dahinter der Wilzenbergturm stand, ein 1889 errichteter Aussichtspunkt, und unten am Berghang das Haus lag, in dem sie fast ein Jahr lang gearbeitet hatte.
Niemandem hatte sie erzählen dürfen, was in dem Haus vor sich ging, noch nicht einmal ihrer Mutter. So hatten die Männer es ihr klargemacht, und sie hatte sich stets daran gehalten, bis das Unfassbare geschehen war. Bis sie mit jemandem reden musste.
Er war der Einzige, an den sie sich hatte wenden können, weil er wusste, was sich hinter der offiziellen Fassade des Hauses abspielte. Er hatte ihr zugehört und sie tröstend in den Arm genommen, weil er sie genauso liebte wie sie ihn. Trotz des Altersunterschieds, der zwischen ihnen herrschte. Trotz der Aufgabe, die er in dem Haus zu erfüllen hatte.
Erneut atmete sie durch und warf einen Blick auf die Armbanduhr, die er ihr geschenkt hatte. Spürte, wie die Warterei sie von Minute zu Minute mehr zermürbte. Sie wollte endlich wieder in seinen Armen liegen, sich sicher und geborgen fühlen und darauf vertrauen, dass er wusste, was zu tun war. So wie immer. So wie in all den Wochen zuvor, seit sie ein Paar waren, von dem niemand etwas wissen durfte.
Dann knackte es wieder.
Ihre Rückenmuskulatur verspannte sich, und sie versuchte, mit den Augen jenen Teil der Dunkelheit zu durchdringen, aus der das Geräusch gekommen war. Einen Moment lang glaubte sie sogar, eine leise Melodie zu vernehmen, die ihr sonderbar vertraut vorkam.
»Hallo? Bist du es?«, rief sie leise.
Die Melodie wurde lauter. Zarte Klänge, und auf einmal wusste sie auch, woher sie sie kannte. Sie lächelte. Freute sich, dass er es nicht vergessen hatte.
Aber warum sagte er nichts? Hatte er Angst, dass jemand sie hören könnte? Hier, mitten in der Nacht, mitten im Wald?
Erneut rief sie seinen Namen, während sie gleichzeitig versuchte, zwischen den dichtstehenden Baumstämmen eine menschliche Kontur auszumachen. Die Melodie war jetzt immer deutlicher vernehmbar.
Dann verstummte sie plötzlich.
»Hallo?«, rief sie nochmals.
Keine Antwort. Nur Stille.
Selbst der Wind hatte sich gelegt. Es war, als würde die Umgebung die Luft anhalten. Sie schluckte, doch ihr Mund war trocken.
Dann sah sie die Bewegung.
Ein Huschen.
Sie sah …
KÖLNGEGENWART
Es gibt Momente, da weiß man schon beim Klingeln des Telefons, dass der Anrufer keine guten Nachrichten hat. Dies war einer davon. Jan Römer war erst vor einer halben Stunde aus den Redaktionsräumen des Nachrichtenmagazins Die Reporter nach Hause gekommen, als es läutete und er Sarahs Nummer auf dem Display sah. Sarah war seine Exfrau, die Mutter ihres gemeinsamen Sohnes Lukas, und wenn sie um diese Uhrzeit anrief, hatte das nichts Gutes zu bedeuten.
Wenigstens kam sie ohne Umschweife zur Sache: »Jan, ich habe Aussicht auf einen besseren Job. Als Lehrerin auf einer Privatschule.«
»Großartig. Glückwunsch.«
»Die Schule ist am Chiemsee. In Bayern.«
Er spürte, wie sein Herz aussetzte.
»Was ist mit Lukas?«
»Wenn ich die Stelle wechsele, kommt er natürlich mit«, erwiderte sie. »Ein Kind gehört zu seiner Mutter.«
Er konnte kaum glauben, wie beiläufig sie ihm diesen Schlag verpasste. Sagte nur: »Lukas ist auch mein Sohn.«
»Klar.«
»Dann wird dir auch bewusst sein, dass ich da ein Wörtchen mitzureden habe.«
»Theoretisch ja. Praktisch nein.«
»Was soll das jetzt heißen?«
»Wir haben doch nach der Trennung immer alles fair gehandhabt, was mit ihm zu tun hatte, oder? Dann wird uns das auch in dem Fall gelingen.«
»Fair?«
»Lass mich doch erst mal ausreden, Jan! Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Lukas kann dich nach dem Umzug alle zwei Wochen am Wochenende besuchen kommen und natürlich die Hälfte der Ferienzeit mit dir verbringen. Weihnachten wechseln wir uns ab, ebenso Silvester und Ostern. Ich denke, das ist unter den gegebenen Umständen eine sehr vernünftige Lösung.«
»Vernünftig?« In ihm stieg Wut auf. »Du teilst mir einfach mal eben so am Telefon mit, dass du mir mein Kind wegnimmst, weil du in irgendein bayrisches Schickeria-Kaff ziehen willst, und redest dann von Vernunft?«
»Schrei bitte nicht so.«
»Ich schreie, wann ich will!«
»Und ich werde nicht in Köln bleiben, nur weil das für dich am bequemsten ist. Punkt. Nicht, wenn sich mir die Chance bietet, woanders hinzugehen, wo ich beruflich wesentlich besser gestellt bin und mehr Geld verdiene. Und wenn du mal in Ruhe darüber nachdenkst, wirst du feststellen, dass das neue Umfeld auch für Lukas eine große Chance ist.«
Er atmete tief durch, schaute auf den Kunstdruck von Monets Houses of Parliament London, der an seiner Wand hing, und versuchte, sich zumindest so weit wieder zu beruhigen, dass er antworten konnte. »Wir haben genug Geld. Du bist Beamtin, ich verdiene gut, es gibt also keinen Grund …«
»Das Problem mit dir ist …«
»Ach, heute nur ein Problem?«
Sie seufzte. »Eines der Probleme ist, dass man über manche Dinge mit dir einfach nicht in Ruhe diskutieren kann. Du bist viel zu emotional und regst dich immer …«
»Erstens: Du diskutierst nicht mit mir, du stellst mich vor vollendete Tatsachen. Und zweitens: Entschuldige bitte, dass ich emotional reagiere, wenn es um mein Kind geht.«
»Ich habe schon zugesagt.«
»Klasse!« Er stieß ein zynisches Lachen aus. »Ohne zuvor mit mir zu reden.«
»Du siehst ja, wohin das führt, wenn ich es versuche.«
»Dann lass ihn bei mir, verdammt noch mal!«, fuhr er sie an. »Köln ist sein Zuhause. Hier hat er seine Schule, seine Freunde, seine vertraute Umgebung. Warum willst du ihm das wegnehmen?«
Er hörte, wie sie durchatmete, bevor sie sagte: »Er kann nicht bei dir leben, Jan. Du bist andauernd unterwegs, manchmal ganze Nächte. Du recherchierst, begibst dich in Gefahr, tust weiß Gott was. Glaubst du ernsthaft, du wärst die richtige Bezugsperson für ein elfjähriges Kind?«
Ein Teil von ihm wusste, dass sie recht hatte. Dennoch war er nicht bereit, in diesem Punkt nachzugeben. »Du gehst weg, nicht ich. Das ist nicht fair, und ich werde mich dagegen wehren.«
»Komm mir nicht so!«, erwiderte sie scharf. »Ich hatte gehofft, das nicht sagen zu müssen, aber meine Anwältin meint …«
»Ach – du hast schon mit einer Anwältin gesprochen?«
»Natürlich.«
»Ich fasse es nicht!«
»Mach, was du willst, aber lerne, wie ein erwachsener Mensch damit umzugehen. Meine Entscheidung steht fest.«
Wütend schmiss er den Hörer auf das Sofa. Als er ihn wieder aufhob, hatte sie schon aufgelegt.
Nichts kann schlimmer sein als ein verregneter Montagabend, an dem die Exfrau einem mitteilte, dass sie einem den Sohn wegnehmen will. Sie raubte ihm Lukas, indem sie ohne sein Einverständnis mit ihm nach Bayern zog – zumindest kam es ihm so vor.
Gleichzeitig wusste er aber auch, dass Sarahs Anwältin einen möglichen Sorgerechtsprozess aller Voraussicht nach gewinnen würde. Ihm graute vor einem Gerichtstermin, vor den damit verbundenen harten Auseinandersetzungen, und er wusste, dass ein solcher Prozess Lukas zerreißen würde. Dass er seinen Sohn ganz verlieren konnte, wenn er mit allen Mitteln um ihn kämpfte.
Am besten wäre es gewesen, wenn er nach dem Telefonat mit Sarah sofort Arslan angerufen hätte. Arslan war einer seiner besten Freunde, ein ehemaliger Profiboxer, der jetzt in Köln-Mülheim ein Boxstudio betrieb. Der hätte ihm dann versichert, dass er voll auf seiner Seite stehe, dass er die Dinge wie Jan sah und keine Frau das Recht hatte, einem Mann das Kind wegzunehmen. Genau das also, was er in diesem Moment hören wollte.
Doch Jan entschied sich anders. Er zog los und suchte sich eine Bar in der Innenstadt, wo er versuchen wollte, sich einen Plan zurechtzulegen, um diesen Umzug doch noch zu verhindern. Er schaffte es nicht. Stattdessen schaffte er es, sich in Rekordzeit zu betrinken. Gin Tonic, Rum mit Cola, Whisky mit Triple Sec und Sprite, alles schön durcheinander und viel zu schnell.
Nach anderthalb Stunden hing er auf dem Klo der Bar und kotzte.
Anschließend schaffte er es noch irgendwie nach Hause. Er schaffte es sogar, sich die Treppen zu seiner Wohnung hochzukämpfen. Was er nicht mehr schaffte, war, sich zu waschen, bevor er vollständig bekleidet ins Bett fiel, wo der Schlaf ihn wie ein verständnisvoller Freund empfing.
In den folgenden zwei Tagen und Nächten richtete Jan sich in dem depressiven Loch ein, in das ihn Sarahs Anruf gestürzt hatte. Er trank direkt nach dem Aufstehen das erste Bier und dachte an das zweite, noch bevor er sich angezogen hatte. Er verbrachte mehr Zeit im Bett als außerhalb und redete mit dem Bild von Lukas, das in einem weißen Rahmen auf der Kommode stand. Bislang hatte das Bild ihm noch keine Antwort gegeben, aber vielleicht würde es das ja nach ein paar weiteren Dosen Bier tun.
Was es dann tatsächlich auch tat. Er telefonierte daraufhin mit Lukas, um zu erfahren, wie sein Sohn zu dem Umzug stand. Es war nicht zu überhören, dass Lukas schon jetzt hin- und hergerissen war, weil er sowohl Sarah als auch ihm gegenüber loyal sein wollte. Und er hörte heraus, dass ein Teil von Lukas sich auf Bayern freute, auf das Haus am See dort, das Sarah ihm offenbar in den schillerndsten Farben beschrieben hatte.
Jan sagte ihm daraufhin Dinge, an die er selbst nicht glaubte: Dass sie auf immer und ewig ein Team bleiben würden, dass Lukas jedes zweite Wochenende nach Köln kommen konnte und sie sich deshalb ja kaum weniger sehen würden. Dass alles beim Alten bliebe, trotz des Umzugs und der Entfernung zueinander. Dabei gab er sich Mühe, seiner Stimme einen fröhlichen Klang zu verleihen, während er sich gleichzeitig die Unterlippe blutig biss.
Nachdem sie eingehängt hatten, schaute Jan sich in seinem Schlafzimmer um. Es sah aus, als hätte jemand strategisch geschickt ein paar Dynamitstangen in den Schubladen verteilt und diese dann gleichzeitig gezündet, worauf ein paar der Kleidungsstücke tot auf dem Boden zurückgeblieben waren. Andere hatten sich verwundet noch ein Stück weitergeschleppt und klammerten sich jetzt an den Schrank und die Bettfüße wie Gefallene.
Er beseitigte die schlimmsten Auswüchse des Chaos, dann ging er duschen, zog sich Jeans, einen dünnen Pullover und Chucks an und verließ am frühen Abend das Haus. Nicht aufgrund irgendwelcher »Das Leben geht weiter«-Anwandlungen, sondern aus rein profanen Gründen.
Essen, zum Beispiel.
Er schloss gerade seine Wohnungstür ab, als er eine Stimme hinter sich hörte. »Guten Abend, Herr Römer! Na, wir zwei haben uns ja schon länger nicht mehr gesehen.«
Christina Guerin wohnte auf derselben Etage wie er. Eine attraktive Blondine Mitte dreißig, die viel dafür tat, in Form zu bleiben. Ihr Mann war Franzose, und sie hatte ihm auch mal gesagt, bei welcher Firma er arbeitete. Diese Information hatte er sofort wieder vergessen, Fakt war aber, dass der gute Mann zu viel unterwegs war und seine Frau zu oft allein ließ.
»Hallo«, sagte Jan und winkte ihr zu.
»Wo geht’s denn hin?«
»Nur kurz vor die Tür, eine Kleinigkeit essen.«
»Ach, das ist ja ein Zufall«, sagte sie und stellte die Einkaufstüten ab. »Ich wollte mir gerade eine Lasagne machen. Wenn Sie möchten, können Sie mir gern dabei Gesellschaft leisten. Mein Mann ist schon wieder im Ausland, und Sie wissen ja, wie das ist – für einen allein zu kochen, macht einfach keinen Spaß.«
»Das ist wirklich nett von Ihnen, aber ich bin schon verabredet. Vielleicht ein anderes Mal, ja?«
Sie musterte ihn mit einem Blick, den er nur schwer deuten konnte. »Wirklich schade«, sagte sie dann. »Einen schönen Abend noch und viel Spaß bei der Verabredung.«
Er winkte ihr zu, dann verließ er das Haus.
Es war ein milder Abend, und die Straßen waren immer noch belebt. Jan ließ sich vom Strom der Passanten treiben und machte extra einen Umweg, bevor er sein Stammlokal auf der Subbelrather Straße erreichte. Dort traf er Mütze, und wie so oft war sie seine Rettung.
*
Mützes richtiger Name lautete Stefanie Schneider, aber so nannte sie niemand. Nicht, seitdem sie sich in der Jugend den Tick angewöhnt hatte, das Haus nie ohne Kopfbedeckung zu verlassen. Ohne Strickmütze oder Baseballcap, so sagte sie, fühlte sie sich nackt und schutzlos.
Mütze war 33 Jahre alt und somit gut zehn Jahre jünger als er. Sie war schlank und groß gewachsen, hatte dunkelblonde Haare und braune Augen, die von bernsteinfarbenen Punkten durchsetzt waren. Ihr Gesicht sah rosig und blitzeblank aus, so gänzlich ungezeichnet vom Leben, obwohl sie sämtliche Schattenseiten kannte. Dennoch schwebte sie wie ein schillernder Vogel über dreckigem Wasser, unverdorben von den Vorgängen in der Tiefe. War ihr Leben wirklich so leicht? Oder verfügte sie einfach über das Talent, es leicht zu nehmen?
Mütze war nicht nur seine Kollegin beim Nachrichtenmagazin Die Reporter, sie war weit mehr als das: der Mensch, dem er wie keinem anderen vertraute. Ob er in sie verliebt war? Wahrscheinlich schon, wenn auch eher unterschwellig. So konnte die Liebe bleiben, ohne die Freundschaft zu zerstören.
In der folgenden Stunde erzählte er Mütze von dem Telefonat mit Sarah, wobei die reine Schilderung des Gesprächs nur fünf Minuten dauerte und der Rest der Zeit dafür draufging, Mütze wissen zu lassen, was er von seiner Exfrau hielt und was er ihr gerade am liebsten antun würde. Dann ging es ihm besser. Ähnlich wie einem Druckbehälter, bei dem das Ventil geöffnet wurde und der auf einen Schlag den ganzen Druck ablassen konnte.
»Geht’s dir jetzt besser?«, fragte sie.
»Ist das so offensichtlich?«
»Der Rotton in deinem Gesicht ist etwas blasser geworden, aber die Halsschlagader pocht immer noch. Weißt du zufällig, ob sie hier einen Defibrillator haben?«
Er lachte, dann bat er sie, ihn mit irgendwas anderem abzulenken. Sie erzählte ihm, dass sie am Vormittag ein Treffen mit Alexander Herold gehabt hatte, dem Herausgeber von Die Reporter, und dabei seinen ganzen Frust über die sinkende Auflage des Magazins und den nicht aufzuhaltenden Vormarsch sozialer Netzwerke abbekommen hatte.
Jan konnte Herolds Verbitterung gut verstehen. Der Mann hatte ein Leben lang für den Qualitätsjournalismus gestritten, immer im Glauben, dass die Leser eine gut recherchierte und professionell aufbereitete Berichterstattung zu würdigen wussten. Nun musste er erleben, wie sich die Öffentlichkeit von seinem Magazin abwandte, von der Lügenpresse allgemein, und sich lieber von dubiosen Quellen im Internet informieren ließ. Gefühlte Wahrheiten hatten die Fakten abgelöst – das konnte jemanden wie Herold nur verbittern.
Ihm erging es ja nicht anders.
»Die gute Nachricht ist aber«, fuhr Mütze fort, »dass er unsere zukünftige Positionierung nicht mehr so stark bei den tagespolitischen Themen sieht, sondern bei Geschichten, die das Internet nicht leisten kann. Bei Reportagen, die Recherche und Zeit voraussetzen: Storys wie unsere Ungeklärten Kriminalfälle also.«
Vor Jahren schon hatte das Magazin begonnen, sich in einer Rubrik länger zurückliegenden Verbrechen zu widmen, die unaufgeklärt geblieben waren. Irgendwann war Jan per Zufall dazugekommen, jetzt war es sein Ressort, und wenn man den Leserbriefen glauben konnte, kam das Thema richtig gut an. Mehr noch – die Leute konnten gar nicht genug davon bekommen, so dass Jan und Mütze mittlerweile Probleme hatten, genügend interessante Fälle auszugraben.
»Wie sieht es denn mit neuem Material aus?«, fragte er, obwohl es ihm noch immer schwerfiel, sich auf etwas anderes als seinen Sohn zu konzentrieren.
»Ich bin da auf einen unaufgeklärten Mord gestoßen, der etwas für uns sein könnte«, fuhr Mütze aufgeregt fort. »1997 ist bei Schmallenberg – das liegt im Sauerland – die Leiche einer 19-Jährigen gefunden worden, Sonja Risse. Sie wurde nachts in einem abgelegenen Waldgebiet mit einem einzigen Stich ins Herz getötet und alles, was der Mörder zurückgelassen hat, war eine Spieluhr, die Hush, litte baby spielte.«
»Und weiter?«
»Nichts weiter«, erwiderte sie säuerlich. »Sonja Risse hatte einen Freund, Stefan Wahlert, der von der Polizei aber als Täter ausgeschlossen werden konnte. Ihr Vater ist schon lange vor ihrem Tod an einem Schlaganfall gestorben, ihre Mutter lebt immer noch in Schmallenberg. Keine Geschwister.«
Mützes Ausführungen zeigten, dass sie sich schon intensiver mit dem Fall beschäftigt hatte, was Jan nicht wunderte. Es war erst ein gutes Jahr her, seitdem er Herold überredet hatte, sie wieder bei den Reportern einzustellen, nachdem sie Jahre zuvor selbst gekündigt hatte. Er hatte Mütze nicht nur im Team haben wollen, weil sie seine Freundin war, sondern auch, weil sie über Qualitäten verfügte, die in der Redaktion dringend gebraucht wurden. Sie war ebenso neugierig wie intelligent und fand in ihren Texten stets den richtigen Ton. Ihre größte Stärke aber waren ihre außergewöhnlichen Recherchefähigkeiten.
»Okay«, erwiderte er. »Was genau macht die Sache für dich so interessant?«
»Fragst du das ernsthaft? Allein schon die Tatumstände sind sonderbar. Ein Mädchen, mitten in der Nacht ganz allein im Wald und nur mit einem roten Kleid bekleidet. Dazu die Spieluhr mit der seltsamen Melodie. Mein Gott, Jan – unsere Leser werden die Story lieben!«
»Autsch.«
»Ich weiß«, erwiderte sie mit einem Schulterzucken. »Moralisch gesehen mag das nicht die beste Erklärung sein, aber unserer Auflage würde es nicht schaden.«
»Hast du denn schon Kontakt zu den Behörden aufgenommen?«
Sie nickte. »Für den Fall zuständig ist ein Hauptkommissar in Meschede, Rafael Schäfer. Ich habe gestern mit ihm telefoniert, und er sagte, dass die Ermittlungen derzeit ruhen, da es keine Spuren mehr gebe, die sie verfolgen könnten. Ansonsten wirkte er meiner Anfrage gegenüber sehr aufgeschlossen. Für mich klang es, als wäre er für ein wenig mediale Aufmerksamkeit sogar dankbar, um frischen Wind in die Sache zu bringen.«
Es war Mütze und ihm tatsächlich schon gelungen, im Rahmen ihrer Recherchen Fälle zu lösen, an denen die Polizei sich die Zähne ausgebissen hatte. Der Grund dafür war einfach: Manche Menschen redeten nicht gerne mit der Polizei – dafür aber mit der Presse. Sei es, weil sie ihre 15 Minuten Ruhm abbekommen wollten, sei es, weil sie den Behörden aus irgendwelchen Gründen ablehnend gegenüberstanden.
Jan fuhr sich mit der Hand über den Nacken. »Hat dieser Kommissar auch gesagt, ob es in den letzten zwanzig Jahren noch andere Morde gegeben hat, bei denen die Tatumstände ähnlich waren? Ein einzelner Stich ins Herz, das Zurücklassen einer Spieluhr – solche Merkmale müssten doch auffallen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Anscheinend nicht, und bevor ich mich selbst auf die Suche mache, wollte ich die Sache zuerst mit dir besprechen.«
Jan spürte, wie gut ihm die Unterhaltung mit Mütze tat. Außerdem konnte er mittlerweile auch ihre Begeisterung für den Fall nachvollziehen. Ein junges Mädchen, das einsam im Wald gestorben war. Ein Stich ins Herz. Das rote Kleid und die Spieluhr, deren Melodie fast jeder kannte.
Mütze hatte recht.
Die Leser würden es lieben.
*
Als Jan am nächsten Morgen wach wurde, stöhnte er. Er stöhnte direkt ein zweites Mal, als er durch das Fenster nach draußen schaute. Der Herbst hatte einen schmutzig grauen Schleier über Köln gelegt, und schwere Gewitterwolken türmten sich am Himmel, gegen die das Tageslicht keine Chance hatte. Am liebsten hätte er sich wieder umgedreht und weitergeschlafen, aber das ging nicht. Herold war ein verständnisvoller Mensch, wenn seine Mitarbeiter persönliche Krisen durchlebten, aber auch seine Geduld war endlich, und dieses Ende war genau heute.
Mühsam stand er auf und wankte in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen. Während das Wasser heiß wurde, dachte er darüber nach, dass die unangenehme Seite des Herbstes fast genauso schlimm war wie die unangenehme des vergangenen Sommers, als die Temperaturen auf bis zu 41 Grad angestiegen waren. Die Stadt hatte kaum noch geatmet, ihr Puls war fast nicht mehr wahrnehmbar gewesen, und sie hatte schlaff in der Hitze gelegen wie ein überfahrenes Tier am Straßenrand, das nur noch auf den Tod wartete.
Zum Duschen und Anziehen brauchte er länger als gewöhnlich, weshalb er das Redaktionsgebäude erst eine halbe Stunde nach Dienstbeginn erreichte. Der Sitz der Reporter lag an einer dieser anonymen Ausfallstraßen im Kölner Norden, eingezwängt zwischen dem Komplex einer Versicherung und einer Tankstelle.
Als er aus dem Aufzug trat, warf er als Erstes einen Blick in Mützes Büro. Es war leer, und nichts in dem Raum deutete darauf hin, dass sie heute schon da gewesen war: keine benutzte Kaffeetasse auf dem Schreibtisch, keine beschmierten Notizzettel in der Ablage. Seufzend schloss Jan die Tür und drehte sich um, wobei er fast mit Tomasz Michalsky zusammenstieß, einem der Politikredakteure des Magazins.
»Guten Morgen«, grüßte Jan.
»Was, bitte schön, soll an diesem Morgen gut sein?«
Wie gewohnt hatte Michalsky dabei nicht den Ansatz eines Lächelns im Gesicht. Unter den Kollegen nannten sie ihn nur den Karpfen, weil er so fischartig kalt und schwerfällig wirkte, aber noch niemand hatte ihm das ins Gesicht gesagt. Manchmal spielte Jan mit dem Gedanken, der Erste zu sein. Er vermutete, dass man einen Preis dafür erhielt, eine bedruckte Tasse oder so was.
Nachdem sich Michalsky ohne ein weiteres Wort entfernt hatte, ging Jan in sein eigenes Büro, ließ sich auf den Stuhl fallen und blätterte die Ablage mit den ungelesenen Nachrichten durch. Mehrere Hausmeldungen lagen darin, ein paar weitergeleitete Leserbriefe und die Einladung zu einem Journalistenkongress in Saarbrücken. Nichts Wichtiges, um das er sich sofort hätte kümmern müssen. Er legte die Papiere wieder zurück und dachte stattdessen über den Mordfall im Sauerland nach, von dem Mütze ihm erzählt hatte.
Die Spieluhr …
Hush, little Baby.
Natürlich kannte er das Lied, konnte sich aber nicht mehr an den Text erinnern. Er fuhr den Rechner hoch, um es sich auf YouTube anzuhören, Strophe für Strophe.
Hush, little baby, don’t say a word.
Papa’s gonna buy you a mockingbird.
Da kaum anzunehmen war, dass eine Drossel für den Tod von Sonja Risse verantwortlich war, hörte er weiter zu. Im Prinzip ging es darum, dass irgendein Baby mit immer neuen Geschenken bedacht wurde, wenn die vorherigen ihren Zweck nicht erfüllten. Wollte die Drossel nicht singen, gab es einen Diamantring. Wollte der Hund nicht bellen, gab es ein Pferd. Irgendwann war Jan sich nicht mehr sicher, ob eines der berühmtesten Schlaflieder der Welt nicht insgeheim eine Liebeserklärung an den Kapitalismus war, bis die letzte Zeile ihn wieder versöhnlich stimmte:
And if that horse and cart fall down,
You’ll still be the sweetest little baby in town.
Danach durchforstete er das Internet und fand heraus, dass das Lied von einem unbekannten Musiker aus den Südstaaten der USA stammte, aber auch diese Information half ihm nicht weiter. Stattdessen kam er sich vor, als würde er gerade für eine Quizshow zum Thema unnützes Wissen trainieren. Er wechselte zu einer Suchmaschine und gab alle möglichen Kombinationen aus Schlagwörtern ein, die ihm zu dem Fall einfielen – die Spieluhr, das Lied, ein einzelner Stich ins Herz. Alles, was er fand, waren etliche Presseberichte über den Mord an Sonja Risse, aber keine Hinweise, dass der Täter noch einmal auf ähnliche Art zugeschlagen haben könnte.
Die Berichte selbst folgten dem altbekannten Muster: Drei oder vier Wochen lang war Sonja Risses Tod das Thema in den lokalen Medien gewesen. Es hatte unzählige Berichte gegeben und Interviews mit selbsternannten Experten, die versuchten zu rekonstruieren, was mit ihr passiert sein könnte. Aber im Endeffekt konnte keine Story, so sensationell sie auch sein mochte, überleben, wenn es kein neues Futter gab. Die Zeitungen und Lokalsender hatten es weiß Gott versucht. Sie waren allen erdenklichen Gerüchten nachgegangen, von einem Liebesmord bis zur Teufelsanbetung, aber in dieser Branche waren keine Nachrichten tatsächlich schlechte Nachrichten. Die Kürze der menschlichen Aufmerksamkeitsspanne war wirklich jämmerlich und wurde auch schnell von anderen Vorkommnissen überlagert – ein Unwetter hier, ein Politikerskandal dort. Man konnte daran auch den Medien die Schuld geben, aber im Prinzip bestimmten die Leser und Zuschauer, was weiter auf Sendung blieb. Solange die Leute die Berichte zu einem Thema ansahen oder die Zeitungen mit dementsprechenden Meldungen kauften, wurde weiter berichtet. Wenn nicht, suchten sich die Redakteure ein neues, glänzendes Spielzeug. Irgendeine Sau ließ sich immer durchs Dorf treiben, um das rastlose Auge der Kundschaft auf sich zu ziehen. Jan verurteilte das nicht, wie könnte er auch? Schließlich war er selbst Teil dieser Maschinerie. Er mochte ihre Spielregeln nicht mögen, musste aber damit leben.
Nachdem er mit dem Studium der Pressemeldungen durch war, ließ er eine Büroklammer, mit der er herumgespielt hatte, auf die Schreibtischunterlage fallen und rieb sich die Stirn. Das Vorgehen des Mörders erinnerte ihn unbestimmt an das Ritual eines Serienkillers. Allerdings musste er auch zugeben, dass ihm spontan kein einziger Serienkiller einfiel, der nur einmal gemordet und danach freiwillig wieder aufgehört hatte.
Er hätte sich jetzt gerne mit Mütze darüber ausgetauscht, aber die war immer noch nicht aufgetaucht. Vielleicht hatte sie einen Außentermin, vielleicht auch einfach nur verschlafen.
Entschlossen griff er zum Hörer und wählte ihre Mobilnummer. »Wo treibst du dich denn rum?«, fragte er, sobald sie den Anruf entgegengenommen hatte.
»Danke der Nachfrage – und wie geht’s dir, du Bauer? Ich bin schon um sechs Uhr aus den Federn gesprungen und zu Rafael Schäfer nach Meschede gefahren, um persönlich mit ihm zu sprechen. Den Weg hätte ich mir allerdings sparen können.«
»War er nicht da?«
»Das schon, aber er konnte mir auch nicht mehr sagen als das, was wir ohnehin schon wussten. Sonja Risse scheint eine ganz normale 19-Jährige gewesen zu sein, in deren Lebenslauf nichts darauf hingedeutet hat, dass sie einmal das Opfer eines Gewaltverbrechens wird. Ihr polizeiliches Führungszeugnis weist keinerlei Einträge auf und laut den Aussagen von Freunden und Bekannten hat sie auch keine Kontakte in kriminelle Kreise gehabt.«
»Was hat die Obduktion ergeben?«
»Nichts. Die einzige Wunde an ihrem Körper war die des Stiches, der zum Tod geführt hat. Ansonsten gab es keine Spuren von Gewalt, auch keine älteren Hämatome, noch nicht einmal ein verheilter Knochenbruch.«
»Hatte sie Rückstände von Alkohol oder Drogen im Blut?«
»Nein.«
»Ist sie vergewaltigt worden?«
»Ich sagte doch: keine weiteren Spuren von Gewalt. Wirklich keinerlei Auffälligkeiten. Der Täter hat sie mit einem Stich ins Herz getötet und anschließend hingelegt, als ob sie schlafen würde. Die Spieluhr stand keinen Meter entfernt auf einem Stein. Laut Schäfer deutet das Fehlen von Abwehrverletzungen übrigens darauf hin, dass sie ihren Mörder gekannt haben muss.«
»Hat er denn wenigstens einen Hinweis gefunden, was Sonja mitten in der Nacht auf dem Wilzenberg gemacht hat?«
»Ursprünglich sind sie wohl davon ausgegangen, dass Sonja sich dort mit einem Liebhaber treffen wollte, ohne allerdings zu wissen, wer dieser Liebhaber gewesen sein könnte. Zuerst hatten sie ihren Exfreund in Verdacht, einen Typen namens Stefan Wahlert. Aber der hat ein Alibi, und zwar ein absolut wasserdichtes: Er war zur Tatzeit mit Freunden auf Mallorca unterwegs.«
Jan seufzte. Trotz Mützes Bemühungen hatten sie immer noch nichts über die Tote herausgefunden, was ihre Geschichte unterfüttern konnte. Überhaupt kam es ihm vor, als ob …
»Warum hast du eigentlich angerufen?«
Er musste sich kurz sortieren, bevor er antwortete: »Ich habe mich gefragt, ob Sonja vielleicht Kontakt zu einem Kriminellen gehabt hatte, der nach dem Mord wegen eines anderen Verbrechens verhaftet wurde und deshalb nicht mehr in Erscheinung getreten ist. Aber diese Theorie hat sich mit deinen Informationen jetzt eigentlich erledigt.«
Sie grummelte etwas Zustimmendes.
»Obwohl …« Jan dachte nach. »Vielleicht gibt es ja eine Verbindung, von der Schäfer nichts ahnt. Vielleicht wurde der Mörder auch nicht verhaftet, sondern ist kurz nach der Tat gestorben.«
»Okay«, sagte Mütze ohne große Begeisterung. »Ich schaue, ob ich noch etwas herausbekommen kann, aber große Hoffnungen mache ich mir da nicht. Auf mich hat Schäfer schon sehr gewissenhaft gewirkt.«
Kurz darauf beendeten sie das Gespräch. Jan spielte einen Moment lang mit dem Gedanken, sich jetzt dem ungeliebten Inhalt der Ablage zu widmen, verwarf ihn aber wieder. Stattdessen ging er wieder auf YouTube, um sich das Lied erneut anzuhören.
Hush, little baby, don’t say a word …
DER UHRMACHER
Der Uhrmacher war in einem kleinen Dorf im Kreis Dithmarschen aufgewachsen, ganz im Westen Schleswig-Holsteins. Zweieinhalbtausend Einwohner, ein Supermarkt und eine Seehundstation. Bis zur nächsten Autobahn brauchte man eine Dreiviertelstunde, dafür lag die Nordsee direkt vor der Haustür. Wunderschöne Kindertage waren das gewesen, mit einer Familie, in der sich alles nur um ihn gedreht hatte. Seine Mutter hatte ihr erstes Kind bereits in der Schwangerschaft verloren, und als er sich dann angekündigt hatte, war sie fast schon zu alt gewesen, um noch ein Kind zu bekommen.
Bei seiner Geburt Mitte der sechziger Jahre flackerten gerade überall die ersten Studentenunruhen auf, die für seine Eltern allerdings wie Nachrichten aus einer anderen Welt geklungen hatten. Hier in Friedrichskoog hatte niemand protestiert. Man lebte im Rhythmus der Gezeiten, und das Aufregendste, was passieren konnte, waren blökende Schafe, die von schwanzwedelnden Hunden über den Deich gejagt wurden.
An seine Kindheit und Jugend hatte er nur gute Erinnerungen, und wenn ihn mit dreizehn, vierzehn jemand gefragt hätte, wie er sich sein weiteres Leben vorstellen würde, wäre die Antwort einfach gewesen: Er würde seine Jugendliebe heiraten, Tierarzt werden und für immer in Friedrichskoog bleiben. Das war seine Welt gewesen, und sie hatte im Norden an der dänischen Grenze angefangen und im Süden in Brunsbüttel geendet. Direkt an der Elbmündung – weiter war er in seiner Kindheit nicht gekommen, wenn man von den zwei Wochen Sommerurlaub absah, die er mit seiner Familie jedes Jahr in Schweden verbracht hatte.
Aber der Uhrmacher war nicht immer ein Kind geblieben.
Anfang der achtziger Jahre wurde in Deutschland die Friedensbewegung stärker, der Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss. 1981 demonstrierten 500000 Menschen auf den Bonner Rheinwiesen, 400000 in Amsterdam, 200000 in Brüssel. Er hatte die Bilder der Demonstranten im Fernsehen gesehen. Der Zusammenhalt der Menschen hatte ihn fasziniert, der Kampf für die gemeinsame Sache. Als zeitgleich im rund vierzig Kilometer entfernten Brokdorf die Proteste gegen das dortige Atomkraftwerk ihren Höhepunkt erreichten, hatte er sich auf sein Mofa gesetzt, eine blaue Kreidler Florett, und war hingefahren.
100 000 Demonstranten waren auf 10 000 Polizisten getroffen, die mit Wasserwerfern und Gummiknüppeln versuchten, den Aufmarsch zu verhindern. Die beiden Gruppen waren ihm vorgekommen wie verfeindete Armeen, ständig verschob sich die Frontlinie, und irgendwann war er hineingeraten. Er trug keine Uniform und war im selben Alter wie die meisten Demonstranten gewesen, also hatten die Polizisten ihn der Gegenseite zugerechnet und zurückgedrängt. Dann war ein Stein über seinen Kopf hinweggeflogen, die Ordnungshüter reagierten mit Schlägen. Er wurde von Gummiknüppeln an Kopf und Schulter getroffen. Bis zu diesem Moment hatte er nur ein Beobachter sein wollen, die politischen Ziele der Linken waren ihm fremd gewesen. Doch in diesen Minuten wurde der Kampf gegen den Imperialismus, gegen die Unterdrücker zu seinem Kampf. Nicht weil er sich bewusst dafür entschieden hätte. Die Wahl hatten andere für ihn getroffen, und mit jedem Hieb, den er abbekam, verfestigte sie sich. Von jetzt an würde er kämpfen, notfalls auch mit Mitteln der Gewalt. Warum sollte man davor zurückschrecken, wenn es die Gegenseite auch nicht tat?
Wahrscheinlich hatte er schon an diesem Tag alles hinter sich gelassen, was ihm zuvor wichtig gewesen war. Sein Dorf, seine Jugendliebe und den Wunsch, Tierarzt zu werden. Als er mit einer blutenden Platzwunde an der Schläfe nach Hause kam, stand sein Entschluss bereits fest: So schnell wie möglich die Behaglichkeit Friedrichskoogs verlassen und mit allen gesellschaftlichen Normen abschließen.
Er war fertig mit ihnen.
Aber die Normen nicht mit ihm.
Jetzt saß der Uhrmacher in einem kleinen Café am Schmallenberger Schützenplatz und aß ein Stück Apfelkuchen. Draußen stoppte gerade ein Auto. Das Beifahrerfenster glitt herunter und ein Mädchen kam angelaufen. Sie beugte sich ins Fahrzeuginnere, und der Uhrmacher blickte auf ihren Hintern, den sie ihm quasi entgegenstreckte. Auf die festen Beine, die unter dem Rock herausschauten, und auf ihr blondes Haar, das im Wind wehte. Sie war noch jung, sechzehn oder siebzehn vielleicht. Fast glaubte er, sie lachen zu hören.
Natürlich lachte sie. Warum auch nicht? Ihr war noch nie etwas Schreckliches widerfahren und wahrscheinlich kannte sie den jungen Kerl, der am Steuer saß.
Vertraute ihm.
Er aß das letzte Stück Kuchen und schloss die Augen, während er an ein anderes Mädchen dachte, das vor langer Zeit einem Mann vertraut hatte. Dann öffnete er die Augen wieder und sah die Bedienung vor sich stehen, die ihn freundlich fragte, ob er noch etwas haben wollte. Er verneinte und verlangte nach der Rechnung. Die Kellnerin entfernte sich, und er dachte über den Ort nach, in dem er sich befand.
Er wusste, dass Schmallenberg rund 25000 Einwohner hatte. Eine Kleinstadt im Sauerland, die zum Regierungsbezirk Arnsberg gehörte. Sie lag rund dreißig Kilometer südlich der Kreisstadt Meschede, am Rande des Rothaargebirges. Wenn man nach Siegen wollte, musste man rund fünfzig Kilometer weit fahren, nach Dortmund über hundert. Der gesamte Ort lebte von seiner Textilindustrie, dem Handwerk und der Holzwirtschaft. In den letzten Jahren war auch der Dienstleistungssektor immer größer geworden, hervorgerufen durch die Touristen, die in den kalten Monaten des Wintersports wegen kamen und sich an warmen Sommertagen an der herrlichen Landschaft erfreuten. Auch die historische Innenstadt mit ihren Brunnen, Skulpturen und Gassen war ein beliebter Anziehungspunkt für Ausflügler.
Der Teil des Ortes, in dem auch das Café lag, in dem er saß, wurde die Kernstadt genannt. Rund 7000 Menschen lebten hier, und wahrscheinlich kannte sich ein Großteil davon beim Namen. Es gab noch so etwas wie einen Gemeinschaftssinn, ein Interesse am Schicksal des anderen. Auch wenn die Einwohner nicht ständig aufeinander hockten, waren sie sich des anderen zumindest bewusst, anders als in den anonymen Wohnblocks der Großstädte. Fühlten sich in ihrem Heimatort sicher und geborgen.
Natürlich gab es auch hier Betrunkene, die nach einem Kneipenbesuch durch die Straßen torkelten, und auf den Schützenfesten konnten auch mal Fäuste fliegen, wenn sich zwei Typen um ein Mädchen stritten. Ab und zu wurde sogar ein Fahrzeug aufgebrochen oder ein Haus von Einbrechern heimgesucht, aber das waren schon Ausnahmen, die ob ihrer Seltenheit dann tagelang Stadtgespräch waren. Nichts, was den Alltag bestimmte, der von der Geborgenheit einer Gemeinschaft bestimmt war, in der fast jeder jeden kannte. Wo samstags der Rasen gemäht und anschließend das Auto gewaschen wurde.
So kannte er Schmallenberg – und so schien es noch immer zu sein. Kaum etwas hatte sich in dem Ort verändert, obwohl er so lange weg gewesen war.
Draußen war das Mädchen mittlerweile in den Wagen gestiegen, und er konnte erkennen, dass sie tatsächlich lachte. Sie warf den Kopf zurück, dann schnallte sie sich an, bevor der Mann am Steuer endlich losfahren konnte.
Ein braves Mädchen. Wahrscheinlich waren ihre Eltern mächtig stolz auf sie.
Kurz darauf stand die Bedienung erneut an seinem Tisch und brachte die Rechnung, wobei sie ihn freundlich anlächelte. Nicht anbiedernd, einfach nur nett, wie die meisten Menschen hier.
Er beglich den Betrag und legte ein ordentliches, aber nicht auffällig hohes Trinkgeld obendrauf. Dann stand er auf und verabschiedete sich mit einem Winken. Trat hinaus auf den sauber gefegten Bürgersteig, wo ihm die langsam untergehende Herbstsonne ins Gesicht schien. Atmete die klare Luft ein, die von den umliegenden Wäldern mit einer Frische erfüllt wurde, die man wahrscheinlich nur dann bewusst wahrnahm, wenn man den Großteil seines Lebens in einer Großstadt verbracht hatte.
Schmallenberg war ein Ort, an dem er damals gerne für immer geblieben wäre. Wo jeder vom anderen wusste, wo er aufgewachsen war und was er aus seinem Leben gemacht hatte. Wo die Einwohner gemeinsam vergessen konnten, was hier vor Jahren geschehen war. Sie alle hatten das gemacht. Hatten weitergedrängt und waren zur Normalität zurückgekehrt, als wenn auf dem Wilzenberg nie etwas Schreckliches geschehen wäre.
Jeder hatte das getan.
Nur er nicht.
*
Drei Tage später war Jan noch immer nicht weitergekommen. Mütze und er hatten sämtliche Fakten und Hintergrundinformationen gesammelt, die man telefonisch oder am Rechner bekommen konnte, jetzt mussten sie raus, vor die Tür treten. Und es gab nur einen Punkt, an dem man beginnen konnte, wenn man sich einer solchen Geschichte nähern wollte.
Ganz am Anfang.
Sonjas Geschichte hatte in Schmallenberg begonnen, und keine vier Kilometer entfernt hatte sie auch geendet. Zwischen dem Anfang und dem Ende hatten nur neunzehn Jahre gelegen, und in diesen Jahren musste auch der Grund für ihre Ermordung zu finden sein. Nicht in jener Zeit, in der sie ein Baby oder Kleinkind gewesen war. Wahrscheinlich auch nicht in den Jahren, in denen sie noch zur Schule gegangen war. Irgendwann danach, vermutlich in den letzten zwölf Monaten ihres Lebens, musste der Auslöser für die Tat stecken, und wenn sie ihn finden wollten, mussten sie genau dort beginnen.
Für das kommende Wochenende hatte Mütze zwei Einzelzimmer in einem Schmallenberger Hotel reserviert. Sie hatten abgesprochen, freitagnachmittags in Köln loszufahren und bis Sonntag im Sauerland zu bleiben. Die Tage vor Ort wollten sie dann nutzen, um mit jedem zu sprechen, der Sonja näher gekannt hatte – angefangen mit ihrer Mutter. Bei der Gelegenheit konnten sie sich auch gleich den Wilzenberg ansehen, um ihn in dem Bericht mit der passenden Atmosphäre darstellen zu können.
Jan nahm sich noch mal den letzten Artikel vor, den er im Internet über Sonjas Ermordung gefunden hatte. Er hatte in einer Lokalzeitung gestanden, war verblüffend gut geschrieben und mit aussagekräftigen Bildern versehen. Sauberer Journalismus, weder reißerisch aufgemacht noch der Schülerzeitungsstil, wie man ihn häufig im Lokaljournalismus fand. Die Überschrift lautete Rotkäppchens einsames Ende, und der Journalist hatte sie wahrscheinlich aufgrund der Farbe des Kleides gewählt, das Sonja zum Zeitpunkt ihrer Ermordung trug.
Irgendetwas an dem Geschriebenen ließ Jans Sinne anspringen. Er konnte es nicht benennen, spürte aber, dass der Lokaljournalist mit seiner These über eine tragisch endende Liebesbeziehung der Wahrheit recht nahe kam. Vielleicht, weil sie sich so gut mit seiner eigenen deckte. Auch Jan war davon überzeugt, dass persönliche Motive der Auslöser für den Mord gewesen waren.
Er war gerade mit dem Artikel durch, als die Tür aufging und Mütze hereinkam. Sie trug eine schwarze Lederjacke und dunkelgraue Jeans, unter der schwarze Chucks hervorschauten. Wie immer sah sie hinreißend aus, selbst als sie den Mund aufriss und gähnte. Dann setzte sie sich mit der einen Hälfte ihres Hinterns auf seine Schreibtischkante und wollte wissen, ob er in den letzten Tagen noch einmal etwas von Sarah gehört hatte.
Allein schon die Frage bereitete ihm Bauchschmerzen. Äußerlich ungerührt zuckte er die Schultern und sagte: »Ich habe von ihrer Anwältin einen Brief bekommen, in dem ziemlich genau das steht, was Sarah bereits am Telefon gesagt hat. Ergänzt um ein paar Drohungen das Sorgerecht betreffend, falls ich mich uneinsichtig zeigen sollte.«
»Oh Mann«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Was für ein verfickter Rosenkrieg! Wenn ich solche Geschichten höre, bin ich immer froh, nicht verheiratet zu sein.«
Das solltest du aber, dachte er. Oder zumindest gebunden. Wenigstens verliebt.
Ihr Job, die Wohnung, dazu eine Katze, die ihr in schöner Regelmäßigkeit aufs Parkett kotzte – das konnte nicht genug sein, nicht für jemanden wie sie. Aber immer, wenn er darauf zu sprechen kam, bekam er die Standardantwort der meisten weiblichen Singles zu hören – zu hohe Ansprüche und überhaupt, einen geeigneten Partner zu finden, wäre verdammt schwierig. Was nüchtern betrachtet meist Bullshit war. Zumindest, wenn man in Betracht zog, dass diese Singles dann später häufig mit einem Partner ankamen, bei dem man sich kopfschüttelnd fragte, welche Ansprüche das wohl gewesen sein sollten, denen ausgerechnet der genügte.
Aber er schwieg. Auch weil er wusste, dass er momentan nicht gerade für die Rolle desjenigen prädestiniert war, der anderen Menschen kluge Beziehungsratschläge geben sollte.
»Ich habe uns für das Wochenende schon zwei Termine gemacht«, unterbrach Mütze seine Grübeleien. »Zum einen mit Sebastian Waldheim, dem ehemaligen Klassenlehrer von Sonja, und zum anderen mit Maria Risse, Sonjas Mutter. Sie klang allerdings nicht gerade begeistert, als sie hörte, dass wir einen Bericht über den Tod ihrer Tochter schreiben wollen. Kann sein, dass mein Anruf verdrängte Erinnerungen geweckt hat.«
»Für wann hast du die Besuche festgemacht?«
»Sebastian Waldheim wäre es am liebsten, wenn wir direkt am Freitag kommen würden. Wir haben jetzt 20 Uhr ausgemacht, damit wir zuvor noch im Hotel einchecken und etwas essen gehen können.«
»Und das Treffen mit der Mutter?«
»Samstags, am besten gegen Mittag. Sie hat aber bereits betont, dass sie nicht wisse, worüber sie mit uns reden solle.«
Das klang nicht gut in seinen Ohren. Wenn die reine Interviewanfrage schon solche Reaktionen hervorrief, kam bei dem anschließenden Besuch selten etwas Vernünftiges heraus.
»In Ordnung«, sagte er dennoch. »Dann haben wir den Sonntag frei, falls sich vor Ort noch andere Möglichkeiten ergeben. Und wir haben genug Zeit, um auf den Wilzenberg zu gehen und uns dort in Ruhe umzusehen.«
Sie beugte sich ihm entgegen. »Hast du dir den Berg mal bei Google Earth angesehen? Wenn nicht, solltest du das unbedingt nachholen! Ich sag’s dir … das ganze Gelände sieht verdammt unheimlich aus.«
»Hm«, machte er abwesend.
Sie stemmte die Fäuste in die Hüften. »Hörst du mir überhaupt zu?«
»Ich muss immer wieder an die Spieluhr denken«, erwiderte er. »Wenn wir davon ausgehen, dass Sonja sie nicht selbst mitgebracht hat, kann sie nur vom Täter stammen. Das Ganze wirkt so … ich weiß auch nicht, arrangiert. Ich glaube, dass diese Uhr – oder die Melodie, die sie spielt – für den Mörder eine enorme Bedeutung haben muss.«
»Vielleicht will er aber auch nur, dass wir das glauben. Vielleicht hat er sie damals ganz bewusst platziert, damit die Polizei sich darüber den Kopf zerbrechen kann, genauso wie wir jetzt. Hast du daran mal gedacht?«
Hatte er.
Aber er glaubte es nicht.
Manchmal kannte man die Wahrheit einfach, ohne sie beweisen zu können. Vielleicht aufgrund von Erfahrungswerten, vielleicht aufgrund eines Bauchgefühls. Die Spieluhr stammte vom Täter, und sie war ihm wichtig, da war er sich sicher. Er wusste nur noch nicht, was der Mörder damit mitteilen wollte.
Nachdem Mütze sein Büro wieder verlassen hatte, nahm Jan sich die von der Polizei freigegebenen Tatortfotos vor, die er vor sich auf dem Schreibtisch ausbreitete. Er betrachtete Bild für Bild und versuchte, die Geschichte dahinter zu erkennen. Es gab immer eine solche Erzählung – mal offensichtlich, mal verborgen in den Details. Manchmal stand den Toten der Mund offen, als hätte es ihnen die Sprache verschlagen. Manchmal machten sie einen ungläubigen Eindruck, als wenn sie erst im letzten Moment ihres Daseins festgestellt hätten, dass die Welt nur ein einziger großer Schwindel ist. Vielleicht war ihr Blick im Moment des Todes auf einen Sonnenstrahl gerichtet, der durch das Laubdach der Bäume fiel, oder auf den Menschen, der ihnen ihr Leben nahm. Ab und zu sah es so aus, als würde den Toten eine Träne in den Augenwinkeln haften, oder sie hatten die Arme ausgebreitet, als wollten sie ihr Schicksal einer höheren Macht anvertrauen.
Jan hätte nur zu gern geglaubt, dass diejenigen, die eines gewaltsamen Todes starben, von einem liebevollen Gott getröstet wurden, der sich fortan auf eine besondere Weise um sie kümmerte. Er wollte darauf hoffen, dass Sonja Risses Tod nicht umsonst gewesen war; dass irgendjemand sie jetzt für das Leid, das sie zu Lebzeiten erlitten hatte, entschädigte.
Leider gab es nichts, das darauf hindeutete.
Auf den achtzehn mal fünfundzwanzig Zentimeter großen Bildern sah er ihren durch das dünne Kleid nur notdürftig bedeckten Körper, die Haut weiß wie Porzellan. Laub hatte sich wie ein Leichentuch über ihr ausgebreitet, die Lippen waren rot, die Augen ins Nirgendwo gerichtet. Sie wirkte unglaublich verletzlich, selbst im Tod. Ein Teenager auf dem Weg zur Frau, die sie niemals geworden war.
Länger als alles andere betrachtete er ihre Augen. Sie wirkten nicht erloschen, aber auch nicht zornig. Stattdessen spiegelten sie eine tiefgehende Verständnislosigkeit wider.
Jan wusste, dass der Blick dieser Augen ihn nicht loslassen würde. Er würde ihn verfolgen, bis er das Geheimnis dahinter gelüftet hatte.
*
Als Mütze ihre Wohnungstür aufschloss, war sämtliche Energie aus ihr herausgeflossen. Sie fühlte sich müde und leer, fast wie ausgebrannt. Sie wusste, dass sie dazu neigte, sich in solche Fälle zu verbeißen und sie persönlich zu nehmen, und auch jetzt spürte sie, dass sie an einen Punkt gelangt war, an dem Sonjas Geschichte begann, zu ihrer eigenen zu werden. Zu etwas, das sie nicht mehr loslassen würde, bis sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft hatte, die sich ihr boten. Ihr Verlangen, die Wahrheit herauszufinden, glich dem Drang eines Ertrinkenden, an die Wasseroberfläche zu gelangen.
In Momenten wie diesen bewunderte sie Jan für seinen Pragmatismus, obwohl er sie damit regelmäßig zur Weißglut trieb. Für ihn waren Aussagen wie »wir werden sehen« oder »das wird sich schon zeigen«, vollkommen befriedigende Antworten auf offene Fragen. Sie war da anders. Sie hasste es, wenn Dinge in der Schwebe waren, konnte es manchmal fast buchstäblich nicht ertragen. Für sie musste alles einer klaren Ordnung folgen. Wenn das nicht der Fall war, erwachte sofort die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Sie brauchte die Kontrolle, und wenn das nicht möglich war, zumindest die Illusion davon. Wahrscheinlich hätte jeder Psychiater einen Heidenspaß mit ihr gehabt.
In dem Moment kam Cleo rutschend um die Ecke gestürmt, miaute mit vor Aufregung zitterndem Schwanz und versuchte so, von dem Gewölle abzulenken, welches sie mitten im Wohnzimmer erbrochen hatte. Seufzend verdrehte Mütze die Augen, zog ihre Chucks aus und hängte die Lederjacke an den Haken. Dann putzte sie Cleos Hinterlassenschaften weg und ging anschließend in die Küche, um sich einen starken Feierabend-Kaffee zu machen.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.