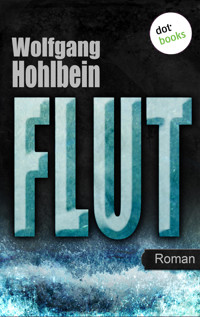0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: jumpbooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Operation Nautilus-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Auf ins Abenteuer: der spannende Roman »Die vergessene Insel« von Wolfgang Hohlbein jetzt als eBook bei jumpbooks. England 1913. Fast hätte Mike die Winterferien im Internat verbringen müssen. Doch dann lädt der Vater seines Mitbewohners ihn und seine Freunde spontan ein, eine Schiffsreise mit ihm zu unternehmen. Als Mike auf dem Weg zum Hafen gekidnappt werden soll, stellt sich heraus, dass ihm sein verstorbener Vater eine geheime Insel in der Karibik vererbt hat. Und dort wartet ein Schatz! Aber genau darauf haben es auch seine Entführer abgesehen. Nun ist es an Mike und seinen Freunden, die Insel zuerst zu finden. Doch was hat es mit diesem geheimen Schatz wirklich auf sich? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das erste Abenteuer aus Wolfgang Hohlbeins »Operation Nautilus«-Reihe für Leser ab 8 Jahren erlebt ihr in »Die vergessene Insel« hautnah mit. Wer liest, hat mehr vom Leben: jumpbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Ähnliche
Über dieses Buch:
England 1913. Fast hätte Mike die Winterferien im Internat verbringen müssen. Doch dann lädt der Vater seines Mitbewohners ihn und seine Freunde spontan ein, eine Schiffsreise mit ihm zu unternehmen. Als Mike auf dem Weg zum Hafen gekidnappt werden soll, stellt sich heraus, dass ihm sein verstorbener Vater eine geheime Insel in der Karibik vererbt hat. Und dort wartet ein Schatz! Aber genau darauf haben es auch seine Entführer abgesehen. Nun ist es an Mike und seinen Freunden, die Insel zuerst zu finden. Doch was hat es mit diesem geheimen Schatz wirklich auf sich?
Über den Autor:
Wolfgang Hohlbein, 1953 in Weimar geboren, ist Deutschlands erfolgreichster Fantasy-Autor. Der Durchbruch gelang ihm 1983 mit dem preisgekrönten Jugendbuch MÄRCHENMOND. Inzwischen hat er 150 Bestseller mit einer Gesamtauflage von über 44 Millionen Büchern verfasst. 2012 erhielt er den internationalen Literaturpreis NUX.
Der Autor im Internet: www.hohlbein.de
Die Romane der Operation-Nautilus-Reihe:
Die vergessene Insel – Erster Roman
Das Mädchen von Atlantis – Zweiter Roman
Die Herren der Tiefe – Dritter Roman
Im Tal der Giganten – Vierter Roman
Das Meeresfeuer – Fünfter Roman
Die schwarze Bruderschaft – Sechster Roman
Die steinerne Pest – Siebter Roman
Die grauen Wächter – Achter Roman
Die Stadt der Verlorenen – Neunter Roman
Die Insel der Vulkane – Zehnter Roman
Die Stadt unter dem Eis – Elfter Roman
Die Rückkehr der Nautilus – Zwölfter Roman
Bei jumpbooks erscheint von Wolfgang Hohlbein: Der weiße Ritter – Erster Roman: WolfsnebelDer weiße Ritter – Zweiter Roman: SchattentanzNach dem großen Feuer
TeufelchenSchandmäulchens Abenteuer
IthakaDer Drachentöter
Saint Nick – Der Tag, an dem der Weihnachtsmann durchdrehte
NORG – Erster Roman: Im verbotenen Land
NORG – Zweiter Roman: Im Tal des Ungeheuers
Weitere Titel sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2018
Copyright © der Originalausgabe 1993 by Verlag Carl Ueberreuter, Wien
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Copyright © 2018 jumpbooks Verlag. jumpbooks ist ein Imprint der dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Attitude, Photobank Gallery, Tithi Luadthong
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (aks)
ISBN 978-3-96053-261-3
***
Damit der Lesespaß sofort weitergeht, empfehlen wir dir gern weitere Bücher aus unserem Programm. Schick einfach eine eMail mit dem Stichwort Operation Nautilus 1 an: [email protected] (Wir nutzen deine an uns übermittelten Daten nur, um deine Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuch uns im Internet:
www.jumpbooks.de
www.facebook.com/jumpbooks
Wolfgang Hohlbein
Die vergessene Insel
Operation Nautilus – Erster Roman
jumpbooks
Es hatte in diesem Jahr früh zu schneien begonnen. Schon vor zehn Tagen waren die ersten weißen Flocken lautlos vom Himmel gefallen und jetzt, einige Tage vor Weihnachten und zwei Tage vor dem Beginn der Ferien, hatten sich die Wiesen, der nahe gelegene Wald und die ineinander geschachtelten Gebäude des altehrwürdigen Internats in eine weiße Zuckerbäckerlandschaft verwandelt, über die ein eisiger Wind fegte. Der kleine See, der zu den Ländereien von Andara-House gehörte und in dem die Schüler im Sommer schwammen, war zugefroren. Bald würde die Eisdecke fest genug sein, um Schlittschuh darauf zu laufen. Nachts rüttelte der Sturm an den Fenstern, brach sich heulend an Erkern und Simsen und klapperte mit den Fensterläden und selbst tagsüber blieb der Himmel meistens grau; es schien gar nicht mehr richtig hell zu werden.
Mike stand am Fenster seines Zimmers und blickte hinaus. Die trübe Stimmung dort draußen passte zu seiner eigenen. Er fühlte sich niedergeschlagen, einsam und so zornig wie der Wind, der zwar seit einiger Zeit innegehalten hatte, zweifellos aber mit dem Hereinbrechen der Dämmerung wieder zu einem neuen Angriff auf die zweihundert Jahre alten Mauern des ehemaligen Schlosses ansetzen würde, das die vornehme Privatschule beherbergte.
Durch das geschlossene Fenster drangen Lärm und lautes Gelächter herein. Mike presste die Nase gegen das kalte Glas und sah nach unten. Die Atempause, die der Sturm einlegte, hatte einige der anderen Schüler auf den Hof gelockt. Sie tollten herum, bewarfen sich mit Schneebällen und waren von einer selten ausgelassenen Stimmung. Mike versetzte der Anblick seiner im Schnee herumspringenden Mitschüler einen schmerzhaften Stich.
Mit einem tiefen Seufzer wandte er sich vom Fenster ab und ließ seinen Blick durch das große Zimmer schweifen, das er mit zwei anderen Internatszöglingen teilte und das in den letzten sechs Jahren sein Zuhause gewesen war. Der Raum war groß und hell, in freundlichen Farben gehalten und mit allem ausgestattet, was ein sechzehnjähriger Junge braucht, um sich wohl zu fühlen: Außer dem gemeinsamen Kleiderschrank, den Betten und dem großen, ebenfalls gemeinsam genutzten Schreibtisch hatte jeder noch einen nur für seine privaten Dinge bestimmten Schrank, für den nicht einmal die Lehrer einen Schlüssel hatten. Über jedem Bett hing ein offenes Regal für Bücher, Spielzeug und andere Dinge.
Nach ein paar Augenblicken wandte sich Mike vom Fenster ab und ging zum Schreibtisch. Sein Blick blieb für eine Sekunde an dem Kalender hängen, der darüber an der Wand angebracht war. Er zeigte den neunzehnten Dezember neunzehnhundertdreizehn – den heutigen Tag – und jemand hatte das Datum rot eingekreist.
Niedergeschlagen setzte sich Mike an den Schreibtisch und nahm den Brief zur Hand, den er gestern Morgen bekommen hatte. Er hatte ihn seither mindestens zwanzigmal gelesen, fast als glaube er, ihn nur oft genug studieren zu müssen, um seinen Inhalt ungültig zu machen.
McIntire hatte ihm den Brief ausgehändigt, und obwohl es unter den Zöglingen von Andara-House als sicher galt, dass der Direktor des Internats Kinder als seine natürlichen Feinde betrachtete, hatte er echtes Mitleid gezeigt. Und so hatte Mike den schmalen weißen Umschlag mit einem flauen Gefühl im Magen geöffnet, das sich nur zu sehr bestätigte.
Um es kurz zu machen: Mike würde die Weihnachtsferien und auch den Silvesterabend dieses Jahres auf Andara-House verbringen, statt zu seinem Vormund nach Indien zu reisen, wie er es in den letzten sechs Jahren immer in den Ferien getan hatte. In dem Brief hatte auch eine wortreiche und umständliche Erklärung für diese bedauerlichen Umstände gestanden – irgendetwas von politischen Wirren und einer unguten Entwicklung im Lande, die es für ihn nicht ratsam erscheinen ließe, in seine Heimat zurückzukehren; zumindest nicht im Moment.
Wie immer, wenn er in Gedanken versunken war, spielten Mikes Finger unbewusst mit dem durchbrochenen Goldamulett, das er an einer dünnen Kette um den Hals trug – das einzige persönliche Andenken an seinen Vater, das er besaß. Nicht ratsam! Mike hätte vor lauter Enttäuschung und Zorn am liebsten laut losgeheult. Was interessierten ihn politische Wirren und eine allgemeine ungute Entwicklung der Dinge?! Er wollte über die Feiertage nach Hause, wie es alle anderen Schüler hier durften, und er konnte und wollte auch nicht einsehen, was ein sechzehnjähriger Junge mit politischen Wirren zu schaffen hatte! Wäre sein Vater noch am Leben gewesen oder irgendein anderer Verwandter, der vielleicht eine wichtige Rolle in Politik und Wirtschaft seines Landes spielte, ja, dann hätte er das vielleicht verstanden. Aber so ...
Mike war ein Waisenkind. Seine Eltern waren bei einem Unfall ums Leben gekommen, als Mike noch nicht einmal zwei Jahre alt war. Sein Vater war Inder und als hoher Beamter im britischen Dienst tätig gewesen. Er hatte seine Frau, eine mittellose Engländerin, auf einem Wohltätigkeitsfest kennen gelernt und sich auf der Stelle in sie verliebt.
Nach dem Tod seiner Eltern lebte Mike bei seinem Vormund, einem Bekannten seines Vaters, bis er alt genug war, um – wie es testamentarisch festgelegt war – nach Europa zu gehen und dort eine gute Schulausbildung zu beginnen. Mike wusste, dass sein Vater ihm ein ansehnliches Vermögen und ein kleines Gut hinterlassen hatte, das er aber nicht kannte. Sooft er seinen Vormund bat, doch mit ihm einmal dorthin zu fahren, winkte dieser ab. Die Reise sei zu weit und zu strapaziös, an seinem einundzwanzigsten Geburtstag gehe alles in Mikes Besitz über und dann könne er auch dort leben, wenn er wolle.
Obwohl er von Geburt aus Inder war, fühlte sich Mike diesem Volk nicht zugehörig. Außerdem sah er nicht einmal wie ein Inder aus. Seine Haut war vielleicht ein wenig dunkler als die eines Europäers, sein Haar tiefschwarz und sein Wuchs sehr schlank, dabei aber durchaus kräftig, doch man hätte schon sehr genau hinsehen müssen, um einen Unterschied zu irgendeinem der anderen Schüler von Andara-House zu entdecken. Sein Vormund hatte ihm einmal gesagt, dass er wohl mehr nach der Familie seiner Mutter schlage und ihr im Übrigen wie aus dem Gesicht geschnitten sei.
Mike war so sehr in seine Gedanken versunken, dass ihm erst nach einer geraumen Weile auffiel, nicht mehr allein im Zimmer zu sein.
Hinter ihm stand Paul, einer seiner beiden Zimmerkameraden. Die beiden kannten sich seit fünf Jahren und waren gute Freunde geworden.
»Hallo«, sagte Mike einsilbig.
»Immer noch damit beschäftigt, Trübsal zu blasen?«, erkundigte sich Paul. Er grinste. Es wirkte nicht ganz echt und es diente genau wie sein lockerer Ton nur dazu, Mike aufzuheitern. Leider funktionierte es nicht.
»Wie kommst du darauf?«, knurrte Mike und stand so heftig auf, dass sein Stuhl scharrend über den Boden fuhr und beinahe umgekippt wäre. »Ich platze gleich vor Freude. Kannst du dir etwas Schöneres vorstellen, als Weihnachten hier zu verbringen und Silvester mit einem Glas Erdbeersaft mit McIntire anzustoßen?«
»Du bist ja nicht ganz allein«, sagte Paul.
Was für ein Trost, dachte Mike sarkastisch. Tatsächlich waren sie in diesem Jahr zu fünft, was die Zahl der Schüler anging, die aus dem einen oder anderen Grund nicht nach Hause konnten und die Ferien hier verbrachten. Mike hätte allerdings auf die Ehre, dazu zu gehören, liebend gern verzichtet. Er ersparte sich deshalb jede Antwort.
Paul ging zu seinem Bett und nahm den Koffer auf, der schon seit dem gestrigen Abend fertig gepackt dort stand. Der Anblick gab Mike einen neuerlichen Stich. Natürlich hatte er gewusst, dass Paul heute abreiste – aber es jetzt zu sehen, gab ihm für eine Sekunde das absurde Gefühl, von seinem Freund im Stich gelassen zu werden.
»Ist dein Vater schon da?«, fragte er.
Paul nickte. »Schon seit einer ganzen Weile. Er spricht noch mit McIntire.« Paul war kein besonders guter Schüler. Er machte auch gar kein Hehl daraus, dass er nicht viel von Schule und Lernen hielt, und wahrscheinlich war der einzige Grund, aus dem er noch immer hier war, der, dass sein Vater ein sehr einflussreicher Mann war. Nebenbei auch ziemlich vermögend – aber das waren die Eltern der allermeisten Kinder hier.
Paul sah ihn noch einen Moment lang mitleidig an, dass Mike schon wieder in Zorn geriet, dann zuckte er mit den Schultern, drehte sich um und ging unter dem Gewicht seines Koffers etwas schief zur Tür. Dort wandte er sich noch einmal an Mike: »Willst du nicht wenigstens mitkommen und hallo sagen? Mein Vater würde sich bestimmt freuen.«
Mike wollte im ersten Moment ablehnen, weil er einen tiefen Groll auf die ganze Welt verspürte. Aber dann begegnete er Pauls Blick, und was er darin las, machte ihm klar, dass er seinen Freund damit verletzt hätte.
Außerdem mochte er Hieronymus Winterfeld. Pauls Vater war Kapitän der kaiserlich deutschen Kriegsmarine, der nicht das erste Mal einen Aufenthalt seines Schiffes vor der englischen Küste dazu nutzte, einen Abstecher nach Andara-House zu machen und seinen Sohn zu besuchen. Kapitän Winterfeld erfreute sich nicht nur bei Mike, sondern auch bei allen anderen Schülern des Internats großer Beliebtheit. Zwar entsprach er äußerlich durchaus dem Bild eines steifen deutschen Marineoffiziers: er war groß, von imposanter Statur, hielt sich stets gerade in seiner dunkelblauen Marineuniform, an deren Brust viele Medaillen und Ordensspangen befestigt waren, und hatte einen stets forschen Gang. Ganz im Gegensatz zu diesem Ehrfurcht gebietenden Äußeren stand jedoch sein Verhalten. Er war nicht nur sehr freundlich, sondern auch ein überaus lustiger und redseliger Mann, der immer eine freundliche Bemerkung parat hatte und kaum eine Gelegenheit ausließ, eine Anekdote aus seinem Leben zur See oder irgendein Abenteuer zu erzählen. Manchmal brachte er kleine Geschenke für Pauls Zimmerkameraden mit und im vergangenen Jahr hatte er sogar auf eigene Kosten eine Barkasse gechartert und Paul und eine Anzahl anderer Jungen zu einer Rundfahrt im Hafen eingeladen.
»Wie ist es?«, fragte Paul, als Mike noch immer zögerte. Mike gab sich einen Ruck und stand auf. »Warum nicht?«, sagte er. »Vielleicht kann ich deinen Vater überreden, mich als blinden Passagier an Bord seines Schiffes zu schmuggeln.«
Auch in den Räumen des Direktors warfen die kommenden Ferien ihre Schatten voraus. Der Schreibtisch im Vorzimmer war verwaist und völlig aufgeräumt. McIntires Sekretärin war eine überaus tüchtige Person, aber das genaue Gegenteil des Direktors. Sie war lustig, immer zu einem Scherz aufgelegt, redete ununterbrochen und verbreitete Chaos, wo immer sie auftauchte. Wie auf ein Stichwort hin erschien sie in diesem Moment bereits mit Mantel, dicken Winterstiefeln und einem jener breitkrempigen Hüte mit einem Gazeschleier, wie sie jetzt in Mode gekommen waren. Als sie die beiden erblickte, lächelte sie.
»Ah, der junge Herr Winterfeld«, sagte sie höflich. »Du bist bestimmt gekommen, um Mäuschen zu spielen und zu hören, was der Herr Direktor mit deinem Vater zu besprechen hat, wie?« Sie blinzelte Paul zu, ging zum Schreibtisch und warf einen letzten Blick auf die blank polierte Platte, wie um sich zu überzeugen, dass ihr auch kein Stäubchen entgangen war, das den Schreibtisch während ihrer Abwesenheit verunzieren mochte. »Aber daraus wird nichts.«
Paul und Mike tauschten einen verwirrten Blick. Sie waren nicht hierher gekommen, um irgendetwas in Erfahrung zu bringen. Außerdem war die gepolsterte Tür zu McIntires Allerheiligstem so dick, dass man dahinter schon eine Kanone hätte abschießen müssen, um auf der anderen Seite einen Laut zu hören.
In diesem Augenblick wurde diese Tür geöffnet und der Direktor von Andara-House trat heraus, dicht gefolgt von Kapitän Winterfeld. Die beiden waren in ein Gespräch vertieft und McIntire lachte sogar, als er Pauls Vater die Tür aufhielt, und das war etwas, was nun wirklich höchst selten vorkam; es war beinahe Anlass genug, auf dem Kalender in Mikes Zimmer das heutige Datum mit einem zweiten roten Kringel zu markieren.
Kapitän Winterfeld sah beeindruckend aus wie immer. Über seiner makellosen Paradeuniform trug er einen weißen Mantel mit Fellkragen und die Kapitänsmütze mit dem goldenen Emblem seines Schiffes verlieh ihm etwas fast Majestätisches. Sein Schnurrbart war sorgsam gezwirbelt und stand so steif von seinem Gesicht ab, als wäre er aus Draht geflochten, und unter dem Mantel klapperte bei jedem Schritt der Offizierssäbel gegen sein Bein. Als er seinen Sohn und Mike erblickte, unterbrach er sein Gespräch mit McIntire für eine Sekunde, um ihnen ein freundliches Nicken zuzuwerfen, dann streckte er dem Direktor zum Abschied die Hand entgegen. »Also dann sehen wir uns nach den Weihnachtsferien wieder.«
»Frisch ausgeruht und bester Dinge«, bestätigte McIntire. »Und machen Sie sich keine Sorgen. Über die paar Kleinigkeiten –« Bei diesen beiden Worten warf er einen unheilschwangeren Blick in Pauls Richtung.
»– werden wir uns schon einig.«
Paul schien plötzlich etwas ungemein Interessantes am Fenster entdeckt zu haben, denn seine ganze Aufmerksamkeit war auf einen imaginären Punkt irgendwo hinter Miss McCrooder gerichtet. Kapitän Winterfeld drückte McIntire noch einmal die Hand und wandte sich dann zu ihnen um. McIntire blieb mit der Hand auf der Klinke unter der Tür stehen, aber Winterfeld beachtete ihn nicht mehr.
»Michael!«, sagte er mit einem erfreuten Lächeln. »Wie schön, dass wir uns wieder einmal sehen.«
Mike erwiderte Winterfelds festen Händedruck und lächelte ebenfalls. Winterfeld schien aber sofort aufzufallen, dass irgendetwas mit Mike nicht stimmte. Er legte den Kopf schräg und blickte ihn eindringlich an. »Was ist los mit dir?«, fragte er geradeheraus. »Du siehst nicht aus wie ein Junge, der sich auf die Ferien freut.«
Das liegt vielleicht daran, dass ich kein Junge bin, der sich auf die Ferien freut, dachte Mike. Er sprach das aber nicht aus, sondern zuckte nur mit den Schultern.
»Ärger?«, erkundigte sich Winterfeld.
»Nein«, antwortete Mike und Paul sagte im gleichen Atemzug: »Ja.«
Der Blick seines Vaters wanderte für einen Moment zwischen seinem und Mikes Gesicht hin und her. »Mike hat keinen besonderen Grund, sich zu freuen«, erklärte Paul. »Er kann in diesen Ferien nicht nach Hause.«
»Ist das wahr?« Winterfeld blinzelte. »Was ist passiert?«
»Es ist so«, schaltete sich der Direktor ein. »Gestern kam ein Brief aus seiner Heimat. Wie es scheint, herrschen in Indien wieder einmal Unruhen. Jedenfalls ist sein Vormund der Meinung, dass es sicherer für Mike ist, wenn er die Feiertage hier bei uns verbringt, statt sich auf die gefahrvolle Reise in eine Provinz zu begeben, in der jeden Moment ein Bürgerkrieg ausbrechen kann.«
Kapitän Winterfeld runzelte bei diesen Worten die Stirn, schwieg aber. Allein die Tatsache, dass Hieronymus Winterfeld – der immerhin ein hoher deutscher Marineoffizier war – seinen Sohn auf ein englisches Internat schickte, bewies zweifelsfrei, wie sehr er seine privaten Dinge von politischen Rücksichtnahmen zu trennen wusste. Aber er blieb trotz allem ein deutscher Offizier, und selbst Mike, der sich nicht die Bohne um Politik kümmerte, war nicht verborgen geblieben, wie angespannt die Lage in Europa war. Während der letzten Monate hatte sich das Verhältnis zwischen Deutschland und Österreich auf der einen und so ziemlich dem ganzen Rest Europas auf der anderen Seite drastisch verschlechtert Man munkelte sogar von Krieg, aber das hielt Mike für übertrieben.
»Das tut mir. sehr Leid«, sagte Winterfeld weich. »Ich weiß, wie das ist, ich bin ebenfalls in einem Internat gewesen, weißt du? Und die Vorstellung, auch noch die wohlverdienten Ferien dort verbringen zu müssen ...« Er schüttelte den Kopf. »Hast du sonst keine Verwandten, zu denen du gehen könntest?«
»Nein«, antwortete Mike. Der europäische Zweig seiner Familie war mit seiner Mutter ausgestorben; das wusste er von seinem Vormund.
»Mike ist nicht ganz allein«, sagte McIntire. »Außer ihm werden noch vier weitere Schüler hier bleiben und es gibt ja auch noch mich und einen Teil des Lehrpersonals, das Weihnachten und Neujahr auf Andara-House verbringt.«
Leider, fügte Mike in Gedanken hinzu, zwang sich aber gleichzeitig zu einem Lächeln und sagte: »Es sind ja nur drei Wochen.«
»Drei Wochen können eine Ewigkeit sein«, sagte Winterfeld. Ein nachdenklicher Ausdruck erschien auf seinen Zügen. »Vielleicht gäbe es da doch noch eine Möglichkeit«, meinte er etwas unschlüssig.
»Welche?«, fragte McIntire.
»Nun, es ist ungewöhnlich, aber ...« Er zögerte einen Moment, dann sprach er weiter. »Michael könnte uns begleiten. Wenigstens für ein paar Tage.«
Mike horchte auf und McIntire legte den Kopf schräg und die Stirn in Falten, wodurch er ein wenig wie ein überraschter Dackel aussah, ohne jedoch die natürliche Freundlichkeit dieser kleinen Hunde auszustrahlen. »Wie meinen Sie das?«
»Nun, des einen Leid ist des anderen Freud, das wissen Sie ja«, antwortete Winterfeld. »An sich hatte ich vor, Paul gleich mit nach Hause zu nehmen. Aber wie es scheint, werden auch wir zumindest die Weihnachtstage noch auf Ihrer freundlichen Insel verbringen. Die LEOPOLD liegt mit einem Maschinenschaden im Hafen, und wie mir mein Erster Ingenieur versicherte, wird die Reparatur mindestens sechs Tage in Anspruch nehmen. Wenn Michael es möchte und Sie einverstanden sind, selbstverständlich, dann könnte er Paul und mich begleiten und an Bord des Schiffes bleiben, bis wir auslaufen.«
Mike riss erstaunt Mund und Augen auf. Aus seiner gerade noch abgrundtiefen Betrübnis wurde ein himmelhohes Jauchzen, das allerdings sofort wieder einen kräftigen Dämpfer bekam, als er McIntire ansah. Das Stirnrunzeln des Direktors zeigte, dass er wenig begeistert von Winterfelds Vorschlag war. Schließlich war Hieronymus Winterfeld Soldat und die LEOPOLD ein Kriegsschiff. Sein Vorschlag verstieß wahrscheinlich gegen so ziemlich jede Regel, die McIntire kannte, und wahrscheinlich auch gegen alle, die er nicht kannte.
»Ich bin nicht ganz sicher, ob ...«, begann McIntire, aber Winterfeld unterbrach ihn sofort.
»Ich übernehme natürlich die volle Verantwortung«, sagte er. »Und es besteht wirklich kein Grund zur Sorge. Wie gesagt: Die LEOPOLD liegt manövrierunfähig im Hafen und ich verbürge mich dafür, dass Michael sicher wieder zurückgebracht wird, bevor wir auslaufen.«
»Ich zweifle nicht an Ihrem Wort, Kapitän Winterfeld«, antwortete McIntire hastig. »Es ist nur ...« Er räusperte sich, dann gab er sich einen Ruck und fuhr ein wenig fester fort: »Ich will ganz ehrlich sein: Die Lage ist nicht nur in Indien gespannt. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich klug ist, wenn sich Mike im Moment an Bord eines deutschen Kriegsschiffes begibt.«
»Sir, ich bitte Sie!«, sagte Winterfeld kopfschüttelnd. »Ich weiß ja nicht, was die Zeitungen hier in Großbritannien für einen Unsinn verbreiten, aber wenn er auch nur halb so groß ist wie der, den sie bei uns schreiben, dann kann ich Sie beruhigen. Weder das Deutsche Kaiserreich noch Österreich-Ungarn tragen sich im Moment mit dem Gedanken an Krieg. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es Ihrer Queen anders ergeht. Immerhin leben wir im zwanzigsten Jahrhundert.«
»Was nichts daran ändert, dass die LEOPOLD ein Kriegsschiff ist.«
Kapitän Winterfeld nahm die Worte gar nicht zur Kenntnis. »Und außerdem«, fuhr er unbeeindruckt fort, »bin ich nicht als Kapitän der kaiserlichen Kriegsmarine hier, sondern als Vater einer Ihrer Schüler.«
McIntire wirkte noch immer unentschlossen und Mikes Herz begann vor Aufregung immer schneller zu klopfen. McIntire musste einfach ja sagen. Nach Winterfelds überraschendem Angebot würde er eine weitere Enttäuschung nicht überleben, da war er ganz sicher.
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, sagte Winterfeld. »Wenn ich mich nicht irre, wird der Schulbetrieb mit dem heutigen Abend sowieso eingestellt. Ich lade Sie, Michael und die vier anderen Schüler, von denen Sie erzählten, zu einem Besuch auf meinem Schiff ein. Sie können sich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass die Jungen dort sicher sind.«
»Ist das denn gestattet?«, fragte McIntire überrascht.
Winterfeld schüttelte den Kopf und grinste plötzlich so breit wie ein Schüler der dritten Klasse, der beobachtet, wie sein Lehrer sich auf den Schwamm setzt, den er auf seinen Stuhl gelegt hat. »Betrachten Sie es als einen Akt der Völkerverständigung«, sagte er. »In einer Zeit wie dieser können auch kleine Gesten große Dinge bewirken – und für Michael und die vier anderen ist es wenigstens ein kleiner Trost.«
McIntire zögerte noch immer, aber Mike spürte, dass sein Widerstand mit jeder Sekunde weiter bröckelte. Vermutlich fand auch er selbst die Vorstellung äußerst verlockend, Winterfelds mächtiges Kriegsschiff aus der Nähe sehen zu können. Mike wurde allein bei dem Gedanken schon fast schwindelig. Paul hatte ihm genug von der LEOPOLD erzählt, um ihn ganz kribbelig werden zu lassen. Welchem Jungen in seinem Alter hätte nicht auch das Herz höher geschlagen bei dem Gedanken, ein paar Tage auf einem richtigen Kriegsschiff zu verbringen? McIntire musste einfach ja sagen!
Und er tat es. »Also gut«, sagte er. Er drehte sich zu Mike herum. »Ich nehme die Einladung für mich und die Jungen an.«
»Prima«, sagte Winterfeld aufgeräumt, »dann schicke ich morgen früh einen Wagen. Sagen wir um neun Uhr?«, wandte er sich an McIntire.
Mike war über diese unerwartete erfreuliche Wendung der Dinge so aufgeregt, dass er vergaß, sich bei Pauls Vater zu bedanken. Sein Herz klopfte' noch immer heftig, als Paul und sein Vater gegangen waren und er wieder in sein Zimmer zurückkehrte.
Dass er in diesem Jahr nicht nach Indien reisen konnte, erwies sich plötzlich als unerwarteter Glücksfall. Indien, so gern er seine Heimat mochte, lief ihm nicht davon, wohl aber vielleicht die LEOPOLD.
Er erreichte sein Zimmer, trat ein – und blieb an der Tür stehen.
Irgendetwas war nicht so, wie es sein sollte.
Aufmerksam sah er sich im Zimmer um. Auf den ersten Blick schien alles zu sein wie vorhin, aber dann gewahrte er doch eine Anzahl kleiner Veränderungen: Eine Schublade des Schreibtisches war aufgezogen und nicht wieder völlig geschlossen worden, sodass ihre Kante einen Zentimeter über die Front des Möbels herausragte, der Brief lag ein wenig anders da als vorhin. Auf dem Regal über seinem Bett hatten zwei Bücher seit Wochen auf dem Kopf gestanden, jetzt standen sie richtig herum.
Dann sah er, dass sein Schrank halb offen stand. Er selbst hatte ihn gestern Abend abgeschlossen und der Schlüssel befand sich in seiner rechten Hosentasche, wie er mit einem raschen Griff feststellte.
Er musterte aufmerksam den Inhalt. Von den wenigen Dingen, die Mike für wert befunden hatte, eingeschlossen zu werden, fehlte kein einziges. Aber es war auch hier wie auf dem Schreibtisch oder dem Regal: Es gab winzige Veränderungen, die Mikes Verdacht endgültig zur Gewissheit machten. Jemand war hier gewesen und hatte seine Sachen durchsucht.
Mike drückte die Tür wieder zu und schloss sorgfältig ab. Wer um alles in der Welt mochte hier gewesen sein, und vor allem: warum? Er wusste natürlich, dass selbst hier schon Diebstähle vorgekommen waren, aber das war doch die Ausnahme – und außerdem besaß er rein gar nichts, was des Stehlens wert gewesen wäre. Er ging zum Schreibtisch, öffnete die Schublade, die ihm vorhin aufgefallen war, und es war dasselbe: Ganz offensichtlich hatte jemand seine Habseligkeiten durchsucht. Aber auch hier fehlte nichts.
Die Sache wurde immer rätselhafter. Trotzdem – es gab an diesem Tag nichts, was Mikes gute Laune wirklich hätte verderben können.
Der Wagen rollte am nächsten Morgen um Schlag neun die verschneite Zufahrt von Andara-House hinauf. Obwohl weder Paul noch sein Vater mitgekommen waren und es sich um einen sehr großen Wagen handelte, herrschte während der fast anderthalbstündigen Fahrt doch eine drückende Enge, denn außer Mike und seinen vier Kameraden hatten sich nicht nur McIntire, sondern auch noch Miss McCrooder zu ihnen gesellt, sodass sie alle froh waren, als sie endlich den Hafen erreichten und aussteigen konnten.
Natürlich war Mike der Erste, der vom Trittbrett des Wagens herunter in den braunen Morast sprang, in den sich der über Nacht gefallene Schnee verwandelt hatte, und beinahe wäre er auf dem schlüpfrigen Boden ausgeglitten und konnte sich nur im letzten Moment am Kotflügel des Wagens festhalten – was ihm nicht nur das schadenfrohe Gelächter seiner Kameraden, sondern auch ein missbilligendes Stirnrunzeln McIntires einbrachte. Aber das störte ihn im Moment herzlich wenig. Er grinste nur fröhlich, trat einen Schritt beiseite, um den anderen Platz zu machen, die hinter ihm aus dem Wagen herausdrängten, und zog den Kragen seiner pelzgefütterten Jacke enger zusammen, während er sich umsah.
Der Teil des Hafens, in den sie der Fahrer gebracht hatte, war eine einzige Enttäuschung: Zur Rechten des schmalen Kais, der mit aufgeweichtem schmutzigem Schnee bedeckt war, reihten sich eine Anzahl niedriger, schäbig aussehender Lagerschuppen, die zum Großteil nicht benutzt zu werden schienen – einige Fenster waren eingeschlagen oder mit Brettern vernagelt, manche der großen Rolltore standen offen, sodass man einen Blick in die leeren, dem Verfall anheim gegebenen Räume dahinter werfen konnte. Aus dem Schornstein eines Gebäudes vielleicht fünfzig Meter vor ihnen stieg weißer Rauch, und noch etwas weiter hinten war eine Anzahl Männer damit beschäftigt, einen Lastkarren zu entladen, davon abgesehen jedoch machte die Gegend einen ziemlich verlassenen Eindruck. Das Bild auf der anderen Seite war noch trostloser. Das Wasser der Themse schwappte träge gegen den Kai und statt der erwarteten Ozeanriesen schwammen nur einige Abfälle auf den braunen, öligen Wellen.
»Nun, wo ist denn dein famoses Schlachtschiff?«, hörte er Juans Stimme hinter sich fragen.