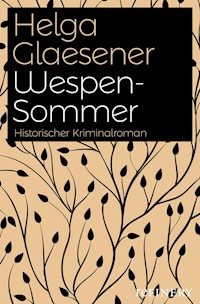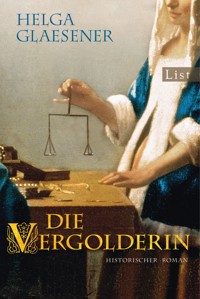
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Braunschweig, 1604: Auf der Flucht vor Plünderern wird Elisabeth von einem geheimnisvollen Blinden gerettet. Er weckt tiefe Gefühle in ihr, obwohl sie einem anderen versprochen ist. In Braunschweig arbeitet sie heimlich als Vergolderin. Ihr Geschick bringt ihr viele Aufträge, aber auch den Zorn der Zunft ein, denn Frauen ist das Handwerk untersagt. Als der Gildemeister davon erfährt, droht Elisabeth die Hinrichtung. Da begegnet sie ihrem Retter wieder. Kann er ihr erneut helfen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Elisabeth Weißvogel hat ihren eigenen Kopf, und der bringt sie immer wieder in Gefahr. Seit dem Tod ihrer Eltern muss sie für ihre beiden Geschwister sorgen. Von ihrem Vater hat sie das Vergolden gelernt. Sie ist eine Meisterin im kunstvollen Fertigen von Goldrahmen und Figuren, die sie an der Gilde vorbei von ihrem Geliebten Berthold verkaufen lässt. Die Öffentlichkeit darf nichts davon erfahren, denn Frauen ist diese Arbeit nicht erlaubt.
Elisabeth liebt dieses anspruchsvolle Handwerk und träumt davon, eines Tages ihr Talent nicht mehr verstecken zu müssen. Doch die herrschenden Männer in Braunschweig haben nichts übrig für die Träume der jungen Frau.
Doch dann gerät Elisabeth zwischen zwei verfeindete Brüder. Einer ist ein wohlhabender Kaufmann, der andere ein mächtiger Gildemeister. Gegen ihren Willen wird sie immer tiefer in die Familienfehde hineingezogen. Ihr kleiner Bruder soll plötzlich ein Dieb sein und sie selbst eine Hure. Versucht ihre Schwester, sie aus Neid ans Messer zu liefern?
Elisabeths Leben liegt in Scherben, und nur ein Wunder kann ihr noch helfen.
Die Autorin
Helga Glaesener, Jahrgang 1955, wurde in Niedersachsen geboren und studierte in Hannover Mathematik. Im Trubel ihrer fünfköpfigen Kinderschar begann sie 1990 mit dem Schreiben historischer Romane, von denen gleich der erste Titel zum Bestseller avancierte. Seitdem veröffentlichte sie in den Genres Historisches, Krimis und humorvolle Frauenliteratur zahlreiche Bücher. Außerdem arbeitet sie als Tutorin bei der Fernuniversität Studiengemeinschaft Darmstadt, wo sie angehenden Autoren die Kniffe des Handwerks verrät. Sie lebt seit 2010 in Oldenburg.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.helga-glaesener.de
Von Helga Glaesener sind in unserem Hause bereits erschienen:
In der Serie Die Toskana-Trilogie:
Wespensommer · Wölfe im Olivenhain · Das Findelhaus
In der Serie Die Thannhäuser-Trilogie:
Der indische Baum · Der Stein des Luzifer
Weitere Titel der Autorin: Die Rechenkünstlerin · Der singende Stein · Du süße sanfte Mörderin · Im Kreis des Mael Duin · Safran für Venedig · Die Safranhändlerin · Wer Asche hütet
Helga Glaesener
Die Vergolderin
Historischer Roman
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Wir danken dem Stadtarchiv Braunschweigfür die Abdruckgenehmigung des Stadtplans von 1606.
ISBN 978-3-8437-0494-6
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch 1. Auflage November 2012 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2011/List Verlag Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München, unter Verwendung einer Vorlage von ZERO Werbeagentur Titelabbildung: © Woman Holding a Balance, c.1664 (oil on canvas), Vermeer, Jan (1632–75)/National Gallery of Art, Washington DC, USA/Bridgeman Berlin Stadtplan: Stadtarchiv Braunschweig, Stadtplansammlung (HXI 2:2)
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
eBook: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Für Michi, der weiß, wie man eine erschöpfte Schriftstellerin aufmuntert und der phantastische Rezepte gegen die berüchtigte Schreibhemmung kennt.»Sehr viel Eis« hat sich dabei als Knüller rausgestellt.Danke, Michi!
Prolog
In der Nähe von Blasheim, Dezember 1602
Maria Weißvogel erwachte von ihrem eigenen Husten, und wie immer in den letzten Tagen hatte sie einen schrecklichen Moment lang das Gefühl zu ersticken. Halb noch im Schlaf, wälzte sie sich auf dem Stroh, das feucht und verklebt den Boden bedeckte. Schleim verstopfte ihre Lungen, und die Anstrengung, ihn fortzuhusten, trieb ihr Hitzeschauer über den Rücken. Ihre Finger tasteten über vertrockneten Tierkot und dann über das mit Lehm verschmierte Flechtwerk des Schafstalls, als sie sich aufrichtete. Erstes Morgenlicht fiel durch die offen stehende Tür.
Ihr Mann war offenbar schon aufgestanden. Sie schaute zu den Kindern, die dicht aneinandergedrängt unter der zweiten Decke schliefen. Die blonden Haare ihrer beiden erwachsenen Töchter waren unter Hauben versteckt, aber Christian, ihr zehnjähriger Bub, lag wie in einem goldenen Glorienschein. Mein Christuskind, dachte sie, und einen Moment lang verdrängte Zärtlichkeit ihre Schmerzen. Doch dann krümmte sie sich unter einem noch schlimmeren Hustenanfall, und jedes weiche Gefühl verging. Sie legte die Hand auf den Mund, um das Geräusch zu dämpfen, und trat mit der Decke um die Schultern in den Morgen hinaus.
Vor ihr, unter einer glitzernden Schneedecke, breitete sich ein Feld aus. Jenseits des weißen Lakens wuchs ein Wald. Die schwarzen Baumspitzen zeichneten sich wie Tintenstriche gegen den rosafarbenen Himmel ab. Das sieht schön aus, dachte sie, aber sie war zu erschöpft, um über die reine Feststellung hinaus noch Freude zu empfinden. Als sie die Decke fester um sich zog, sah sie, dass ihre Hand rot verschmiert war. Sie hustete Blut. Schon seit Tagen.
Stirnrunzelnd blickte sie zu der Brandruine, die einen Steinwurf entfernt am Feldrand lag. Eine ehemalige Scheune, in die der Blitz eingeschlagen war. Hatte August sich dorthin verkrochen? Zumindest wiesen die Spuren im Schnee in diese Richtung.
Dreiundsiebzig Tage, dachte sie, und plötzlich überwältigte sie Verzweiflung. Vor dreiundsiebzig Tagen hatte man sie aus Osnabrück vertrieben. Seit dreiundsiebzig Tagen irrte sie mit August und den Kindern durch ein feindseliges Land, in dem man sie mit Abfall und Steinen bewarf, in dem sie hungerten, froren, litten und zu Gesindel verkommen waren. Einen Moment lang hasste sie ihren Mann für das, was er ihnen angetan hatte. Schleppenden Schrittes folgte sie den Spuren im Schnee.
Sie hatten den Bauern nicht gefragt, ob sie in seinem Schafstall übernachten durften. Es war Heiligabend, und aus irgendeinem Grund hätte Maria es richtig gefunden, um Erlaubnis zu bitten, und sie glaubte auch, dass sie sie bekommen hätten und vielleicht sogar etwas zu essen. Aber August war dagegen gewesen. Er drückte sich vor allem, was Schwierigkeiten verhieß. Lieber litt und darbte er, als zu kämpfen. Immer noch hustend, rätselte sie, was ihn von dem bisschen Wärme, das ihr Körper ausstrahlte, zur Scheune getrieben haben mochte.
Die Brettertür quietschte, als Maria sie öffnete. Das bleiche Morgenlicht fiel durch das offene Dach und beschien den hinteren Teil der Ruine, wo der Schnee wie ein Leichentuch Mist und nasses Stroh bedeckte. Sie sah mit einem Blick, dass die Scheune leer war. Müde ging sie noch einige Schritte, dann sackte sie auf einen umgestürzten Holzklotz. Heute ist Weihnachten, dachte sie wieder, und der Gedanke an die Stube, in der sie im vergangenen Jahr gemeinsam gegessen hatten, schnürte ihr die Kehle zu.
Damals waren sie noch geachtete Leute gewesen, eine Goldschmiedefamilie, die zwar keine Reichtümer besaß, aber ihr Auskommen hatte. Dann war August zum Fälscher geworden. Er hatte für eine Kette statt Goldreifen mit Gold überzogene Kupferringe benutzt. Der Betrug war aufgeflogen, und nach einer schändlichen Verhandlung vor dem Gildegericht war ihrem Mann das Stadtrecht abgesprochen worden und man hatte ihm auf ewig jede Goldschmiedetätigkeit verboten. Ausgepeitscht hatten sie ihn auch.
Maria verbot sich, weiter darüber nachzudenken. Wenn sie diese Bilder in ihren Kopf ließ – ihr blutüberströmter, nackter Mann, die Bürger, die sie bespuckten und mit allem nach ihnen schlugen, was sie zu fassen bekamen, das Weinen ihrer Kinder, die mitleidigen Blicke einiger weniger wohlwollender Nachbarn –, dann nahm ihr die Scham das letzte Restchen Luft.
Sie bückte sich zur Seite, um mit etwas Schnee das Blut von der Hand zu waschen, richtete sich wieder auf, wollte zur Tür zurück – und erstarrte. Über dem Türbalken hingen zwei löchrige Stiefel. Einen Moment lang war sie wie gelähmt. Ihr Blick wanderte wie unter Zwang von den Stiefeln zu einer zerlumpten Hose hinauf und dann zu einem Gürtel und einem löchrigen Wams, aus dem nackte Arme baumelten.
August starrte auf sie herab. Seine Augen, die aus den Höhlen quollen, gaben ihm ein vorwurfsvolles Aussehen. Siehst du, was du angerichtet hast? Wohin du mich mit deinen Vorwürfen und deiner Besserwisserei getrieben hast?
»Mutter?«
Maria fuhr zusammen. Sie wollte die schlanke Gestalt, die durch das Scheunentor trat und sich suchend umblickte, ins Freie zurückstoßen, aber ihr fehlte die Kraft. »Elisabeth …«
»Was ist denn?«
Maria schwankte. Rasch fasste Elisabeth zu, stützte sie und half ihr vorsichtig zu Boden. Das Kleid des Mädchens war zerrissen, ihr Gesicht verdreckt und einer der Mundwinkel blutig eingerissen, aber als ihr die Haube von den Haaren rutschte und das goldblonde Haar um das zarte Gesicht quoll, zeigte sich plötzlich wieder ein Schein ihrer alten Schönheit, die die Burschen in Osnabrück um den Verstand gebracht hatte. Voller Zärtlichkeit und Verzweiflung zugleich dachte Maria: Wie konnte Gott ihr das antun? Wie konnte er ein so schönes Kind mit so viel Unglück bedenken?
Elisabeth zog ihr die Hand vom Mund und schaute nüchtern auf die rote Schmiere. »Das ist Blut.«
»Nicht weinen«, flüsterte Maria.
Aber Elisabeth weinte gar nicht. Stattdessen zog sie die Decke fester um die Schultern ihrer Mutter. »Wir brauchen einen Arzt«, sagte sie ruhig. Nur konnten sie den nicht bezahlen. Nicht einmal eine der Kräuterfrauen, auf die sie gelegentlich in den Wäldern stießen. Das wussten sie beide.
Dann entdeckte auch Elisabeth die baumelnde Leiche. Sie sagte nichts, aber ihr heftiges Keuchen zeigte, wie der Anblick sie schockierte. Beide starrten auf den toten Körper. »Er hat sich wie immer den leichtesten Weg ausgesucht«, sagte das Mädchen schließlich bitter. Und dann: »Wir brauchen trotzdem einen Arzt, Mutter.«
Maria zog ihre Tochter an sich. Sie glühte vor Fieber, jede einzelne Faser ihres Körpers tat weh, und in ihr breitete sich eine Schwäche aus, die nichts mehr mit dem Hunger zu tun hatte, an dem sie litten. Sie wusste, dass sie sterben würde, wahrscheinlich schon bald.
»Hör zu, Kind«, flüsterte sie. »Ihr müsst nach Braunschweig gehen, zu eurem Großvater, zu Franz Weißvogel. Er hat seinen Sohn, euern Vater, nicht leiden können, aber er ist der einzige Verwandte, der euch geblieben ist, und vielleicht hat er ja seinen Enkelkindern gegenüber ein weicheres Herz. Ihr müsst ihn aufsuchen und um Hilfe bitten.«
Maria spürte, wie der Körper ihrer Tochter steif wurde, als ahnte sie bereits, was für eine Bürde ihr auferlegt werden sollte. »Dann bringt uns dorthin.«
Marias Stimme wurde weicher, als sie weitersprach. »Wenn ich’s doch nur könnte. Deine Schwester …« Sie stockte. Der Herr hatte es für gut befunden, ihre Töchter unterschiedlich zu erschaffen. Sie liebte sie beide, musste sich aber mit schlechtem Gewissen eingestehen, dass Elisabeth ihr näher stand. Lissi war nicht nur hübsch. Sie besaß auch eine besondere Herzenswärme und Fröhlichkeit und einen Schwung, der überall, wohin sie kam, gute Laune verbreitete.
Marga war völlig anders. Obwohl nicht hässlich, hatte sie etwas Griesgrämiges. Sie krittelte herum und belehrte und kommandierte ihre Umgebung, und wenn jemand bei August wegen einer Hochzeit vorgefühlt hatte, so hatten sich die Gespräche fast immer um Elisabeth gedreht. Maria wusste um den tiefen Neid, den Marga ihrer Schwester gegenüber verspürte. Sie seufzte.
»Mutter?« Elisabeth schüttelte sie vorsichtig. »Wir können nicht bleiben. Es wird bald Tag. Wenn man uns erwischt …«
»Ich werde sterben.«
Elisabeth schüttelte den Kopf. »Nein! Ich koche Wasser. Sobald Ihr etwas Warmes …«
»Und du wirst für Marga und Christian sorgen müssen.«
Elisabeth ließ sie los. Sie stand auf, und es dauerte mehrere Augenblicke, ehe sie wieder sprach. »Und wer beschützt mich?« Ihre Stimme brach vor Bitterkeit, und Maria ging auf, dass das Bild der Stärke, das sie von Lissi hatte, längst nicht mehr stimmte. Der Hungerwinter hatte an ihrer Tochter wie an ihnen allen gefressen. Kein Wunder. Wie oft hatte sie an die Türen der Bauernhäuser geklopft und war beschimpft und von Hunden über die Wiesen gehetzt worden. Wie oft hatten sich Kerle an sie herangemacht, als wäre sie ein Abfall, auf den jeder Anspruch erheben konnte. Sie hatte auf ihre eigene Art darauf reagiert, indem sie misstrauisch und hart wurde. Wenn ihr überhaupt noch ein Scherz über die Lippen kam, dann klang er gallig.
Madonna, warum hat August ihr nicht erlaubt, Berthold Stammer zu heiraten?, dachte Maria mit einem zornigen Stich im Herzen. Dann wäre sie verheiratet gewesen, als man August beim Fälschen erwischte, und sie hätte in Osnabrück bleiben und vielleicht sogar die Geschwister aufnehmen können.
Sie verbarg ihre Gefühle und strich über die Hand ihrer Tochter. »Du bist stark, Elisabeth, und das ist eine Gnade des Himmels. Versündige dich nicht am Allmächtigen.«
»Wir werden mit oder ohne meine Stärke verhungern«, sagte Elisabeth rau.
»Du darfst nicht so reden!«
»Uns schleicht einer hinterher. Schon seit zwei Tagen. Ein Mann mit einem ausgeschlagenen Auge. Wenn er sieht, dass Vater fort ist …«
»Dann müsst ihr eben schauen, dass ihr fortkommt. Ihr geht nach Braunschweig«, unterbrach Maria sie, jetzt mit Schärfe. »Und nun komm. Wir schneiden Vater vom Strick. Was auch immer er verbrochen hat, er soll ein christliches Begräbnis erhalten, und deshalb muss es so aussehen, als hätte ihn die Kälte …«
»Er hat sich erhängt. Wie kann’s dann christlich sein? Lässt Gott sich denn so leicht aufs Glatteis führen?«
»Bitterkeit ist weder ein Schmuck noch ein Schutz. Hilf mir, Kind!«
Es kostete Mühe, den Leichnam, der bereits steif wurde, auf den Boden zu holen. Elisabeth benutzte dazu eine Leiter, die sie in einer Ecke der Scheune fand. Sie war es auch, die anschließend den Kälberstrick vom Balken zog, an dem August sich erhängt hatte. Maria hätte ihr gern die Last abgenommen, den Toten auch noch hinauszuschleppen, aber sie hätte nicht einmal seine Stiefel tragen können, so schwach war sie.
Elisabeth war klug genug, den Leichnam einige Schritt weit in der Spur zurückzutragen, die sie hinterlassen hatten. Erst dann ließ sie ihn in den Schnee fallen. Als sie zu ihrer Mutter zurückkehrte, blickte sie sich kein einziges Mal nach ihm um. »Wir wollen also nach Braunschweig?«
Maria lehnte sich gegen die Scheunenwand. »Noch eines«, sagte sie. »Gott hat dir nicht nur ein starkes Herz, sondern auch geschickte Hände und den Blick einer Künstlerin gegeben. Das ist sein zweites Geschenk an dich, Elisabeth. Du bist eine begabte Vergolderin. Vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe.«
Ihre Tochter starrte an ihr vorbei auf die Scheunenwand.
»Und lass nicht zu …«, dass dein Herz hart wird, hatte Maria sagen wollen, aber sie brachte es nicht über sich. Jede Grausamkeit, jede Gemeinheit, die ihre Tochter erlebt hatte, hatte sich wie eine Schicht Eis um ihr Herz gelegt. Wie konnte man ihr befehlen, diese Schicht schmelzen zu lassen, war sie doch vielleicht das einzige, was sie davor bewahrte, zu zerbrechen.
»Du musst mir etwas schwören, Elisabeth. Jetzt. Auf das Kreuz an meinem Hals, damit ich in Ruhe sterben kann.« Sie griff nach der schmalen, warmen Hand und legte sie auf das heilige Schmuckstück. »Schwöre mir, dass du Marga und Christian beschützt. Dass du sie nach Braunschweig in ein gottgefälliges Leben zurückbringst. Schwöre mir das.«
Eins
Siebzehn Monate später
Hans Lippold war Hauptmann einer dreißigköpfigen Räuberbande, die sich auf das Brandschatzen einsam gelegener Höfe und auf Kirchendiebstähle spezialisiert hatte. Über Monate hinweg hatte er die Landjäger, die ihn fangen wollten, abgeschüttelt, und als Krönung seiner Untaten hatte er die Tochter des Alfelder Bürgermeisters entführt, sie zu seiner Räuberhure gemacht und sie geschwängert. Aber dann war ihm der Boden unter den Füßen zu heiß geworden, und nun hatte man ihn in der Nähe von Braunschweig gesichtet, wo er sich angeblich niedergelassen hatte.
Hier, irgendwo hier, dachte Elisabeth und hatte Mühe, gegen die Furcht anzukämpfen, die ihr die Brust umklammerte. Am Himmel funkelten Sterne, die sie aber kaum wahrnahm. Sie eilte, eingehüllt in ihren Mantel, einen einsamen Weg entlang, der östlich des Braunschweiger Landwehrwalls durch einen Wald führte. Seit einer halben Stunde hatte sie kein Gebäude mehr zu Gesicht bekommen.
Braunschweig war groß, und die Wälder und Äcker, die die Stadt umgaben, schier unüberschaubar. Kaum anzunehmen, dass sie den Mordgesellen hier begegnen würde. Trotzdem konnte sie die Gedanken an Lippold und seine Bande nicht verdrängen. Vor allem wegen der Knöchelchen. Marga hatte das Gerücht vom Markt mitgebracht und brühwarm weitererzählt: Lippold hatte die Kinder, die ihm die Bürgermeistertochter gebar, erwürgt und ihre Leichen in die Baumkronen gehängt. Wenn dann der Wind durch ihre Gebeine fuhr und an den Knöchelchen riss, hatte er zu der unglücklichen Mutter gesagt: Hör nur, wie unsere Kindlein singen. Dieser schreckliche Satz hatte sich in Elisabeths Hirn eingebrannt. Hör nur, wie unsere Kindlein singen. Marga hatte ihn mehrere Male wiederholt, so empört war sie gewesen. Und nun war es, als wimmerten die dünnen Stimmchen im Geäst und als jammerten sie aus sämtlichen Büschen. Stumm verfluchte Elisabeth Margas Neigung zu Schauergeschichten. Ging sie diesen Weg nicht schon zum fünften Mal? Und noch nie hatte sie etwas Unheimlicheres gesehen als einen Wolf oder Fuchs, die flohen, sobald sie ihrer ansichtig wurden. Knöchelchen!
Sie zwang sich, ihre Aufmerksamkeit auf den Weg zu richten. Das Mondlicht machte Äste, Bodensenken und Teile des Gebüschs am Wegrand sichtbar. Sie sah kleines Getier vorbeihuschen, und konnte, wenn das Licht günstig fiel, sogar einzelne Blätter im schwarzen Buschwerk erkennen. Der Landwehrwall, das Verteidigungswerk, das die Stadt in einem großzügigen Abstand von mehreren Meilen umringte, tauchte immer wieder zwischen den Bäumen auf. Im Grunde war dieses Stück Wald sicherer als die Braunschweiger Gassen, in denen es von Beutelschneidern nur so wimmelte.
Unbewusst tastete ihre Hand nach der Brust. Denn das war die andere Sache. Sie trug etwas unter dem Mieder, das einen Mann wie Lippold sofort auf ihre Fersen gesetzt hätte: Blattgold – fünfzehn hauchdünn gehämmerte Quadrate, sechs mal sechs Zoll groß, die in einer flachen Holzschachtel steckten.
Berthold Stammer, der Mann, den sie liebte, war aus Osnabrück nach Braunschweig geritten und hatte ihr heimlich diesen Schatz zugesteckt. Denn er hatte sich nicht von ihr losgesagt – trotz der Schande, die Vater über sie gebracht hatte. Nachdem Großvater sie aufgenommen hatte, hatte sie ihm eine Nachricht übermitteln können, wo sie jetzt wohnten, und da war er gekommen. Und hatte ihr angeboten, ihr Gold zu überlassen, um damit Spiegelrahmen zu verzieren. Diese Rahmen verkaufte Berthold weiter und gab ihr den Gewinn. Elisabeth sparte die Münzen, um Christian, ihrem Bruder, eine Lehre bezahlen zu können. Und – wer weiß – vielleicht sogar Marga eine Mitgift. Du kannst dich auf mich verlassen, Mutter!
Sie lächelte einen Moment und klopfte auf die Holzschachtel. Nicht weit entfernt – kurz vor dem Gliesmaroder Tor – hatte ein Feuer einen Teil der Dornenhecke niedergebrannt, die den Landwehrwall schützte. Dort würde sie sich hindurchzwängen. Dann würde der Torwächter, den sie mit einigen Pfennigen bestochen hatte, sie in die Stadt zurücklassen. Und in spätestens einer Stunde – lange bevor Großvater und die anderen erwachten – war sie wieder zu Hause.
Während sie noch diesem erfreulichen Gedanken nachhing, drang plötzlich ein Schrei durch den Wald. Ein schrilles Geräusch, das die Nacht durchschnitt und sich anhörte, als brüllte ein Mensch in höchster Not oder größtem Schmerz auf. Sie blieb wie angewurzelt stehen und horchte. Aber der Schrei war schon wieder verklungen, und einen Moment fragte sie sich, ob sie ihn sich wie das Singen der Säuglingsknochen nur eingebildet hatte. Nervös zog sie die Kapuze ihres schwarzen Wollmantels über die blonden Haare.
Und dann hörte sie etwas, das viel schlimmer als ein Schrei war. Nämlich Männerstimmen, die sich ihr von einem Seitenweg aus näherten.
Rasch flüchtete sie ins Unterholz. Sie kauerte sich hinter einen Busch voller Blätter und Dornen, raffte mit hämmerndem Herzen den schwarzen Mantel um ihr Kleid, bis er den helleren Stoff bedeckte, und wartete. Fieberhaft suchte sie mit den Augen die Dunkelheit ab. Aber nichts rührte sich, und auch das Gespräch war wieder verstummt. Vielleicht hatten die Männer einen anderen Weg eingeschlagen? Sie biss sich auf die Lippe, duckte sich noch tiefer und versuchte sich vorzustellen, was die Leute um diese Zeit in den Wald geführt haben mochte. Nichts davon gefiel ihr. Lippold? War es vielleicht wirklich Lippold?
Sie merkte, wie ihre Füße zu kribbeln begannen. Wie spät es wohl war? Die Wache des Mannes, den sie bestochen hatte, endete um Mitternacht. Wenn sie ihn verpasste, würde sie erst am Morgen nach Hause zurückkehren können. Und dann setzte es Fragen, die sie lieber nicht beantworten wollte. Die Männer waren fort, nicht wahr?
Umständlich richtete sie sich wieder auf, rieb den eingeschlafenen Fuß an der Wade und kehrte auf den Pfad zurück. Niemand war zu sehen, keine Menschenseele weit und breit. Sie lächelte verzerrt. Vorsichtig folgte sie dem Weg, bis er eine Biegung machte. Und zauderte erneut. Baumkronen verdeckten hier den Himmel, und das Stück Weg, das vor ihr lag, was stockdunkel. Vergeblich versuchte sie, die Finsternis mit den Augen zu durchdringen. Und dann waren die Stimmen plötzlich wieder da, und zwar hinter ihr und dieses Mal so nah, als säßen ihr die Kerle direkt im Nacken. Elisabeth flüchtete ins Unterholz zurück, blieb aber nicht stehen, sondern rannte weiter.
»Hey, da ist er!«, hörte sie jemanden schreien.
»Los, hinterher. Dreckskerl! Wir kriegen dich!«, brüllte eine böse, tiefe Stimme.
O Herrgott, lass das nicht zu, erbarme dich … Ihr Mantel verfing sich im Gestrüpp, und sie musste daran reißen, um weiterzukommen. Zweige brachen unter ihren Füßen, und die Blätter raschelten wie Seidenkleider. Sie machte einen Höllenlärm. Der Wald schien plötzlich lebendig geworden zu sein. Die Sträucher schnappten nach ihren Kleidern, und Luftwurzeln brachten sie zum Stolpern.
»Ich ss…eh nichts«, rief einer ihrer Verfolger.
Sie erstarrte und drehte den Kopf. Ohne dass sie es bemerkt hatte, war einer der Männer ihr bedrohlich nahe gekommen.
»Und ich sag: Er ist hier! Ein Gulden obendrauf für den, der ihn schnappt.«
»Und zwei für den, der ihm die Kehle durchschneidet.« Das war wieder die tiefe, böse Stimme. »Ist deine Schuld! Wir hätten nur warten müssen!«
»Scheiß drauf!«
»Ja, schsch…eiß, aber ohne den geh ich nicht zurück, das ssag ich euch. Hitzel wwwird wütend, wenn wir ihm sagen, dass er uns durch die Lappen ist. Hhhört ihr was?«
Elisabeth konnte kein Glied rühren. Eine Welle aus Angst spülte durch ihren Körper. Die Männer waren mindestens zu dritt. Und wenn sie sie einkreisten? Und wenn das vielleicht schon geschehen war? Ihr Kopf flog herum, aber hier im Unterholz, unter den dichten Laubkronen, war es so dunkel, dass sie nichts sehen konnte, was weiter als eine Armlänge entfernt war. Sie stand bis zu den Waden in den verrottenden Blättern. Es war unmöglich, einen lautlosen Schritt zu tun. Sollte sie sich einfach niederducken? Doch selbst das würde jemand, der lauschte, hören. Halb verrückt vor Angst, wollte sie ihren Mantelstoff von einem Dornenzweig befreien, in dem er sich verhakt hatte. Sie zupfte am Stoff …
Und wurde am Arm gepackt.
Wären ihre Kiefer nicht im Bemühen, jeden Laut zu unterdrücken, völlig verkrampft gewesen, hätte sie jetzt wohl aufgebrüllt. Die Hand zog sie mit festem Griff einige Schritte weit in eine noch tiefere Dunkelheit. »Psst.« Jemand presste sie an sich und umschlang sie mit beiden Armen, jedoch ohne ihr dabei weh zu tun. Sie musste in eine Höhle geraten sein.
»Ich hab ihn gesehen, verdammt. Gerad eben noch.« Das war die dunkle, böse Stimme.
Der Stotterer lachte. »Oo…der des Teufels Großmutter.«
»Halt die Schnauze!«
Blätter raschelten. Elisabeth hielt den Atem an. Um sie herum roch es nach Feuchtigkeit und Erde, nach Urin und Stalldreck. An ihrer Hand klebte etwas wie Spinnweben. Aus den Augenwinkeln sah sie einen Spalt, der eine Winzigkeit heller als der Rest ihrer Umgebung war – den Zugang zu der Höhle, in die man sie gezogen hatte.
»Nun lärmt doch nicht so!«, fauchte die dunkle, böse Stimme.
»Aa…ber vielleicht …«
»Er kann nicht weit sein. Wir müssen horchen«, wurde der Stotterer angeblafft.
Der Mann, der Elisabeth festhielt, roch schwach nach Parfüm. Sein Wams war weich – vielleicht aus Samt, dachte sie. Er schien mit den anderen nichts zu tun zu haben. Ein Retter. Ein von Gott gesandter Engel, dachte sie, und musste an sich halten, nicht nervös aufzulachen. Gott sandte seine Engel nicht zu gewöhnlichen Menschen. Und gewiss nicht zu einer wie ihr, die den eigenen Vater hasste und den Großvater, der sie aufgenommen hatte, fast ebenso. Nein, es musste sich um einen Kaufmann handeln, oder einen ähnlich reichen Menschen, den die Strauchdiebe überfallen hatten. Er hatte sich hierhergeflüchtet, und die Männer hatten ihn verfolgt. Und sie selbst war dummerweise zwischen die Fronten geraten. Gott, lass nicht zu, dass ich hier sterbe …
»Ich weiß, dass er hier ist«, murrte die dunkle, böse Stimme schließlich. »Er war vor mir. Ich hatt ihn so gut wie gekrallt, den Scheißer!«
»Du hättest ihn gar nicht erst entkommen la…assen dürfen«, mäkelte der Stotterer. »Hi…itzel wird das nicht …«
»Hörst du?«
Der Stotterer musste nicht fragen, was sein Kumpan meinte. Wieder gellte ein Jammerlaut durch die Nacht.
»Er lässt den Kutscher brennen«, hauchte einer der Männer.
»A…aaber das muss er nicht. Wir ha…am doch alles, was wir wolln.«
Die böse Stimme lachte. »Er tut’s auch nicht, weil er muss, sondern weil’s ihm Spaß macht, du Ratte!«
»A…aaber er muss doch gar nich!« Der Stotterer klang, als wollte er in Tränen ausbrechen. Die Männer waren jetzt so nah herangekommen, dass ihre Körper den Eingang verdunkelten. Ein schieres Wunder, dass ihnen der Spalt verborgen blieb.
»Wenn du keinen Ärger willst«, flüsterte die dunkle, böse Stimme hämisch, »dann sag ihm in dieser Stimmung lieber nich, was er muss oder nicht muss.«
Ein weiterer Schrei. Dieses Mal schien er gar nicht mehr enden zu wollen. Er wurde schriller und immer qualvoller, und Elisabeth krallte die Finger in den Samt des Fremden. »Psst«, flüsterte der Mann, es war nur ein Hauch in ihrem Haar. Er drehte behutsam ihr Gesicht und drückte ihr Ohr gegen seine Brust, so dass der Schrei zwischen seiner Hand und dem Stoff seiner Kleider verklang. Sie spürte den Schlag seines Herzens und seine Finger, die beruhigend über ihren Kopf strichen.
Der Schrei war doch nicht verstummt. Mit einem Mal hörte Elisabeth ihn wieder, aber auf seltsame Weise. Er kam jetzt nicht mehr von außen, sondern schien durch ihren Kopf zu gellen. Und plötzlich sah sie auch die Bilder eines Mannes, den man verbrannte. Eine Puppe, die in einem Scheiterhaufen hüpfte. Einen roten, mitleiderregenden Feuertänzer.
»Psst«, hauchte der Fremde und strich durch ihr Haar …
Als Elisabeth ihre Umgebung wieder bewusst wahrzunehmen begann, saß sie auf einem steinigen, unebenen Boden, mit dem Rücken gegen eine Felswand gelehnt. Morgenlicht fiel in einem dünnen Strahl auf den Boden vor ihren Füßen und beschien schwarze Krümel – wahrscheinlich Mäusedreck. Eine Zeitlang war sie zu benommen, um sich zu erinnern, wo sie war. Dann fiel ihr die Nacht wieder ein, und ihr Magen verkrampfte sich. Und von einem Moment auf den nächsten war alles wieder da: der Feuertänzer … die Schreie … seine zuckenden Glieder in den Flammen …
Entsetzt presste sie die Fäuste auf die Ohren, aber das half überhaupt nichts. Es war, als hätte sich der Schrei in ihrem Kopf gefangen. Als hätte man einen Vogel vom Himmel geholt und in einen Käfig gesperrt. Und die Stäbe des Käfigs bestanden aus brennenden Menschen.
Jemand sprach. Es dauerte eine Weile, bis sie es überhaupt merkte. Der Mann. Der Mann, der sie in die Höhle gezogen hatte. »Alles gut?«
Der Klang seiner Stimme vertrieb die Schreie. Auch die Bilder verblassten.
»Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Die Kerle sind fort, schon vor Stunden, noch in der Nacht. Niemand wird dir etwas tun.«
Elisabeth nahm die Hände von den Ohren, biss auf ihr Daumengelenk und starrte auf ihre schwarzen Schnürschuhe und den Saum ihres Mantels, der sich über den Schuhen kräuselte. Sie hätte sich gewünscht, dass der Mann mit seiner tiefen, beruhigenden Stimme weitersprach, aber er fand offenbar, dass alles gesagt war. Heilige Jungfrau, ich danke dir. Sie flüsterte hastig ein Gebet. Gott hatte sie erhört. Sie lebte. Sie hatte das entsetzliche Ereignis der vergangenen Nacht heil überstanden.
Ihre Blicke wanderten durch die Höhle. Nicht alle Wände waren aus Fels. Über ihr hatten sich Baumwurzeln durch Erde gebohrt. Ein in Jahrhunderten entstandenes natürliches Versteck. Möglicherweise hausten hier Eulen, denn zwischen dem Mäusedreck lagen Federn und Gewölle. Sie rappelte sich steif auf und wischte den Schmutz von ihren Kleidern.
Der Mann hatte sich mit dem Rücken zu ihr an den Fels am Höhleneingang gelehnt und schaute ins Freie. Sie starrte auf seinen Hinterkopf. Er hatte dichtes, braunes, lockiges Haar, das er etwas länger trug, als es Mode war. Über dem schwarzsamtenen Wams hing ein weißer Spitzenkragen, und auch aus den Ärmeln quollen feinste Spitzen, die aber zerrissen waren. Er sah gut aus, nicht nur wegen seiner feinen Kleider. Die meisten Mädchen hätten sich nach ihm umgeschaut. Außer, sie haben ein Jahr lang auf der Straße gelebt und mitbekommen, was sich hinter dem Äußeren verbirgt, dachte Elisabeth bitter. Wie die Kerle waren, wenn sie sich einer Frau gegenübersahen, die keinen Beschützer an der Seite hatte. Berthold war anders, zum Glück. Doch die meisten Männer … »Ihr hättet mich wecken können«, sagte sie spröde.
Der Fremde rührte sich nicht.
Verstohlen griff Elisabeth nach ihrer Holzschachtel. Sie befand sich immer noch unter dem Mieder, wie sie erleichtert feststellte. Das war das Wichtigste. Sie hatte ihr Gold behalten. Der Mann, den sie gebrannt hatten, tat ihr leid, aber er ging sie nichts an. Nach dem Winter auf der Straße ging sie überhaupt nichts mehr etwas an, außer Marga, Christian und sie selbst. Und wem das hartherzig vorkam, der wusste eben nicht, wie es im Leben zuging.
Zögernd trat sie neben den Fremden. Hatte er sie vor dem Tod bewahrt? Oder hatte er nur versucht, sich selbst einen Vorteil zu verschaffen, als er sie in die Höhle zog? Widerstrebend gestand sie sich ein, dass er ihr wohl hatte helfen wollen. Wenn das Raubgesindel sie erwischt hätte, hätten sie ihn vielleicht in Ruhe gelassen. Ich muss ihm danken, dachte Elisabeth. Aber sie hasste Dankbarkeit. Dankbar sein zu müssen hieß, einzugestehen, dass man schwach gewesen war, und wer schwach war, ging unter. Das war eine weitere Lehre, die sie aus dem Hungerwinter gezogen hatte.
»Danke«, stieß sie hervor.
Der Mann lächelte kurz, schaute sie dabei aber nicht an. Sein Blick hing an den Büschen, die im Morgentau glänzten und wahrhaftig nichts boten, das irgendein Interesse gerechtfertigt hätte.
Elisabeth räusperte sich. »Der, den sie … den sie gebrannt haben … Er ist wohl tot?«
»Das wünsche ich ihm.«
Elisabeth blickte in sein Gesicht. Der Fremde hatte einen Grund, die Haare länger als üblich zu tragen. Über seine linke Gesichtshälfte zog sich Narbengewebe, wohl von einer Verbrennung. Noch ein Feuertänzer, dachte sie. Sie schämte sich, als sie merkte, dass sie ihn anstarrte. Hastig blickte sie ebenfalls ins Gebüsch. Die Erde davor war niedergetreten. Dort mussten die Mordgesellen gestanden haben, als sie nach ihr suchten. Dort hatten sie den Schreien des Mannes gelauscht, den dieser Hitzel marterte, um dann …
»O gütige Jungfrau«, stieß sie entgeistert hervor.
»Was denn?«
»Ich bin eingeschlafen. Ich … ich kann mich nicht daran erinnern, wann die Männer gegangen sind. Ich … bin eingeschlafen.« Sie hörte das Erschrecken in ihrer eigenen Stimme. Ganz in ihrer Nähe war ein Mensch zu Tode gequält worden, und sie war darüber selig eingeschlummert. Sie besaß so viel Mitgefühl wie ein Stück Vieh.
»Man kennt es aus dem Krieg.«
»Was?«
»Ein Araber hat mir davon erzählt, aus Tunis«, sagte der Mann. »Er hat es auf Kriegszügen beobachtet. Einige Menschen schlafen ein, kurz bevor die Schlacht beginnt. Nicht weil sie betrunken wären oder feige. Einfach so. Es ist eine Narretei der Natur.«
»Ah ja.« Marga würde ihn auslachen. Sie würde ihm erklären, dass ihre Schwester durch ihr Unglück eben nicht demütig geworden war, wie es einem gottesfürchtigen Menschen zukam, sondern herzlos. Und genau so war’s ja auch. »Findet Ihr den Weg aus dem Wald heraus?«, fragte sie den Fremden, um die Stille zu durchbrechen.
»Nein«, sagte der Mann.
»Es ist ganz einfach. Seht Ihr, dort drüben, wo die Büsche niedriger …«
»Ich bin blind.«
»Was?« Sie starrte ihn an. Und wusste, dass er log. Er war dem Überfall entkommen. Das allein bewies, dass er nicht blind sein konnte. Und er hatte sie in der Dunkelheit gesehen und in die Höhle gezogen. Nur wusste sie keinen Grund, warum er ihr etwas vorflunkern sollte. Vorsichtig schob sie sich ins Freie und baute sich vor ihm auf. Die Augen des Mannes waren mandelförmig, tiefbraun, warm und im Moment überschattet von Müdigkeit, aber sie wirkten keinesfalls blicklos.
Elisabeth hatte viele Blinde gesehen. Sie lungerten ja zu Dutzenden auf den Marktplätzen und vor den Kirchen herum. Geblendete, oder Leute, denen der Star gestochen worden war und die trotzdem ihr Augenlicht verloren hatten. Ihre Pupillen waren meist milchig, und ihre Gesichter misstrauisch und verängstigt. Dieser Mann dagegen schien völlig gelassen zu sein.
»Alles gesehen?«
Sie errötete. »Ihr seid nicht blind. Ihr habt mich in die Höhle gezogen.«
»Du hast davorgestanden. Und geatmet wie ein Wal.«
»Ich hätte einer der Raubmörder sein können. Wie konntet Ihr sicher sein …«
»Jäger weinen nicht.«
»Ich habe nicht geweint.«
Der Mann lächelte. Er hatte ein einnehmendes Gesicht, trotz der Brandnarbe. Willensstark und lebhaft. »Bring mich in die Stadt, ist das möglich?«
»Wie habt Ihr die Höhle gefunden? Wie seid Ihr bei dem Überfall entkommen?«
»Lässt sich die Inquisition mit einem Geldstück vermeiden?«
»Entschuldigt.« Er hatte sie gerettet. Das stand fest. Sie sah, dass er Kratzer an Stirn und Wangen und an fast jeder bloßen Stelle seines Körpers hatte. In seinem Haar steckten Kiefernnadeln. Dass seine Ärmelspitzen zerrissen waren, hatte sie ja schon festgestellt. Er war also tatsächlich durch das Unterholz geflüchtet.
»Blind heißt nicht taub und nicht lahm und nicht dumm und … nicht mit einem Überfluss an Zeit gesegnet«, erklärte der Fremde plötzlich ungeduldig. »Komm näher.« Elisabeth griff nach seinem Arm, aber er schob ihre Hand fort und tastete nach ihrer Schulter. »Wie heißt du?«
»Elisabeth.«
»Gut, dann … Es tut mir leid, Elisabeth, was dir widerfahren ist. Es tut mir auch leid, dass du jetzt nicht einfach davonrennen …«
»Ich brauche niemandem leidzutun!«
Sie sah, dass er sich auf die Lippe biss. Dann lachte er plötzlich. »Touché, junge Dame. Hören wir also auf, einander mit Mitleid und Ähnlichem auf die Nerven zu gehen. Und sehen wir zu, dass wir diesen unwirtlichen Ort verlassen.«
Sie hatte vor, den Blinden beim Gliesmaroder Tor abzuliefern. Der Wächter, der auch eine kleine Gastwirtschaft und einen Laden für frisches Gemüse betrieb, würde sich um ihn kümmern. Niemand brauchte zu wissen, dass Elisabeth, die Enkeltochter des ehrwürdigen Goldschmiedemeisters Franz Weißvogel, die Nacht vor den Toren verbracht hatte. Denn das war ihre größte Sorge: Dass sie irgendwie in ein schlechtes Licht geraten könnten. Marga wollte heiraten, und vor allem brauchte Christian eine Lehrstelle. Doch die Gilde würde niemals der Aufnahme eines Jungen in den Lehrlingsstand zustimmen, wenn auch nur der leiseste Verdacht aufkäme, dass sie sich seiner irgendwann würde schämen müssen.
Bis jetzt hatten sie allen Argwohn vermeiden können. Sie besuchten die Gottesdienste, trugen voluminöse Hauben, unter denen züchtig die Haare verschwanden, und das Schicklichste, was man sich an Kleidung vorstellen konnte. Christian zog vor wirklich jedermann die Mütze, und wenn Großvater das Haus verließ, war immer einer von ihnen dabei, um ihn zu stützen. Sie machten sich krumm, um als anständig zu gelten. Wenn nur niemand dahinterkommt, unter welchen Umständen wir Osnabrück verlassen haben, dachte Elisabeth. Dann wäre alles aus. Dann verjagen sie uns auch von hier. Niemand will etwas mit dem Nachwuchs eines Fälschers zu tun haben.
»Warte!«, unterbrach der Fremde ihre Gedanken.
»Bitte?« Elisabeth blieb stehen. Nicht weil sie es wollte – es drängte sie mit jeder Faser voran –, sondern weil der Blinde sie festhielt. »Was ist denn?«
»Jemand kommt.« Sie sah, wie sein Gesicht sich anspannte. Natürlich, wenn man sich ausschließlich auf sein Gehör verlassen musste, war man schutzlos, auch als Mann. Obwohl er eigentlich nicht ängstlich wirkte. Eher ungeduldig, wie jemand, der eine Menge vorhat und sich ärgert, dass die Zeit verrinnt. »Und? Was siehst du?«
Sie schaute sich um. Vor ihnen lag der plumpe graue Gliesmaroder Turm mit der Brücke, der Zollschranke und dem Gastwirtsschild. Doch weder der Torwächter noch sonst eine Gestalt war zu sehen. Im Gemüsegarten streunte eine schwarz gefleckte Katze, die ein lahmes Bein hatte, und ein Rollwägelchen im Gras neben dem Zaun deutete darauf hin, dass sich irgendwo ein Krüppel ausruhte. Das war alles.
Nichts, wollte sie sagen, doch im selben Moment bog ein Trupp schwerbewaffneter Reiter in den Farben der Stadt Braunschweig um einen Waldzipfel und näherte sich von der anderen Seite her der Brücke. Das Sonnenlicht ließ die Hellebarden und Gewehrläufe aufblitzen und die blaugrünen Pfauenfedern in ihren Hüten strahlen.
»Büttel«, erklärte sie schroff. Schon klapperten Pferdehufe auf dem Holz. Einer der Soldaten sprang ab und hob für seine Begleiter die Zollschranke an. Der Anführer der Männer, ein Kerl um die vierzig mit rotgeädertem Gesicht und großspurigen Bewegungen, sprengte auf den Weg, wobei er zu ihnen hinüberspähte.
»Ruf sie an«, befahl der Blinde.
»Ihr braucht sie nicht.«
»Darf ich das bitte selbst entscheiden?«
Sie holte Luft. Ihre Schulter tat weh, weil der Blinde Dutzende Male gestolpert war und sich an ihr festgehalten hatte, und am liebsten hätte sie ihn angefahren. Aber er hatte ihr das Leben gerettet, das durfte sie nicht vergessen. Inzwischen war es auch gleich geworden, wer was entscheiden wollte, denn den Glatzkopf hatte die Neugierde gepackt. Er ritt heran.
Über sein feistes Gesicht glitt ein Lächeln, als er sie musterte. »He da, die Herrschaften. Schon so früh unterwegs?« Während er sprach, klebte sein Blick an Elisabeth. Das war nicht weiter verwunderlich. Großvater versorgte sie nicht gerade großzügig, aber sie hatten jeden Tag mindestens eine Mahlzeit im Topf, und ihre ausgehärmten Gesichtszüge und die müden, traurigen Augen waren der alten Schönheit gewichen. Die meisten Männer starrten Elisabeth an. Sie hasste es, denn auf das Starren folgten oft genug anzügliche Bemerkungen, die sie an das Leben auf der Straße erinnerten. Voller Abneigung wich sie dem Blick des Mannes aus.
»Ein Überfall«, stieß sie hervor. »Offenbar wurde dieser Mann hier ausgeraubt. Ich habe ihn gerade eben getroffen. Er ist blind und … Leider weiß ich nicht, wo genau sich das Unglück …«
Der Blinde ließ sie los. »Wie heißt du?«, fragte er den Reiter. Er schien ihn direkt anzuschauen. Orientierte er sich am Klang der Stimmen? Schätzte er ab, wohin er die Blicke richten musste, um sein Gebrechen nicht allzu offensichtlich werden zu lassen?
Elisabeth sah, dass dem Büttel der herrische Ton missfiel. Er taxierte die Kleider des Kaufmanns, um sich auszurechnen, wie viel Ärger es ihm verschaffen könnte, wenn er nicht den nötigen Respekt aufbrachte. Widerwillig rang er sich zu einer Auskunft durch. »Aßmus Schinkel, Herr. Ich kontrolliere mit meinen Männern die Landwehrwälle, wenn es beliebt. Also ein Überfall, sagt Ihr. Schon wieder. Tja, in letzter Zeit war einiges los in den Wäldern …«
Elisabeth schlüpfte davon. Der Kaufmann war in der Obhut der Büttel, alles Weitere ging sie nichts mehr an. Als sie die Brücke überquerte und die Stimmen hinter ihr verklangen, legte sie ihre Hand wieder auf das Gold unter dem Mieder. Bitte, heilige Jungfrau, lass Marga heute lange schlafen, betete sie, obwohl es aussichtslos war. Ihre Schwester arbeitete, sobald ein Lichtstrahl es zuließ.
Als sie sich noch einmal umdrehte, sah sie, dass Aßmus Schinkel ihr nachstarrte.
Zwei
Als sie die Stadt erreichte, war dort bereits der Arbeitstag angebrochen – was sich vor allem in einem ungeheuren Lärm äußerte. Auf der Fallersleber Straße, der östlichen Einfallstraße in die Stadt, drängten sich die Karren der Bauern, die auf den Märkten ihr Frühgemüse und ihr Kleinvieh feilbieten wollten. Mägde aus dem Badehaus schütteten – übermüdet nach dem Treiben der vergangenen Nacht – Eimer mit schmutzigem Wasser in die Gosse. Eine junge, sehr schöne Frau, die an einem Fenster saß, schmierte etwas Graues aus einem Tiegel auf eine Eiterwunde am Ellbogen, die sie misstrauisch beäugte. Am Hagenmarkt läuteten die Glocken der Katharinenkirche, und auf ihren Stufen suchten sich die Bettler ihre angestammten Plätze und erhoben die klagenden Stimmen.
Elisabeth wich einer Magd aus, die einen Karren voller Holzeimer zu dem Marktbrunnen mit den vergoldeten Schalen und Statuen zog. Das Mädchen war kaum zehn Jahre alt und der Karren entschieden zu schwer für ihren mageren Körper. Die Kleine lächelte sie an, unsicher, weil sie nicht wusste, womit sie die Aufmerksamkeit der fremden Frau erregt hatte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!