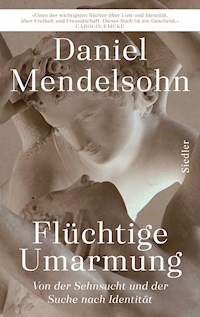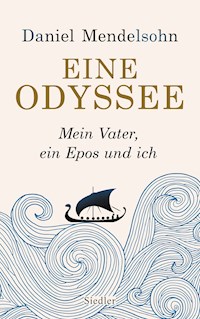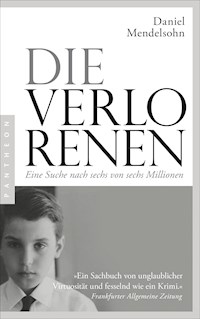
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der preisgekrönte internationale Bestseller jetzt in einer Neuausgabe
Als Daniel Mendelsohn ein kleiner Junge war, begannen ältere Verwandte zu weinen, wenn er ein Zimmer betrat – so sehr ähnelte er seinem Großonkel Shmiel, der im Holocaust ermordet worden war. Schon immer fasziniert von der Geschichte seiner Familie, machte sich Daniel 2001, nachdem er auf alte Briefe stieß, auf die Suche, um herauszufinden, was mit Shmiel und seinen Angehörigen geschehen war.
Das Ergebnis ist ein sehr persönlicher Bericht, in dem er die Schablonen sprengt, die sich über die Schrecken der Shoah legten – und zugleich eine »Legende von Nähe und Distanz, Intimität und Gewalt, Liebe und Tod«. Denn parallel zu seiner eigenen Erzählung erzählt er die Schöpfungsgeschichte wieder, mit ihren ewigen Themen des Ursprungs und der Familie, der Versuchung und des Exils, des Bruderverrats, der Schöpfung und Vernichtung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 980
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Daniel Mendelsohn
DIEVERLORENEN
Eine Suche nach sechs von sechs Millionen
Aus dem amerikanischen Englischübersetzt von Eike Schönfeld
Pantheon
Die Originalausgabe erschien 2006unter dem Titel The Lost: A Search for Six of Six Millionbei HarperCollins, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Pantheon-Ausgabe Januar 2021Copyright © 2006, 2013, Daniel MendelsohnAll rights reservedCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe2021 by Pantheon Verlagin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München,unter Verwendung einer Vorlage von Rudolf Linn, KölnUmschlagabbildung: © privatSatz: Uhl + Massopust GmbH, AalenISBN 978-3-641-28278-3V001
www.pantheon-verlag.de
Die deutsche Ausgabe dieses Buches istdem Andenken an meinen großen LehrerFred Hertrich gewidmet.
Die Familie von Shmiel Jäger
ERSTER TEIL
BereschitoderAnfänge
(1967–2000)
Wenn wir ein gewisses Alter überschritten haben, werfen dieSeele des Kindes, das wir gewesen, und die Seelen der Toten,aus denen wir hervorgegangen sind, mit vollen Händen ihreSchätze und ihren bösen Zauber auf uns.
Marcel Proust,Auf der Suche nach der verlorenen Zeit(Die Gefangene)
1
Die formlose Leere
Vor einiger Zeit, als ich sechs, sieben oder acht Jahre alt war, kam es zuweilen vor, dass ich ein Zimmer betrat und bestimmte Leute zu weinen begannen. Die Zimmer, in denen das geschah, befanden sich zumeist in Miami Beach, Florida, und die Leute, auf die ich diese sonderbare Wirkung hatte, waren, wie fast alle Mitte der sechziger Jahre dort, alt. Fast alle (so jedenfalls erschien es mir damals) waren Juden – Juden jener Spezies, die, wenn sie einander ihren hoch geschätzten Klatsch erzählten oder zum lange hinausgezögerten Ende einer Geschichte oder der Pointe eines Witzes kamen, ins Jiddische verfielen, was natürlich zur Folge hatte, dass die Höhepunkte dieser Geschichten und Witze den Jungen unter uns unverständlich blieben.
Wie viele ältere Einwohner von Miami Beach zu jener Zeit lebten diese Leute in Wohnungen oder kleinen Häusern, die denen, die nicht darin lebten, ein wenig muffig erschienen und in denen es im Allgemeinen ruhig zuging, bis auf jene Abende, wenn die Klänge der Shows von Red Skelton, Milton Berle oder Lawrence Welk aus den Schwarz-Weiß-Fernsehern plärrten. In gewissen Abständen wurde es in ihren muffigen, stillen Wohnungen jedoch laut von den Stimmen kleiner Kinder, die im Winter oder Frühling auf einen mehrwöchigen Besuch bei diesen alten Juden aus Long Island oder New Jersey hergeflogen waren, wo sie ihnen vorgeführt und auch noch gezwungen wurden, starr vor Verlegenheit und Scheu, ihre papiernen, kalten Wangen zu küssen.
Die Wangen alter jüdischer Verwandter! Wir wanden uns, wir stöhnten, wir wollten hinunter zu dem nierenförmigen beheizten Swimmingpool hinter dem Wohnkomplex laufen, aber erst mussten wir alle Wangen küssen, die bei den Männern nach Keller und Haarwasser und Tiparillos rochen und auf denen kratzige Koteletten wuchsen, die so weiß waren, dass man sie oft für Fussel hielt (wie einmal mein kleiner Bruder, der versuchte, die störenden Flusen wegzuzupfen, wofür er einen unsanften Klaps auf den Kopf erhielt), die bei den alten Frauen ein diffuses Aroma von Gesichtspuder und Bratöl verströmten und so weich waren wie die »Not«-Tüchlein, die sie tief in ihre Handtaschen gestopft hatten wie Blütenblätter neben das violette Riechsalz, schrumplige Hustenbonbonpapierchen und zerknüllte Geldscheine … Die zerknüllten Scheine. Halt das mal für Marlene, bis ich wieder rauskomme, trug die Mutter meiner Mutter, Nana nannten wir sie, meiner anderen Großmutter an einem Tag im Februar 1965 auf, als sie ihr eine kleine rote Lederhandtasche mit einem zerknitterten Zwanzigdollarschein darin übergab, bevor man sie zu einer diagnostischen Operation in den OP rollte. Sie war gerade neunundfünfzig geworden, und es ging ihr nicht gut. Meine Großmutter Kay gehorchte und nahm die Handtasche mit dem zerknüllten Schein, und gemäß ihrem Versprechen übergab sie sie meiner Mutter, die sie noch einige Tage später in der Hand hielt, als Nana, in eine schlichte Fichtenkiste gelegt, wie es Brauch ist, auf dem Friedhof Mount Judah in Queens beerdigt wurde, in dem Abschnitt, der sich (wie eine Inschrift auf einem Granittor mitteilt) im Besitz der First Bolechower Sick Benevolent Association befindet. Um dort begraben zu werden, musste man dieser Vereinigung angehören, was wiederum bedeutete, dass man aus einer Kleinstadt von ein paar tausend Einwohnern namens Bolechow kommen musste, die fast auf der anderen Seite der Welt in einer Landschaft lag, die einst zu Österreich, dann zu Polen und dann vielen anderen gehört hatte.
Freilich wurde die Mutter meiner Mutter – mit deren weichen Ohrläppchen, daran klobige blaue oder gelbe Kristallohrringe, ich immer spielte, wenn ich bei ihr auf dem geflochtenen Gartensessel vorn auf der Veranda meiner Eltern auf dem Schoß saß, und die ich zu einer bestimmten Zeit lieber mochte als alle anderen, weswegen ihr Tod zweifellos das erste Ereignis war, an das ich deutliche Erinnerungen habe, auch wenn diese Erinnerungen bestenfalls Fragmente sind (das wellenförmige Fischmuster auf den Fliesen an den Wänden des Wartesaals im Krankenhaus; meine Mutter sagt eindringlich etwas zu mir, etwas Wichtiges, auch wenn es noch vierzig Jahre dauern sollte, bis ich mich daran erinnerte, was es war; ein komplexes Gefühl aus Sehnsucht, Furcht und Scham; das Geräusch von Wasser, das in eine Spüle läuft) –, wurde die Mutter meiner Mutter nicht in Bolechow geboren, sondern war vielmehr die einzige meiner vier Großeltern, die in den Vereinigten Staaten zur Welt kam, was ihr als Teil einer bestimmten Gruppe Menschen, die heute ausgestorben ist, ein gewisses Prestige verlieh. Allerdings war ihr gut aussehender und dominanter Mann, mein Großvater, Opa, in Bolechow geboren und bis zum Jüngling herangewachsen, er und seine sechs Geschwister, die drei Brüder und die drei Schwestern, und aus diesem Grund war es ihm gestattet, eine eigene Grabstelle in jenem bestimmten Teil des Friedhofs Mount Judah zu besitzen. Dort liegt nun auch er, ebenso seine Mutter, zwei seiner drei Schwestern und einer seiner drei Brüder. Die andere Schwester, die hochgradig besitzergreifende Mutter eines Einzelkinds, folgte ihrem Sohn in einen anderen Staat und liegt dort begraben. Von den anderen beiden Brüdern war einer so vernünftig und vorausschauend (wie man uns immer sagte), mit seiner Frau und seinen kleinen Kindern in den dreißiger Jahren von Polen nach Palästina auszuwandern, und wurde infolge dieser weisen Entscheidung schließlich in Israel beerdigt. Der älteste Bruder, der von allen sieben Geschwistern auch am besten aussah, am meisten verehrt und hofiert wurde, der Prinz der Familie, war 1913 als junger Mann nach New York gekommen, jedoch nach einem knappen Jahr, in dem er dort bei einer Tante und einem Onkel wohnte, zu der Erkenntnis gelangt, dass ihm Bolechow lieber war. Und so ging er nach einem Jahr zurück – eine Entscheidung, von der er, da er dort glücklich und wohlhabend wurde, wusste, dass sie die richtige war. Er hat überhaupt kein Grab.
Von diesen alten Männern und Frauen – die manchmal allein schon bei meinem Anblick weinten, diesen alten Juden mit Wangen, die geküsst werden mussten, mit ihren Uhrarmbändern aus Krokoimitat und den schmutzigen jiddischen Witzen und den dicken schwarzen Plastikbrillen, mit den vergilbten Plastikhörgeräten, deren Kabel ihnen über den Rücken hingen, mit ihren Gläsern, randvoll mit Whiskey, mit den Bleistiften, die sie einem bei jeder Begegnung hinhielten und die den Namen einer Bank oder eines Autohändlers trugen; mit den A-Linie-Kleidern aus bedruckter Baumwolle und den Dreifachsträngen weißer Plastikperlen und den blassen Kristallohrringen und dem roten Nagellack, der auf ihren endlos langen Fingernägeln blitzte und klackte, wenn sie Mah-Jongg und Canasta spielten oder die endlos langen Zigaretten hielten, die sie rauchten –, von denen hatten diejenigen, die ich zum Weinen bringen konnte, bestimmte andere Dinge gemein. Sie alle redeten mit einem besonderen Akzent, mit dem ich vertraut war, weil er, wenn auch schwach, aber erkennbar, die Aussprache meines Großvaters durchzog; nicht zu stark, denn als ich alt genug war, um solche Dinge wahrzunehmen, hatten sie hier in Amerika schon ein halbes Jahrhundert lang gelebt, und dennoch eignete manchen Wörtern, besonders solchen mit r und l, Wörtern wie darling oder wonderful, eine verräterische Rauheit, etwas Sonores, sie hatten eine bestimmte Art, in die t und th zu beißen, in Wörtern wie terrible und (ein Wort, das mein Großvater, der gern Geschichten erzählte, häufig gebrauchte) truth. It’s de troott!, sagte er. Diese ältlichen Juden unterbrachen einander gern bei solchen Treffen, wenn sie und wir uns alle bei jemandem im muffigen Wohnzimmer drängten, fielen anderen in die Geschichte, um sie zu korrigieren, um einander zu erinnern, was zu dieser oder jener vahnderful oder (was wahrscheinlicher war) tahrrible time wirklich geschehen war, dollink, I vuz dehre, I rrammenbah, and I’m tellink you, it’s de troott.
Noch charakteristischer und denkwürdiger war, dass sie alle anscheinend zweite, alternative Namen füreinander hatten. Das verwirrte mich, als ich sechs, sieben Jahre alt war, zutiefst, weil ich glaubte, meine Nana (beispielsweise) heiße Gertrude, manchmal auch Gerty, weshalb ich auch nicht begriff, warum sie in dieser ausgesuchten Gesellschaft in Florida bei großen Familienzusammenkünften, die vierzig Jahre nach der Ausschiffung der herrischen und zu Dramen neigenden Familie ihres Mannes in Ellis Island und ihrer Neudefinierung als Amerikaner (wobei sie unablässig weiter Geschichten aus Europa erzählten) stattfanden, zu Golda wurde. Ebenso wenig verstand ich, warum der jüngere Bruder meines Großvaters, unser Onkel Julius, ein großer Verteiler beschrifteter Bleistifte, der ungewöhnlich spät geheiratet hatte und den mein prunkender, gut gekleideter Großvater immer mit einer Nachsicht behandelte, die man gemeinhin schlecht erzogenen Haustieren vorbehält, plötzlich zu Yidl wurde (erst Jahrzehnte später erfuhr ich, dass der Name auf seiner Geburtsurkunde Judah Arie, »Löwe von Judäa«, gelautet hatte). Und wer war überhaupt diese Neche, die mein Großvater manchmal als seine liebste jüngste Schwester bezeichnete, die aber, wie ich wusste, 1943 im Alter von fünfunddreißig Jahren (so erzählte es mir mein Großvater, womit er mir erklärte, warum er diesen Feiertag nicht mochte) am Thanksgiving-Tisch der Schlag getroffen hatte; wer war diese Neche, da ich doch wusste oder zu wissen glaubte, dass seine geliebte kleine Schwester Tante Jeanette gewesen war? Nur mein Großvater, dessen richtiger Name Abraham war, hatte einen mir verständlichen Spitznamen: Aby, und das verstärkte das Gefühl in mir, dass er ein Mensch von totaler und transparenter Authentizität war, einer, dem man vertrauen konnte.
Von diesen Menschen weinten manche, wenn sie mich sahen. Ich trat ins Zimmer, sie sahen mich an und (vor allem die Frauen) führten beide verkrümmten Hände mit den Ringen und den Knoten, die ihre Knöchel waren, geschwollen und hart wie bei einem Baum, diese Hände führten sie an ihre vertrockneten Wangen und sagten mit einem kleinen theatralischen Atemzug: Oj, er set ojss seier enlech zu Shmiel!
Oh, er sieht Shmiel so ähnlich!
Und dann fingen sie an zu weinen und machten leise Ausrufe und wiegten sich vor und zurück, und ihre rosa Pullover oder Windjacken schlackerten ihnen lose um die Schultern, und dann setzte ein rechter Schwall Schnellfeuerjiddisch ein, von dem ich dann ausgeschlossen war.
Über diesen Shmiel wusste ich natürlich etwas: der älteste Bruder meines Großvaters, der mit seiner Frau und seinen vier schönen Töchtern während des Krieges von den Nazis umgebracht worden war. Shmiel. Von den Nazis umgebracht. Letzteres war, wie wir alle wussten, die ungeschriebene Unterschrift unter den wenigen Fotografien, die wir von ihm und seiner Familie hatten; sie liegen jetzt sorgfältig verstaut in einer Plastiktüte in einer Schachtel in einem Karton im Keller meiner Mutter. Ein offenbar wohlhabender Geschäftsmann Mitte fünfzig, der mit sichtlichem Besitzerstolz vor einem Lastwagen neben zwei uniformierten Fahrern steht; eine Familie, um einen Tisch versammelt, die Eltern, vier kleine Mädchen, ein unbekannter Fremder; ein schicker Mann in einem Mantel mit Pelzkragen, einen Fedora auf dem Kopf; zwei junge Männer in der Uniform des Ersten Weltkriegs, der eine, wie ich wusste, der einundzwanzigjährige Shmiel, die Identität des anderen hingegen war unmöglich zu erraten, unbekannt und nicht zu ermitteln. … Unbekannt und nicht zu ermitteln, das konnte frustrierend sein, erzeugte aber auch einen gewissen Reiz. Die Fotografien von Shmiel und seiner Familie waren deshalb so viel faszinierender als die anderen Familienbilder, die so penibel im Familienarchiv meiner Mutter verwahrt wurden, eben weil wir fast nichts über ihn, über sie wussten; ihre ernsten, nichts aussagenden Gesichter erschienen uns daher umso verlockender.
Lange Zeit gab es nur die stummen Fotografien und manchmal auch das unbehagliche Flirren in der Luft, wenn Shmiels Name fiel. Zu Lebzeiten meines Großvaters geschah dies nicht sehr oft, denn es war, wie wir wussten, die Tragödie seines Lebens, dass sein Bruder und seine Schwägerin und die vier Nichten von den Nazis umgebracht worden waren. Selbst ich, der ich, wenn er zu Besuch kam, immer gern zu seinen Füßen saß, die in weichen Lederpantoffeln steckten, und seinen zahlreichen Geschichten über »die Familie« zuhörte, was natürlich seine Familie bedeutete, deren Name einst Jäger gewesen war (und die, gezwungen, den Umlaut abzulegen, als sie nach Amerika kamen, nach und nach zu Yaegers und Yagers und Jagers und, wie er, Jaegers wurden: alle diese Schreibweisen finden sich auf den Grabsteinen auf dem Mount Judah), diese Familie, die jahrhundertelang eine Metzgerei und dann, später, einen Fleischhandel in Bolechow hatte, eine hübsche Stadt, ein lebendiges Städtchen, ein Schtetl, ein Ort, der berühmt war für das Holz und Fleisch und die Lederwaren, die seine Kaufleute nach ganz Europa lieferten, ein Ort, an dem man leben konnte, ein schönes Fleckchen am Fuß der Berge; selbst ich, der ich ihm so nahe war, der ihn mit zunehmendem Alter so oft über Familiendinge ausfragte, ihre Geschichte, Daten, Namen, Beschreibungen, Orte, sodass er, wenn er auf meine Fragen antwortete (auf dünnem Briefpapier der Firma, die er vor langer Zeit besessen hatte, mit blauer Tinte aus einem fetten Parker-Füller), gelegentlich schrieb: Lieber Daniel, bitte stelle mir keine Fragen mehr über die mischpoche, denn ich bin ein alter Mann und erinnere mich an nichts mehr, und außerdem, willst Du denn wirklich noch mehr Verwandte finden?! – selbst mir war es unangenehm, sie zur Sprache zu bringen, diese schreckliche Sache, die Shmiel widerfahren war, seinem eigenen Bruder. Von den Nazis umgebracht. Als Kind, als ich erstmals den Refrain über Shmiel und seine verlorene Familie hörte, fand ich es schwierig, mir vorzustellen, was genau das bedeutete. Selbst später noch, nachdem ich alt genug war, um etwas über den Krieg erfahren zu haben, die Dokumentarfilme gesehen, mit meinen Eltern die Folge einer PBS-Serie namens The World at War angeschaut hatte, der die Angst machende Warnung voranging, bestimmte Bilder des Films seien für Kinder zu aufwühlend – selbst später war es schwer vorstellbar, wie genau man sie umgebracht hatte, schwer, die Einzelheiten, die Besonderheiten zu erfassen. Wann? Wo? Wie? Mit Gewehren? In der Gaskammer? Doch mein Großvater wollte es nicht sagen. Erst später begriff ich, dass er es deshalb nicht sagen wollte, weil er es nicht oder nicht genau genug wusste, und dass dieses Nichtwissen Teil dessen war, was ihn quälte.
Und so brachte ich es nicht zur Sprache. Stattdessen hielt ich mich an sichere Themen, an Fragen, die es ihm gestatteten, lustig zu sein, was er gern war, wie zum Beispiel in dem folgenden Brief, den er mir kurz nach meinem vierzehnten Geburtstag geschrieben hatte:
20. Mai / 74
Lieber Daniel,
habe Deinen Brief mit allen seinen Fragen erhalten, kann Dir aber leider nicht alle Antworten geben. Ich habe in Deinem Brief gesehen, wo Du mich fragst, ob Du mit allen Deinen Fragen meinen engen Zeitplan störst, die Antwort lautet NEIN
Ich habe gesehen, dass Du Dich sehr darüber freust, dass ich mich an den Namen von HERSHS Frau erinnere. Auch ich freue mich, weil Hersh mein Großvater ist und Feige meine Großmutter.
Und was nun die Geburtsdaten der beiden angeht, ich kenne sie nicht, weil ich nicht dabei war, aber wenn einmal der MESSIAH kommt und alle Verwandten Wiedervereint sind, werde ich sie fragen …
Ein Nachtrag zu diesem Brief ist an meine Schwester und meinen jüngsten Bruder gerichtet:
Liebste Jennifer und Lieber Eric,
wir danken Euch beiden für Eure wundervollen Briefe, und wir freuen uns besonders, weil Ihr keine Fragen zur Mischpoche habt
LIEBE JENNIFER,
ICH WOLLTE DIR UND DEINEM BRUDER ERIC ETWAS GELD SCHICKEN, ABER WIE DU WEISST, ARBEITE ICH NICHT UND HABE AUCH KEIN GELD. ALSO LIEBT TANTE RAY EUCH BEIDE SEHR, UND TANTE RAY LEGT ZWEI DOLLAR BEI EINEN FÜR DICH UND EINEN FÜR ERIC.
VIELE GRÜSSE UND KÜSSE
TANTE RAY UND OPA JAEGER
Und im PS schrieb er meiner Mutter:
Liebste Marlene,
bitte lass Dir mitteilen, dass Dienstag, 28. Mai, JISKOR ist …
Jiskor, Jizkor: ein Gedenkgottesdienst. Mein Großvater dachte immer an die Toten. Jeden Sommer, wenn er uns besuchen kam, gingen wir mit ihm zum Mount Judah, um meine Großmutter und alle anderen zu besuchen. Wir Kinder bummelten herum und betrachteten gelangweilt die Namen auf den bescheidenen Grabsteinen und flachen Platten oder das riesige Grabdenkmal in Form eines Baums, dem die Äste abgehackt waren, das an die ältere Schwester meines Großvaters erinnerte, die mit sechsundzwanzig gestorben war, eine Woche vor ihrer Hochzeit, wie mein Großvater mir jedenfalls immer erzählte. Einige dieser Steine trugen graublaue Plaketten mit der Aufschrift ›Immerwährende Fürsorge‹, nahezu alle Namen wie Stanley und Irving und Herman und Mervin, wie Sadie und Pauline, Namen, die meine Generation als typisch jüdisch empfindet, wobei es – eine jener Ironien, die nur das Vergehen einer gewissen Zeit verdeutlichen kann – vielmehr so ist, dass die Juden, die ein Jahrhundert zuvor eingewandert waren, mit Namen wie Selig und Itzig, wie Hercel und Mordko, wie Scheindel und Perl geboren worden waren, sich für diese Namen gerade deshalb entschieden hatten, weil sie ihnen als sehr englisch, sehr unjüdisch erschienen. Wir bummelten also herum und sahen uns das alles an, während mein Großvater, wie stets in einem makellosen Sportjackett, mit scharfen Bügelfalten an der Hose, kühn gebundener Krawatte und Einstecktuch, seinen akribischen und systematischen Rundgang begann, reihum vor jedem Grab stehen blieb, vor dem seiner Mutter, seiner Schwester, seines Bruders, seiner Frau, alle hatte er sie überlebt, und dabei die Gebete auf Hebräisch in einem eindringlichen Gemurmel sang. Fährt man auf dem Interboro Parkway in Queens, hält beim Eingang zum Friedhof Mount Judah und blickt über den Steinzaun an der Straße, kann man sie dort alle sehen, kann ihre angenommenen, ein wenig hochtrabenden Namen lesen, begleitet von den rituellen Bezeichnungen: Geliebte Frau, Mutter und Großmutter; Geliebter Mann; Mutter.
Also ja: Er dachte immer an die Toten. Es sollten noch viele Jahre vergehen, bis ich erkannte, wie sehr er an sie dachte, mein stattlicher und lustiger Großvater, der so viele Geschichten kannte, der sich so großartig kleidete; mit seinem glatt rasierten ovalen Gesicht, den zwinkernden blauen Augen und der geraden Nase, die in die feinste Andeutung einer Knolle auslief, als hätte derjenige, der ihn gestaltete, im letzten Moment beschlossen, einen Hauch Humor dazuzutun; mit seinem spärlichen, säuberlich gebürsteten weißen Haar, seiner Kleidung, seinem Kölnischwasser und der Maniküre, seinen berüchtigten Witzen und den verwickelten, tragischen Geschichten.
Mein Großvater kam Jahr für Jahr im Sommer, denn im Sommer war das Wetter auf Long Island nicht so drückend wie in Miami Beach. Er blieb immer einige Wochen, in Begleitung einer der vier Frauen, mit der er da gerade verheiratet war. Wenn er kam, belegte er (und manchmal auch die Frau) das Zimmer meines kleinen Bruders mit den zwei schmalen Einzelbetten. Dort hängte er, vom Flughafen eingetroffen, seinen Hut auf einen Lampenschirm und faltete sein Sportjackett säuberlich über eine Stuhllehne, danach wandte er sich seinem Kanarienvogel Schloimele zu, was Jiddisch ist und kleiner Salomon heißt, stellte den Käfig auf ein kleines eichenes Kinderpult und besprengte den kleinen Vogel mit ein paar Tropfen Wasser, nur um ihn ein wenig zu erfrischen. Anschließend holte er langsam, akribisch die Sachen aus seinen sorgfältig gepackten Taschen und legte sie behutsam auf einem der zwei winzigen Betten aus.
Mein Großvater war für eine ganze Reihe von Dingen berühmt (in dem Sinne, wie eine bestimmte Art jüdischer Einwanderer und ihre Familien jemanden als »berühmt« für etwas bezeichnen, was in der Regel bedeutet, dass ungefähr sechsundzwanzig Menschen davon wissen) – für seinen Humor, für die drei Frauen, die er nach dem Tod meiner Großmutter heiratete und von denen er sich, bis auf die eine, die ihn überlebte, in rascher Abfolge scheiden ließ, für seine Art, sich zu kleiden, für gewisse Familientragödien, seine Orthodoxie, dafür, wie er sich bei Kellnerinnen und Ladenbesitzern in Erinnerung hielt, Sommer um Sommer –, doch für mich war das Herausragende an ihm seine Frömmigkeit und seine herrliche Kleidung. Als Kind und auch noch als Jugendlicher erschienen mir diese zwei Dinge als die Grenzen, innerhalb derer seine Fremdheit, sein Europäischsein existierten: das Terrain, das ihm gehörte und niemandem sonst, ein Raum, in dem es möglich war, weltlich und fromm, stilvoll und religiös zugleich zu sein.
Als Erstes packte er immer die Samttasche mit den Gegenständen aus, die er für sein Morgengebet brauchte – fürs dawnen. Das hatte er an jedem Tag seines Lebens von dem Tag im Frühling 1915 an getan, als seine Bar-Mizwa gefeiert wurde, bis zu dem Morgen vor dem Tag im Juni 1980, als er starb. Diese seidengefütterte Tasche aus burgunderrotem Samt, auf deren Vorderseite eine von aufsteigenden Löwen von Judäa flankierte Menora mit Goldfaden gestickt war, enthielt seine Kippa, einen gewaltigen, altmodischen weiß-hellblauen Tallit samt den kitzeligen Fransen, in dem er gemäß den Vorschriften, die er mir an einem heißen Tag im Jahr 1972, da war ich zwölf, ein Jahr vor meiner Bar-Mizwa, akribisch diktierte, an jenem Junitag begraben wurde, und die ledernen Gebetsriemen, die Tefillin, die er sich jeden Morgen um den Kopf und den linken Unterarm band, worauf er dann dawnete – und wir ihn in stummer Ehrfurcht betrachteten. Für uns war das ein bizarrer, aber auch majestätischer Anblick: Jeden Morgen nach Sonnenaufgang umwickelte er, auf Hebräisch murmelnd, seinen Arm mit den Lederbändern und band sich danach einen einzelnen dicken Lederriemen, an dem ein Lederkästchen mit Versen aus der Tora angebracht war, so um den Schädel, dass Letzteres auf seiner Stirn saß, dann legte er den riesigen, ausgebleichten Tallit und die Kippa an, zog seinen Siddur heraus, sein Gebetbuch für den Alltag, und murmelte rund eine halbe Stunde lang Worte, die für uns vollkommen unverständlich waren. Manchmal sagte er, wenn er damit fertig war: Ich habe ein gutes Wort für euch eingelegt, da ihr ja nur Reformierte seid.
Mit derselben Genauigkeit und Akribie seines Betrituals kleidete sich mein Großvater auch jeden Morgen an, präzise und ordentlich, eben auch ein Ritual. Mein Großvater war das, was man früher einen snappy dresser nannte, einer, der sich in Schale wirft. Seine gebürstete und geschniegelte Erscheinung, seine gute Kleidung waren lediglich äußerer Ausdruck einer inneren Eigenschaft, die für ihn und seine Familie das charakterisierte, was es hieß, ein Jäger zu sein, etwas, das sie Feinheit nannten: eine Kultiviertheit, ethisch und ästhetisch zugleich. Man konnte immer davon ausgehen, dass seine Socken zu seinem Pullover passten, und er bevorzugte Hüte mit weicher Krempe, in deren Band eine oder auch zwei kecke Federn steckten, bis die letzte seiner vier Frauen – die ihren ersten Mann und eine vierzehnjährige Tochter in Auschwitz verloren hatte und deren weichen, tätowierten Unterarm ich, als ich klein war, immer gern hielt und streichelte, und die, weil sie, wie ich heute glaube, so viel verloren hatte, etwas so Frivoles wie eine Feder am Hut nicht ertrug – sie schließlich herauszupfte. An einem typischen Sommertag in den Siebzigern mochte er Folgendes tragen: eine senfgelbe, sommerleichte Wollhose mit adretten Bügelfalten, ein weiches weißes Strickhemd unter einem Pullunder mit senffarben-weißem Schottenkaro, hellgelbe Socken, weiße Wildlederschuhe und einen Hut mit weicher Krempe, an dem, je nachdem, welches Jahr es in den Siebzigern war, eine Feder steckte oder auch nicht. Bevor er das Haus verließ, um ein paarmal um den Block oder in den Park zu spazieren, spritzte er sich ein wenig 4711 Kölnischwasser auf die Hände und klatschte es sich auf Wangen und Doppelkinn. Jetzt, sagte er dann und rieb sich die manikürten Hände, können wir ausgehen.
Das alles beobachtete ich aufmerksam (dachte ich jedenfalls). Er mochte auch ein Sportjackett tragen – was ich kaum fassen konnte, da weder eine Hochzeit noch eine Bar-Mizwa anstand –, in das er dann jedes Mal sein Portemonnaie wie auch, in die Innentasche auf der anderen Seite, eine merkwürdige Brieftasche steckte, lang und schmal, eigentlich zu groß in einer Weise, wie bestimmte europäische Herrenartikel für amerikanische Augen immer irgendwie die falsche Größe haben, und aus einem Leder, zu nahezu wildlederartiger Glätte abgegriffen, das, wie mir heute klar ist, da die Brieftasche sich in meinem Besitz befindet, Straußenleder war, die mich damals aber lediglich als pickelig amüsierte. Während er sprach, betrachtete ich ihn vom Bett meines kleinen Bruders aus und bewunderte seine Sachen: den Pullunder mit Schottenkaros, die weißen Schuhe, die eleganten Gürtel, die schwere, blau-goldene Flasche Kölnischwasser, den Schildpattkamm, mit dem er sich die spärlichen weißen Haare zurückstrich, das abgewetzte, gerunzelte Portemonnaie, das, wie ich schon damals wusste, kein Geld enthielt, wobei ich mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen kontte, was daran so kostbar sein mochte, dass er es jedes Mal, wenn er sich so makellos kleidete, bei sich tragen musste.
Das war der Mann, von dem ich im Laufe der Jahre Hunderte von Geschichten und Tausende Fakten sammelte, die Namen seiner Großeltern und Großonkel und Tanten und Vettern und Basen zweiten Grades, die Jahre, in denen sie geboren, und Orte, wo sie gestorben waren, den Namen des ukrainischen Hausmädchens, das sie als Kinder in Bolechow gehabt hatten (Lulka) und das sich immer beschwerte, die Kinder hätten einen Magen »wie eine bodenlose Grube«, und welchen Hut sein Vater, mein Urgroßvater, immer trug (einen Homburg: Er war ein gepflegter Mann mit einem Spitzbart und in seiner kleinen, aber lebendigen Stadt eine Art großes Tier, dafür bekannt, dass er seinen potenziellen Geschäftspartnern ungarischen Tokaier mitbrachte, »um den Handel zu versüßen«, und mit fünfundvierzig war er in einem Kurort in den Karpaten namens Jaremcze, wo er aus Gesundheitsgründen zur Kur weilte). Opa erzählte mir von dem Stadtpark mit der Statue des großen polnischen Dichters des neunzehnten Jahrhunderts, Adam Mickiewicz, und dem kleinen Park gegenüber dem Platz mit seiner Lindenallee. Er rezitierte für mich – und ich lernte – den Text von »Mayn Shtetele Belz«, dem kleinen kinderliedartigen jiddischen Lied über die Stadt, die ganz in der Nähe derjenigen lag, in der er aufgewachsen war, das ihm seine Mutter ein Jahr vor dem Untergang der Titanic vorgesungen hatte:
Mayn heymele, dort vu ikh hobMayne kindershe yorn farbrakht.Belz, mayn shtetele Belz,In ormen shtibele mit aleKinderlakh dort gelakht.Yedn shabes fleg ikh loyfn dortMit der tchine glaychTsu zitsen unter dem grinemBeymele, leyenen bay dem taykh.Belz, mayn shtetele Belz,Mayn heymele vu ch’hob gehatDi sheyne khaloymes a sach.
Mein Heimatle, wo ich habMeine Kinderjahr verbracht.Belz, mein Schtetl Belz,in einem kleinen armen Häuschen mit allden kleinen Kindern hab ich gelacht.Jeden Sabbat dort bin ich mitmeinem Gebetbuch hinund hab mich unter den kleinen grünenBaum gesetzt und am Flussufer gelesen.Belz, mein Schtetl BelzMein Heimatle, wo ich einstSo viele schöne Träume gehabt …
Von meinem Großvater erfuhr ich auch von dem alten ukrainischen Waldmenschen, der in den Bergen oberhalb Bolechows lebte, aber in der Nacht vor Jom Kippur, als er sah, wie sich die ungewöhnliche und für ihn beängstigende Stille über die schimmernden Städte am Fuße der bewaldeten Ausläufer der Karpaten senkte, als die Juden in den Schtetln sich auf diesen furchterregenden Feiertag vorbereiteten, von seinem Berg herabkam und bei einem freundlichen Juden wohnte, so groß war die Furcht des Ukrainers in jener einen Nacht jedes Jahr vor den Juden und ihrem düsteren Gott.
Die Ukrainer, sagte mein Großvater hin und wieder mit einem müden kleinen Seufzer, wenn er diese Geschichte erzählte. Uu-kra-ii-ner. Die Ukrainer. Unsere goyim.
Und so kam er also jeden Sommer nach Long Island, und ich saß zu seinen Füßen, und er erzählte. Er erzählte von der älteren Schwester, die eine Woche vor ihrer Hochzeit gestorben war, und erzählte von der jüngeren Schwester, die mit neunzehn mit dem Verlobten der älteren Schwester verheiratet wurde, dem buckligen (sagte mein Großvater), zwergenhaften Vetter, den erst das eine und dann das andere dieser reizenden Mädchen hatte heiraten müssen, weil der Vater dieses hässlichen Vetters, erzählte mein Großvater, die Schiffstickets bezahlt hatte, die diese zwei Schwestern und ihre Brüder und ihre Mutter, die ganze Familie meines Großvaters, in die Vereinigten Staaten gebracht hatten, und als Preis dafür eine schöne Schwiegertochter verlangt hatte. Er erzählte verbittert davon, wie dieser Vetter, der natürlich auch sein Schwager war, 1947 meinen Großvater zweiundvierzig Treppen im Chrysler Building hinabgejagt hatte, nachdem ein bestimmtes Testament verlesen worden war, und dabei eine Schere schwang, vielleicht war es auch ein Briefoffner; erzählte von einer knauserigen Tante, der Frau des Onkels, der seine Überfahrt nach Amerika bezahlt hatte – jener Tante, bei der der ältere Bruder meines Großvaters, der Prinz, während seines Kurzaufenthalts in den Vereinigten Staaten 1913 hatte wohnen müssen, vielleicht hatte ja auch ihre Knauserigkeit zu seiner Entscheidung geführt, nach Bolechow zurückzukehren, jener Entscheidung, die da noch so richtig schien.
Und er erzählte von der angenehmen Bescheidenheit der Bar-Mizwas im alten Land, verglichen (wie man spüren sollte) mit der allzu überladenen und aufdringlichen Opulenz der heutigen Feier: erst die religiösen Zeremonien in kalten Tempeln mit ihren schrägen Dächern und danach die Empfänge in üppigen Country Clubs und Speisesälen, Anlässe, bei denen Jungen wie ich die Parascha lasen, den Abschnitt aus der Tora für jene Woche, und die Haftara-Abschnitte sangen, die Passagen aus den Propheten, die jede Parascha begleiten, ohne zu wissen, was wir da sangen, dabei aber von dem sich anschließenden Empfang und der Aussicht auf heimliche Whiskey Sours träumten (und so sang ich auch meine: ein Auftritt, der damit endete, dass meine Stimme brach, laut, zutiefst beschämend, als ich gerade das allerletzte Wort sang, aus einem reinen Sopran zu dem Bariton abstürzte, bei dem sie bis heute geblieben ist). Nu, so?, sagte er. Da ist man dann statt morgens um sechs um fünf aufgestanden, man hat eine extra Stunde in der Schul gebetet, und dann ist man nach Hause gegangen und hat mit dem Rabbi und seiner Mutter und seinem Vater Plätzchen und Tee zu sich genommen, und das war’s dann auch. Er erzählte, wie er auf der zehntägigen Überfahrt nach Amerika seekrank wurde, von der Zeit, Jahre zuvor, als er eine Scheune voller russischer Kriegsgefangener bewachen musste, im Ersten Weltkrieg, da war er sechzehn, und da hatte er auch Russisch gelernt, eine der vielen Sprachen, die er konnte; von der nebulösen Gruppe Vettern, die ihn immer mal wieder in der Bronx besuchten und die rätselhafterweise »die Deutschen« genannt wurden.
Alle diese Geschichten erzählte mir mein Großvater, alle diese Dinge, aber nie sprach er über seinen Bruder und seine Schwägerin und die vier Mädchen, die für mich weniger tot als verloren waren, nicht nur aus der Welt verschwunden, sondern was für mich noch schrecklicher war – auch aus den Geschichten meines Großvaters. Weswegen ich von all diesen Geschichten, all diesen Menschen am wenigsten die sechs kannte, die ermordet worden waren, diejenigen, die, so schien es mir damals, die ungeheuerlichste Geschichte hatten, die, die zu erzählen sich am meisten lohnte. Doch bei diesem Thema blieb mein gesprächiger Opa stumm, und seine Stummheit, ungewöhnlich und verkrampft, verklärte das Thema Shmiel und seine Familie, machte sie zu etwas Unaussprechlichem und daher Unfassbarem.
Unfassbar.
Jedes einzelne Wort der Fünf Bücher Mose, des Kerns der hebräischen Bibel, ist über viele Jahrhunderte hinweg analysiert, geprüft, interpretiert und dem forschenden Blick strenger Gelehrter dargeboten worden. Nach allgemeiner Übereinkunft war der größte aller Bibelkommentatoren der französische Gelehrte Rabbi Schlomo ben Jizchak aus dem elften Jahrhundert, besser bekannt als Raschi, ein Name, der nichts anderes als ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben seines Titels, Namens und Patronymikums ist: Ra(bbi) Sch(lomo ben) J(zchak) – Raschi. 1040 in Troyes geboren, überlebte Raschi die schrecklichen Umwälzungen jener Zeit, zu denen auch das Gemetzel an den Juden gehörte, einem Nebenprodukt gewissermaßen des Ersten Kreuzzugs. Seine Ausbildung erhielt er in Mainz, wo er bei jenem Mann studierte, der der größte Student des berühmten Gerschom von Mainz gewesen war (da ich immer gute Lehrer hatte, liebe ich solche intellektuellen Genealogien), begründete mitfünfundzwanzig seine eigene Akademie und wurde noch zu Lebzeiten als der größte Gelehrte seiner Zeit angesehen. Sein Interesse für jedes einzelne Wort des Textes, den er studierte, fand in der verkrampften Knappheit seines Stils den perfekten Ausdruck; vielleicht wegen Letzterem wurde Raschis Bibelkommentar selbst zum Gegenstand rund zweihundert weiterer Kommentare. Ein Beleg für Raschis Bedeutung ist, dass die erste gedruckte hebräische Bibel seinen Kommentar enthielt. … Interessant für mich ist die Feststellung, dass Raschi, wie mein Großonkel Shmiel, nur Töchter hatte, was, soweit man das sagen kann, für einen Mann mit einem gewissen Ehrgeiz im Jahr 1040 eine größere Belastung darstellte als 1940. Dennoch führten die Kinder dieser Töchter Raschis das großartige Erbe ihres Großvaters fort, weswegen sie als baalej tossafot bekannt wurden, als »Diejenigen, die erweiterten«.
Obwohl Raschi der überragende Kommentator der Tora bleibt – und mithin auch der ersten Parascha der Tora, des Leseabschnitts, mit dem die Tora beginnt und der selbst nicht mit einem, sondern rätselhafterweise zwei Schilderungen der Schöpfung beginnt, der die Geschichte von Adam und Eva und dem Baum der Erkenntnis enthält und daher eine Passage ist, die im Lauf der Jahrtausende besonders gründliche Kommentare auf sich gelenkt hat –, ist es doch wichtig, die Interpretationen moderner Kommentatoren zu berücksichtigen wie die kürzlich erschienene Übersetzung samt Kommentar von Rabbi Richard Elliot Friedman, die in ihren aufrichtigen und tiefgründigen Versuchen, den alten Text mit dem zeitgenössischen Leben zu verbinden, so offen und freundlich ist wie der Raschis verdichtet und abstrus.
Beispielsweise beschäftigt sich Raschi in seiner gesamten Analyse des ersten Kapitels der Genesis – dessen hebräischer Name Bereschit wörtlich »Am Anfang« bedeutet – mit winzigen Details von Sinn und Diktion, die Rabbi Friedman einfach kommentarlos übergeht, wohingegen es Friedman (der zugegebenermaßen für ein breiteres Publikum schreibt) darauf ankommt, allgemeinere Punkte zu erhellen. Ein Beispiel: Beide Gelehrte verweisen auf die berühmten Schwierigkeiten, die allererste Zeile von Bereschit zu übersetzen – Bereschit bara Elohim et-haschamajim we’et-ha’arez. Entgegen der Annahme von Millionen, die die Lutherbibel gelesen haben, bedeutet diese Zeile nicht »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde«, sondern muss etwas wie »Am Anfang von Gottes Schöpfung von Himmel und Erde …« bedeuten. Friedman erwähnt lediglich das »klassische Problem« der Übersetzung, ohne näher darauf einzugehen, wohingegen Raschi Unmengen von Tinte darauf verwendet, worin das Problem überhaupt besteht. Und das Problem ist kurz gesagt das, was das Hebräische wörtlich sagt, nämlich »Am Anfang von, schuf Gott Himmel und Erde«. Denn auf das erste Wort, Bereschit, »Am Anfang von« (b’, »am« + reschit, »Anfang«), müsste eigentlich ein weiteres Substantiv folgen, doch in der ersten Zeile von Paraschat Bereschit – wenn wir uns auf ein Parascha mit Namen beziehen, verwenden wir die Form »Paraschat« – folgt auf das Wort Bereschit ein Verb: bara, »schuf«. Nach einer ausführlichen Diskussion der linguistischen Fragen löst Raschi das Problem schließlich damit, dass er bestimmte Parallelen aus anderen Texten heranzieht, in denen auf Bereschit statt eines Substantivs ein Verb folgt, was uns gestattet, diese ersten entscheidenden Worte wie folgt zu übersetzen:
Am Anfang von Gottes Schaffen des Himmels – als die Erde gestaltlos und formlos gewesen war und Finsternis auf dem Angesicht des Tiefen war und Gottes Geist über dem Angesicht des Wassers schwebte – sprach Gott: »Es werde Licht.«
Entscheidend ist für Raschi, dass die falsche Lesart eine verkehrte Chronologie der Schöpfung suggeriert: dass Gott erst den Himmel, dann die Erde, dann das Licht und so weiter schuf. So aber war es nicht, sagt Raschi. Wenn man bereits bei den Details ungenau ist, stimmt auch das Gesamtbild später nicht.
Die Art und Weise, in der winzige Nuancen von Wortstellung, Diktion, Grammatik und Syntax weit größere indirekte Auswirkungen auf die Gesamtbedeutung eines Texts haben können, färbt Raschis Kommentar durchgängig. Für ihn (um ein weiteres Beispiel zu nehmen) ist der berüchtigte »doppelte Beginn« der Genesis – der Umstand, dass sie nicht nur eine, sondern zwei Schilderungen der Schöpfung enthält, deren erste mit derErschaffung des Kosmos beginnt und mit der der Menschheit endet (Genesis 1, 1–30), während die zweite sich von Beginn an auf die Erschaffung Adams konzentriert und fast sofort zur Geschichte Evas, der Schlange und der Vertreibung aus dem Paradies übergeht – im Grunde eine Frage des Stils, die recht einfach zu erklären ist. In seinen Erläuterungen zu Genesis 2 nimmt Raschi das Gegrummel der Leser vorweg – die Erschaffung des Menschen wurde schließlich schon in Genesis 1, 27 behandelt –, erklärt jedoch, nachdem er selbst einiges an Rabbiweisheit befragt hat, er habe eine gewisse »Regel« entdeckt (zufällig Nummer dreizehn von zweiunddreißig, die bei der Erklärung der Tora helfen), und diese Regel besage, wenn auf eine allgemeine Erklärung oder Geschichte eine zweite Version dieser Geschichte folge, so solle die zweite als eine detailliertere Erläuterung der ersten verstanden werden. Und daher solle die zweite Erzählung der Erschaffung des Menschen in Genesis 2 sozusagen als erhöhte Version der ersten in Genesis 1 begriffen werden. Und so ist es ja auch: Denn im ersten Kapitel der Genesis mit seiner trockenen, chronologischen Auflistung der Erschaffung von Kosmos, Erde, ihrer Fauna und Flora und schließlich der Menschheit stimmt uns nichts auf die überbordende Erzählung des zweiten Kapitels ein mit ihren Geschichten von Unschuld, Betrug, Verheimlichung, Vertreibung und letztlich Tod, von dem Mann und der Frau an dem abgeschiedenen Ort, dem jähen und verhängnisvollen Auftauchen des mysteriösen Eindringlings, der Schlange, und dann: der Zerschlagung der friedlichen Existenz. Und im Mittelpunkt dieses Dramas – denn Raschi nimmt nicht geringe Mühen auf sich, um zu erklären, dass es tatsächlich im Mittelpunkt steht – das mysteriöse und irgendwie bewegende Symbol des Baums im Garten, eines Baums, der, zu der Ansicht bin ich gelangt, die Freude wie auch das Leid darstellt, die beide vom Wissen um die Dinge herrühren.
So interessant das alles sein mag, gab ich im Zuge meiner Auseinandersetzung mit der Genesis und ihren Kommentatoren in den letzten Jahren natürlich Friedmans allgemeiner Erklärung, warum die Tora so beginnt, den Vorzug. Ich sage »natürlich«, weil die Frage, die Friedman seinen Lesern begreiflich machen will, im Grund eine schriftstellerische ist: Wie beginnt man eineGeschichte? Für Friedman erinnert der Beginn von Bereschit an eine Technik, die wir alle vom Film kennen: »Wie manche Filme, die mit einem weiten Schwenk beginnen, der sich dann verengt«, schreibt er, »schwenkt das erste Kapitel der Genesis von einem Blick auf Himmel und Erde allmählich auf den ersten Mann und die erste Frau. Der Fokus der Geschichte verengt sich weiter: von Universum zu Erde zu Menschheit zu bestimmten Ländern und Völkern zu einer einzelnen Familie.« Und dennoch, so mahnt er den Leser, bleiben uns die breiteren, kosmischen Belange der welthistorischen Geschichte, die uns die Tora erzählt, beim Weiterlesen im Hinterkopf und liefern den fruchtbaren Nährboden des Sinns, der der Geschichte dieser Familie eine solche Tiefe gibt.
Friedmans Beobachtung impliziert, und das ist sicher richtig, dass der Verstand häufig mehr Mühe hat, das Gesamtbild als die kleinen Dinge zu erfassen, dass es beispielsweise für den Leser naturgemäß reizvoller ist, die Bedeutung eines gewaltigen historischen Ereignisses anhand der Geschichte einer einzelnen Familie zu verinnerlichen.
Da von Shmiel nur wenig gesprochen wurde und wenn, dann eher im Flüsterton oder auf Jiddisch, eine Sprache, in der meine Mutter sich mit meinem Vater unterhielt, damit sie ihre Geheimnisse wahren konnten – wegen alldem war es reiner Zufall, wenn ich tatsächlich etwas über ihn erfuhr.
Einmal, ich war noch klein, hörte ich zufällig mit, wie meine Mutter, die mit ihrer Cousine telefonierte, etwas sagte wie: Ich hab gedacht, sie hätten sich versteckt und die Nachbarin hätte sie angezeigt, oder nicht?
Einmal, Jahre später, hörte ich jemanden sagen: Vier schöne Töchter.
Einmal hörte ich zufällig, wie mein Großvater zu meiner Mutter sagte: Ich weiß nur, dass sie sich in einem kessle versteckt hielten. Da ich zu der Zeit schon wusste, dass ich bei seinem Akzent Anpassungen vornehmen musste, fragte ich mich nur, als ich ihn das sagen hörte: Welches castle, also Schloss? Nach den Geschichten, die er mir erzählt hatte, war Bolechow nicht eben der Ort für Schlösser; es war ein kleiner Ort, das wusste ich, ein friedlicher Ort, eine Kleinstadt mit einem Platz und einer Kirche oder auch zwei und einer Schul und betriebsamen Geschäften. Erst viel später, lange nachdem mein Großvater gestorben war und ich mich eingehender mit der Geschichte dieser Stadt beschäftigt hatte, wusste ich, dass Bolechow, wie so viele andere polnische Schtetl, früher im Besitz eines adligen polnischen Grundbesitzers gewesen war, und in dem Wissen glich ich die neue Information natürlich mit meiner alten Erinnerung an das ab, was ich meinen Großvater hatte sagen hören: Ich weiß nur, dass sie sich in einem kessle versteckt hielten. Einem Schloss. Offensichtlich hatten Shmiel und seine Familie in der großen Residenz der Adelsfamilie, der einmal ihre Stadt gehört hatte, ein Versteck finden können, und dort hatte man sie auch entdeckt, nachdem sie verraten worden waren.
Irgendwann hörte ich dann jemanden sagen, es sei nicht die Nachbarin gewesen, sondern das eigene Hausmädchen, die schikse. Das fand ich verwirrend und verstörend, denn auch wir hatten eine Putzfrau, die – ich wusste, dass schikse das bedeutete – eine Goi war, und zwar Polin. Fünfunddreißig Jahre lang kam die polnische Putzfrau meiner Mutter, eine große, breithüftige Frau, die wir irgendwann für eine dritte Großmutter hielten und die sich auch so benahm, eine Frau, die, als aus den Sechzigern die Siebziger und aus den Siebzigern die Achtziger wurden, dieselbe Körperform annahm, die (wie man den wenigen Fotografien von ihr entnehmen kann) Shmiels Frau Ester einmal gehabt hatte, kam also jede Woche zu uns ins Haus und saugte und wischte und fegte und putzte und gab meiner Mutter zunehmend auch Ratschläge, welcher Nippes wohin zu stellen sei (Is Gerümpel!, beschimpfte sie dieses oder jenes Stück Porzellan oder Kristall. Werfen Sie in Müll!). Nachdem Mrs Wilk und meine Mutter Freundinnen geworden waren und die wöchentlichen Besuche im Haus in zunehmend längere Lunches mit hart gekochten Eiern, Brot, Käse und Tee am Küchentisch übergingen, an dem die beiden Frauen, deren Welten weniger weit auseinander waren, als man zunächst meinen mochte (mein Großvater erzählte, wenn er zu Besuch kam, Mrs Wilk immer seine anstößigen, schlüpfrigen Witze auf Polnisch), nach all den Jahren der Dienstage, an denen sie stundenlang zusammensaßen und klagten und sich bestimmte Geschichten erzählten – beispielsweise die, die Mrs Wilk schließlich meiner Mutter anvertraute, wie, jawohl, ihr und den anderen polnischen Mädchen ihrer Stadt, Rzeszów, beigebracht wurde, die Juden zu hassen, aber sie hätten es ja nicht besser gewusst – und auch über die pani klatschten, die reichen Nachbarinnen, die ihre Mahlzeiten nicht mit ihren Putzfrauen teilten, nach dieser Zeit, in der die beiden Frauen Freundinnen wurden, brachte Mrs Wilk meiner Mutter Gläser mit polnischen Delikatessen, die sie zubereitet hatte, deren herrlichste, gleichermaßen wegen des amüsanten Klangs ihres Namens und des feinen Aromas, das sie verströmten, etwas war, das sie »gawampkies« aussprach: scharf gewürztes Hackfleisch, eingewickelt in Kohlblätter, die in einer gehaltvollen roten Soße schwammen …
Deshalb und wohl auch, weil ich nicht in Polen aufwuchs, schmerzte es mich, dass Shmiel und seine Familie von dem schikse-Hausmädchen verraten worden waren.
Ein anderes Mal, Jahre später, sagte der in Israel lebende Vetter meiner Mutter, Elkana, der Sohn des zionistischen Bruders, der in den dreißiger Jahren so vernünftig gewesen war, Polen zu verlassen, und ein Mann, der mich heute mehr als jeder andere noch Lebende an seinen Onkel, meinen Großvater, erinnert, in einem Telefongespräch – mit seiner allwissenden Autorität und seinem verschmitzten Humor, seinem Reichtum an Familiengeschichten und Familiengefühlen, ein Mann, der, hätte er seinen Familiennamen nicht geändert, um sich Ben-Gurions Hebraisierungspolitik in den fünfziger Jahren anzupassen, noch heute den Namen Elkana Jäger trüge, den er bei der Geburt erhalten hatte, den Namen, auf den, mit geringen Veränderungen in der Schreibweise, einstmals ein Homburg tragender Fünfundvierzigjähriger gehört hatte, der eines Morgens in einem Kurort in einer Provinz eines Reichs, das nicht mehr besteht, tot umfiel –, sagte also mein Cousin Elkana: Er hatte Lastwagen, und diese Lastwagen wollten die Nazis.
Einmal hörte ich jemanden sagen: Er war einer der Ersten auf der Liste.
Das alles hörte ich also, als ich noch ein Kind war. Mit der Zeit verschmolzen diese geflüsterten Fetzen, diese Gesprächsfragmente, die ich, wie ich wusste, nicht hören sollte, zu den dünnen Konturen der Geschichte, die wir lange Zeit zu kennen glaubten. Einmal, da war ich schon ein wenig älter, fasste ich den Mut, danach zu fragen. Ich war ungefähr zwölf, und meine Mutter und ich gingen die breiten, flachen Betonstufen zu der Synagoge hinauf, der wir angehörten. Es war Herbst, die Zeit der Hohen Feiertage; wir gingen zum Jiskor, der Gedenkfeier, dem Gottesdienst. Zu der Zeit musste meine Mutter das Kaddisch, das Gebet für die Toten, nur für ihre Mutter sprechen, die so unerwartet gestorben war, nachdem sie ihr einen Zwanzigdollarschein anvertraut hatte (den sie noch immer hat: Der Schein ist in der roten Lederbörse ganz unten in einer Schublade in ihrem Haus auf Long Island sicher verwahrt, und manchmal nimmt sie ihn heraus und zeigt ihn mir, dazu die Brille und das Hörgerät meines Großvaters, als wären es Reliquien) – »nur für ihre Mutter«, denn alle anderen lebten noch: ihr Vater, ihre Schwestern und Brüder, alle, die fünfzig Jahre zuvor aus Europa herübergekommen waren, alle bis auf Shmiel. An jenem Abend stiegen wir langsam diese flachen Stufen hinauf, damit meine Mutter ihre Mutter betrauern konnte. Vielleicht hatte sie mich an dem Tag wegen meiner blauen Augen mitgenommen, die auch sie und ihre Mutter hatten. Die Sonne ging unter, und es wurde plötzlich kühl, weshalb meine Mutter sich entschloss, noch einmal zum Parkplatz zu gehen und einen Pullover aus dem Wagen zu holen, und während dieses kurzen Aufschubs vor dem (wie ich glaubte) beängstigenden Gebet erzählte sie plötzlich von ihrer Familie, ihren toten Verwandten, und ich lenkte das Gespräch auf diejenigen, die ermordet worden waren.
Ja, ja, sagte meine Mutter. Damals war ihre Schönheit voll erblüht: die hohen Backenknochen, der kräftige Kiefer, das breite, fotogene Filmstarlächeln mit den erotischen, markanten Schneidezähnen. Ihre Haare, die mit den Jahren zu einem kräftigen Kastanienbraun gedunkelt waren, in dem sich aber noch einige blonde Strähnchen hielten, das einzige Zeichen, dass sie einmal, wie ihre Mutter und Großmutter, ein Flachskopf gewesen war, so wie früher mein Bruder Matthew (Matthew, Matt, der das schmale, hochwangige, etwas längliche Gesicht einer Ikone der orthodoxen Kirche, seltsam katzenartige bernsteinfarbene Augen sowie einen platinblonden Haarschopf hatte, um den ich mit meiner Masse krauser, nicht zu bändigender welliger dunkler Haare ihn insgeheim beneidete) – die Haare meiner Mutter flatterten in dem auffrischenden Herbstwind. Sie seufzte und sagte: Onkel Shmiel und seine Frau, die hatten vier schöne Töchter.
In dem Moment, als sie das sagte, flog laut ein kleines Flugzeug über uns hinweg, und einen Augenblick lang dachte ich, sie hätte nicht Töchter (daughters), sondern Hunde (dogs) gesagt, was mich ein wenig irritierte, da ich, obwohl wir so wenig wussten, immer geglaubt hatte, wir wüssten wenigstens dies: dass sie vier Töchter hatten.
Meine Verwirrung währte jedoch nur einen Augenblick, da meine Mutter Sekunden später, mit leicht veränderter Stimme, hinzufügte, fast wie zu sich selbst: Sie haben sie alle vergewaltigt und umgebracht.
Ich stand da wie erstarrt. Ich war zwölf und im Sexuellen für mein Alter ein wenig zurückgeblieben. Ich empfand, als ich diese schockierende Geschichte hörte – desto schockierender, wie mir schien, wegen der beinahe sachlichen Art, in der meine Mutter diese Information preisgab, als redete sie nicht mit mir, ihrem Kind, sondern mit einem Erwachsenen, der über ein tiefes Wissen über die Welt und ihre Grausamkeiten verfügte –, ich empfand mehr als alles andere Verlegenheit. Nicht Verlegenheit wegen des sexuellen Aspekts der Information, in die ich gerade eingeweiht wurde, vielmehr eine Verlegenheit darüber, dass jeder weitere Wissensdrang hinsichtlich dieses außerordentlichen und überraschenden Details von meiner Mutter als sexuelle Lüsternheit fehlinterpretiert werden könnte. Und so ließ ich, von meiner eigenen Scham erstickt, die Bemerkung verstreichen, was meiner Mutter natürlich noch merkwürdiger erschienen sein muss, als wenn ich sie gebeten hätte, mir mehr zu erzählen. Das alles raste mir im Kopf herum, als wir erneut die Stufen zu unserer Synagoge hinaufschritten, und als ich dann endlich in der Lage war, eine Frage zu dem, was sie gesagt hatte, aufwendig zu formulieren, und zwar in einer Weise, die nicht unangemessen erschien, waren wir an der Tür und gleich drin, und dann war es Zeit, die Gebete für die Toten zu sprechen.
Es ist unmöglich, für die Toten zu beten, wenn man ihre Namen nicht kennt.
Natürlich kannten wir Shmiel: Von allem anderen abgesehen war es der hebräische Name meines Bruders Andrew. Und wir wussten, dass es auch Ester gegeben hatte – nicht »Esther«, wie ich später entdeckte –, seine Frau. Über sie wusste ich lange Zeit außer ihrem Namen gar nichts, erfuhr dann noch ihren Mädchennamen, Schneelicht, über dessen Bedeutung ich später, als ich Deutsch studierte und seine Schönheit erkannte, eine vage Freude empfand.
Shmiel also, und Ester und Schneelicht. Doch hinsichtlich der vier schönen Töchter offenbarte mein Großvater in all den Jahren, die ich ihn kannte, all den Jahren, in denen ich ihn befragte und ihm Briefe mit nummerierten Fragen über die mischpoche, die Familie, schrieb, keinen einzigen Namen. Bis zum Tod meines Großvaters kannten wir nur den Namen eines der Mädchen, und zwar deshalb, weil Onkel Shmiel selbst ihn auf die Rückseite eines jener Fotos geschrieben hatte, in der kraftvollen, geneigten Handschrift, mit der ich später, nach dem Tod meines Großvaters, nur allzu vertraut werden sollte. Auf die Rückseite eines Schnappschusses von ihm selbst, seiner fülligen Frau und einem kleinen Mädchen in einem dunklen Kleid hatte er eine kurze Notiz auf Deutsch geschrieben: Zur Errinerung, dann das Datum, 25/7 1939, und die Namen Sam, Ester, Bronia; daher wussten wir, dass diese Tochter Bronia hieß. Die Namen sind mit blauem Filzstift unterstrichen, einem, mit denen mein Großvater im Alter gern seine Briefe schrieb (er verzierte seine Briefe gern mit Zeichnungen; eine seiner liebsten war ein Pfeife rauchender Matrose). Diese Unterstreichung interessiert mich. Warum, frage ich mich jetzt, fand er es nötig, ihre Namen zu unterstreichen, die er doch sicher kannte? Hatte er das für sich selbst gemacht, als er, schon alt, des Nachts dasaß, wer weiß, wann und für wie lange, und diese Fotos betrachtete, oder hatte er es für uns getan?
Die deutsche Formel Zur Erinnerung erscheint, manchmal falsch geschrieben, immer in Shmiels energischer Handschrift, auf fast allen Fotos, die Shmiel seinen Geschwistern in Amerika schickte. Beispielsweise taucht sie auch auf der Rückseite des Schnappschusses auf, auf dem Shmiel mit seinen Fahrern neben einem Lastwagen posiert, das Bild des erfolgreichen Kaufmanns, in der rechten Hand eine Zigarre, die linke in die Hosentasche gesteckt, das Jackett gerade so weit offen, dass man die goldene Uhrkette blitzen sieht, der kleine, frühzeitig weiß gewordene Schnurrbart in dem Zahnbürstenstil, den ein anderer berühmt gemacht hatte, sauber getrimmt. Auf die Rückseite dieses Fotos schrieb Shmiel Zur Errinerung an dein Bruder, und dann noch eine etwas längere Widmung samt Datum: 19. April 1939. Shmiel schrieb an seine Geschwister nur auf Deutsch, obwohl sie sich nie in dieser Sprache, sondern nur auf Jiddisch unterhalten hatten, und auch mit den Gojim ihrer oder anderer Städte hatten sie nicht deutsch gesprochen, sondern polnisch oder ukrainisch. Für sie blieb Deutsch immer die offizielle Hochsprache, die Sprache von Regierung und Grundschule, eine Sprache, die sie in einem großen Klassenzimmer lernten, in dem einst (wie ich erfahren habe) ein großes Porträt des österreichisch-ungarischen Kaisers Franz Joseph I. gehangen hatte, das dann durch eines von Adam Mickiewicz, dem großen polnischen Dichter, ersetzt wurde und dann durch eines von Stalin und dann von Hitler und dann von Stalin und dann – nun, zu dem Zeitpunkt gab es dann keine Jägers mehr, die dort zur Schule gingen und sahen, wessen Bild dort gerade hing. Jedenfalls lernten sie Deutsch, Shmiel und seine Brüder und Schwestern, in der Baron-Hirsch-Schule, und in ihren Köpfen blieb Deutsch auch die Sprache, in der man ernste Dinge schrieb. Zum Beispiel (vier Jahrzehnte, nachdem diese Geschwister erstmals ihr du und Sie und der und dem und eins-zwei-drei lernten) Wie Ihr lässt in die papers weist ihr abisel was die juden machen hier mit, daß ist aber ein hunderster teil waß ihr weißt, oder, etwas später, Ich werde zwar schiken ein Brief geschrieben in Englisch nach Washington adresiert zum President Rosiwelt und werde schreiben daß meine alle geschwiester samt ganze family sind in Amerika sogar meine Eltern sind begraben dort, und ich bin hier ällend, und will zurück kein [nach] Amerika, vieleicht gelingt daß.
Deutsch, die Sprache für gewichtige Dinge, konnten sie lesen und schreiben, wobei sie nur selten Fehler in der Schreibweise oder Grammatik machten, und nur gelegentlich ins Jiddische oder, noch seltener, ins Hebräische rutschten, was sie ebenfalls rein mechanisch lernten, als sie Jungen und Mädchen während der Herrschaft des Kaisers waren, dessen Kaiserreich schon bald verloren sein sollte. So wie Shmiel in einem seiner Briefe ins Hebräische rutschte:… ich will mit meiner lieben Frau und solche teuer 4 Kinder araus von dem gehenim. Gehenim bedeutet auf Hebräisch »Hölle«, und als ich diesen Brief zum ersten Mal las in dem Jahr, das von dem, in dem Shmiel ihn schrieb, ebenso fern war wie dieses von seiner Geburt, spürte ich einen plötzlichen, lebhaften Hauch von etwas von solcher Zartheit, als ob es beinahe vollständig verloren gewesen war: ein flüchtiger, aber intensiver Augenblick vielleicht seiner Kindheit und der meines Großvaters, vielleicht auch der Art, wie ihr Vater halb im Zorn, halb im Spaß ins Hebräische wechselte, wenn er seine Kinder ausschimpfte und darüber klagte, wie sie ihm das Leben zur Gehenim gemacht hätten, ohne 1911 freilich zu ahnen, zu was für einer Hölle diese Stadt noch werden würde.
Deutsch ist also die Sprache, in der sie schrieben. Aber das einzige Mal, dass ich meinen Großvater tatsächlich einmal hatte Deutsch sprechen hören, war lange, nachdem Shmiel nichts weiter als Erde und Wetter eines ukrainischen Weidelands geworden war, als mein Großvater nämlich, während er zähneknirschend Vorkehrungen für seinen jährlichen Kuraufenthalt in Bad Gastein traf, zu dem ihn seine vierte Frau nötigte, zu dieser Frau sagte (die etliche Tätowierungen auf dem Unterarm hatte und die es, nachdem sie ein Menschenalter und viele Regimes zuvor eine wohlerzogene Russin gewesen war, ablehnte, Jiddisch zu sprechen), als sie ihre zahlreichen Koffer und die besondere Nahrung für Schloimele zu Ende packten: Also, fertig?, weswegen ich möglicherweise Deutsch auf immer, selbst noch, nachdem ich es lesen und sprechen gelernt habe, mit älteren Juden assoziiere, die gezwungen werden, an Orte zu reisen, an die sie nicht wollen.
Zur Erinnerung. Dieses Bild mit seiner Widmung ist der Grund dafür, dass Shmiel viel später der Einzige der sechs war, dessen Geburtstag und -jahr wir kannten. Der 19. April war sein vierundvierzigster Geburtstag, doch er schrieb nicht »aus Anlass seines 44. Geburtstags«, vielmehr schrieb er »im 44 lebensjahr«, und wenn ich das lese, fällt mir auf, dass er nicht einfach »Jahr« schrieb; auch wenn das bestimmt beiläufig geschah und ich keine Sekunde annehme, dass er beim Schreiben darüber nachgedacht hat, finde ich es dennoch bemerkenswert, vielleicht weil ich weiß, dass er an jenem Frühlingstag, als dieses Foto gemacht wurde, noch genau vier dieser Lebensjahre zu leben hatte.
Daher kannten wir einige Namen und ein Datum. Nach dem Tod meines Großvaters kamen gewisse Dokumente Shmiel betreffend in unseren Besitz, dazu noch einige weitere Fotografien, die keiner von uns bisher gesehen hatte, und erst als wir diese Dokumente fanden und die Fotos ansahen, erfuhren wir endlich die Namen der anderen Mädchen oder glaubten es jedenfalls. Ich sage »glaubten es jedenfalls«, weil wir aufgrund gewisser Eigenheiten von Shmiels altmodischer Handschrift (zum Beispiel die kleine horizontale Linie, die er oben an seine kursiven l anfügte, oder dass er seine End-y so schrieb, wie wir heute das End-z machen würden, wenn wir denn noch Langschriftbriefe in ordentlicher Schreibschrift schrieben) einen der Namen falsch gelesen hatten. Deshalb glaubten wir lange, tatsächlich noch über zwanzig Jahre nach dem Tod meines Großvaters, dass die Namen der vier schönen Töchter von Shmiel und Ester wie folgt lauteten:
LorcaFrydka (Frylka?)RuchatzBronia
Das aber war, wie gesagt, erst nach dem Tod meines Großvaters. Bis dahin glaubte ich, das Einzige, was wir jemals über sie wissen würden, sei das eine Datum, 19. April, die drei Namen Sam,Ester, Bronia und natürlich ihre Gesichter, wie sie uns aus den Fotografien entgegensahen, ernst, lächelnd, offen, gestellt, besorgt, selbstvergessen, aber stets stumm und stets schwarz und grau und weiß. An sich wirkten Shmiel und seine Familie, jene sechs verlorenen Verwandten, drei davon namenlos, völlig fehl am Platz, markierten eine fremdartige, graue Abwesenheit im Zentrum dieser lebhaften und lärmenden und oftmals unverständlichen Gegenwart, dieser Gespräche, dieser Geschichten, unbewegliche, sprachlose Chiffren, über die inmitten von Mah-Jongg und roten Fingernägeln und Zigarren und Gläsern Whiskey, die zu Pointen auf Jiddisch getrunken wurden, unmöglich etwas sehr Wesentliches zu erfahren war, außer eben der einen hervorstechenden Tatsache, dieser schrecklichen Sache, die geschehen war und die durch das eine kennzeichnende Etikett zusammengefasst wurde: von den Nazis umgebracht.
Lange bevor wir davon wussten, in den Tagen, als allein der Anblick meines Gesichts genügte, um Erwachsene zum Weinen zu bringen, lange bevor ich begonnen hatte, bei geflüsterten Telefongesprächen die Ohren zu spitzen, lange vor meiner Bar-Mizwa war ich, und das ist die Wahrheit, bestenfalls nicht mehr als ein wenig neugierig, nicht besonders interessiert an ihm, an ihnen, empfand vielleicht sogar einen vagen Unmut darüber, dass diese Ähnlichkeit mich noch mehr zum Ziel grapschender, klammernder alter Leute machte, in deren modrige Wohnungen wir in Sommer- und Winterferien traten, Schachteln mit Schokolade und kandierten Orangen in der Hand, die gelb und grün und rot und auch noch orange waren, was herrlich war.
Die meisten waren harmlos, manche auch sehr lustig. Häufig saß ich, als ich sechs, sieben oder acht war, zufrieden bei meiner Großtante Sarah, der Schwester der Mutter meines Vaters, auf dem Schoß, spielte mit ihren Perlen und versuchte heimlich, aber konzentriert, in der schimmernden Oberfläche ihrer chinesisch-roten Nägel mein Spiegelbild zu sehen, während sie mit ihren drei Schwestern, die einander sehr nah waren, Mah-Jongg spielte.
Aber manche dieser alten Juden, das wussten wir Kinder, so klein wir da auch waren, mussten um jeden Preis gemieden werden. Da gab es zum Beispiel Minnie Spieler, die Witwe des Fotografen, mit ihrer Nase und den klauenartigen Fingern und den komischen »Boheme«-Sachen, die sie trug; Minnie Spieler, auf die auf unserem Familienfriedhof in Queens ein leeres sandiges Rechteck mit einem Blechschild im Boden wartete, auf dem reserviert für mina spieler stand, was uns jedes Jahr, wenn wir hingingen, um auf die Gräber unserer toten Verwandten Steine zu legen, verstörte und ich mich voller Abneigung fragte, was sie auf unserem Familienfriedhof überhaupt zu suchen hatte. Mit Minnie wollte man nicht sprechen; sie fasste einen bei diesen Treffen mit ihren krabbengleichen Händen am Arm und schaute einem durchdringend ins Gesicht wie eine, die etwas verloren hat und hofft, man könne ihr helfen, es zu finden, und wenn ihr dann klar wurde, dass man nicht der war, den sie suchte, wandte sie sich jäh ab und schlich ins nächste Zimmer.
Es gab also Leute wie Minnie Spieler, die nach einer Weile gar nicht mehr zu den Familientreffen kamen – sie war, hieß es, nach Israel gezogen –, weswegen es mir nie mehr einfiel, mich nach ihr zu erkundigen.
Derjenige unter den Alten aber, den es am meisten zu meiden galt, war der, den wir nur als Herman der Friseur kannten. Bei diesen Treffen, bei denen ich gelegentlich Leute zum Weinen brachte, tauchte auch dieser Herman der Friseur auf, klein und geschrumpft, tief gebeugt, unvorstellbar alt, älter noch als mein Großvater, und versuchte, einem Dinge zuzuflüstern – vielmehr eigentlich mir, denn ich hatte immer das Gefühl, dass er sich auf mich stürzte, wenn man sein langsames, aber entschlossenes Schlurfen denn als »stürzen« bezeichnen konnte; immer näherte er sich mir, versuchte, mich an der Hand oder am Arm zu packen, lächelnd, mit den Zähnen klackernd, die, wie ich heute weiß, nicht die eigenen waren, beim Näherkommen etwas Jiddisches murmelnd, was ich damals noch nicht verstand. Natürlich verdrückte ich mich, sobald ich mich zwischen ihm und der Wand hinauszwängen konnte, und rannte in die Arme meiner Mutter, die mir dann einen vollendeten grünen Halbkreis kandierte Orange gab, während Herman in der Ecke mit einem der anderen alten Bolechower Juden lachte, selbstgefällig lächelnd auf mich zeigte und sagte, was für ein frische jingele,