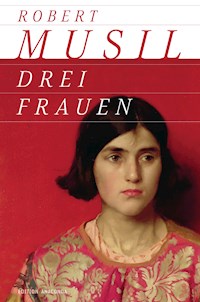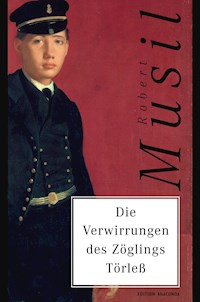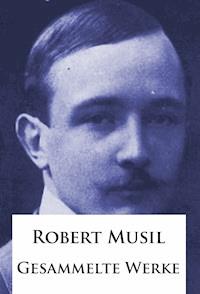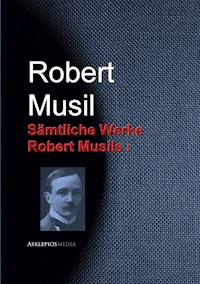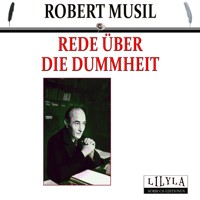Robert Musil
Die Verwirrungen des Zöglings Törleß
Books
- Innovative digitale Lösungen & Optimale Formatierung -
2017 OK Publishing
ISBN 978-80-272-1696-3
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Text
Eine kleine Station an der Strecke, welche nach Rußland führt.
Endlos gerade liefen vier parallele Eisenstränge nach beiden Seiten zwischen dem gelben Kies des breiten Fahrdammes; neben jedem wie ein schmutziger Schatten der dunkle, von dem Abdampfe in den Boden gebrannte Strich.
Hinter dem niederen, ölgestrichenen Stationsgebäude führte eine breite, ausgefahrene Straße zur Bahnhofsrampe herauf. Ihre Ränder verloren sich in dem ringsum zertretenen Boden und waren nur an zwei Reihen Akazienbäumen kenntlich, die traurig mit verdursteten, von Staub und Ruß erdrosselten Blättern zu beiden Seiten standen.
Machten es diese traurigen Farben, machte es das bleiche, kraftlose, durch den Dunst ermüdete Licht der Nachmittagssonne: Gegenstände und Menschen hatten etwas Gleichgültiges, Lebloses, Mechanisches an sich, als seien sie aus der Szene eines Puppentheaters genommen. Von Zeit zu Zeit, in gleichen Intervallen, trat der Bahnhofsvorstand aus seinem Amtszimmer heraus, sah mit der gleichen Wendung des Kopfes die weite Strecke hinauf nach den Signalen der Wächterhäuschen, die immer noch nicht das Nahen des Eilzuges anzeigen wollten, der an der Grenze große Verspätung erlitten hatte; mit ein und derselben Bewegung des Armes zog er sodann seine Taschenuhr hervor, schüttelte den Kopf und verschwand wieder; so wie die Figuren kommen und gehen, die aus alten Turmuhren treten, wenn die Stunde voll ist.
Auf dem breiten, festgestampften Streifen zwischen Schienenstrang und Gebäude promenierte eine heitere Gesellschaft junger Leute, links und rechts eines älteren Ehepaares schreitend, das den Mittelpunkt der etwas lauten Unterhaltung bildete. Aber auch die Fröhlichkeit dieser Gruppe war keine rechte; der Lärm des lustigen Lachens schien schon auf wenige Schritte zu verstummen, gleichsam an einem zähen, unsichtbaren Widerstande zu Boden zu sinken.
Frau Hofrat Törleß, dies war die Dame von vielleicht vierzig Jahren, verbarg hinter ihrem dichten Schleier traurige, vom Weinen ein wenig gerötete Augen. Es galt Abschied zu nehmen. Und es fiel ihr schwer, ihr einziges Kind nun wieder auf so lange Zeit unter fremden Leuten lassen zu müssen, ohne Möglichkeit, selbst schützend über ihren Liebling zu wachen.
Denn die kleine Stadt lag weitab von der Residenz, im Osten des Reiches, in spärlich besiedeltem, trockenem Ackerland.
Der Grund, dessentwegen Frau Törleß es dulden mußte, ihren Jungen in so ferner, unwirtlicher Fremde zu wissen, war, daß sich in dieser Stadt ein berühmtes Konvikt befand, welches man schon seit dem vorigen Jahrhunderte, wo es auf dem Boden einer frommen Stiftung errichtet worden war, hier heraußen beließ, wohl um die aufwachsende Jugend vor den verderblichen Einflüssen einer Großstadt zu bewahren.
Denn hier erhielten die Söhne der besten Familien des Landes ihre Ausbildung, um nach Verlassen des Institutes die Hochschule zu beziehen oder in den Militär-oder Staatsdienst einzutreten und in allen diesen Fällen, sowie für den Verkehr in den Kreisen der guten Gesellschaft galt es als besondere Empfehlung, im Konvikte zu W. aufgewachsen zu sein.
Vor vier Jahren hatte dies das Elternpaar Törleß bewogen, dem ehrgeizigen Drängen seines Knaben nachzugeben und seine Aufnahme in das Institut zu erwirken.
Dieser Entschluß hatte später viele Tränen gekostet. Denn fast seit dem Augenblicke, da sich das Tor des Institutes unwiderruflich hinter ihm geschlossen hatte, litt der kleine Törleß an fürchterlichem, leidenschaftlichem Heimweh. Weder die Unterrichtsstunden noch die Spiele auf den großen üppigen Wiesen des Parkes noch die anderen Zerstreuungen, die das Konvikt seinen Zöglingen bot, vermochten ihn zu fesseln; er beteiligte sich kaum an ihnen. Er sah alles nur wie durch einen Schleier hindurch und hatte selbst untertags häufig Mühe, ein hartnäckiges Schluchzen hinabzuwürgen; des Abends schlief er aber stets unter Tränen ein.
Er schrieb Briefe nach Hause, beinahe täglich, und er lebte nur in diesen Briefen; alles andere, was er tat, schien ihm nur ein schattenhaftes, bedeutungsloses Geschehen zu sein, gleichgültige Stationen, wie die Stundenziffern eines Uhrblattes. Wenn er aber schrieb, fühlte er etwas Auszeichnendes, Exklusives in sich; wie eine Insel voll wunderbarer Sonnen und Farben hob sich etwas in ihm aus dem Meere grauer Empfindungen heraus, das ihn Tag um Tag kalt und gleichgültig umdrängte. Und wenn er untertags, bei den Spielen oder im Unterrichte, daran dachte, daß er abends seinen Brief schreiben werde, so war ihm, als trüge er an unsichtbarer Kette einen goldenen Schlüssel verborgen, mit dem er, wenn es niemand sieht, das Tor von wunderbaren Gärten öffnen werde.
Das Merkwürdige daran war, daß diese jähe, verzehrende Hinneigung zu seinen Eltern für ihn selbst etwas Neues und Befremdendes hatte. Er hatte sie vorher nicht geahnt, er war gern und freiwillig ins Institut gegangen, ja er hatte gelacht, als sich seine Mutter beim ersten Abschied vor Tränen nicht fassen konnte, und dann erst, nachdem er schon einige Tage allein gewesen war und sich verhältnismäßig wohl befunden hatte, brach es plötzlich und elementar in ihm empor.
Er hielt es für Heimweh, für Verlangen nach seinen Eltern. In Wirklichkeit war es aber etwas viel Unbestimmteres und Zusammengesetzteres. Denn der »Gegenstand dieser Sehnsucht«, das Bild seiner Eltern, war darin eigentlich gar nicht mehr enthalten. Ich meine diese gewisse plastische, nicht bloß gedächtnismäßige, sondern körperliche Erinnerung an eine geliebte Person, die zu allen Sinnen spricht und in allen Sinnen bewahrt wird, so daß man nichts tun kann, ohne schweigend und unsichtbar den anderen zur Seite zu fühlen. Diese verklang bald wie eine Resonanz, die nur noch eine Weile fortgezittert hatte. Törleß konnte sich damals beispielsweise nicht mehr das Bild seiner »lieben, lieben Eltern«, – dermaßen sprach er es meist vor sich hin – vor Augen zaubern. Versuchte er es, so kam an dessen Stelle der grenzenlose Schmerz in ihm empor, dessen Sehnsucht ihn züchtigte und ihn doch eigenwillig festhielt, weil ihre heißen Flammen ihn zugleich schmerzten und entzückten. Der Gedanke an seine Eltern wurde ihm hiebei mehr und mehr zu einer bloßen Gelegenheitsursache, dieses egoistische Leiden in sich zu erzeugen, das ihn in seinen wollüstigen Stolz einschloß wie in die Abgeschiedenheit einer Kapelle, in der von hundert flammenden Kerzen und von hundert Augen heiliger Bilder Weihrauch zwischen die Schmerzen der sich selbst Geißelnden gestreut wird. – – –
Als dann sein »Heimweh« weniger heftig wurde und sich allgemach verlor, zeigte sich diese seine Art auch ziemlich deutlich. Sein Verschwinden führte nicht eine endliche Zufriedenheit nach sich, sondern ließ in der Seele des jungen Törleß eine Leere zurück. Und an diesem Nichts, an diesem Unausgefüllten in sich erkannte er, daß es nicht eine bloße Sehnsucht gewesen war, die ihm abhanden kam, sondern etwas Positives, eine seelische Kraft, etwas, das sich in ihm unter dem Vorwand des Schmerzes ausgeblüht hatte.
Nun aber war es vorbei, und diese Quelle einer ersten höheren Seligkeit hatte sich ihm erst durch ihr Versiegen fühlbar gemacht.
Zu dieser Zeit verloren sich die leidenschaftlichen Spuren der im Erwachen gewesenen Seele wieder aus seinen Briefen und an ihre Stelle traten ausführliche Beschreibungen des Lebens im Institute und der neugewonnenen Freunde.
Er selbst fühlte sich dabei verarmt und kahl, wie ein Bäumchen, das nach der noch fruchtlosen Blüte den ersten Winter erlebt.
Seine Eltern aber waren es zufrieden. Sie liebten ihn mit einer starken, gedankenlosen, tierischen Zärtlichkeit. Jedesmal, wenn er vom Konvikte Ferien bekommen hatte, erschien der Hofrätin nachher ihr Haus von neuem leer und ausgestorben, und noch einige Tage nach jedem solchen Besuche ging sie mit Tränen in den Augen durch die Zimmer, da und dort einen Gegenstand liebkosend berührend, auf dem das Auge des Knaben geruht oder den seine Finger gehalten hatten. Und beide hätten sie sich für ihn in Stücke reißen lassen.
Die unbeholfene Rührung und leidenschaftliche, trotzige Trauer seiner Briefe beschäftigte sie schmerzlich und versetzte sie in einen Zustand hochgespannter Empfindsamkeit, der heitere, zufriedene Leichtsinn, der darauf folgte, machte auch sie wieder froh und in dem Gefühle, daß hiedurch eine Krise überwunden worden sei, unterstützten sie ihn nach Kräften.
Weder in dem einen noch in dem andern erkannten sie das Symptom einer bestimmten seelischen Entwicklung, vielmehr hatten sie Schmerz und Beruhigung gleichermaßen als eine natürliche Folge der gegebenen Verhältnisse hingenommen. Daß es der erste, mißglückte Versuch des jungen, auf sich selbst gestellten Menschen gewesen war, die Kräfte des Inneren zu entfalten entging ihnen.
Törleß fühlte sich nun sehr unzufrieden und tastete da und dort vergeblich nach etwas Neuem, das ihm als Stütze hätte dienen können.
Eine Episode dieser Zeit war für das charakteristisch, was sich damals in Törleß zu späterer Entwicklung vorbereitete.
Eines Tages war nämlich der junge Fürst H. ins Institut eingetreten, der aus einem der einflußreichsten ältesten, und konservativsten Adelsgeschlechter des Reiches stammte.
Alle anderen fanden seine sanften Augen fad und affektiert; die Art und Weise, wie er im Stehen die eine Hüfte herausdrückte und beim Sprechen langsam mit den Fingern spielte, verlachten sie als weibisch. Besonders aber spotteten sie darüber, daß er nicht von seinen Eltern ins Konvikt gebracht worden war, sondern von seinem bisherigen Erzieher, einem doctor theologiae und Ordensgeistlichen.
Törleß aber hatte vom ersten Augenblicke an einen starken Eindruck empfangen. Vielleicht wirkte dabei der Umstand mit, daß es ein hoffähiger Prinz war, jedenfalls war es aber auch eine andere Art Mensch, die er da kennen lernte.
Das Schweigen eines alten Landedelschlosses und frommer Übungen schien irgendwie noch an ihm zu haften. Wenn er ging, so geschah es mit weichen, geschmeidigen Bewegungen, mit diesem etwas schüchternen Sichzusammenziehen und Schmalmachen, das der Gewohnheit eigen ist, aufrecht durch die Flucht leerer Säle zu schreiten, wo ein anderer an hundert unsichtbaren Ecken des leeren Raumes schwer anzurennen scheint.
Der Umgang mit dem Prinzen wurde so zur Quelle eines feinen psychologischen Genusses für Törleß. Er bahnte in ihm jene Art Menschenkenntnis an, die es lehrt, einen anderen nach dem Falle der Stimme, nach der Art, wie er etwas in die Hand nimmt, ja selbst nach dem timbre seines Schweigens und dem Ausdruck der körperlichen Haltung, mit der er sich in einen Raum fügt, kurz nach dieser beweglichen, kaum greifbaren und doch erst eigentlichen, vollen Art, etwas Seelisch-Menschliches zu sein, die um den Kern, das Greif-und Besprechbare, wie um ein bloßes Skelett herumgelagert ist, so zu erkennen und zu genießen, daß man die geistige Persönlichkeit dabei vorwegnimmt.
Törleß lebte während dieser kurzen Zeit wie in einer Idylle. Er stieß sich nicht an der Religiosität seines neuen Freundes, die ihm, der aus einem bürgerlich freidenkenden Hause stammte, eigentlich etwas ganz Fremdes war. Er nahm sie vielmehr ohne alles Bedenken hin, ja sie bildete in seinen Augen sogar einen besonderen Vorzug des Prinzen, denn sie potenzierte gewissermaßen das Wesen dieses Menschen, das er dem seinen völlig unähnlich, aber auch ganz unvergleichlich fühlte.
In der Gesellschaft dieses Prinzen fühlte er sich etwa wie in einer abseits des Weges liegenden Kapelle, so daß der Gedanke, daß er eigentlich nicht dorthin gehöre, ganz gegen den Genuß verschwand, das Tageslicht einmal durch Kirchenfenster anzusehen und das Auge so lange über den nutzlosen vergoldeten Zierat gleiten zu lassen, der in der Seele dieses Menschen aufgehäuft war, bis er von dieser selbst ein undeutliches Bild empfing, so als ob er, ohne sich Gedanken darüber machen zu können, mit dem Finger eine schöne, aber nach seltsamen Gesetzen verschlungene Arabeske nachzöge.
Dann kam es plötzlich zum Bruche zwischen beiden.
Wegen einer Dummheit, wie sich Törleß selbst hinterher sagen mußte.
Sie waren nämlich doch einmal ins Streiten über religiöse Dinge gekommen. Und in diesem Augenblicke war es eigentlich schon um alles geschehen. Denn wie von Törleß unabhängig schlug nun der Verstand in ihm unaufhaltsam auf den zarten Prinzen los. Er überschüttete ihn mit dem Spotte des Vernünftigen, zerstörte barbarisch das filigrane Gebäude, in dem dessen Seele heimisch war, und sie gingen im Zorne auseinander.
Seit der Zeit hatten sie auch kein Wort wieder zueinander gesprochen. Törleß war sich wohl dunkel bewußt, daß er etwas Sinnloses getan hatte, und eine unklare, gefühlsmäßige Einsicht sagte ihm, daß da dieser hölzerne Zollstab des Verstandes zu ganz unrechter Zeit etwas Feines und Genußreiches zerschlagen habe. Aber dies war etwas, das ganz außer seiner Macht lag. Eine Art Sehnsucht nach dem früheren war wohl für immer in ihm zurückgeblieben, aber er schien in einen anderen Strom geraten zu sein, der ihn immer weiter davon entfernte.
Nach einiger Zeit trat dann auch der Prinz, der sich im Konvikte nicht wohl befunden hatte, wieder aus.
Nun wurde es ganz leer und langweilig um Törleß. Aber er war einstweilen älter geworden, und die beginnende Geschlechtsreife fing an sich dunkel und allmählich in ihm emporzuheben. In diesem Abschnitt seiner Entwicklung schloß er einige neue, dementsprechende Freundschaften, die für ihn später von größter Wichtigkeit wurden. So mit Beineberg und Reiting, mit Moté und Hofmeier, eben jenen jungen Leuten, in deren Gesellschaft er heute seine Eltern zur Bahn begleitete.
Merkwürdigerweise waren dies gerade die Übelsten seines Jahrganges, zwar talentiert und selbstverständlich auch von guter Herkunft, aber bisweilen bis zur Roheit wild und ungebärdig. Und daß gerade ihre Gesellschaft Törleß nun fesselte, lag wohl an seiner eigenen Unselbständigkeit, die, seitdem es ihn von dem Prinzen wieder fortgetrieben hatte, sehr arg war. Es lag sogar in der geradlinigen Verlängerung dieses Abschwenkens, denn es bedeutete wie dieses eine Angst vor allzu subtilen Empfindeleien, gegen die das Wesen der anderen Kameraden gesund, kernig und lebensgerecht abstach.
Törleß überließ sich gänzlich ihrem Einflusse, denn seine geistige Situation war nun ungefähr diese: In seinem Alter hat man am Gymnasium Goethe, Schiller, Shakespeare, vielleicht sogar schon die Modernen gelesen. Das schreibt sich dann halbverdaut aus den Fingerspitzen wieder heraus. Römertragödien entstehen oder sensitivste Lyrik, die im Gewande seitenlanger Interpunktionen wie in der Zartheit durchbrochener Spitzenarbeit einherschreitet: Dinge, die an und für sich lächerlich sind, für die Sicherheit der Entwicklung aber einen unschätzbaren Wert bedeuten. Denn diese von außen kommenden Assoziationen und erborgten Gefühle tragen die jungen Leute über den gefährlich weichen seelischen Boden dieser Jahre hinweg, wo man sich selbst etwas bedeuten muß und doch noch zu unfertig ist, um wirklich etwas zu bedeuten. Ob für später bei dem einen etwas davon zurückbleibt oder bei dem andern nichts, ist gleichgültig, dann findet sich schon jeder mit sich ab, und die Gefahr besteht nur in dem Alter des Überganges. Wenn man da solch einem jungen Menschen das Lächerliche seiner Person zur Einsicht bringen könnte, so würde der Boden unter ihm einbrechen oder er würde wie ein erwachter Nachtwandler herabstürzen, der plötzlich nichts als Leere sieht.
Diese Illusion, dieser Trick zugunsten der Entwicklung fehlte im Institute. Denn dort waren in der Bibliothek wohl die Klassiker enthalten, aber diese galten als langweilig, und sonst fanden sich nur sentimentale Novellenbände und witzlose Militärhumoresken.
Der kleine Törleß hatte sie wohl alle in einer förmlichen Gier nach Büchern durchgelesen, irgendeine banal zärtliche Vorstellung aus ein oder der anderen Novelle wirkte manchmal auch noch eine Weile nach, allein einen Einfluß, einen wirklichen Einfluß, nahm dies auf seinen Charakter nicht.
Es schien damals, daß er überhaupt keinen Charakter habe.
Er schrieb zum Beispiel unter dem Einflusse dieser Lektüre selbst hie und da eine kleine Erzählung oder begann ein romantisches Epos zu dichten. In der Erregung über die Liebesleiden seiner Helden röteten sich dann seine Wangen, seine Pulse beschleunigten sich und seine Augen glänzten.
Wie er aber die Feder aus der Hand legte, war alles vorbei; gewissermaßen nur in der Bewegung lebte sein Geist. Daher war es ihm auch möglich, ein Gedicht oder eine Erzählung wann immer, auf jede Aufforderung hin, niederzuschreiben. Er regte sich dabei auf, aber trotzdem nahm er es nie ganz ernst und die Tätigkeit schien ihm nicht wichtig. Es ging von ihr nichts auf seine Person über, und sie ging nicht von seiner Person aus. Er hatte nur unter irgend einem äußeren Zwang Empfindungen, die über das Gleichgültige hinausgingen, wie ein Schauspieler hiezu des Zwanges einer Rolle bedarf.
Es waren Reaktionen des Gehirns. Das aber, was man als Charakter oder Seele, Linie oder Klangfarbe eines Menschen fühlt, jedenfalls dasjenige, wogegen die Gedanken, Entschlüsse und Handlungen wenig bezeichnend, zufällig und auswechselbar erscheinen, dasjenige, was beispielsweise Törleß an den Prinzen jenseits alles verstandlichen Beurteilens geknüpft hatte, dieser letzte, unbewegliche Hintergrund, war zu jener Zeit in Törleß gänzlich verloren gegangen.
In seinen Kameraden war es die Freude am Sport, das Animalische, welches sie eines solchen gar nicht bedürfen ließ, sowie am Gymnasium das Spiel mit der Literatur dafür sorgt.
Törleß war aber für das eine zu geistig angelegt und dem anderen brachte er jene scharfe Feinfühligkeit für das Lächerliche solcher erborgter sentiments entgegen, die das Leben im Institute durch seine Nötigung steter Bereitschaft zu Streitigkeiten und Faustkämpfen erzeugt. So erhielt sein Wesen etwas Unbestimmtes, eine innere Hilflosigkeit, die ihn nicht zu sich selbst finden ließ.
Er schloß sich seinen neuen Freunden an, weil ihm ihre Wildheit imponierte. Da er ehrgeizig war, versuchte er hie und da, es ihnen darin sogar zuvorzutun. Aber jedesmal blieb er wieder auf halbem Wege stehen und hatte nicht wenig Spott deswegen zu erleiden. Dies verschüchterte ihn dann wieder. Sein ganzes Leben bestand in dieser kritischen Periode eigentlich nur in diesem immer erneuten Bemühen, seinen rauhen, männlicheren Freunden nachzueifern, und in einer tief innerlichen Gleichgültigkeit gegen dieses Bestreben.
Besuchten ihn jetzt seine Eltern, so war er, solange sie allein waren, still und scheu. Den zärtlichen Berührungen seiner Mutter entzog er sich jedesmal unter einem anderen Vorwande. In Wahrheit hätte er ihnen gerne nachgegeben, aber er schämte sich, als seien die Augen seiner Kameraden auf ihn gerichtet.
Seine Eltern nahmen es als die Ungelenkigkeit der Entwicklungsjahre hin.
Nachmittag kam dann die ganze laute Schar. Man spielte Karten, aß, trank, erzählte Anekdoten über die Lehrer und rauchte die Zigaretten, die der Hofrat aus der Residenz mitgebracht hatte.
Diese Heiterkeit erfreute und beruhigte das Ehepaar.
Daß für Törleß mitunter auch andere Stunden kamen, wußten sie nicht. Und in der letzten Zeit immer zahlreichere. Er hatte Augenblicke, wo ihm das Leben im Institute völlig gleichgültig wurde. Der Kitt seiner täglichen Sorgen löste sich da und die Stunden seines Lebens fielen ohne innerlichen Zusammenhang auseinander.
Er saß oft lange – in finsterem Nachdenken – gleichsam über sich selbst gebeugt.
Zwei Besuchstage waren es auch diesmal gewesen. Man hatte gespeist, geraucht, eine Spazierfahrt unternommen, und nun sollte der Eilzug das Ehepaar wieder in die Residenz zurückführen.
Ein leises Rollen in den Schienen kündigte sein Nahen an und die Signale der Glocke am Dache des Stationsgebäudes klangen der Hofrätin unerbittlich ins Ohr.
»Also nicht wahr, lieber Beineberg, Sie geben mir auf meinen Buben acht?« wandte sich Hofrat Törleß an den jungen Baron Beineberg, einen langen, knochigen Burschen mit mächtig abstehenden Ohren, aber ausdrucksvollen, gescheiten Augen.
Der kleine Törleß schnitt ob dieser Bevormundung ein mißmutiges Gesicht und Beineberg grinste geschmeichelt und ein wenig schadenfroh.
»Überhaupt«, – wandte sich der Hofrat an die übrigen, – »möchte ich Sie alle gebeten haben, falls meinem Sohne irgend etwas sein sollte, mich gleich davon zu verständigen.«
Dies entlockte nun doch dem jungen Törleß ein unendlich gelangweiltes: »Aber Papa, was soll mir denn passieren?!« obwohl er schon daran gewöhnt war, bei jedem Abschiede diese allzugroße Sorgsamkeit über sich ergehen lassen zu müssen.
Die anderen schlugen indessen die Hacken zusammen, wobei sie die zierlichen Degen straff an die Seite zogen, und der Hofrat fügte noch hinzu: »Man kann nie wissen, was vorkommt, und der Gedanke, sofort von allem verständigt zu werden, bereitet mir eine große Beruhigung: schließlich könntest du doch auch am Schreiben behindert sein.«
Dann fuhr der Zug ein. Hofrat Törleß umarmte seinen Sohn, Frau von Törleß drückte den Schleier fester ans Gesicht, um ihre Tränen zu verbergen, die Freunde bedankten sich der Reihe nach, dann schloß der Schaffner die Wagentür.
Noch einmal sah das Ehepaar die hohe, kahle Rückfront des Institutsgebäudes, – die mächtige, langgestreckte Mauer, welche den Park umschloß, dann kamen rechts und links nur mehr graubraune Felder und vereinzelte Obstbäume.
Die jungen Leute hatten unterdessen den Bahnhof verlassen und gingen in zwei Reihen hintereinander auf den beiden Rändern der Straße, – so wenigstens dem dicksten und zähesten Staube ausweichend, – der Stadt zu, ohne viel miteinander zu reden.
Es war fünf Uhr vorbei und über die Felder kam es ernst und kalt, wie ein Vorbote des Abends.
Törleß wurde sehr traurig.
Vielleicht war daran die Abreise seiner Eltern schuld, vielleicht war es jedoch nur die abweisende, stumpfe Melancholie, die jetzt auf der ganzen Natur ringsumher lastete und schon auf wenige Schritte die Formen der Gegenstände mit schweren glanzlosen Farben verwischte.
Dieselbe furchtbare Gleichgültigkeit, die schon den ganzen Nachmittag über allerorts gelegen war, kroch nun über die Ebene heran, und hinter ihr her wie eine schleimige Fährte der Nebel, der über den Sturzäckern und bleigrauen Rübenfeldern klebte.
Törleß sah nicht rechts noch links, aber er fühlte es. Schritt für Schritt trat er in die Spuren, die soeben erst vom Fuße des Vordermanns in dem Staube aufklafften – und so fühlte er es: als ob es so sein müßte: als einen steinernen Zwang, der sein ganzes Leben in diese Bewegung – Schritt für Schritt – auf dieser einen Linie, auf diesem einen schmalen Streifen, der sich durch den Staub zog, einfing und zusammenpreßte.
Als sie an einer Kreuzung stehen blieben, wo ein zweiter Weg mit dem ihren in einen runden, ausgetretenen Fleck zusammenfloß, und als dort ein morschgewordener Wegweiser schief in die Luft hineinragte, wirkte diese, mit ihrer Umgebung in Widerspruch stehende, Linie wie ein verzweifelter Schrei auf Törleß.
Wieder gingen sie weiter. Törleß dachte an seine Eltern, an Bekannte, an das Leben. Um diese Stunde kleidet man sich für eine Gesellschaft an oder beschließt ins Theater zu fahren. Und nachher geht man ins Restaurant, hört eine Kapelle, besucht das Kaffeehaus. Man macht eine interessante Bekanntschaft. Ein galantes Abenteuer hält bis zum Morgen in Erwartung. Das Leben rollt wie ein wunderbares Rad immer Neues, Unerwartetes aus sich heraus …
Törleß seufzte unter diesen Gedanken und bei jedem Schritte, der ihn der Enge des Institutes näher trug, schnürte sich etwas immer fester in ihm zusammen.
Jetzt schon klang ihm das Glockenzeichen in den Ohren. Nichts fürchtete er nämlich so sehr wie dieses Glockenzeichen, das unwiderruflich das Ende des Tages bestimmte – wie ein brutaler Messerschnitt.
Er erlebte ja nichts und sein Leben dämmerte in steter Gleichgültigkeit dahin, aber dieses Glockenzeichen fügte dem auch noch den Hohn hinzu und ließ ihn in ohnmächtiger Wut über sich selbst, über sein Schicksal, über den begrabenen Tag erzittern.
Nun kannst du gar nichts mehr erleben, während zwölf Stunden kannst du nichts mehr erleben, für zwölf Stunden bist du tot …: das war der Sinn dieses Glockenzeichens.
Als die Gesellschaft junger Leute zwischen die ersten niedrigen, hüttenartigen Häuser kam, wich dieses dumpfe Brüten von Törleß. Wie von einem plötzlichen Interesse erfaßt, hob er den Kopf und blickte angestrengt in das dunstige Innere der kleinen, schmutzigen Gebäude, an denen sie vorübergingen.
Vor den Türen der meisten standen die Weiber, in Kitteln und groben Hemden, mit breiten, beschmutzten Füßen und nackten, braunen Armen.
Waren sie jung und drall, so flog ihnen manches derbe slawische Scherzwort zu. Sie stießen sich an und kicherten über die »jungen Herren«; manchmal schrie eine auch auf, wenn im Vorübergehen allzu hart ihre Brüste gestreift wurden, oder erwiderte mit einem lachenden Schimpfwort einen Schlag auf die Schenkel. Manche sah auch bloß mit zornigem Ernste hinter den Eilenden drein; und der Bauer lächelte verlegen – halb unsicher, halb gutmütig – wenn er zufällig hinzugekommen war.
Törleß beteiligte sich nicht an dieser übermütigen, frühreifen Männlichkeit seiner Freunde.
Der Grund hiezu lag wohl teilweise in einer gewissen Schüchternheit in geschlechtlichen Sachen, wie sie fast allen einzigen Kindern eigentümlich ist, zum größeren Teile jedoch in der ihm besonderen Art der sinnlichen Veranlagung, welche verborgener, mächtiger und dunkler gefärbt war als die seiner Freunde und sich schwerer äußerte.
Während die anderen mit den Weibern schamlos – taten, beinahe mehr um »fesch« zu sein als aus Begierde, war die Seele des schweigsamen, kleinen Törleß aufgewühlt und von wirklicher Schamlosigkeit gepeitscht.
Er blickte mit so brennenden Augen durch die kleinen Fenster und winkligen, schmalen Torwege in das Innere der Häuser, daß es ihm beständig wie ein feines Netz vor den Augen tanzte.
Fast nackte Kinder wälzten sich in dem Kot der Höfe, da und dort gab der Rock eines arbeitenden Weibes die Kniekehlen frei oder drückte sich eine schwere Brust straff in die Falten der Leinwand. Und als ob all dies selbst unter einer ganz anderen, tierischen, drückenden Atmosphäre sich abspielte, floß aus dem Flur der Häuser eine träge, schwere Luft, die Törleß begierig einatmete.
Er dachte an alte Malereien, die er in Museen gesehen hatte, ohne sie recht zu verstehen. Er wartete auf irgend etwas, so wie er vor diesen Bildern immer auf etwas gewartet hatte, das sich nie ereignete. Worauf …?… Auf etwas Überraschendes, noch nie Gesehenes; auf einen unerhörten Anblick, von dem er sich nicht die geringste Vorstellung machen konnte; auf irgend etwas von fürchterlicher, tierischer Sinnlichkeit; das ihn wie mit Krallen packe und von den Augen aus zerreiße; auf ein Erlebnis, das in irgendeiner noch ganz unklaren Weise mit den schmutzigen Kitteln der Weiber, mit ihren rauhen Händen, mit der Niedrigkeit ihrer Stuben, mit … mit einer Beschmutzung an dem Kot der Höfe … zusammenhängen müsse…. Nein, nein; … er fühlte jetzt nur mehr das feurige Netz vor den Augen; die Worte sagten es nicht; so arg, wie es die Worte machen, ist es gar nicht; es ist etwas ganz Stummes, – ein Würgen in der Kehle, ein kaum merkbarer Gedanke und nur dann, wenn man es durchaus mit Worten sagen wollte, käme es so heraus; aber dann ist es auch nur mehr entfernt ähnlich, wie in einer riesigen Vergrößerung, wo man nicht nur alles deutlicher sieht, sondern auch Dinge, die gar nicht da sind .. Dennoch war es zum Schämen.
»Hat das Bubi Heimweh?« fragte ihn plötzlich spöttisch der lange und um zwei Jahre ältere v. Reiting, welchem Törleß’ Schweigsamkeit und die verdunkelten Augen aufgefallen waren. Törleß lächelte gemacht und verlegen und ihm war, als hätte der boshafte Reiting die Vorgänge in seinem Innern belauscht.
Er gab keine Antwort. Aber sie waren mittlerweile auf den Kirchplatz des Städtchens gelangt, der die Form eines Quadrates hatte und mit Katzenköpfen gepflastert war, und trennten sich nun voneinander.
Törleß und Beineberg wollten noch nicht ins Institut zurück, während die andern keine Erlaubnis zu längerem Ausbleiben hatten und nach Hause gingen.
Die beiden waren in der Konditorei eingekehrt.
Dort saßen sie an einem kleinen Tische mit runder Platte, neben einem Fenster, das auf den Garten hinausging, unter einer Gaskrone, deren Lichter hinter den milchigen Glaskugeln leise summten.