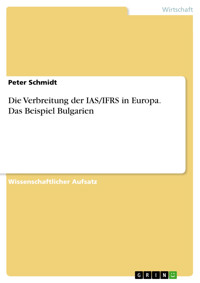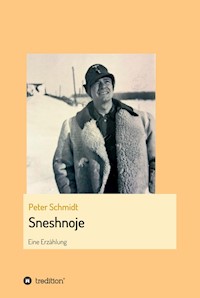5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ferdinand, der Sohn des österreichischen Konditormeisters Waginger und seiner Frau, wächst im Berlin der dreißiger Jahre auf, überlebt als Soldat durch glückliche Umstände den Weltkrieg, folgt seinen musikalischen Neigungen und beginnt eine Laufbahn als Dirigent. Als fünfzig Jahre nach Kriegsende die NS-Vergangenheit prominenter Angehöriger der sogenannten Flakhelfergeneration durchleuchtet wird, vertuschen, leugnen oder verharmlosen viele von ihnen belastende Details ihrer Biografie. Auch Ferdinand Waginger, der inzwischen weltberühmte Maestro, gerät ins Fadenkreuz der "Nazi-Jäger" bekennt Farbe und legt öffentlich Rechenschaft über sich und sein Leben in jener Zeit ab. Und dennoch holt ihn seine Vergangenheit ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Peter Schmidt
Die Wahrheit glaubt dir erstmal keiner
Roman
© 2020 Peter Schmidt
Umschlaggestaltung: kunstmacher
Titelbild: Gerd Altmann auf Pixabay
Lektorat: MGS
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 42, 22359 Hamburg
ISBN
978-3-347-11761-7 (Paperback)
978-3-347-11762-4 (Hardcover)
978-3-347-11763-1 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Impulse für dieses Buch verdanke ich Dieter W., dem ich nie begegnet bin, und von dem ich nicht einmal weiß, ob er den Krieg überlebt hat. Die Figur des Ferdinand Waginger entstand aus Bruchstücken einer Handvoll nachgelassener Briefe eben dieses Mannes aus den Jahren 1942/43.
Die Handlung des Romans und seine Figuren, mit Ausnahme zeitgeschichtlicher Personen, sind frei erfunden.
ERSTER TEIL
Eine waagrechte Wolkenschicht aus Zigarrenrauch teilte das Rektoratszimmer in eine obere und eine untere Hälfte. Nur, als er zur Begrüßung Haltung einnahm und sich reckte, konnte er den massiven Schädel des Oberstudiendirektors oberhalb der Qualmschicht erkennen. Sogleich tränten seine Augen und er musste husten.
Mit seiner tabakgebeizten, deckenhohen Holztäfelung wirkte das Turmzimmer auf Ferdinand jedes Mal beklemmend, obwohl er diesen Ort weit besser kannte als viele seiner Mitschüler. Nur ein einziges Mal, er war noch Sextaner, musste er in diesem Raum als Strafe für eine Mutprobe eine gepfefferte Standpauke samt Ohrfeige über sich ergehen lassen. Es hatte sich so lustig und so täuschend ähnlich angehört, als er am Morgen dem Pedell statt „Heil Hitler!“ „Dreiliter!“ zugerufen hatte.
Von diesem Vorfall abgesehen, waren später ausschließlich Lob und Auszeichnungen für herausragende sportliche Leistungen Anlässe, zu denen er zu erscheinen hatte.
Der flinke Blondschopf aus der Unterprima war ein guter Leichtathlet, im Hürdenlauf immer Schulbester und darum sehr gefragt bei Wettkämpfen. Dem Schulchor war er eine wertvolle Stütze, übertraf seine Mitsänger nicht nur an Körpergröße, sondern auch mit seiner schönen Stimme. Man war stolz auf den einzigen Sohn des Bäcker- und Konditormeisters Alois Waginger.
Schulleiter Wuttke erwiderte den Gruß mit fahrig ausgestrecktem rechtem Arm und wedelte unter Zuhilfenahme einer Zeitung energisch Rauchschwaden beiseite, um sein Gegenüber besser sehen zu können.
„Lies selbst, Waginger“, hustete jetzt auch er, warf die Zeitung vor sich auf den Tisch und klopfte mit dem Zeigefinger auf die rot unterstrichene Schlagzeile der Ausgabe vom 25. März 1939.
Obwohl Ferdinand, mit Ausnahme seiner jüdischen Mitschüler, als einziger nicht der HJ angehörte, hatte ihm das bisher nur selten zum Nachteil gereicht. Studienrat Bröker, den alle nur Brö nannten, pflegte mit ihm außerhalb des Unterrichts sogar ein fast freundschaftliches Verhältnis. Der junge, engagierte Deutsch- und Musiklehrer verstand es, die musischen Talente seines begabten Schülers zu fördern, inszenierte Sketche und kleine Theaterstücke, mit denen sie gemeinsam auf Festen auftraten oder durch die Gemeindehäuser tingelten. Bisweilen konnte Brö auch vor der Klasse nicht von seiner Leidenschaft lassen und dröhnte, als spräche der Führer an sein Volk, Ferdinand solle ihm bloß nicht seine Eltern in die Schule schicken. Er sähe sich sonst gezwungen ihnen zu erzählen, was für ein Faulpelz ihr Sohn sei.
Dann blitzte jedes Mal Ferdinands schauspielerisches Talent auf, wenn er sich zum Vergnügen seiner Mitschüler mal reichlich geknickt gab oder mit geschickten Worten konterte. Auch sein Klassenlehrer Schröder, der nicht nur wegen der wunderlichen Art sich zu kleiden, sondern auch seines Verhaltens wegen von Kollegen wie Schülern liebevoll ‚Frontgeist‘ genannt wurde, war Ferdinand stets wohl gesonnen.
„Begreifst du, was das bedeutet?“ polterte Wuttke, legte seine Zigarre für einen Moment auf den Rand des Aschenbechers, schaute Ferdinand mit hochgezogenen Augenbrauen erwartungsvoll an und hielt ihm die aktuelle Ausgabe des Völkischen Beobachters vors Gesicht:
2. Jugenddienstverordnung zum HJ-Gesetz erlassen
„Bis jetzt konnte ich gegenüber der Parteileitung noch immer begründen, weshalb ich bei dir ständig ein Auge zugedrückt habe“, fuhr er im Flüsterton fort, denn er wusste, dass die Wände seines Rektorats Ohren hatten. „Ab jetzt wird das nicht mehr so ohne weiteres möglich sein“, tuschelte er, um urplötzlich, und ausschließlich an die Adresse seines linientreuen Vorzimmerdrachens gerichtet, loszubrüllen: „Mit mir nicht, das sage ich Ihnen, Waginger, mit mir nicht!“ Seine Entschlossenheit bekräftigend knallte er die Faust wie einen Dampfhammer auf die Tischplatte, was den vor sich hin kokelnden Zigarrenstumpen vollends zum Absturz in den Aschenbecher brachte, was bei Beiden Belustigung auslöste. Während Wuttke den stinkenden Brandrest aus der Asche fingerte und seine Stimme erneut dämpfte, zwinkerte er Ferdinand verschwörerisch zu.
„Jedenfalls eines muss dir klar sein, wir werden dich unmöglich zur Reifeprüfung zulassen können, wenn du weiterhin der Hitlerjugend fernbleibst. Ab sofort können deine Eltern sogar gezwungen werden dich dort anzumelden. Besprecht das bitte zuhause.“
Unter der Tür brüllte er noch einmal theatralisch: „Und jetzt raus!“, schubste Ferdinand aus dem Zimmer und knallte die Tür hinter ihm zu.
„War`s schlimm?“ heuchelte Frau Bolz Mitleid als Ferdinand sehr überzeugend den gebrochenen Helden mimte und mit hängenden Schultern stumm durchs Sekretariat schlich.
„Köstlich, einfach köstlich Ihre Pralinen, Waginger! Meine Trude sagt immer: wie gut, dass der Führer Österreich heimgeholt hat ins Reich, sonst wären uns diese Köstlichkeiten nicht vergönnt gewesen! Nicht auszudenken! Da muss ich ihr ausnahmsweise zustimmen.“
Mit der gebotenen Demut, verbrämt mit angeborenem österreichischem Schmäh, nötigte Herr Waginger den hochverehrten Herrn Ortsgruppenleiter, doch auch einmal die Fondant-Pralinen zu probieren, seine neueste Kreation nach geheimer Rezeptur der Urgroßmutter mütterlicherseits.
Der ließ sich nicht zweimal bitten und, als er seine genießerisch geschlossenen Augen wieder aufschlug, überreichte ihm Waginger noch eine Kostprobe seiner teuersten Schokolade.
„Für`d gnä Frau Gemahlin mit die bestn Empfehlungen vom Haus, wo die Frau Ortsgruppenleiter sölbstredend ollaweil hochwillkommen is.“
Sich die letzten Spuren des Fondants von den Fingern leckend, wechselte der Parteimann unvermittelt den Ton und wurde amtlich.
„Sie wissen schon, weshalb ich hier bin?“ schnarrte er. Natürlich hatte Meister Waginger diese Zeitung überflogen, die er zwar verabscheute, die nicht zur Kenntnis zu nehmen er sich aber als Geschäftsmann in diesen Zeiten nicht leisten konnte. Vorsichtshalber deponierte er das tägliche Exemplar gut sichtbar im Laden.
„Wahrscheinlich wieder ween dem Ferdi“, seufzte Waginger.
„Stimmt genau! Ihre verstockte und unverständliche Weigerung, ihn zur HJ anzumelden, kann nun, erst recht nach der neuesten Gesetzeslage, nicht länger toleriert werden. Wir hatten, weiß Gott, genug Geduld, aber jetzt ist Schluss. Ohne Beitritt zur Hitlerjugend wird er die Schule verlassen müssen und die Zulassung zum Abitur kann er vergessen. Sagen Sie ihm das. Sie machen sich als Eltern strafbar, wenn Sie die Aufnahme Ihres Sohnes weiterhin hintertreiben. Längst überfällig, dieses neue Gesetz! Zwingen Sie mich also nicht, demnächst nicht nur zum Vergnügen, sondern in dienstlicher Angelegenheit in Ihrem Geschäft erscheinen zu müssen. Mein Arm reicht weit, aber auch ich habe Anweisungen und wie jeder aufrechte Volksgenosse meine Pflicht zu erfüllen“, schlug die Hacken zusammen, drehte sich zur Tür und verließ mit zackigem Deutschem Gruß das Ladengeschäft.
„An guaten Doag no und ergebenste Grüße an die Frau Gemahlin“, stammelte Waginger, aber der Ortsgruppenleiter war schon außer Hörweite.
Nach dem Abendessen erschien Herrn Waginger der Zeitpunkt günstig, Ferdinand vom Besuch des Ortsgruppenleiters zu berichten. Frau Waginger war damit beschäftigt, das jüngste Familienmitglied zu Bett zu bringen, und so waren Vater und Sohn ungestört. Lange Jahre hatte das Ehepaar Waginger nicht mehr mit einem weiteren Kind gerechnet. Umso liebevoller wurde Trinchen, wie alle sie nannten, in der Familie willkommen geheißen. Sie war jetzt in einem Alter, in dem die Erwachsenen schon sehr auf ihre Worte achten mussten, da die Kleine wahllos alles nachplapperte, was sie aufschnappte.
„Ja“, sagte Ferdinand, „genau wegen dieses neuen Gesetzes hat mich Wuttke heute ins Rektorat bestellt. Wenn ich nicht der HJ beitrete, könne ich auch nicht zum Abitur zugelassen werden. Vielleicht müsste ich sogar die Schule verlassen. Er würde es nicht verhindern können.“
Hätte er von sich aus entscheiden können, so wäre Ferdinand der Hitlerjugend schon längst beigetreten. Doch seine Eltern, besonders seine Mutter, waren von Beginn an dagegen gewesen. Vater Waginger, aus einem katholisch geprägten Wiener Elternhaus stammend, war 1918 als junger Mann kriegsversehrt heimgekehrt und wollte seinem einzigen Sohn ein ähnliches Schicksal ersparen. Seit Hitlers Konkordat mit der katholischen Kirche waren seine Vorbehalte gegen den Landsmann Hitler zwar kleiner geworden, aber als die Nationalsozialisten die Synagogen ansteckten, konnte auch er das nicht gutheißen. Zumal er die Bestimmungen der Nürnberger Rassengesetze nicht teilte und das nicht nur, weil er zahlreiche jüdische Kundschaft hatte.
Mutter Waginger stammte aus einer sozialdemokratischen Familie und war in der Distanz zur Ideologie der Nationalsozialisten mit ihrem Mann zwar grundsätzlich einig, vertrat dies jedoch kompromissloser als er. Nicht erst, als am 10. Mai 1933 Bücher von für verfemt erklärten Schriftstellern im ganzen Reich öffentlich verbrannt worden waren, schwante ihr, dass das erst der Anfang sein würde. Ihre kompromisslose Haltung zeigte sich auch, als die Nazis 1934 die Elternbeiräte in den Schulen abschafften, um der Partei stärkeren Einfluss zu ermöglichen.
Direktor Wuttkes Vorgänger, ein strammer Nazi der ersten Stunde, der kurz darauf die Schulleitung abgab, um Parteikarriere zu machen, hatte zu einer als Konzertabend deklarierten Veranstaltung alle Elternvertreter in die Schule geladen, um den Anwesenden mitzuteilen, nicht länger gebraucht zu werden. Als Einzige traute sich Frau Waginger, das nicht unwidersprochen zu akzeptieren, verließ unter Protest die Veranstaltung und war fortan noch entschiedener gegen die Nazis und ihre Pläne als zuvor. Lediglich aus Geschäftsräson und auf inständiges Bitten ihres Mannes hielt sie ihre politische Einstellung außerhalb der Familie, so gut es ging, zurück. Hinter verschlossenen Türen aber machte sie ihrem Zorn häufig Luft, was zunehmend vor allem mit Ferdinand zu Konflikten führte. „Alle meine Schulkameraden sind dabei, nur ich nicht, weil ihr mich nicht lasst“, war Ferdinand immer wieder trotzig den mütterlichen Argumenten entgegengetreten.
„Halt dich da raus,“ mahnte sie ihn dann. „Auch wenn´s dir schwerfällt. Das ist nichts für dich! Da werden aus unseren Jungs künftige Soldaten gemacht. Segelfliegen und Motorradfahren, Tauchen oder Funken lernt man da, ich weiß. Mit Speck fängt man Mäuse! Aber auch Gräben schaufeln, Schießen und Fallschirmspringen. Wenn die Halunken damit die Jugend erst einmal eingefangen haben, lassen sich aus den Jungen schneller brauchbare Soldaten machen. Später sollen sie ihr Leben für Deutschland und den Führer geben!“
Bei diesem Thema konnte sie sich so richtig in Rage reden. „Und genauso machen sie es mit den Mädchen beim BDM. Weißt du, was die dort lernen? Na, sag schon“, forderte sie ihn heraus.
Aber außer Tanzen, Singen, Handarbeiten und Kochen fiel Ferdi nichts ein.
„Stimmt ja alles“, bestätigte Frau Waginger. „Aber hauptsächlich sollen sie einmal brave Hausfrauen und Mütter werden, die dem Führer möglichst viele Kinder gebären, damit er immer genügend Soldaten zur Verfügung hat für seine verrückten Eroberungspläne.
Jugend dient dem Führer!
Du kennst die Plakate doch auch!“ Natürlich kannte er die, hatte aber trotzdem keine Idee, was er Mutters Argumenten entgegenhalten sollte. Was seine Mitschüler von den Kameradschaftsabenden und Ferien-Zeltlagern berichteten, klang völlig anders. Vielleicht hat Mutter sich da einfach verrannt, dachte er dann, denn ihre grundsätzliche Ablehnung der neuen Zeit war ihm ja nicht unbekannt. Als ob sie lesen konnte was in ihm vorging, holte sie ihn aus seinen Gedanken.
„Und was sagst du zu dem Foto neulich in der Zeitung, das von dem Großzeltlager der Hitlerjugend. Dieses riesige Plakat! Irgendwo da unten in Oberbayern war das. Aidling am Riegsee - jetzt fällts mir wieder ein.
Wir sind zum Sterben für Deutschland geboren!
Glaubst du immer noch, das sei eventuell nicht so ernst gemeint?“ Diese Nazis trauen sich doch mittlerweile ganz unverblümt zu sagen, was sie vorhaben, und keiner stellt sich ihnen in den Weg. Es kann doch wohl nicht angehen, dass die Leute das nur für Gerede halten! Ich fürchte, die meisten sind so total verblendet, dass sie das tatsächlich glauben. Ich will nicht, dass mein einziger Sohn für diese verbohrten Ideen verheizt wird. Deine Fähigkeiten liegen ganz woanders, du bist nicht zum Kämpfen geboren. Mit dem, was du kannst, wirst du deinem Land dereinst bei weitem nützlicher sein können. Falls das deutsche Volk je wieder zur Vernunft kommen sollte!“
Ferdinand war jedes Mal total verunsichert, wenn sie so redete und ihm einschärfte, ihre Worte um Gottes willen für sich zu behalten. Möglicherweise hatte sie ja doch recht. Andererseits, warum erwähnte sie denn nicht auch das Positive, das die Nationalsozialisten seit ihrem Machtantritt schon in kurzer Zeit bewerkstelligt hatten. Den Aufschwung der Wirtschaft, den Rückgang der Arbeitslosigkeit. Sie sah oft alles wirklich viel zu düster. Mutter liebte ihn doch, wieso wollte sie nicht einsehen, dass er immer weniger Lust dazu hatte, noch länger abseits zu stehen. Stets hatte er sich dem elterlichen Willen gebeugt. Doch dass er einmal nicht zum Abitur zugelassen, oder gar ganz von der Schule fliegen würde, konnten die Eltern doch im Ernst nicht wollen! Er selbst war zu diesem Opfer jedenfalls nicht bereit. Das sagte er auch seinem Vater, als der von den Drohungen des Leiters der Ortsgruppe Schlachtensee berichtete.
„Dös wird scho irgendwie wern, s´is no nie nix so heiß gessn worn, als wies vom Herd kummn is!“
„Päpps, ich glaube, du verkennst die Lage!“
Immer kam Vater mit solchen Sprüchen daher, vor allem, wenn er selbst nicht weiterwusste. Mag ja sein, dass es Lebenslagen gibt, in denen solche Allerweltsfloskeln hilfreich sind. Aber jetzt nicht, da war Ferdinand sich sicher. „Ich helf dir gern im Geschäft, Vater, das weißt du. Aber ohne Reifezeugnis von der Schule abzugehen, das könnt ihr nicht von mir verlangen!“
Hinter Ferdinands Wunsch, nun endlich in die HJ eintreten zu dürfen, steckten allerdings noch ganz andere Triebkräfte.
Es wäre ihm peinlich gewesen, dem Vater und schon gar nicht seiner Mutter, die sich jetzt wieder zu ihnen gesetzt hatte, auch nur ein Sterbenswörtchen von der flüchtigen Begegnung zu erzählen, die ihn erst vor kurzem ziemlich durcheinandergebracht hatte. Bei einer Chorveranstaltung hatte er mehrere Solopartien zu singen. Jedes Mal, wenn er dazu nach vorne an den Bühnenrand trat, himmelten ihn drei Augenpaare aus der ersten Reihe unablässig an. Die flotten BDM-Mädels in weißer Bluse, schwarzem Halstuch und blauen Röcken brachten ihn fast aus dem Konzept. Bravo, du da, mit dem Kussmund! rief ihm die hübscheste der drei im Schutz des lebhaften Schlussbeifalls zu. Doch noch ehe er reagieren konnte, waren die drei Schönen kichernd in der Menge verschwunden.
Mal wieder eine günstige Gelegenheit verpasst, haderte er mit sich. Doch bei aller Reue machte ihn die Begebenheit auch ganz schön stolz.
Jochen Kröger war nur wenige Jahre älter, aber mit seinen knapp zwanzig Jahren im Umgang mit Mädchen doch schon recht erfahren. Als frischgebackener Rekrut in Ausbildung hatte er bei der Truppe zwar noch überhaupt nichts zu melden, aber wenn er zuhause in Uniform auftauchte, flogen ihm die Herzen der Mädels zu und andauernd hatte er eine andere.
„Schon mal gehört, die inoffizielle Abkürzung für BDM?“, feixte Jochen und weidete sich an Ferdis ratlosem Gesicht. „Bubi Drück Mich“, prustete er los. „Falls du mal andere Versionen hören solltest - das ist noch die harmloseste von allen. Mensch trau dich einfach mal was, kannst dir doch nicht immerzu selber die Palme schütteln!“
Ferdi fühlte sich ertappt und wurde rot.
„Dann verzichtest du eben erstmal auf die Reifeprüfung und wenn sie dich von der Schule werfen, kannst du bei Vater immer noch eine ordentliche Lehre machen und dann sehen wir weiter“, klinkte sich Frau Waginger wieder ins Gespräch ein. Ihr Mann runzelte die Stirn, wollte ihr im Beisein des Jungen aber nicht in den Rücken fallen. „Kommt Zeit, kommt Rat!“, war alles, was er in linkischer Unverbindlichkeit zu sagen wagte, jedoch in keiner Weise zur Lösung des Problems beitrug.
„Ihr könntet wirklich ein bisschen mehr hinter mir stehen!“, begehrte Ferdi auf, „und allmählich damit aufhören, mir ständig Vorschriften zu machen. Bin alt genug, eigene Entscheidungen zu treffen. Außerdem hätte ich, um der HJ beizutreten, schon bisher euere Einwilligung überhaupt nicht gebraucht“, trumpfte er auf.
Nie zuvor hatte er mit seinen Eltern in diesem Ton geredet, aber jetzt musste es endlich einmal sein, davon war er überzeugt.
Vorne im Laden klopfte es an die Eingangstür.
„Mir ham scho lang gschlossn!“ rief Waginger von hinten durch die Wohnung in den Verkaufsraum und schickte vernehmlich ein „Kruzitürken no amol!“ hinterher. „Kommens morgn wieder, ab Achte is offn.“
Neugierig, wer da zu dieser Stunde noch Einlass begehrte, erhob er sich aber doch und tastete sich in den dunklen Verkaufsraum. Noch immer war nicht erkennbar, wer da vor der Tür stand, da klopfte es erneut an die Schaufensterscheibe. Diesmal kräftiger als bei ersten Mal. „Herr Waginger, Studienrat Bröker hier, bitte öffnen Sie, es ist dringend.“
Als Brö die Stube betrat, saß Ferdinand mit hochrotem Kopf am Wohnzimmertisch. Frau Waginger schien geweint zu haben, reichte Herrn Bröker dennoch tapfer die feuchte Hand und bat darum, sie für einen Augenblick zu entschuldigen, sie müsse nur kurz nachsehen, ob die Kleine eingeschlafen sei.
„Hoffentlich bringen´s koane schlechtn Nochrichtn“, räusperte sich der Konditor, bot dem Gast einen Stuhl an und schob ihm den Teller mit Konfekt hin. „Bittschön, bedienens Ihnen, Herr Studienrat.“
Dankbar stürzte sich Bröker auf ein Fondant-Stückchen und fasste ungeniert noch einige Male nach, bis sich auch Frau Waginger wieder zu ihnen gesellte.
„Nichts für ungut, ich möchte mich keinesfalls in Ihre Angelegenheiten einmischen, doch nehme ich an, Ferdis Zukunft ist Ihnen mindestens ebenso wichtig wie mir. Alle hier am Tisch wissen, dass seine unterrichtlichen Leistungen nicht immer Anlass zu großer Freude bieten. Mir und vielen meiner Kollegen, ganz besonders auch Herrn Oberstudiendirektor Wuttke, liegt Ferdis Verbleib an unserer Schule dennoch sehr am Herzen. Seine sportlichen Erfolge sind Aushängeschild unserer Anstalt und sein musisches Talent schmückt Schulchor und Theatergruppe. Was sollten wir bloß ohne ihn tun? Doch wie Sie wissen, verlangt die neue Rechtslage klare Entscheidungen.“
Stumm senkten zwei der drei Wagingers den Blick auf die Tischplatte, beide mit den gleichen Gedanken hinter der Stirn. Nur Frau Waginger schien die Ruhe selbst zu sein. Nach einer kleinen Pause, in der er sich abermals am Konfekt bediente, verkündete Brö mit vollem Mund:
„Aber es gibt eine Lösung!“
Ruckartig schnellten die Köpfe der männlichen Wagingers wieder nach oben und fixierten den Gast voller Neugier.
„Dass Sie seinen Eintritt in die HJ kategorisch ablehnen, und auch er selbst lange Zeit keine Notwendigkeit dazu sah, hat mir Ferdi anvertraut. Seien Sie versichert, das bleibt vollständig unter uns.
Mit dem neuen Gesetz sieht die Sachlage inzwischen allerdings anders aus. Davon unabhängig müssen Sie zur Kenntnis nehmen, dass gleichaltrige Jungs und Mädchen in Ferdis Leben eine zunehmend größere Rolle spielen und er verständlicherweise nicht abseitsstehen möchte.“
Der junge Waginger musste schlucken. Hatte Brö etwa von der Sache mit den drei Mädels Wind bekommen?
„Und worin besteht also nun die Lösung, die Sie vorschlagen“? drängelte Frau Waginger.
„Greifen´s nur zu, Herr Oberstudienrat, wann´s Ihnen doch schmeckt. S´ís gnug im Haus!“, ermunterte ihn ihr Mann. Dem Schulmeister war Frau Wagingers kritischer Blick natürlich nicht entgangen, er zierte sich deshalb ein wenig, war aber letztlich nicht in der Lage, den steirischen Köstlichkeiten des Konditors ernsthaften Widerstand entgegen zu setzen. Und so genehmigte er sich eine weitere Praline.
„Leider immer noch ohne Ober-, Herr Waginger, leider“, winkte Brö lächelnd ab.
„Aber verdient hättens des scho, so wia I des siag“, grinste der alte Charmeur, sichtlich bemüht dem kauenden Besucher endlich dessen Lösungsvorschlag zu entlocken. „Sie müssen wissen“, hob der an und spürte der dahinschmelzen Praline in seinem Mund nach, „ich habe da einen alten Studienfreund.“
Ferdi spitzte die Ohren.
„Der leitet die Berliner Rundfunkspielschar.“
„Also doch HJ“, ranzte Frau Waginger.
„Ja und nein.“ Ihre Reaktion überraschte den erfahrenen Pädagogen nicht, so dass er fortan die Nennung der beiden Buchstaben vermied. „Formal sind die Rundfunkspielscharen zwar Teil der Organisation, aber Jungen und Mädchen, die dort mitmachen, sind von den üblichen Aktivitäten des Jugendverbandes weitestgehend befreit. Es handelt sich um Chor- oder Instrumentalgruppen musikalisch ganz besonders begabter Jugendlicher. Zu ihren Aufgaben gehört die regelmäßige Teilnahme an Rundfunksendungen, Filmaufnahmen für Spielfilme oder schon auch mal die Mitwirkung bei Wochenschauen. Bisweilen treten die Rundfunkspielscharen sogar im befreundeten Ausland oder bei anderen Sendern im Reich auf.“
„Dann san die Jugendlichen praktisch hauptsächlich am Singen und Musizieren, stimmt´s?“ Herr Waginger konnte seine Sympathie für Brös Idee unschwer verbergen.
„Mit seiner gut ausgebildeten Sing- und Sprechstimme und auf meine Empfehlung hin, würde Ferdinand dem herkömmlichen Dienst entgehen und ohne Umschweife in die Rundfunkspielschar aufgenommen werden. Er könnte weiter auf unserer Anstalt bleiben, könnte im Schulchor brillieren und stünde der Schule, wenn es seine Zeit erlaubt, sogar für Sportwettkämpfe zur Verfügung. Etwa zwei- bis dreimal in der Woche müsse er allerdings für Proben und Auftritte im Haus des Rundfunks in der Masurenallee erscheinen. Manchmal stünden auch Gastspiele in anderen Städten oder Filmaufnahmen bei der UFA in Babelsberg oder in der Oberlandstraße in Tempelhof auf dem Programm.“
Ferdi hätte jauchzen können vor Glück. Das war die Lösung!
Während ihr Gemahl seine Freude über Brös Vorschlag kaum zu kaschieren wusste, verriet Frau Wagingers Gesichtsausdruck weiterhin Skepsis.
„Wird denn Ferdi das alles schaffen können, ohne die Schule dabei zu vernachlässigen“, fragte sie. „Er tut sich ja jetzt schon in manchen Fächern nicht leicht.“
„Wir werden ihn schon durchkriegen, lassen Sie das mal unsere Sorge sein. Direktor Wuttke hat mir zugesichert, dass es zumindest seitens der Schulleitung keine Probleme geben wird. Überlegen Sie sich die Sache also gut, besprechen Sie alles und lassen Sie mich, oder besser gleich Herrn Oberstudiendirektor Wuttke persönlich, bis morgen wissen, wie Sie sich entschieden haben. Wir werden uns dann um alles Weitere kümmern. Sie verstehen, die Sache verträgt keinen Aufschub.“
Dann erhob er sich, knuffte Ferdi freundschaftlich in die Seite und ließ sich von Herrn Waginger auf dem Weg zur Tür widerstandslos noch eine Tüte Konfekt aufnötigen. Schon bald nach der Entscheidung, die nicht ohne heftige Wortwechsel zwischen Mutter und Sohn endlich getroffen wurde, stellte sich Ferdinand zum ersten Mal in der Masurenallee vor.
Bereits nach der ersten Gesangsprobe war allen klar, was man an ihm haben würde.
Ferdi fühlte sich spontan wohl. Vor allem gefiel ihm, dass es ein gemischter Chor war.
Nur Frau Waginger tat sich schwer damit, dass ihr Sohn immer öfter, mitunter sogar an Wochenenden, nicht zuhause war. Natürlich spürte auch sie, wie sich der Junge allmählich verändert hatte und erwachsener geworden war. Ferdinand war dermaßen im Glück, dass ihm nur selten bewusstwurde, nun, als Mitglied der Rundfunkspielschar, ein aktives, wenn auch nur winziges Teilchen des nationalsozialistischen Systems geworden zu sein.
Manche Liedtexte, die sie zu singen hatten, kamen nicht nur ihm merkwürdig vor. Sobald es unruhig wurde in den Reihen der Sänger, wiegelte der Chorleiter ab. Nirgendwo auf der Welt würden sich Chöre den Text, den sie zu singen hätten, selbst aussuchen können.
Da war einfach nichts dagegen zu sagen.
Auf einem großen Treffen mehrerer Rundfunkspielscharen aus dem ganzen Reich geschah etwas Merkwürdiges. Baldur von Schirach, der Reichsjugendführer, begrüßte die Sängerinnen und Sänger, und selbst der Reichspropagandaminister Goebbels nahm sich Zeit für eine Ansprache. Als er zum Rednerpult schritt, konnte jeder sehen, wie er wegen seines Klumpfußes leicht hinkte. Ferdinand musste an Heini denken, der wegen einer Kinderlähmung leicht gehbehindert war und deshalb nicht mitkommen durfte. Einen Krüppel wolle man an dem Chortreffen nicht dabeihaben, hieß es.
Auf der Rückfahrt nach Berlin, als er mit Gudrun seine Empörung über diese Beobachtung teilen wollte, legte sie ihm sanft die Hand auf die Lippen.
„Am besten du behältst das für dich, Ferdi“, hauchte sie ihm ins Ohr, küsste ihn verstohlen und schon waren seine Zweifel rasch wieder verflogen.
Bei der Ufa war es meistens sehr lustig und wahnsinnig spannend zu beobachten, wie es auf dem Filmgelände und in den Studios zuging. Einmal bekam Ferdi, allerdings nur von Ferne, sogar den berühmten Heinz Rühmann zu sehen, der sich zu Dreharbeiten in Babelsberg aufhielt. Eigentlich hörte er ihn mehr, als dass er ihn sah. Diese unverwechselbar leiernde Stimme war einfach zu markant und nicht zu überhören. Ferdi war für einen Beitrag in der Wochenschau ausgesucht worden und hatte ein paar, wie ihm schien, belanglose Sätze zu rezitieren, während ihn die Kamera umkreiste.
Mich traf ein fordernd Anruf eben
als ich an mir verzweifeln wollt
Was alles hast du mir gegeben
Nimm mich doch ganz in deine Huld
Dass sein Gedichtvortrag für einen Wochenschaubeitrag zu Führers Geburtstag zum Einsatz kommen sollte, hatte man ihm nicht gesagt. Aber er war mächtig stolz, als Gudrun ihm erzählte, sie habe ihn in der Wochenschau im Tauentzienpalast auf der riesigen Leinwand gesehen. Auch Mädels anderer Chöre sprachen ihn bewundernd auf sein Filmdebut an, als die Berliner Rundfunkspielschar bei der Weltring-Sendung Jugend singt über die Grenzen auftrat. Fast drei Dutzend Jugendchöre aus vielen Nationen trugen Volksweisen und Lieder aus ihrer jeweiligen Heimat vor. Die Veranstaltung wurde als Signal der internationalen Verständigung in alle beteiligten Länder übertragen, was ein unvergessliches Erlebnis für alle Mitwirkenden war. Frau Waginger blieb ihrer skeptischen Grundhaltung treu und ließ sich von Veranstaltungen und Radioübertragungen wie diesen, die sie für NS-Propaganda hielt, wenig beeindrucken.
1939 war das erste Radio in die Familie gekommen. Obwohl es gebraucht war, sei es doch eine ziemliche Investition gewesen, betonte Vater Waginger immer wieder gerne. Aber wenn er schon Geld für so ein Ding ausgebe, dann solle es auch etwas Ordentliches sein.
Und es war etwas Ordentliches.
Ein Traum von Radioapparat: ein Blaupunkt 4W77 mit Thermometerskala und einem magischen Auge. Die Volksempfänger, die im Volksmund hinter vorgehaltener Hand nur Goebbelsschnauze genannt wurden und in Einfachausführung schon ab knapp 40 Reichsmark zu kaufen waren, empfingen nur wenige regionale Sender. Der um ein Vielfaches teurere Blaupunkt hingegen fing auch Sender ein, die auf Kurzwelle ausstrahlten.