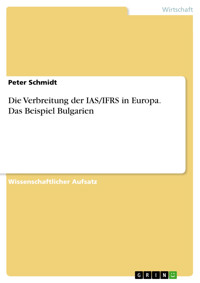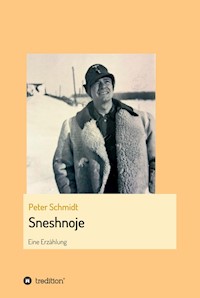Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Am liebsten betrachtet er Menschen von hinten, weil Hosennähte interessanter sind als Gesichter. Und seine Frau würde er auf der Straße vermutlich nicht erkennen. Denn Peter Schmidt ist Autist. Eine unsichtbare Mauer trennt ihn von seinen Mitmenschen. Er kann sich nicht in andere einfühlen und ihre Mimik nicht deuten. Smalltalk ist für ihn ein Balanceakt zwischen den Fettnäpfchen. All das macht ihn nicht gerade zum Traumprinzen, dem die Herzen der Frauen zufliegen. Dennoch ist er heute ein glücklich verheirateter Familienvater. Wie er die Herausforderung der Liebe trotz vieler Hindernisse und Umwege gemeistert hat, davon erzählt er in seiner ungewöhnlichen Autobiografie. Es ist ein Sprachkunstwerk eines sympathischen Außenseiters und ein Plädoyer für die Vielfalt des Seins.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Bildteil
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Peter Schmidt
Ein Kaktus zum Valentinstag
Ein Autist und die Liebe
Patmos Verlag
INHALT
278 Vorwörter
Welt, ich komme!
Vorboten einer fernen Sehnsucht
Vom Tanzen zur Checkliste
Erste Beziehungspraxis
Auf der Straße nach Irgendwo
Begegnung mit einem toten Freund
Der Freundekomet
Ostpreußische Flirtkunde
Ein folgenreicher Zahnarztbesuch
Das satanische Telefonat
Durch eine Ebene der Leere
Am Fuß des emotionalen Gebirges
Sonne, Mond und Liebe
Allabendliche Auto-Sessions
Mathematische Liebe
Kirche nach der Feuerzangenbowle
Einblick in eine fremde, emotionale Welt
Dunkle, helle Sternzeiten
Das Drama mit den vierzig Küssen
Ein apokalyptisches Candle-Light-Dinner
Krokusse, Kakteen und Kakerlaken
Der Tanz auf dem Vulkan
Goldene Reifen zum ersten Ringtag
Ozeanische Trennung
Wasserweiten unter dem Kreuz des Südens
El Condor Pasa und das faszinierende Nichts
Am jenseitigen Ufer
Miteinander schlafen?!
Endlich: der Tropentauglichkeitstest
An der Weserquelle
Eiertanz vorm leeren Stubenwagen
Die Landung des ersten Ra
Nächster Halt: Hämelerwald
Klimazonen des Lebens
Geheimnisvolle Elche im eisigen Ostwind
Im Tal des Melibokus
Kein Anschluss unter dieser Nummer!
Als der Weihnachtsmann schon am 9. Dezember kam
Expeditionen in den Familienalltag
Danke, Dieter!
Emotionale Versteinerung in Stonehenge
Bedingungslose Liebe
Winkel oder Würfel?
Das verlorene Hähnchenbein
Silencia, meine irdische Oase einer erdfernen Welt
Nostalgie in der Fremde
La pagaille complête
Wendhausen – wo das BÜS nie kam
Am Tor zum Ich
Der seltsame Schlüssel
Die finale Auto-Session
882 Nachwörter
Entschuldigung für gestern, heute und morgen
Danksagung
Meiner lieben Frau, meinem Gnubbelchen, der Mau, und meinen lieben RaRas zugeeignet. Auch wenn ich es nicht auf die vielleicht aus eurer Sicht übliche Weise zeigen konnte, ich habe euch alle wirklich lieb.
Jeder Mensch aber ist nur er selber,
er ist auch der einmalige, ganz besondere,
in jedem Fall wichtige und merkwürdige Punkt,
wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen,
nur einmal so und nie wieder.
Darum ist jedes Menschen Geschichte wichtig.1
HERMANN HESSE
1 Textauszug aus: Hermann Hesse, Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend, in: ders.: Sämtliche Werke in 20 Bänden. Herausgegeben von Volker Michels, Band 3: Roßhalde, Knulp, Demian, Siddharta, S. 235. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2001. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin.
278 Vorwörter
Liebe Leserinnen und Leser!
Vor Ihnen liegt eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, geschrieben aus der Perspektive eines autistischen Menschen. Liebe mit Autismus, so sollte man meinen, das schließt sich gegenseitig aus. Das ist doch wie ein schwarzer Schimmel, eine Unmöglichkeit. In der Tat ist es in gewisser Weise so, als sei man schwul und wünscht sich aber eine Familie mit Haus, Hof und Garten.
Der Weg, dies umzusetzen, ist alles andere als üblich. Aber wo ein Wille ist, gibt es einen Weg. Und wer neue Wege gehen will, muss ohne Wegweiser auskommen! So lautet seit Schultagen mein Lebensmotto.
Diesen Weg zu gehen, bedeutet, mit konkurrierenden Sehnsüchten zurechtzukommen. Einerseits wollte ich immer allein sein, um alles unter Kontrolle zu haben. Andererseits fühlte ich mich einsam, und das wollte ich nicht sein. Die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit ließ mich schließlich den Weg gehen, von dem ich nicht wusste, warum er über so viele himmelhoch eisige Berge führen musste, um endlich zum Ziel zu gelangen. Der Weg ist das Ziel! Und auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Auf der Autismus-Bundestagung in Nürnberg im Jahre 2008 stellten meine Frau und ich unseren individuellen Weg vor – eine Liebe mit Autismus. Dabei stellte ich mein emotionales Erleben als Straße durch Landschaften dar. Heraus kam ein Vortrag, der von autistischen und nichtautistischen Menschen gleichermaßen sichtbar bewegend aufgenommen worden ist. Ich hatte einen Weg gefunden, darzustellen, was in mir passiert.
Seither spielte ich mit dem Gedanken, meine Geschichte aufzuschreiben. Doch die Verarbeitung meiner Autismus-Diagnose brauchte Zeit. Ein gutes Buch will aus der Distanz geschrieben sein. Denn erst wenn man auf dem Berg steht, sieht man wirklich, wie die Ebenen zu Füßen des Gebirges strukturiert sind.
Welt, ich komme!
Am 29. Juni 1985, einem rostbraunroten Tag, durchschreite ich zum letzten Mal das Hauptportal des Gymnasiums Groß Ilsede – als Schüler! Im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Abi in der Tasche. Endlich frei! Welt – ich komme!
Am Abend abiballt es in einer Gaststätte. Die meiste Zeit verbringe ich dort mit den Papamamas, meinen Eltern, und mit Katrin, einer Mitschülerin, mit der ich gelegentlichen Kontakt habe. Der Ball geht allmählich zu Ende, als ich doch noch auf die Tanzfläche muss. Ich weiß nicht, ob es dreiviertelt oder vierviertelt, und überhaupt, ich kann meine Füße nicht sortieren. Arme Katrin – vermutlicherweise.
Aber dennoch spaßt es ungewöhnlich. Da spüre ich auf einmal etwas ganz Seltsames in mir, das ich von mir gar nicht kenne. Tanzen kann richtig Spaß machen! »Ja dann is Danz op de Deel, Danz op de Deel!« Nach diesem Lied tanzen Katrin und ich noch ein letztes Mal. Dann enden schließlich und endgültig die neun geduldig ertragenen Jahre auf dem Gymnasium Groß Ilsede. Das Lied echot in mir noch lange nach.
Die Schulzeit, sie ist nun endgültig und für immer vorbei. Unwiderruflich. Zeit für ein kurzes Resümee.
Es war einmal ein kleiner, geheimnisvoller Junge. Der zappelte an allen belebten Straßenkreuzungen und Bahnübergängen. Und kannte alle Länder samt ihren Umrissen und Hauptstädten. Derselbe Junge biss seine Mitschüler, wenn sie ihn ärgerten, weil er gehört hatte, dass er sich an der Schule einfach mehr durchbeißen müsse.
Ich bin nie in einen Sportverein eingetreten, weil es da viel mehr um das Gruppenerlebnis als um das Spiel ging. Auch in der Klasse fehlte mir der Zugang zur üblichen spontanen Cliquenbildung. Ich war nicht ein einziges Mal in der Disco, weil zu lärmig laut und verr(a)ucht, habe nicht eine einzige BRAVO selber gekauft, weil da einfach zu viel Blabla drinstand. Ich habe nicht ein einziges Glas Bier getrunken. Halt, jetzt hätte ich fast gelogen. Die einzig nennenswerte Ausnahme war auf einer Klassenfahrt. Da waren wir im Biermuseum in Heidelberg, einem offiziellen Programmpunkt, den die Klasse gegenüber der Schulleitung als Kultur verkauft hat. Ich habe auch nicht eine einzige Zigarette geraucht, weil das gesundheitsschädlich ist und obendrein sehr gardinen- und klamottenstinkend macht.
Und ich habe seit Jahren keine Geburtstagsgäste aus der Schule mehr eingeladen. Statt der Gesichter kannte ich die Nähte und Falten der Hosen der Mitschüler. Wie zum Beispiel den weißen, durchgescheuerten Ring auf der einen Tasche am Jeanshintern von Michael. Überhaupt schaute ich alle Menschen lieber von hinten an. So vermied ich den direkten, unangenehm wespenartig stechenden Blickkontakt.
Die Pubertät fiel für mich quasi aus. Weil ich nicht flirten konnte. Warum, das wusste ich nicht. Aber es war so. Ich spürte es. So zeigte ich auch keinerlei sichtbares Interesse am anderen Geschlecht. Manche meinten daher auch, ich sei schwul. Wie auch immer, ich wollte auf jeden Fall irgendwann auch einmal meine eigene Familie haben. Und die gab es nun einmal nur mit einer Frau, auch wenn manch ein Junge doch auch ganz attraktiv ausgesehen hat.
Die Schulpforte, sie liegt hinter mir. So beginne ich, das Leben nach der Schule zu planen. Die Meilensteine des Lebens sind schnell identifiziert: Studium überleben, einen Doktor machen, um endlich frei forschen zu können oder viel Geld zu verdienen, dabei möglichst eine Frau finden, später Familie gründen, Haus und Hof erstehen und vor allem viele Reisen rund um die Welt machen, um Straßen zu sammeln und Vulkane zu besteigen.
Endlich kann ich hoffen, eine Welt zu finden, die vielleicht mehr bereithält für Menschen, die so sind wie ich. Endlich kann ich hoffen, viele der ungeliebten Dinge nicht mehr tun zu müssen. Endlich kann ich meinen Plan umsetzen. Endlich ist der Klassenklatsch vorbei. Und ich habe die Aussicht, aus dem Dorfmilieu ins Rampenlicht der Welt zu treten. Aufbruchstimmung!
Clausthal-Zellerfeld ist eine überschaubare Stadt inmitten der Natur. Dort beginne ich mein Studium der Geophysik. Als mich meine Papamamas besuchen, haben sie mein grünes Büchlein mitgebracht, in das früher meine Mitschüler geschrieben haben. Ich frage meine Mutter, die für mich »die Locken« heißt, ohne dass ich sie jemals wirklich so genannt habe. Die Locken, weil ich sie als Kind immer unter der Haube mit diesen komischen, bunten, an drahtige Rohre erinnernden Lockenwicklern gesehen habe.
»Warum habt ihr denn das Ding mitgebracht?«
»Sieh mal rein, einer hat noch was reingeschrieben!«
Ich nehme das Büchlein und entdecke tatsächlich einen neuen Text auf einer Seite, die damals neben etlichen für Mitschüler vorgesehenen Seiten auch immer leer geblieben war. Dort steht mit der Handschrift meines Vaters, des braunen Brummelbären, geschrieben:
»Gehst Du ins Leben nun hinaus,
halt eins hoch ›Dein Elternhaus‹.
Wie glücklich Dir auch fällt Dein Los,
vergiss es nicht, es zog Dich groß.
Mit den besten Wünschen
für den weiteren Lebensweg!«
Mit diesen Worten verabschiedet mich mein Vater, der sich nur selten um mich gekümmert hat, in die Unabhängigkeit. Brauner Brummelbär heißt er deswegen, weil er oft brummelte und meist braune Stoffhosen trug, wenn er gerade mal nicht in blauen Arbeitsklamotten steckte.
Als ich am nächsten Tag von der Uni nach Hause komme, finde ich einen kleinen Zettel auf meinem Schreibtisch. Darauf steht: »Ihre Mutter hat angerufen! Ihre Tante ist gestern Abend gestorben und am Mittwoch ist die Beerdigung. Sie möchten einmal daran denken.« Es dauert eine Weile, bis ich begreife, dass es sich um Tante Else handelt.
Die Locken kennt keine Tränen der Trauer von mir. Auch deswegen fordert sie mich immer wieder auf, »menschlicher« zu werden. Als zum Beispiel meine Omas starben, zogen für mich ihre hinterbliebenen Körper auf den Friedhof. Dort wurden sie zu Erblassern. So stand es jedenfalls immer auf einem Formularzettel. Tote nennt man im Amtsdeutsch offenbar so merkwürdig, weil ihre Hautfarbe erblasst, dachte ich. Das war alles. Ich trauere auch, aber anders als die Menschen, die ich kenne. Die regnen bei einem Todesfall oft im Gesicht, was ich bis heute nicht verstehe.
Tante Else war die Frau von Onkel Willi, der mit mir früher die lange Brücke über die Gleisspaghetti der Eisenbahn überquert hat, um mit mir zur autovollen Straße am Bahnhof und zur autoleeren Berlin-Autobahn zu gehen. Wo es leider keine Ausbeute für meine Autonummernbücher gab, in denen ich alle Fahrzeuge notierte, deren Ortskennzeichen ich zum ersten Mal sah. Beide wohnten früher in Peine, dort, wo das Eisen fauchend glühte und wo die Rohre im Rohrraum gluckurgelten.
Ganz in der Nähe ihrer alten Wohnung lag auch der Bahnhof. Immer wenn dort ein Zug hielt, tönte es aus schwarzlochigen, blechernen Trichtern: »Peine, hier Peine!« Gleich neben dem Bahnhof lag damals auch der drohglockende, rot-weiß gestangte, klengschrankende Bahnübergang. Das war früher die beste Stelle in der ganzen Stadt. Denn dort woppten die Autos über die schräglagigen Gleise. Rauf rein in die Stadt. Runter raus aus der Stadt. Bis die rot-weißen Stangenschranken drohglockten und immer wieder alles zugwartend erstarrte.
Dort erlebte ich stets ekstatische Freude. Dann tänzelte ich mit den Beinen und flatterte mit den Armen und Händen. Wie ein Vogel, so nannten es andere, die es sahen. Für diese anderen war ich stets der geheimnisvolle kleine Junge, der immer und überall seltsame Sachen machte.
Die gute alte Tante Else brauchte sich nun also endlich nicht mehr im Bett wund zu liegen, brauchte endlich keinen Gehbock mehr zu heben. Bei Tante Else durfte ich alle Schränke aufmachen, um zu schauen, was drinnen stand und lag. Tante Else, die mich immer fest drücken wollte, gegen meinen Widerstand, weil ich Schwierigkeiten hatte, angefasst zu werden. Tante Else, die immer den kuchigen Kaffee hatte, diese Tante Else ist nun also entkörpert.
Sie hatte allen Grund zu verzweifeln, doch sie war bis zuletzt ein lebensfroher Mensch gewesen. Auch dann noch, als sie längst ans Bett gefesselt war. Tante Else war immer lieb zu mir, sie war eine der Tanten, die mich bewunderten.
Immer mehr lieb gewonnene Menschen entschwinden auf einmal aus meinem Erleben, ohne dass neue nachkommen. Menschen, die meine Kindheit beeinflussten. Ältere Menschen, denn mit Gleichaltrigen spielte ich selten, als Jugendlicher fast gar nicht mehr. Ich spüre, wie ich immer mehr alleine zurückbleibe.
Ich muss selber für neue Freunde sorgen, die alte ersetzen können. Und in ferner Zukunft auch für eigene Kinder. Und das alles fällt mir schwer. Warum? Tante Elses Tod führt mir wieder einmal die Vergänglichkeit allen Seins vor Augen. Alles, aber auch alles, was deine Zeit als Kind geprägt hat, entschwindet auf einmal, sage ich mir.
Das Land, von dem ich aufbrach, ist auf einmal außer Sichtweite. Vor mir liegt unbekanntes Terrain. Wie ein Entdecker auf einem Schiff, der aufbricht, um unbekannte Welten zu finden, plane ich das Abenteuer, versuche ich, das Unbeherrschbare unter Kontrolle zu bringen. Einerseits fühle ich mich gefangen im eigenen Körper. Andererseits scheint es so zu sein, dass die Welt erst durch Körperung erlebbar ist: Welt, ich komme!
Vorboten einer fernen Sehnsucht
Hohe Tannen rauschen draußen im Winterwind. Ich bin im warmen Drinnen und schaue aus dem geöffneten Fenster. Es ist Dezember. Der dunkelste Monat im Jahr. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Starr stehe ich am Fenster. Starr sehe ich hinaus.
Mein Blick gilt einem Fußweg, der im fahlen, punktuellen Licht der Straßenlaternen liegt und steil einen Berghang hinaufführt. Von dort bin ich vor fast zwei Stunden hergekommen.
Meine Ohren lauschen dem stillen Rauschen der hohen Tannen, deren Zweige da draußen im Winde wedeln. Das erinnert mich an die still gelegene Hütte des Alm-Öhi aus der Zeichentrickserie »Heidi«. Genauso wie in diesem Film rauschen die Tannen jetzt in der Einsamkeit, meiner empfundenen Einsamkeit.
In meinem Gesicht beginnt es zu regnen. Ich war noch niemals im Leben so traurig wie jetzt. Es ist etwas passiert, das ich so noch nie vorher erfahren habe. Ich glaube, die Menschen nennen es Liebe, die verloren ging.
Mein Gesicht regnet sich ein, erst ein paar Tropfen, dann gießt es kitzelnde Ströme auf der Haut. Dieses Gesichtswetter dauert mehrere Stunden, es regnet mal stärker, mal wieder schwächer. Ich bin nicht in der Lage, so wie sonst der Natur vor meinem Fenster einfach nur zuzuschauen, einfach die Stille des Augenblicks zu genießen. Stattdessen erkenntnisse ich, dass ich das erste Mal im Leben im Zusammenhang mit einem Menschen traurig bin. Und damit vor allem, dass ich mein Leben nicht einsam und allein verbringen will.
Die latent in mir schlummernde Sehnsucht nach zweisamer Romantik ist erwacht. Noch nie fühlte ich mich so einsam. Allein sein, das kann ich immer wieder genießen, weil ich dann selbst bestimmen kann, was geschehen soll und was nicht. Aber einsam sein? Das will ich nicht. Diese Erkenntnis überkommt mich, wie die Morgenröte die Nacht ablöst.
Die Liebe kam an mich nicht ran. Und ich kam nicht an die Liebe ran. Und wer weiß, ob das, was ich glaube unter Liebe nun verstehen zu können, auch das ist, was die geliebte Person darunter versteht. Am fernen Horizont der wüstenhaften Gegend, die mein aktuelles inneres Erleben beschreibt, zeichnet sich eine spitzgratige Silhouette scheinbar unüberwindlicher Berge ab. Meine Lebensstraße führt geradewegs darauf zu.
Die Liebe, die ich entdeckte und noch bis vor wenigen Minuten sah, verschwand bei meiner Annäherung wie eine Fata Morgana. Vor mir liegen nichts als viele, viele Meilen Wüste. Vom grünen Land der Liebe ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Gar nichts. Ganz im Gegenteil.
Die spitzgratigen Berge am Horizont verheißen himmelhohe Gebirge, also Gebiete eisiger Kälte, die zu überwinden sind, um in ein Land zu gelangen, in dem ich meine eigene Familie haben werde, in dem ich glücklich sein kann.
Ich spüre, dass für mich der Weg zu so einer wahren Freundschaft und Liebesbeziehung unermesslich lang und unendlich schwer sein könnte. Einige meinen ja sogar, es gebe ihn für mich gar nicht. Warum? Was steht da bloß im Weg, das ich nicht sehen kann? Ich verstehe das nicht.
Immer wieder ist es das versteckte Zwischenmenschliche, das alle Menschen um mich herum auf Anhieb verstehen, ich dagegen nicht. Und immer wieder frage ich mich, warum die Menschen Dinge wie Wegstrecken und Logik, die für mich auf Anhieb klar sind, nicht oder nur sehr mühsam begreifen.
Wieder einmal fühle ich mich einsam – verlassen – abgeschoben – verstoßen. Was war geschehen? Wie konnte es dazu kommen?
Ich war verliebt – ohne Gegenliebe.
Jeden Dienstag und jeden Donnerstag tanzten wir zusammen. Ich kannte Gesa aus den Geologieseminaren und habe sie vor acht Monaten gefragt, ob sie Lust habe, mit mir zu tanzen. Sie stimmte zu, und so tanzten wir uns im Laufe der Monate zusammen. Ganz am Anfang wusste ich nicht, wann es dreiviertelte und wann es vierviertelte. Ich tanzte einfach irgendwie. Es dauerte lange, bis ich einigermaßen Taktgefühl bekam. Und es dauerte auch lange, bis ich es ertragen konnte, ganzkörperlich berührt zu werden. Aber ich schaffte es. Ich verordnete mir dieses Training genauso wie das Training in der Gemeinschaft wie eine Art von Therapie.
Dafür trat ich vor zwei Jahren in die nichtschlagende, musikalische Studentenverbindung Ascania Halle-Clausthal ein, zu der auch Andreas gehörte. Ein Mensch, der stets das Gute in den Menschen sah. Mein erster freundschaftlicher Kontakt nach der Schulzeit. Er hatte mich in die Verbindung eingeführt. Und das, obwohl ich weder wirklich gut singen noch ein Instrument spielen konnte. Mit Andreas erlebte ich einsame Wanderwege im Oberharz, unsere gemeinsame Navigationshilfe war die verflixte Wanderkarte, auf der so mancher Weg nicht richtig eingetragen war. Offiziell in der Verbindung aufgenommen fühlte ich mich nach dem ersten »Zipfeltausch«, einem Ritual, das die Verbundenheit stärken soll. »Alles fest im Griff?!«, lautete damals mein Motto, das auf dem »Zipfel« eingraviert wurde, den ich von einem anderen »Bundesbruder« erhielt.
Je nachdem, wie die Rahmenbedingungen aussahen, hatte ich »alles fest im Griff« oder eben auch nicht. Fachliche Angelegenheiten im Studium waren meist unproblematisch, die Herausforderungen meines Lebens warteten ganz klar bei allem, was mit Beziehungen zwischen Menschen und mit Kommunikation zu tun hatte. Und um mich in diesem Bereich zu verbessern, versuchte ich mich in der Verbindung aktiv einzubringen.
Es kam sogar zu Auftritten vor den Alten Herren. Mein kleiner grüner Kaktus war eines meiner Lieblingsstücke, die wir sangen. Und besonders viel Spaß brachte mir stets die gesangliche Vertonung des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung nebst Beweis, einer wichtigen Säule der höheren Mathematik.
Auch wurde es nötig, an den ganzen Stiftungsfestbällen aktiv teilzunehmen. Da trat ich dann den Damen auf der Tanzfläche erst einmal kräftig auf die Füße. Ich musste einfach parkettsicherer werden. Zum Glück gab es im Hochschulsportprogramm der TU Clausthal kostenlose Tanzkurse, die mich beim Lösen dieser schweren Aufgabe unterstützen sollten.
Die Tanztherapie schlug an. Von Mal zu Mal wurde ich besser. Ich erlebte geradezu eine Renaissance des Tanzens. Denn den ersten Tanzkurs zur Konfirmation, da wurde ich mehr getanzt, als dass ich selbst etwas im Griff hatte. Damals war ich froh, als dieses dorfübliche Pflichtprogramm endlich endete.
Tanzen, das war nichts für mich. Das erreichte mich überhaupt nicht. Und nun passierte schleichend gar das Gegenteil. Tanzen wurde zum Ritual. So konnte ich mir irgendwann gar nicht mehr vorstellen, wie ein Leben ohne regelmäßiges Tanzen überhaupt funktionieren sollte.
Es gelang mir, Gesa auf den nächsten Stiftungsfestball der Studentenverbindung Ascania Halle-Clausthal mitzunehmen. Das war gar nicht so einfach, denn sie hatte einen Freund, der in einer anderen Stadt studierte. Und sie trafen sich immer am Wochenende. Für diesen Ball musste sie in Clausthal bleiben, konnte also ihren Freund nicht sehen.
Für mich war das ein hohes Zeichen dafür, dass sie mich auch mochte, dass sie mich annahm, so wie ich gebaut war. Solche Menschen gab es bisher nur wenige. So erlebte ich auf diesem Ball mit ihr einen wahren Tanzrausch. Wann immer die Musik spielte, tanzten wir beide uns die Füße platt. Manchmal auch ganz alleine vor allen Leuten. Auch so etwas hatte es mit mir noch nie vorher gegeben.
Wir tanzten und tanzten und tanzten Kleid und Anzug amazonas-nass. Amazonas, so heißt der Schweißfluss, der mir oft beim Schwitzen in der Rückgratkuhle körperabwärts hinten in die Hose fließt. Dieser Fluss trat hoffnungslos über die Ufer. Mein Anzug war bis aufs Jackett durchgeschwitzt. Die Hose klebte am Hintern fest.
Gesa hatte mir ganz nebenbei ein doppeltes Geschenk gemacht: Sie befreite mich vom blöden Small Talk an den Balltischen, den ich nie senden konnte und der mich auch nie wirklich erreichte. Und sie tanzte mit mir, was das Parkett vertragen konnte. Manchmal im Takt, manchmal im Gegentakt, manchmal doppeltes Tempo, Hauptsache Spaß – Spaß – Spaß.
»Peter, wo hast du DAS denn gelernt, vor einem Jahr konntest du doch noch nicht einmal einen Walzer von einem Foxtrott unterscheiden, und jetzt kannst du keinen Tanz auslassen! Was ist denn da passiert?«, wollten viele Bundesbrüder und Alte Herren wissen.
»Jeder Tanzkurs beginnt mit dem ersten Schritt!«, sagte ich nur. Kurzum, ich fühlte mich wie ein Fakir, der sein Nagelbrett umdreht und feststellt: »Ich glaub, ich hab da was Wunderbares entdeckt!«
Der Bewunderung für meine Tanzkünste stand aber auch Kritik gegenüber: Ich hätte mich viel zu wenig unterhalten, viel zu wenig am Tisch gesessen und vor allem, ich hätte vergessen, auch die anderen Damen, zumindest die an meinem Tisch, aufzufordern.
Ja, einzelne Tänze mit anderen Damen gab es ja, aber das war immer nur ein Rumstolpern. Auf diese Damen konnte ich mich nicht einstellen. Das Tanzen mit denen war kein Vergleich zu dem, wie geschmeidig es mit Gesa funktionierte.
Ich hatte Glück mit meiner Tanzpartnerin. Sie schien mich interessant zu finden. Irgendwann spürte ich, dass ich diese Partnerin für mehr als nur fürs Tanzen haben wollte. Das musste keimende Liebe sein!
Denn im Laufe der Zeit gehörte es dazu, sich nach dem Tanzen noch zu unterhalten. Dabei erzählte ich Gesa viele, viele Dinge, auch über Geologie und Astronomie, die sie anscheinend äußerst spannend fand, denn es dauerte oft Stunden, bis wir den Abend oben auf dem Berg, wo das Tanztraining im Foyer einer Schule stattfand, endlich beendeten. Anschließend ging ich stets den Fußweg an den hohen Tannen vorbei, der den Tanztrainingsort mit meiner Straße verband.
Heute aber war alles anders als sonst. Diesmal kam Gesa diesen Weg bis zu meiner Straße fahrradschiebend mit, denn ich hatte noch etwas Wichtiges zu sagen und bat sie, mich ein Stück zu begleiten.
Das Tanzen mit Gesa lieferte herrliche Erlebnisse. Ich wollte sie niemals mehr vermissen. Und obendrein hatte sie etwas, das mir offenkundig fehlte: das Gespür für zwischenmenschliche Kommunikation.
Kurzum, ich meinte, die ideale Partnerin vor mir zu sehen. So hatte ich mich in Gesa verliebt. Und das musste sie unbedingt jetzt zu wissen bekommen. Aber bloß wie – wie – wie?
Als sie sich verabschieden wollte und sich schon zum Fortfahren umdrehte, fasste ich allen Mut zusammen und sagte stotternd schlicht das, was ich die ganze Zeit über glaubte ihr sagen zu müssen, ohne dessen Konsequenzen wirklich durchdacht zu haben: »Gesa, du hast in mir bislang verborgene Sehnsüchte geweckt. Ich kann dich eigentlich nicht mehr hergeben. Ich glaube zu wissen, dass ich dich liebe! Gesa, ich habe gelernt, dich zu lieben. Ich liebe dich, ich habe dich geliebt, wenn du jetzt wegfährst, sollst du das wenigstens gewusst haben!«
Sie drehte sich wieder um und sagte zunächst nichts. Wir schwiegen uns an. Nach einiger Zeit fing sie an zu schluchzen, dann zu heulen, das sah ich, obwohl ich so etwas sonst nie sah, aber diesmal war es mehr als deutlich.
Dann erzählte sie mir, warum wir beide niemals zusammen kommen könnten – gesichtsregnend, über zwei Stunden lang. Ich erhielt das bis dahin wertvollste Feedback auf meine Außenwirkung mit konkreten illustrativen Beispielen: »Iiiih, mit DEM tanzt du?!«, »Dieser Typ ist doch total komisch, der hat doch gar keine Gefühle«, »Wie der schon geht, irgendwie steif und immer auf Zehenspitzen«, all das und noch viel mehr sollen andere über mich zu ihr gesagt haben.
Es waren nicht die Informationen an sich, die mich berührten, sondern dass Gesa trotz solcher Bemerkungen anderer über mich weiterhin mit mir getanzt hatte, dass sie sich davon offenbar überhaupt nicht hatte irritieren lassen. Respekt. Dann wurden vor ihr auch meine Augen feucht. Mich überrannten bisher nie da gewesene Gefühle. Wie eine Art Resonanz verschlechterte sich das Gesichtswetter von Gesa noch mehr. Ich hatte noch niemals eine Frau so regnen gesehen. Als sie ihre Stimme wiederfand, sagte sie:
»Peter, es ist wichtig, wie man miteinander umgeht, dass man miteinander glücklich wird, dass man den anderen auch versteht, mitfühlen kann. Du reagierst einfach nicht auf emotionale Signale, die dir andere senden. Es mögen Missverständnisse sein, aber das irritiert, man fühlt sich vernachlässigt.«
»Das kann ich halt nicht so wie andere, jeder Mensch hat Fehler!«
»Ja, aber es gibt Fehler, mit denen kann ich leben, und es gibt Fehler, mit denen kann ich nicht leben, wenn ich eng mit jemandem zusammen bin!«
»Du glaubst also nicht, dass wir trotz erheblicher gemeinsamer Interessen gut zusammen auskommen würden!«
»Ehrlich gesagt, nein! Auch dann nicht, wenn ich noch keinen Freund hätte!«
Das alles war hammerhart für mich. Doch ich wollte noch genauer erfahren, was andere über mich dachten:
»Gibt es noch mehr Beispiele, über die du reden kannst, was die Leute an mir komisch finden?«
»In den Geologieübungen zum Beispiel bist du allen sofort dadurch aufgefallen, dass du immer Steine dazugelegt hast, die du selber mitgebracht hattest. Das kam nicht gut an!«
»Ich wollte halt wissen, ob die Assistenten nur die Steine kannten, die in der Kiste waren, oder ob sie wirklich Ahnung von Geologie hatten!«
»Die anderen fühlten sich genervt! Irgendwie hatte ich auch den Eindruck, dass du von irgendetwas ablenken wolltest, dass du dich hinter deinen Witzen versteckst!«
Ja, ich hatte ihr gerne Witze erzählt, um kurzweiligen Gesprächsstoff zu haben. Ich dachte, Witze aller Art würden sie unterhalten. Daher fragte ich sie:
»Ablenken, wovon, verstecken, wovor?«
»Das weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass du hinter einer Art Mauer bist! Du bist liebenswürdig, keine Frage, aber ich komme irgendwie nicht richtig an dich ran.« Und dann nach einer Pause: »Stefan ist mein Freund – und das soll auch so bleiben.«
Während ich so das Straßenpflaster musterte, wandte sie sich ab und fuhr davon. Ich schaute ihr so lange nach, bis sie unten an der Kreuzung verschwand. Denn ich fühlte, wie ein wichtiges Kapitel in meinem Leben zu Ende ging.
Ja, dass sie zu ihrem Freund steht, das ist eigentlich eine sehr wertvolle Eigenschaft, die ich mir auch von einer Freundin wünschen würde. Und wenn sie Stefan für mich verlassen würde, würde sie gerade diese wichtige Eigenschaft verlieren. Da wird mir klar, dass ich mich zukünftig nur noch mit einer Frau anfreunden kann, die definitiv noch keinen Freund hatte, also jungfräulich ist!
Irgendwie bedanke ich mich im Stillen für diese allererste wirklich umfassende, unverhüllte Rückmeldung von Gesa. Es ist ein Schock. Aber auch ein wertvolles Feedback, das ich mir unbedingt zum Feedforward machen muss. Mir wird klar: Eine Liebe beruht nun mal auf Gegenseitigkeit, wenn von der anderen Seite nichts kommen kann, dann geht es eben nicht. Dann ist es gut so. Dann muss jetzt Schluss sein, alles andere wäre wirklich ein Irrweg.
Noch vor einem halben Jahr hatte ich nichts, aber auch gar nichts gefühlt. Ich war kalt, total kalt. Und jetzt hätte ich diese Gesa am liebsten nicht mehr hergegeben. In meinem Zimmer lege ich Musik in meinen Kassettenrekorder. Bei der Melodie von Room with a view, Zimmer mit Aussicht, überkommen mich die Gefühle. Ich gehe auf den Flur, um dort am Fenster zu sein. Am Fenster, ja, so hieß auch mal ein Lied, das ich immer wieder und wieder abspielte. Damals, als ich sechzehn war und ich beobachtete, wie alle anderen sich menschlich von mir immer weiter entfernten.
Nun bin ich melancholisch. Ich war genau genommen immer allein. Aber es hat mich nie wirklich gestört. Ich genoss es zu reisen, ich genoss Amerika, ich genoss Island, die Kanarischen Inseln, immer mit mir selbst. Keiner quatschte dazwischen, keiner nölte mich voll, keiner wollte was von mir. Ich bestimmte, wo es langgehen sollte, und da ging es auch lang, ohne Wenn und Aber. Das war ein schönes Gefühl.
Und nun zeichnen sich in mir konkurrierende Sehnsüchte ab: Zum einen die Sehnsucht nach Erhalt und Beherrschung der Situation. Und zum anderen die Sehnsucht nach menschlicher Geborgenheit und Heimat in einer eigenen Familie. Wie kriege ich das bloß zusammen? Ich glaube verschwommen zu ahnen, dass da noch ganz andere, für mich bislang äußerst nebulöse Dinge eine Rolle spielen.
»Gott, Manitu, Allah oder wie du auch immer heißen magst, wenn da ein Weg für mich existiert, dann lass mich ihn finden!« So bete ich mich gerne voran. Mein Weg wird kein leichter sein, denn bisher waren immer nur die Wege ausgeschildert, die nicht zu mir passen. Denn für schwierige, nicht alltägliche Wege über himmelhohe Gebirge und abgrundtiefe Schluchten scheint es keine Wegweiser zu geben. Da hilft nur Gott.
In ewig echoenden Gedanken versunken lege ich mich auf mein Bett. Mitsamt Klamotten schlafe ich schließlich darüber ein.
Über Weihnachten rette ich mich erst einmal auf meine Insel, indem ich nach Hause, in mein Elternhaus, fahre. Dort bin ich allein, aber nicht einsam. Die verbleibende Studienzeit bis zur Abgabe der Diplomarbeit werde ich von dort managen. Und die Prüfungsvorbereitungen werde ich auch von zu Hause machen. Ich muss dafür nicht jeden Tag an der Uni anwesend sein.
Wenige Monate später, nach viereinhalb Jahren Studium, habe ich mein Diplom geschafft: Diplom-Geophysiker steht auf der Urkunde der Universität. In der Geologieprüfung wurde ich Dinge gefragt, die so einfach waren, dass ich diese Prüfung sogar mit meinem Wissen aus der Grundschule hätte bestehen können.
Das Studium war über weite Strecken reine Urlaubszeit, vor allem in der sogenannten vorlesungsfreien Zeit, die ich immer als Semesterferien gesehen habe und nicht als Zeit für lästige Praktika oder Lernen. Ich brauchte die Zeit, um mich von den Menschen und ihrem Gehabe zu erholen. Das gelang mir immer am besten, wenn ich irgendwo auf den Straßen der Welt unterwegs war oder Vulkane bestiegen habe.
Es mag paradox klingen, aber ich studierte gerade dadurch sehr schnell und effektiv, weil ich vier Monate Ferien im Jahr hatte! Wieder einmal zeigte sich, dass nur ich selbst wusste, was für mich gut war und was nicht. Alle warnten mich davor, so viel Urlaub zu machen, ich würde ja nie fertig mit dem Studium. Wäre ich diesen Ratschlägen gefolgt, wäre ich noch lange nicht fertig, sondern hätte mich im Frust festgefressen.
Da das mit der Liebe in Clausthal ja erst mal nichts geworden ist und mir auch niemand einen wirklich attraktiven Job angeboten hat, entscheide ich mich, einen Kindheitstraum zu verwirklichen: Ich will das Ende der Gleise vom klengschrankenden Bahnübergang erleben. So steige ich in Peine in den Zug. Motto: Go East.
Was für ein herrliches Konzert, das bei Marienborn östlich von Helmstedt beginnt: Rattatta-klack-klack – Rattatta-klack-klack. So geht das bis nach Berlin und immer weiter und weiter – Warschau – Brest – Minsk – Moskau – Jaroslawl – vorbei an den vielen Schranken-Babuschkas, die in der Sowjetunion die Bahnschranken kurbeln, wie früher auch in Peine – Omsk – Nowosibirsk – Irkutsk – Ulan-Bator – Beijing – Wuhan – Changsha – Guangzhou – und schließlich Hongkong. Es ist einfach herrlich, aus dem Zugfenster zu schauen und die vorbeiziehenden Landschaften und Städte zu genießen. Die endlose Taiga, die innerasiatischen Steppen, die Wüste Gobi, die Reislandschaften und wilden, verdschungelten Berge im Süden Chinas.
Nach einem Intermezzo als Meeresgeophysiker an der Universität Hamburg entscheide ich mich, im Sommer auch noch in die andere Richtung bis ans Ende der Gleise zu fahren. Mit einem Interrailticket reise ich bis nach Marrakesch in Marokko und bis nach Narvik in Nordnorwegen. Es gibt nichts Schöneres als fahren – fahren – fahren.
Insbesondere auf diesen Zugfahrten und an den Orten, die ich besichtigt habe, fallen mir immer wieder die vielen reisenden Paare auf. Ob ich dieses Erlebnis auch einmal haben werde, frage ich mich immer öfter. So gewinnt die in mir schlummernde Sehnsucht nach Liebe wieder an Bedeutung. Sie überblendet mit jedem gefahrenen Kilometer die ewige Sehnsucht nach dem geplanten Abenteuer des Reisens.
Vom Tanzen zur Checkliste
Mein Studium setze ich als Doktorand an der Universität in Kiel fort, weil ich dort wenigstens halbwegs meinen Neigungen als Forscher nachgehen darf. Abseits der quirligen Stadt Kiel mitten in Gettorf finde ich meine Oase der Ruhe. Ich habe mir ein Zimmer bei einer alten Dame namens Vogt gemietet. Auf ihrem Anwesen herrscht eine häusliche, Geborgenheit ausstrahlende Atmosphäre.
Ihr Haus hat einen wunderschönen Gemeinschaftsraum, eine helle, freundliche, blumenreiche Loggia mit Fernsehgerät und einer total gemütlichen Eckbank. Von dort geht mein Blick stets in ihren grünen Garten, in dem auch viele ganz hohe Bäume stehen. In der Loggia esse ich morgens mein Frühstück, das gibt jedem einzelnen Tag den richtigen Schwung. Auch Abendessen mache ich mir hier regelmäßig. Und nicht selten setzt sich die Vermieterin dazu. Und dann erzählt sie mir spannende Geschichten aus Ostpreußen. Dort spielten sich ihre Kindheit und Jugend vor dem Krieg ab.
Dinge, die sie selber erlebt hat, ja erleben musste. Dinge, die sie gezeichnet haben. Vom großen Treck. Von eisiger Winterkälte. Und von ihren Partnerschaften und ihrem Mann, den sie lange Zeit hatte. Ostpreußische Strenge, Herzlichkeit und Herrlichkeit prägten sie nachhaltig. Heute ist sie Witwe und teilt ihr Haus gern mit Studenten und Doktoranden.
Natürlich besuche ich an meiner neuen Wirkungsstätte auch sofort die Tanzkurse des Hochschulsports. Auch finde ich dort problemlos Tanzpartnerinnen. Mit der Zeit ergibt es sich, dass ich mich dauerhaft und regelmäßig mit Brigitte, einer Studentin der Pharmazie, zum Tanzen verabrede. Obwohl sie auch schon einen Freund hat, macht mit ihr das Tanzen immer mehr Spaß. Sie eröffnet mir neue Welten.
Zum Beispiel entdecke ich mit ihr langsam, aber sicher auch die Diskothek für mich. Immer dann, wenn in Kiels größter Disco, der »MAX Music Hall«, die »Ballnacht« angesagt ist, wird auf der Fläche hauptsächlich Standard und Latein, aber auch Discofox getanzt. So gehen wir zusammen dorthin, um spaßige Tanzpraxis zu bekommen. Für mich ist das eine Art Disco-Therapie.
Ich merke schnell, dass Discos für mich keine Orte sind, um einmal meine Frau fürs Leben zu finden. Die ganzen Frauen, die da hingehen, sind nicht mein Typ. Und der Lärm und der Rauch werden mit zunehmender Stunde am Abend immer unerträglicher. Und die Musik ist leider immer viel zu laut.
Immerhin schaffe ich es, Brigitte zu überreden, dass wir unsere Tanzpausen immer lärmfrei und erholsam vor der Disco einlegen. Im Winter ziehen wir uns dazu sogar in mein Auto zurück, das in der Nähe auf einem Parkplatz steht. Natürlich habe ich darin auch einen Vorrat an Getränken gebunkert. Das spart ganz nebenbei noch Verzehrkosten.
Nach wie vor spaßt es viel beim Tanzen. Und ich möchte das Tanzen nicht mehr missen. Aber aus irgendeinem Grund scheint es für mich nicht vorgesehen zu sein, auch einmal eine Frau beim Tanzen kennen zu lernen. Denn da gehen anscheinend nur vier Arten von Damen hin:
solche, die schon lange gerne tanzen und demzufolge auch bereits einen Partner haben;
solche, die zwar gerne tanzen, aber die mit einem tanzfeindlichen Partner zusammen sind und keinen Partner außerhalb des Tanzens mehr haben wollen;
solche, die das Tanzen nur benutzen, um jemanden zum kurzfristigen Spaß kennen zu lernen, und
solche, die zwar auch einen Partner suchen, die aber irgendetwas an sich haben, was auch andere schon abgeschreckt hat, also solche, die keinen Partner abbekommen.
Wo ich für mich mal eine Freundin finden soll, weiß ich nicht. An der Uni unternehme ich viele Versuche, Freundschaften zu knüpfen. Wir treffen uns in Studentenkneipen, wo es immer so viel Gezwatscher, ein undefinierbares Stimmendurcheinander, gibt. Wir spazieren durch den Botanischen Garten, tanzen zusammen. Mehr passiert nicht. Denn immer wieder wollen die Damen außer der gegebenen Freizeitbeschäftigung mit mir tiefer gehend keinerlei Bindungen eingehen. Lockere Freundschaften: ja, aber engere Beziehungen: nein. Aus irgendeinem geheimnisvollen Grund wird daraus nie etwas.
Ich mache mir Gedanken. Vielleicht muss ich wählerischer sein, um mein Ziel zu erreichen? Im Laufe der Zeit erarbeite ich mir eine Checkliste mit wichtigen Merkmalen und Eigenschaften, die eine Frau haben muss, damit sie zu mir passt:
Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz
Verlässlichkeit
natürlicher, häuslicher und familiärer Typ
ähnlicher Musikgeschmack
Ruhe ausstrahlender Typ
Interesse an gemeinsamen Freizeitaktivitäten, die das Partnererlebnis nachhaltig stärken, zum Beispiel Fahrradfahren, Wandern, Tanzen, Reisen; entweder sollte sie mitmachen oder zumindest akzeptieren, dass ich diesen Aktivitäten zeitweise alleine nachgehe
Nichtraucherin
alkoholphobe Einstellung
Innere Werte sind für mich viel wichtiger als ihre äußere Erscheinung. Insbesondere wünsche ich mir keine nach Selbstdarstellung oder ewigem Flirt lechzende Discotante, die zwar vielleicht vom Äußeren her sexuell anregend ist, aber ansonsten nichts zu bieten hat. Mit einer Frau, die vielleicht nicht so toll aussieht, aber dafür ein »Schatz« ist, werde ich letztendlich viel glücklicher werden.
Ich werde bei allen Bekanntschaften, die ich in Zukunft mache, sofort überprüfen, ob eine Frau diese Punkte erfüllt, bevor ich mich weiter mit ihr beschäftigen werde. Im Laufe der Zeit lerne ich mehrere potentielle Freundinnen kennen. Die meisten davon beim Tanzen im Rahmen des Hochschulsports, andere irgendwo an der Uni. Auch schalte ich eine Annonce im Kieler Stadtmagazin:
»Doktorand, 24/176 (kein Discotyp), sucht nichtrauchende Sie (19–26 J.). Begeistern auch dich phantastische Landschaften, Naturerlebnisse und Traumstraßen? Bringst du noch Spaß am Tanzen mit und zählen für dich Natürlichkeit, Romantik und Offenheit, dann sollten wir uns endlich kennen lernen!«
Neben einer Fülle unseriöser Angebote sind einige Damen dabei, mit denen ich mich treffe. Aber keine davon erfüllt wenigstens eine Mindestanzahl der Punkte auf meiner Checkliste. Die Frau, die ich suche, scheint es nicht zu geben.
Der Winter neigt sich dem Ende zu. Mittlerweile ist es morgens bereits hell. Wenn ich wach werde, begrüßt mich herrliches, helles Vogelgezwitscher, das von Tag zu Tag immer mehr wird. Es erweckt in mir die Lebensfreude. Und es verstärkt meine Sehnsucht nach einer Partnerin.
Erste Beziehungspraxis
Derjenige, über den ich seinerzeit mein Zimmer in Gettorf vermittelt bekam, ist Mitglied einer Kieler Studentenverbindung. Als er von mir erfährt, dass ich ebenfalls einer Verbindung angehöre, lädt er mich zum Ball anlässlich des Stiftungsfestes seiner Verbindung ein. Dort lerne ich Cordula kennen, mit der ich mich auch nach dem Fest immer mal wieder treffe.
Ganz vorsichtig tasten wir uns von Treffen zu Treffen mehr an den anderen heran. So lernen wir uns immer besser kennen und beginnen uns zu mögen. Jedenfalls hat es den Anschein, denn ich darf ausprobieren, wie es ist, sie zu umarmen und zu berühren. Und sie darf mich auch berühren.
Gelegentlich tauschen wir sogar schon Küsse aus, obwohl mir das überhaupt nicht gefällt. Denn nach meinem Kennenlernplan, den ich mir mittlerweile aufgestellt habe, ist das Küssen noch nicht dran. Mindestens neun Monate müssen eigentlich vergehen, bevor ich sagen kann, ob ich sie wirklich lieben kann oder nicht.
Aber sie will es schneller. Frauen scheinen das so zu wollen. Das bestätigen diverse Filme im Fernsehen. Also bin ich bereit, mich darauf einzulassen. Aber es sind irgendwie noch keine echten Liebesküsse. Wir tanzen auch miteinander, wir fahren Fahrrad, machen Ausflüge, besuchen Flohmärkte und auf ihre Initiative hin Kulturveranstaltungen.
Ich bin froh, dass wir so viel gemeinsam unternehmen können, eine solche Zweisamkeit habe ich vorher noch nie erlebt. Das bringt uns immer näher zusammen. Natürlich stelle ich Cordula meiner Vermieterin vor. Nachdem sie gegangen ist, bekomme ich am Abend ein seltsames, ermahnendes Feedback: »Herr Schmidt, diese Dame ist für Sie viel zu unterkühlt. Sie haben zwar Schwierigkeiten, Gefühle zu zeigen und zu erkennen, aber Sie sind innerlich warm, sehr warm. Und Sie brauchen eine Frau, die innen auch warm ist, so wie Sie. Diese Dame, Herr Schmidt, diese Dame ist viel zu kalt für Sie.«
Ich kann mit diesen Worten wenig anfangen. Menschen haben immer eine Temperatur von ungefähr 37 Grad. Haben sie eine höhere oder niedrigere Temperatur, dann sind sie krank. Aber ich spüre auch, dass Cordula nicht so ist wie ich. Und dann sind da ja noch die Punkte meiner Checkliste, die sie nicht wirklich erfüllt: Sie kann nicht so lange tanzen wie ich, nicht so lange Fahrrad fahren wie ich und geht andauernd in ein Fitness-Studio.
Immer wieder hat Cordula keine Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Das finde ich sehr bedauerlich. Wer keine Zeit hat, für den ist etwas anderes wichtiger. Und das ist ohne Wertung. Für mich heißt das, dass ich in dieser Zeit nicht so wichtig in ihrem Leben bin wie ihre Gesundheit! Das ist grundsätzlich okay, denn auch für mich ist die Gesundheit das Wichtigste, aber warum muss man sich Gesundheit in Fitness-Studios abholen?
Solche Fitness-Center sind für mich wie Folterkammern, vor allem diese Krafträume darin. Warum mühen sich Menschen in geschlossenen Räumen ab, wenn sie doch draußen so schön Ausdauersport in Form von Fahrrad fahren machen könnten? Dafür hat Cordula dann keine Zeit mehr oder ist schon bald komplett erschöpft. Schade.
Wenn ich joggen wollen würde, würde ich draußen Strecke machen, die Natur dabei erleben, Eindrücke aufsaugen, frische Luft einatmen, aber doch nicht auf der Stelle laufen, während die Gummistraße unter mir durchzieht. Wie frustrierend, man läuft, macht und tut und kommt dennoch nicht vom Fleck!
Ich weiß nicht, ob ich Cordula wirklich liebe oder nicht. Ich weiß nur eines, ich will eine Frau haben, mit der ich ewig zusammen sein kann. Ich zweifle immer mehr, ob Cordula diese Frau ist.
Den Sommerurlaub verbringen wir ohnehin getrennt. Sie fährt mit einer Reisegruppe quer durch die USA. Diese Tour hatte sie schon gebucht, bevor wir uns kennen gelernt haben. Und ich bin mit dem Forschungsschiff »Meteor« zwischen Teneriffa und Gran Canaria unterwegs mit abschließender Überfahrt nach Hamburg.
Bei herrlichstem Sommerwetter passieren wir nach vielen tausend Seemeilen die deutsche Nordseeküste. Fremdartig wie eine Fata Morgana sehen die Inseln und die fern hinter dem Horizont liegenden Häfen aus. Gewaltige Luftspiegelungen lassen die ententeichartig glatte Oberfläche des Wassers mit dem Himmel bizarr verschwimmen. Wie ein surrealistisches Gemälde. Welch verkehrte Welt, durch Mauern aus Luft verzerrt.
Schiffe, die scheinbar kieloben fahren, weil deren Aufbauten nach unten zeigen, Inseln, die in der Luft hängen, und Schiffe, die auf einmal zu Strichen zusammenschmelzen, bevor sie wieder größer werden, wenn sie sich der »Meteor« nähern. Die Menschen an Bord brutzeln sich unter der stechenden, steil stehenden Sonne braun – und das auf der Nordsee!
Mit Einbruch der Dunkelheit tuckern wir in eine tropisch anmutende laue Nacht hinein. Es geht die breite Elbe hinauf. Als wir am nächsten Morgen schließlich im Hafen von Hamburg ankommen, ist da niemand, der mich abholt. Auch keine Cordula, denn sie ist ja in Amerika. So fühle ich mich verlassen.
Wochenlang saß ich mit anderen Menschen im wahrsten Wortsinne im selben Boot. Es war zeitweise anstrengend, weil manche Menschen mit meiner Art zu sein nichts anfangen konnten oder wollten. Aber es war auch sehr schön, was das Sammeln von Erfahrungen und Erlebnissen angeht.
Nach dem Ende der Forschungsfahrt erreicht mich eine Postkarte aus Amerika. Merkwürdige Dinge stehen darauf. Sätzeweise berichtet Cordula über die Reisegruppe. Wie toll die ganzen Leute so seien und dass ihr die Reise deswegen sehr gut gefalle. Kaum ein Wort über die Landschaft oder über Amerika. Das gibt mir zu denken. Sie berichtet zwar vom Yellowstone-Nationalpark, aber vor allem, dass sie dort just dann auf Toilette musste, als der Old-Faithful-Geysir ausbrach. Und dass danach die Gruppe, zu der sie gehörte, abgefahren sei. Und dass sie daher leider den Ausbruch nicht erleben konnte. Und dass das ja nicht so schlimm sei.
Wenn ich dringend auf Toilette gemusst hätte und ausgerechnet in diesen Minuten der Geysir ausgebrochen wäre, der nur alle zwei Stunden spuckt, dann hätte ich mit Nachdruck darauf bestanden, diese Zeit abzuwarten. Ich wäre niemals in den Yellowstone-Park gekommen, um statt des berühmten Old Faithful in Eruption nur eine Toilette zu sehen. Yellowstone ohne Old Faithful, das käme einer Amputation der Reise gleich. Da wäre die ganze Reise sofort mit ungenügend bewertet worden. Und wenn die ganze Gruppe ohne mich weitergefahren wäre! Da hätte es keine Argumente seitens des Reiseleiters oder der Gruppe gegeben, die mich von meiner Blockade abgebracht hätten. Mir wird auch klar, dass ich den Rest der Reise in dieser Gruppe kein Wort mehr über die Lippen bekommen hätte, wenn man mir dieses Verhalten übel genommen hätte.
Ich spüre, dass hier ein grundlegender Unterschied zwischen uns beiden liegt. Dass wir uns hier fatal fürchterlich gestritten hätten, wären wir gemeinsam auf Reisen gewesen, weil ihr die Gruppe und ihr Ansehen in der Gruppe wichtiger sind als der Old Faithful. Amerika scheint für sie nur eine Kulisse zu sein. Es geht ihr mehr um das Gruppenerlebnis als um das Ziel. Das ist bei mir völlig anders. Wenn ich verreise, dann will ich eine neue Gegend kennen lernen. Ich will mich nicht mit einer Reisegruppe amüsieren. Im Gegenteil, auf die könnte ich auch verzichten. Eine liebe Postkarte, die mich dennoch zum Grübeln bringt.
Ich entschließe mich, zu Cordulas Eltern zu fahren und mit ihnen über Cordula zu reden. Denen erzähle ich, dass ich es sehr schade finde, dass ihre Tochter leider viel zu schnell schlappmacht beim Ausdauertanzen und beim Fahrradfahren. Da habe ich mir Frauen anders vorgestellt. Daraufhin sagen sie mir, dass Cordula eben nicht so ausdauernd sei wie manch andere Frau. Das bedeutet für mich sofort, dass nicht alle Frauen so sind wie Cordula, dass es da noch Alternativen geben könnte, mit denen ich langfristig erheblich glücklicher werden könnte.