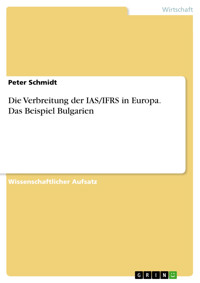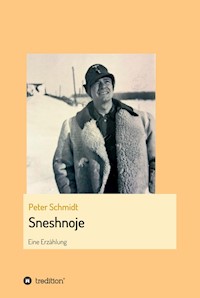Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Karriere mit Autismus. Schon als Kind weiß Peter Schmidt alles über Planeten, Wüsten und Vulkane. Und das Geophysikstudium absolviert er mit links. Doch als er aus seiner Leidenschaft einen Beruf machen will, fangen die Probleme an. Er erkennt die Gesichter seiner Kollegen nicht wieder und zu seinen Kunden ist er so ehrlich, dass er die Marketingstrategie seines Chefs unterläuft. Denn Peter Schmidt ist Autist: fachlich hochbegabt, aber sozial gehandicapt. Doch er lässt sich nicht unterkriegen, macht Karriere in der IT-Branche und bringt mit seiner Querdenkerei dem Unternehmen immense Vorteile. Peter Schmidts neues Buch ist der Bericht über den steinigen Weg eines Autisten in der Arbeitswelt. Und es ist die Erfolgsgeschichte eines Menschen, der trotz seiner Andersartigkeit sein berufliches Glück findet
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Peter Schmidt
Kein Anschluss unter diesem Kollegen
Ein Autist im Job
Patmos Verlag
»Wir wissen nicht so genau, ob Sie nun die Kapazität oder der Widerstand
im System sind, Herr Schmidt!«
»Das hängt von der Frequenz ab, Herr Professor!«
Für alle, die mir halfen, helfen und helfen werden, Visionen wahr werden zu lassen.
Für alle Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, aktuell zusammenarbeiten und noch zusammenarbeiten werden, die mir die Chance gaben, mich mit dem weiterzuentwickeln, was ich anzubieten habe, die an mich glaub(t)en und die mich im Rahmen ihrer Möglichkeiten förder(te)n.
Und natürlich für die Papamamas, meine Eltern,
und natürlich für mein Gnubbelchen, die Mau, meine Frau,
sowie für meine Tochter und meinen Sohn.
Hinweis zum Persönlichkeitsschutz: Alle im Buch im geschäftlichen Kontext vorkommenden Namen von lebenden Personen wurden anonymisiert.
Inhalt
OPENING WARM-UP
Der nicht mit den Wölfen heult
VON DER ARBEIT BIS ZUM ABI
Bir, iki, üç – Geburt einer vulkanischen Sehnsucht
… und plötzlich blaut das Rot
Rätselhaftes Pflichtcasting
STUDENT SEIN, WENN DIE VEILCHEN BLÜHEN
Aufbruch ins Ungewisse
Das Amen im Hörsaal
Goethes Werke sind keine Fabrik!
Ski, Schein, Schnee und Sein
In einer geophysikalischen Firma arbeiten nur Geophysiker!
Vordiplom am Vesuv
Zipfeltausch an einem korngoldgelben Tag
Diplom im Labor der Petrophysik
ALS GEOPHYSIKER IM DIENSTE DER WISSENSCHAFT
Die Meteor-Boje überm Atlantis-Seamount
Die Entdeckung vollster Zufriedenheiten
Ganz legale Bestechung
Zug verpasst!(?)
Die »goldene« Stelle
Traumjob in der Südsee
Abgeforscht!
MEINE KARRIERE ALS SAP-EXPERTE IM PHARMAKONZERN
Arbeitsloses Intermezzo
Peter Schmidt relaunched
Im Zeichen von Tor, Turm und Brücke
Manchmal muss man das Rad neu erfinden!
Hinter den Kulissen des Informationswürfels
Die Ablöse
Angekommen in der Hierarchie
Endlich Prozessverantwortung
Im Zeichen des gespaltenen Golfspielers
»Da fehlen Ihnen Basics, Herr Schmidt, Basics!«
Lost at sea
Endlich Gestaltungshoheit
EH&S – Current Progress
Im Zeichen der großknorrigen, dickbäumigen Allee
C’est la vie à Paris
Der Architekt im Leuchtturmteam
Als Gastarbeiter in Deutschland
Der Berg ruft zum Tanz mit DJ Ötzi
Die Urlaubsblockade
How to work with Peter
An der Pagode des Lichts
Der nicht ins Schema passt
CLOSING COOL-DOWN
Nachwörternde Nimm-mits
Danke dafür, dass ich meine Ziele erreichen durfte
OPENING WARM-UP
Der nicht mit den Wölfen heult
Wüstenhaft trockene Vorträge sind meist perfekte Einschlafhilfen. Ich will aber keinen langweiligen, zum Gähnen animierenden Vortrag halten, sondern eine Performance abliefern, die das Publikum berührt. Dass ich keine trockenen Vorträge mag, hat offenbar auch der Wettergott mitbekommen. So liefert er pünktlich zum Veranstaltungsbeginn ein wolkenwasserfallreiches, schweres Gewitter.
»Durchgang zum Vielleicht«, so heißt die Veranstaltung 2011 in Bremen, auf der ich zu meinen Erfahrungen als Autist im Beruf referiere. Starke, symbolische Bilder aus meinem Fotoarchiv stützen meinen Vortrag wie Brückenpfeiler. So erkläre ich am Beispiel der wirr wirkenden, aber dennoch sehr strukturierten Gleisspaghetti des Gleisvorfeldes am Frankfurter Hauptbahnhof, wie Wege in und durch das Berufsleben funktionieren oder auch nicht. Ich titele meine Präsentation über meine Abenteuer auf steinigen Wegen durch das Arbeitsleben mit »Der nicht mit den Wölfen heult«.
Wenige Tage später kontaktieren mich gleich mehrere Menschen. Mein Vortrag habe sie sehr beeindruckt und nun wolle man auch das zugehörige Buch kaufen, könne es aber nirgendwo finden. Man habe vergeblich im Internet gesucht und beim örtlichen Buchhandel nachgefragt. Ja, sogar ein Weihnachtsgeschenk solle es werden, schreibt eine verzweifelte Mutter. Beim Recherchieren, warum die alle nach einem Buch fragen, das es doch noch gar nicht gibt, stoße ich im Internet auf einen großen, aussagekräftigen Zeitungsartikel über meinen Auftritt, in dem ich als Autor des Buches »Der nicht mit den Wölfen heult« vorgestellt werde.
Aber erst wenn der Weg auf den Gipfel vollendet oder zumindest eine Passhöhe mit wichtigem Meilensteincharakter erklommen ist, lassen sich aus der Adlerperspektive die Zusammenhänge der Wege tief unten im Tale, wo alles begann, verstehen. Es liegt in der Natur der Sache, dass man nur mit dem Erreichen von Aussichtspunkten viele Lebenserfahrungen aus der Distanz in nie vorher gesehenen Zusammenhängen begreifen kann. Die Zeit, darüber zu berichten, ist gereift.
Dieses Buch zeigt, wie ein offenkundig autistischer Mensch Karriere machen kann. Denn das kommt selten vor. Die Schwierigkeit liegt darin, dass Autismus nicht unbedingt auf den ersten Blick zu sehen ist. Die Unsichtbarkeit ist in der Undeutbarkeit oder Fehldeutung von Auffälligkeiten begründet, die von anderen wahrgenommen werden. So wie unsichtbare Radioaktivität, die aber dennoch durch ihre Wirkung auffällt! Während bei einem Rollstuhlfahrer sofort einsichtig ist, wo er Unterstützung braucht und was von ihm nicht verlangt werden kann, ist es bei einem autistischen Menschen für Außenstehende viel schwieriger, zwischen dem Nichtkönnen und dem Nichtwollen zu unterscheiden.
Schon immer habe ich gespürt, dass ich anders als andere Menschen funktioniere. Meine Stärken waren mir immer bewusst. Aber erst 2007, als ich im Alter von 41 Jahren die Diagnose Autismus erhielt, habe ich erfahren, worin genau meine größten Schwächen liegen. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Deuten nonverbaler Kommunikationssignale und kann keine Emotionen aus Gesichtern lesen. Außerdem kann ich mich nicht intuitiv in andere hineinversetzen, so dass mir aus Sicht anderer mangelnde Empathie vorgeworfen wird, ich somit immer wieder soziale Situationen nicht verstehe und Irritationen nahezu täglich meinen Alltag bestimmen. Auch panikartige Zustände und Blockaden, die immer dann aufkommen, wenn ich mich um vieles gleichzeitig kümmern soll oder es anders kommt als geplant, sowie starre Rituale und stereotype Handlungen machen es nicht gerade leichter.
Heute bin ich stolz darauf, dass es mir dennoch gelungen ist, viele Bereiche in der Arbeitswelt kennenzulernen. Ich sammelte Erfahrungen bei meiner Ausbildung an der Uni als Student, bei meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Angestellter in einer großen Behörde, in Zeiten von Arbeitslosigkeit und als Experte für SAP-Software in unterschiedlichsten Funktionen bei verschiedenen Firmen in der freien Wirtschaft.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, nun viel Spaß auf meiner von Rückschlägen und Erfolgen bestimmten Achterbahnfahrt durch mein Berufsleben.
VON DER ARBEIT BIS ZUM ABI
Bir, iki, üç – Geburt einer vulkanischen Sehnsucht
Es duftet nach Braten, belegten Brötchen und Bier. Nach Schnaps, Schinken, Schwein und Schweiß. Und es riecht nach Käseplatten, Knabberkram und Korn. Nicht das Korn, das auf dem Felde wächst, nein, den Korn, den die Leute trinken: »Proooost! Auf dein 25-Jähriges!«, hallt es im April 1975 durch das leutevolle, essensatt tischgedeckte, persisch geteppichte und schrankwandig braune Wohnzimmer.
Ich bin jetzt neun Jahre alt. In einer Zeit vor meiner Zeit hatte der braune Brummelbär, mein braunstoffhosig brummelnder Vater, angefangen zu arbeiten. 25 Mal hat die Erde seither die Sonne umrundet. Deswegen sind heute die ganzen Leute da. Und die reden auch alle nur über die Arbeit. Genauer: über Probleme »auf der Arbeit«, wie die das nennen. Über Autos, Hausbaustellen und Leute, die gar nicht da sind. Die am Tisch fehlen.
Arbeiten tut man auf der Hütte. Genauer: auf der »Ilseder Hütte«! Das ist da, wo schlanke schlotige Schornsteine zwischen braundreckigen Backsteinhäusern riechend rauchen. Da, wo das flüssige, heiße Eisen gemacht wird. Da, wo es immer wieder faucht und zischend glüht. Diese Hütte steht mitten zwischen den Dörfern Gadenstedt, Groß Ilsede und Ölsburg hinter einem endlos langen Bretterzaun.
Wenn die gelbrot glühend heiße Soße aus den Öfen kommt, fließt sie in riesige Kippeimer, die auf Eisenbahnwaggons montiert sind. Wenn diese Kippeimerwaggons über den Bahnübergang beim Groß Ilseder Schloss fahren, dann sieht man durch einen Schlitz unterm Deckel die gelb glühende heiße Hölle blitzen, die im Innern dieser Waggons herrschen muss.
Rauchend rollen die riesigen, mit tränigem, gefrostetem Roheisen verdreckten Kippeimer nach Peine. Dort fahren sie auf einer hohen und langen, stahlträgerreichen Bogenbrücke über alle stolpersteinenden Peiner Südstadtstraßen hinweg. Ins Walzwerk, wo das aus Ilsede kommende, nun langsam erstarrende Eisen fauchend weiterglüht und zu langen grellheißen Eisenbahnschienen geformt und gezogen wird, die dann immer rotschwarzdunkler werden. Auch da arbeiten viele Leute.
Direkt neben dieser Fabrik, in der Braunschweiger Straße, die an der hohen Fabrikmauer entlangführt, wohnt der Onkel Willi. Er arbeitete im Walzwerk. Und ist jetzt abgearbeiteter Rentner. Er besucht uns häufig zusammen mit Tante Else, die mich immer sehr mag. Manchmal kommt er auch dann, wenn ganz viele andere Leute da sind. So wie jetzt.
Bei uns gibt es immer wieder viele Leute. Vor allem, wenn einer Geburtstag feiert. Und es gibt dann meist viele schöne Dinge zu essen, die sonst leider nie auf dem Tisch stehen. Und solange das leckere Essen auf dem Tisch steht und ich Hunger habe, sitze ich mit den ganzen zwatschernden Leuten zeitweise zusammen am weißgetischdeckten, essplattenvollen Tisch.
Aber auch wenn die Leute sich ausnahmsweise mal für Astronomie interessieren. Oder einer von denen mal wieder irgendwo im Urlaub war, wo wir leider nie hinfahren. In Spanien zum Beispiel. Auf den Kanarischen Inseln. Oder am Gardasee. Dann spaßen auch die Leute, nicht nur das Essen. Aber meistens nervt das zwitschernde und zwatschernde Blabla nur. Wozu machen und brauchen die Leute das bloß?
Ich brauche es nicht und verschwinde dann im Kinderzimmer. Dort bin ich zwar allein, aber es herrscht Ruhe. Schöpferische Ruhe. Mein Blick fällt auf ein dunkelrotes, heftartiges Büchlein. Es enthält Wörtertabellen. Zwei Spalten. Deutsch und daneben Türkisch. Banjo Odassi. Welch schönes wellig volles Wort! Noch besser gefallen mir die Zahlen, denn die haben auf einmal ganz andere Farben:
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Und 11 ist dann »on bir«! Klingt bayrisch wie »oan Bier«, »ein Bier«! Heißt aber »zehn-eins«. Das ist eigentlich doch auch viel logischer als »elf«. Warum deutscht es »elf« statt »einundzehnzig« wie bei »einundzwanzig«? So viele Fragen, die mir keiner der Zwatschernden da unten im Wohnzimmer beantworten kann. Ich spreche lieber schweigend. Mit den Büchern. Sie erzählen mir viel. Vielleicht beantworten sie mir auch irgendwann einmal das. So spaßt es, in diesem Buch »Deutsch-Türkisch – Türkisch-Deutsch« mit den geordneten Wörtern zu schmökern.
Das mit den ganzen Leuten da in der Stube, das gehört komischerweise auch noch zur Arbeit des braunen Brummelbären. Weil es oft auch Arbeitskollegen sind. Und da gibt es auch jede Menge Türken. Einer von denen hat uns sogar eingeladen, mal zu seiner Familie in die Türkei zu kommen.
Ich schaue mir den Weg im Atlas an. Mehrere tausend Kilometer mit dem Auto. Viele neue Straßen würde ich sehen. Und endlich mal andere Länder: Österreich, Jugoslawien, Bulgarien, Türkei! Ich bin begeistert. Doch graudicke Wolken der Enttäuschung verdrängen die wolkenlosblaue Begeisterung schnell, als die Antwort der Locken, wie ich still meine Mutter nenne, kommt: »Was soll’n wir’n da? Da gibt’s doch nichts! Da sind doch nur ein Paar Schafe und ein Haufen Steine! Wenn’s da was anderes geben würde, wären doch die ganzen Türken nicht hier! Da haben wir es doch in unserm Garten vieeeel schöner!«
Natürlich ist der Garten bei uns ein schöner Baumpark. Aber ich will ja auch nicht da wohnen, nur einfach mal hinfahren, sehen und erleben – und dann wiederkommen. Es ist doch was anderes, dort Straßen zu besuchen, als dort zu wohnen! Schade, dass meine Papamamas das wohl leider doch nicht machen werden. Da es scheint, als könne sich der braune Brummelbär so eine Reise eventuell doch vorstellen, ergänzt die Locken nach einigen Minuten der Stille laut bastaschlussend: »Das kostet ’nen Haufen Geld! Werner, das geht nich’ an! Basta!«
Ach ja, wir haben ja immer kein Geld. »Was das alles kostet, darüber macht ihr euch alle keine Gedanken!« Das hat die Locken schon so oft zu vielem gesagt. Da immer noch denkende Stille im Raum herrscht, kommt von der Locken noch etwas hinterher: »Und außerdem verstehe ich da kein einziges Wort! Da brauch’n wir nun wirklich nich’ hin! Da kann ich mich mit denen ja überhaupt nicht unterhalten!«
In diesem Moment muss ich an das Wörterbuch denken. Die Tabellenbrücke zwischen Deutsch und Türkisch. Und an Omma Liesbeth, die längst tot ist, wie sie mich früher mal in ihrem großschnörkelig verspiegelten Schlafzimmer im alten Haus fragte: »Was willste denn mal werden?« Damals war es das erste Mal, dass ich mir Gedanken machte, ja machen musste, was ich mal arbeiten will, um ihr eine Antwort zu geben. Denn schon damals stand für mich irgendwarum feinfühlig fest, dass ich niemals »auf der Hütte« arbeiten könnte.
Das und die Sache mit dem »Nichtunterhalten« stimmen mich nun sehr nachdenklich. Da ich mir nach wie vor nicht vorstellen kann, so zur Arbeit zu gehen wie der braune Brummelbär. Mit all diesen ganzen Leuten, die man dann immer einladen muss. Und in so einer lauten und dreckigen Fabrik. Wie halten die Leute das da bloß aus? Lieber würde ich sterben, als da zu arbeiten.
Es gab Kinder aus dem Kindergarten, die wollten Lokomotivführer werden. Wie langweilig. Immer nur in einer Lok im Kreis herumzufahren. Oder zwischen Peine und Ilsede glühendes Eisen fahren. Manche wollten auch Astronaut werden. Ja, den Mond oder andere Sterne und Planeten zu sehen, das wäre schon toll, aber in so einem engen Fernseheranzug durch die Gegend zu humpeln, nein, das ist nichts für mich.
Bereits zu Omma Liesbeths Zeiten, lange vor der Schule, brachte mir das tabellarisch geordnete, rote Büchlein »Deutsch-Türkisch« beim Lesenlernen viel Freude. Auf die Frage, wozu man das gebrauchen kann, lernte ich, dass man damit helfen könne, andersartige Menschen wie die Türken zu verstehen. Und dass man das »Dolmetscher« nennt! Fortan wollte ich Dolmetscher werden. Arbeiten, indem ich Wörtertabellenbücher auswendig lerne und dann dafür sorge, dass sich alle verschiedensten Leute der Erde gut miteinander verstehen.
Schnell sortieren sich die Gedanken. Es kommt mir eine geniale Idee. Ich gehe zur Locken, um ihr klarzumachen, dass das mit dem Verstehen der Leute kein Grund ist, nicht in die Türkei zu fahren: »Ich mache das mit dem Verstehen! Dann bin ich eben euer Dolmetscher!«
»Aber mein Goldfasan, du kannst doch auch kein Türkisch!«, meint die Locken nur. »Aber das lässt sich doch ändern! Ich habe ja schon längst angefangen zu lernen: Bir, iki, üç und einige Wörter mehr kenne ich schon! Bis wir da sind, kann ich genug Türkisch!«
Die Reise wird dennoch niemals stattfinden. Und ich lerne, dass wir immer zu wenig Geld haben, weil der braune Brummelbär immer noch nur Schlosser ist. Ein Maschinenschlosser. So nennt man diese Leute auf der Hütte also. Hüttenleute.
Wenn ich mal arbeiten werde, dann jedenfalls nicht in so einer Hütte oder in Räumen, in denen viele Menschen zwatschern! Ich hoffe, dass man auch einmal etwas ganz anderes arbeiten kann, denn mich faszinieren keine Maschinen und Leute, sondern ferne Gegenden. Ich will wissen, was das hier für eine Welt ist. Schon als ich vier Jahre alt war, wollte ich vom braunen Brummelbären wissen, wie es hinter dem Horizont aussieht. So träumte ich von fantastischen Landschaften jenseits der Morgenröte, die von mir einmal entdeckt werden sollen. Straßen werden mich einmal dahin führen. Ich will wissen, wie es da aussieht. Nach der Kurve ist vor der Kurve. Bis zum Ende der Straße.
Und vor wenigen Monaten sah ich in einem Fernsehfilm eine geheimnisvoll gelbbraunschwarze Insel mit merkwürdigen Blitzen oben auf einem kahlen Berg mit Loch. Seitdem will ich alles wissen über diese Berge mit den Löchern: Vulkane! Die Faszination für Vulkane und wüstenartige, leere Landschaften, die übersichtlich sind und Ruhe ausstrahlen, packt mich. Lebenslänglich!
Diese allbestimmende Sehnsucht, die gegen alle Unwägbarkeiten des alltäglichen Lebens befriedigt werden will, setzt in mir ungeahnte Kräfte frei. Dieses vulkanische Feuer gibt mir die Energie, neue Wege zu finden, noch wegelose Routen in meiner Lebenslandschaft zu wagen, um dort Spuren zu hinterlassen, denen andere dann folgen können. Der Nutzen des Entdeckens. Doch nicht nur auf der Erde.
Denn seit ein Freund des braunen Brummelbären bei einem Grillabend zu mir sagte, dass die Sterne am Himmel viele, viele langnullige Zahlen weit weg sein sollen, will ich alles wissen über Sterne, Planeten und Galaxien. Klirrender Frost, knirschender Schnee und knackendes Eis bei minus 13 °C können mich nicht davon abhalten, den kristallklaren, dunklen, funkelnden Sternenhimmel mit meinem Tasco-Spiegelteleskop zu erforschen. Immer öfter stelle ich mein Teleskop auf einen kantigen Betonweg, der durch ein kälteerstarrtes Kartoffelfeld führt, und gebe mich den augenscheinlich unendlichen Weiten des Alls hin.
So schaue ich besonders im Winter über das »Woher komme ich?« sinnierend in den eisig kalten Himmel, das Oben voller leuchtender Sterne. Wenn ich mal groß bin, werde ich Geoforscher oder Astronom. Auf jeden Fall etwas, das mir Spaß macht, bei dem ich beobachten, entdecken, analysieren, gestalten und präsentieren darf. Und damit ich die fernen Länder erleben kann, muss ich einmal ganz viel Geld verdienen, jedenfalls deutlich mehr als der braune Brummelbär.
… und plötzlich blaut das Rot
Am Gymnasium wird einige Jahre später plötzlich die alltägliche stundenplanhafte Unterrichtsordnung gestört. Der Klassenlehrer kündigt unüblichen, fachnamenlosen Unterricht an, der nicht einem der Fächer auf dem Stundenplan zuordenbar ist. Es werden mintfarbene »Step«-Hefte ausgeteilt. Darin sind viele Fragen enthalten, die auswählbare Antwortalternativen enthalten. Und je nachdem, was man da auswählt, erhält man Punkte in verschiedensten Berufskategorien wie »künstlerisch«, »sprachlich« oder »naturwissenschaftlich«.
Es gibt eine Vielzahl von Berufen. Alle Menschen sind verschieden. Der Unterricht soll vor allem denjenigen, die noch keine Vorstellungen über ihre bald kommende Zeit nach der Schule haben, helfen, geeignete berufliche Ziele zu finden. Und denjenigen, die schon Vorstellungen haben, soll das Heft Erkenntnisse bringen, ob die eigenen Vorstellungen von einem bestimmten Beruf auch mit den dort verlangten Fähigkeiten übereinstimmen.
Was kann ich? Was kann ich nicht? Was wird in welchem Beruf erwartet? Was nicht? Wo liegen meine Stärken? Wo meine Schwächen? Abgefragt werden weniger Fachkenntnisse, sondern mehr allgemeine Anforderungen wie »kreatives Arbeiten«, »logisches Denken«, »strukturiertes Arbeiten«, »eher zurückgezogen arbeiten« oder »viel mit Menschen zu tun haben« und Ähnliches.
Einige Mitschüler stellen merkwürdige Fragen, für die das Buch überhaupt keine Antworten enthält: »Wie viel Urlaub bekommt man da? Wird man da auch verbeamtet? Wie viel Geld verdient man da? Muss man da oft Überstunden machen? Wann habe ich da Feierabend? Muss man in Schichten arbeiten? Ist man da jeden Abend auch zu Hause, um in den Sportverein zu gehen? Kann man die Welt sehen? Im Büro arbeiten? Draußen arbeiten? Wird man damit berühmt? Kommt man damit auch mal ins Fernsehen? Geht das mit einer Ausbildung oder muss man da studieren?«
Was für Fragen! Die anderen müssen alle ganz anders ticken als ich. Als ich mir überlegt habe, dass ich wohl einmal Geoforscher werden will, habe ich mir solche Fragen überhaupt nicht gestellt. Ich habe einfach danach entschieden, was ich kann, was ich weiß und was mich fachlich fasziniert. Mathematik, Physik, die Erde und Astronomie. Ganz toll wäre es, ein Geophysiker zu werden, der selbst bestimmen kann, was zu erforschen ist. So wie Jacques Cousteau, der auch selbst entscheidet, wohin er mit seiner »Calypso« fährt.
Beim Durcharbeiten der Berufsfindehefte fällt mir auf, dass ich zum Beispiel kreativ bin, aber nicht spontan. Aber diese Kombination von Eigenschaften soll es anscheinend gar nicht geben. Denn kreative Berufe scheinen automatisch immer Flexibilität und Spontanität vorauszusetzen. Diese stehen aber wiederum meinem Bedürfnis nach Planbarkeit entgegen. Es wird verlangt, dass ein guter General auch schießen können muss, ein toller Sänger auch Noten lesen können muss oder man niemals ein guter Bergsteiger und Weltenbummler sein kann, wenn man seinen Rucksack nicht vernünftig packen kann. Da gibt es konkurrierende Anforderungen. Ein Schema, in das ich nicht passe.
So geht aus den ganzen Anforderungsprofilen hervor, dass ich eigentlich nicht für das Arbeiten als Angestellter geeignet zu sein scheine. Das kann doch aber gar nicht sein! Denn es werden doch wohl nicht alle Arbeiten so lärm- und leutevoll sein wie die des braunen Brummelbären. Einerseits bin ich guter Dinge und gehe davon aus, dass es da Plätze für mich gibt. Andererseits erscheint mir das Kommende irgendwie diffus ungreifbar.
Nach der Schule brauche ich immer erst eine Auszeit von ein bis zwei Stunden, um mich von dem ganzen sozialen Stress zu erholen. Denn in der Schule muss man in der Klasse lernen, es gibt keinen Einzelraum. Im Beruf gibt es später angeblich nur Achtstundentage und oft auch Überstunden. Das würde mit mir nur funktionieren, wenn ich immer genau das machen kann, was zu mir passt. Wenn sozusagen genau mein Angebot nachgefragt wird. Denn nur für das, was auch gefragt ist, gibt es Geld. Nicht für das, was man macht, wenn das keiner haben will. Ich muss es also schaffen, die Schnittmenge zwischen dem, was ich kann, und dem, was andere haben wollen, möglichst groß zu machen.
Trotz aller Widersprüche meint allerdings auch das »Step«-Heft, dass »Wissenschaftler« noch am ehesten das Richtige für mich sein könnte. Also wische ich alle Bedenken und Zweifel, die das Heft aufkommen ließ, wieder weg. Es bleibt dabei: Geophysik studieren, promovieren, um viel Geld zu verdienen oder Professor zu werden, um die Welt zu entdecken, zu erforschen und kennenzulernen. Dann kann ich bestimmen, wo es langgehen muss, und es auch vermeiden, andauernd mit Menschen arbeiten zu müssen. Mein Plan. Meine Vision.
Um ein wenig zu überprüfen, was wir Schüler über das Arbeitsleben herausgefunden haben, müssen wir auch noch ein mehrwöchiges Betriebspraktikum machen. Wo soll ich denn bloß ein Praktikum als Geophysiker oder Astronom machen? Da ideet es in mir: die Wilhelm-Förster-Sternwarte in Berlin. Von denen kriege ich seit geraumer Zeit immer Informationen zugeschickt.
Noch bevor ich da überhaupt eine Bewerbung hinschicke, erfahre ich, dass der Praktikumsplatz leider unbedingt in der Nähe der Schule sein müsse. Weil die Schule Aufsicht führe, also die Lehrer den Platz auch erreichen können müssen. Schade, ich bin noch nie in Berlin gewesen. Und so eine richtige Sternwarte hätte ich auch gern endlich mal gesehen.
Stattdessen finde ich mich einige Monate später in einem rohrvollen chemischen Labor wieder, das zu der fauchend rauchenden, schornsteinreichen Fabrik gehört, in der hier in der Gegend so viele Menschen arbeiten, auch der braune Brummelbär. In Peine. In der Nähe von Onkel Willi. In einem Ausbildungslabor des Peiner Walzwerks. Keine Sternwarte, keine Vulkane. Sondern Chemie, die nicht nur im Reagenzglas, sondern auch zwischen den Leuten stimmen muss.
In einem Labor müssen wir Versuche machen. Messen. Analysieren. Titrieren. Tröpfchenweise gieße ich eine weitere Flüssigkeit bekannter Zusammensetzung in ein Röhrchen, in dem bereits eine rote Flüssigkeit unbekannter Zusammensetzung ist. Geduldig warte ich Tropfen für Tropfen, dass da irgendwas passiert. Ganz plötzlich, bei einem einzigen Tropfen, blaut das Rot. Die ursprünglich rote Flüssigkeit ist auf einmal blau. Staunend stehe ich davor.
Es kann also im Leben passieren, dass sich ein Zustand urplötzlich total verändert. Wegen eines einzigen, einzelnen, winzigen Tropfens. Tausende Tropfen taten nichts. Und dann das! Aufgrund der verbrauchten Menge der zugekippten Flüssigkeit lässt sich nun die Zusammensetzung der ehemals roten Flüssigkeit berechnen.
Man kann also einem System etwas beständig hinzufügen, ohne dass sich was ändert – nach außen. Und ganz plötzlich ändert sich alles auf einmal – hin zu einem neuen Gleichgewichtszustand. Sehr interessant. Höchst interessant! Denn das kenne ich auch von mir selbst. Früher hatte ich stets große Angst vor einem Gewitter, bis diese bei einem wasser- und blitzreichen Unwetter schlagartig in Faszination umkippte. Genauso ging es mir mit den Vulkanen. Was hatte ich für eine Angst, als ich als Siebenjähriger in der Tagesschau die Lavafontänen von Heimaey sah! Ich glaubte tatsächlich, dass auch in unserem Garten urplötzlich so eine Fontäne austreten könnte. Und als dann zwei Jahre später der abenteuerige Film »Die geheimnisvolle Insel« im Fernsehen lief, kippte diese Angst in eine Sehnsucht um. Ich wollte Vulkane besteigen. Immer wieder gab und gibt es Situationen, da drehe ich mich in meiner Einstellung um 180 Grad, da kommt es durch Erfahrungen zu einem abrupten Perspektivwechsel, der sich aber schleichend anbahnte.
So faszinierend das alles ist, so schlimm ist für mich die Erkenntnis, dass ich in so einem Labor niemals dauerhaft arbeiten könnte. Dort hätte ich kein Büro, dessen Tür ich hinter mir zumachen kann. Kein Büro, in dem nur ich alleine sitze. In das ich mich zum Erholen zurückziehen kann. Wo ich denken kann. Kreativ sein kann. Nichts dergleichen. Irgendwie ist das Labor zwar sauber und nicht so dreckig wie die Orte, an denen der braune Brummelbär arbeitet, aber in so einem großen Raum, in dem ständig irgendwas summt und klackert, in dem alle kantinenähnlich durcheinanderreden, da würde ich eingehen wie ein Kaktus, den man zu viel gießt. Das geht gar nicht!
So hoffe ich, dass ich nach einem Studium so schnell wie möglich Wissenschaftler in meinem eigenen Büro werden kann. Nur so kann ich arbeiten. Wie Heinz Haber Bücher schreiben. Oder so wie Jacques Cousteau auf meiner eigenen »Calypso« forschen. Ich brauche einen Raum, in dem meine Regeln gelten, wo ich das Sagen habe und bestimmen kann, wann Ruhe herrscht.
Das Praktikum bestätigt, was ich schon immer gespürt habe. Betonfest steht: Niemals werde ich in so einer rohrvollen Fabrik arbeiten können wie der braune Brummelbär!
Weil ich nicht so viel mit Leuten von der Schule zusammen bin, kriege ich zu Hause immer wieder schallplattenartige Ratschläge zu hören: »Du musst viel mehr mit den Wölfen heulen! Viel mehr aus dir rauskommen, vor allem viel, viel menschlicher werden!«
Warum sollte ich in den Wald gehen, um mit Tieren zu weinen? Außerdem gibt es doch gar keine Wölfe mehr, oder vielleicht ja doch, wenn man tief genug in den Wald geht? Und wie wo raus soll ich da kommen? Ich bin doch ein Mensch, habe doch Arme und Beine, wie alle Menschen. Vielleicht meinen die ja die Mauer, die ich in mir spüre. Die mich gläsern von den anderen trennt. So wie ein Fenster, das das Innen vom Außen abgrenzt. Unsichtbar. Aber dennoch wirksam. Diese Mauer habe ich schon, so lange ich denken kann.
Und wo ich schon darüber nachdenke, da gibt es noch etwas, womit ich Schwierigkeiten hätte: Im Jahreskalender des braunen Brummelbären hat fast jeder Tag einen Buchstaben: F, M oder N. Sie alle stehen für anderszeitiges Arbeiten: Frühschicht, Mittagschicht und Nachtschicht. Zwischen N und F gibt es Tage, die haben keinen Buchstaben. An denen muss der braune Brummelbär nicht auf Arbeit. Und dann gibt es da noch Tage, die haben ein U. Diese Tage sind genauso wie die Tage ohne F, M oder N.
U steht eigentlich für Urlaub. Was so viel bedeutet wie Ferien. Keine Arbeit. Aber immer wenn ein U in seinem Kalender steht, dann wird bei uns irgendwas renoviert oder gebaut. Oder im Garten gearbeitet. Nur alle zwei Jahre gibt es wirkliche Wegfahrferien. Dann geht es an die See. Oder in die Berge. Viele in der Klasse müssen wie ich auch zu Hause bleiben, aber es gibt einige, die zu tollen, fernen Inseln fliegen dürfen.
Immer wenn die Locken sich darüber aufregt, dass sie ja nur noch für die Kinder und den Garten da sei, sage ich ihr: »Dann geh doch endlich wieder arbeiten! Dann haben wir vielleicht auch endlich nicht mehr zu wenig Geld!« Und jedes Mal mühlt es die gleiche Antwort aus ihrem Mund: »Da macht man und tut man, und was ist der Dank dafür, ’nen Tritt innen Arsch! Wenn ich noch berufstätig wär, dann würdet ihr euch hier aber alle ganz gewaltig umkucken! Dann wär das hier aber nicht mehr so schön! Dann würde der Dreck drei Meter hoch liegen! Und eure Wäsche könntet ihr dann selber machen! Essen kochen, einkaufen! Und wer macht den ganzen Garten, füttert die Karnickel, die Hühner, pflückt die vielen Äpfel und Birnen, damit wir im Winter was zu essen haben? Wer mäht den Rasen und, und, und?«
Ja, das kostet dann also das Geld, das die Locken nicht verdient. Wenn das alles jemand für uns machen würde, dem wir dann das Geld geben müssten, bleibt die Frage, ob es mehr oder weniger kosten würde als das, was die Locken kriegen würde, wenn sie wieder auf Arbeit geht. Würde sie weniger kriegen, lohnt es sich nicht, arbeiten zu gehen. Würde sie dagegen mehr kriegen, würde es sich lohnen. Wir hätten alles schön und mehr Geld. Doch dies wird nie weiter diskutiert. Anscheinend möchte sie gerne zu Hause arbeiten, vermisst aber dabei, mal rauszukommen. Oder es ist tatsächlich doch deutlich teurer, jemand anders die ganze Arbeit machen zu lassen.
Wie auch immer, auch wenn ich nicht arbeiten kann wie die ganzen anderen, ich will Geld haben! Und die Vulkane sehen. Die Welt kennenlernen. Die Panamericana abfahren. Um meine Sehnsüchte zu befriedigen, werde ich arbeiten, um Geld zu verdienen! Das muss doch gehen! Irgendwie!
Am 6. April 1984, einem wirrgrünen Tag, besuche ich mit dem Physikleistungskurs die Hannover-Messe. Bereits beim Betreten des Messegeländes geht meine hautige Sprinkleranlage an. Der Schweiß des Stresses quillt aus allen meinen Poren und führt zur Überflutung meiner Haut. Zum Glück habe ich zur Jacke eine Jeans angezogen, die den amazonigen Schweißfluss tarnt, der die Hosengegend um die Gesäßnaht mit der Haut am Hintern verklebt.
Beim Betreten der menschenvollen Hallen verkrampft sich schließlich mein ganzer Hals. Ich kriege vor lauter Eindrücken und Elektronikgeruch, der in der Luft hängt, zum allerersten Mal im Leben Kopfschmerzen. Alles im Nacken versteift. Ein völlig neues Gefühl.
Am liebsten hätte ich, dass jemand meinen Kopf in den Schwitzkasten nimmt. Ihn so richtig allseitig drückt, damit er weiterhin zusammenhält. Denn mein Kopf fühlt sich an, als wolle er gleich in alle Richtungen auseinanderplatzen. Es kommt mir so vor, als würden ölig verschmierte, gliedreiche, gigantische Eisenketten den ständig steigenden Innendruck aus den Ohren herausziehen. Aber die Gliederkette ist eisenschwer und endlos. Leider habe ich daher kaum Kapazitäten im Kopf frei, um das zu empfangen, was ich hier sehen kann.
Nach gefühlten endlosen Hallenfußgängerstaukilometern kommen wir an einen Stand, dem unsere ganze Faszination gilt. Mäuse! Ein Stand mit Mäusen. Computermäusen. Die Tastatur der Zukunft soll eine so akustisch wörtlich »Körrser-Führung durch die Maus« bekommen. Man könne dann durch simples »Anklicken« ein »Menü« aufrufen. Eine Revolution!
Es gibt etliche Bildschirme, an denen wir das ausprobieren können. Bisher war und ist es so, dass man nur mit Hilfe der Pfeiltasten auf der Tastatur den Cursor, die aktuelle Eingabe- und Schreibposition auf dem Bildschirm, genau da hinstellen kann, wo er hinsoll. Das mit der Maus, wenn das wirklich mal richtig gut gehen sollte, wäre natürlich genial, hyperobergenial!
Für einen kurzen Moment bin ich kopfschmerzfrei, bis in mir die Erkenntnis aufsteigt, dass ich angesichts der vielen Sachen, die es hier gibt, trotz der schulischen »15-Punkte-Eins« von wirklicher Informatik da draußen im Arbeitsleben noch gar nichts begriffen habe. Ja, PASCAL-Programme, die kann ich schreiben. Und mit Schildkröten-Grafik auf dem Bildschirm farbige, logoartige Flächen wie einfache Staatsflaggen erzeugen. Aber um ganze, große Roboter zu steuern, da muss man wohl noch viel mehr können.
Trotz oder gerade wegen der Kopfschmerzen spüre ich, dass dieser Technologie die Zukunft gehört. Dass sich mein Leben mit dem Verarbeiten von Masseninformationen beschäftigen wird. Dass diese Sachen faszinierend und bedrohend zugleich sind. Faszinierend, weil sich ungeahnte Möglichkeiten der Datenverarbeitung auftun, die den Alltag erleichtern werden. Bedrohend, weil damit die Zukunft absolut unplanbar wird.
Was würde die Lufthansa machen, wenn plötzlich das Beamen erfunden wird? Sie wäre überflüssig. Auch bräuchten wir dann alle keine Straßen mehr. Wir könnten auf einer Karibikinsel wohnen und arbeiten. Per Leitung. Oder ferngesteuert. Da weht der Orkan der Veränderung, er zieht auf. Es wird darauf ankommen, in den aufziehenden Wind der Veränderung geeignete Windmühlen zu stellen und sich nicht zu verkriechen.
Kaum bin ich wieder zurück, muss ich darüber mit Katrin, einer Mitschülerin in meinem Jahrgang, sprechen. Sie ist in den letzten Monaten so eine Art Freundin geworden, weil auch sie so wie ich in der Vergangenheit eine Außenseiterrolle innehatte, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Mit ihr kann man sich ganz gut über philosophische Dinge austauschen.
Als ich Katrin, die sich unter anderem für Sprachen interessiert, sage, dass man zukünftig vielleicht gar keine Dolmetscher mehr braucht, weil man einfach einen Text in den Computer eingeben kann und dann auf Knopfdruck eine fast perfekte Übersetzung erhalten könnte, meint sie: »Peter, du spinnst, Computer können rechnen, Statistiken erzeugen, aber doch keine Texte verarbeiten.«
»Doch, alles, was irgendwie logisch abläuft oder sonst wie geregelt ist, kann man automatisieren. Auch Sprache. Glaube mir! Du wirst sehen. Sehr bald. Dazu braucht man nur das weiterzudenken, was ich da auf der Messe in Hannover gesehen habe.«
Ich kann zwar nicht Fußball spielen, aber mir spaßt es, Bundesligatabellenstatistik zu machen. So entwickle ich im Informatikunterricht mit einem Apple IIe ein PASCAL-Programm, bei dem man den Spielplan und die Spielergebnisse eingeben kann. Und als Auswertung die aktuelle Bundesligatabelle erhält. Denn die Tabellenberechnung folgt klaren, programmierbaren, logischen Regeln – im Gegensatz zu dem Spiel, das oft nicht so klar geregelt wird, wenn man sich die Schiedsrichterentscheidungen anschaut.
Und da ich mit der Aufgabe weit vor dem verabredeten Abgabezeitpunkt fertige, programmiere ich gleich noch eine viel spannendere Schülerdatenverarbeitung. Damit kann man dann alle möglichen Statistiken über Mitschüler und deren Noten auswerten. Damit automatisiere ich mir das Erkennen von Strukturen in Zahlensammlungen. Das, was ich früher mühsam aus dem Klassenbuch in meinen eigenen »Lehrerkalender« übertragen und zu Hause ausgewertet habe, geht jetzt per Knopfdruck. Man muss nur einmal die Auswertelogik programmieren und dann kann man das immer wieder anwenden, auf alle in derselben Struktur eingegebenen Daten. Juchzig, herrlich juchzig!
Zur Belohnung meiner Aktivitäten bekomme ich zusammen mit einem Klassenkameraden ein Stipendium am Kerschensteiner Kolleg am Deutschen Museum in München. Dort bewundere ich die vielen komplexen Maschinen und verblüffe, was passiert, wenn man irgendwelche Details wegnimmt. Denn erst dann merkt man, wofür die eigentlich da sind. So als wenn man bei einem Haus die Dachrinne abmontiert und sich beim nächsten Regen über das Geschmier und Gepladder an der Hauswand ärgert. Ach, dafür haben die dieses Ding in die Maschine eingebaut! Genauso leuchtet auch unmittelbar die Entwicklung der heute hochkomplexen Computer ein. Die einzelnen Entwicklungsschritte erscheinen rückblickend nur logisch.
Rätselhaftes Pflichtcasting
Doch bevor ich mich weiter mit Computern befassen kann, bevor ich Geophysik studieren kann, wartet leider noch die Bundeswehr auf mich. Alle Jungen müssen »dienen«, entweder bei der Bundeswehr oder beim Zivildienst, heißt es. Dabei kursieren an der Schule diverse Gerüchte über das Leben bei der Bundeswehr. Und demnach ist die Bundeswehr genauso wie die Hütte kein wirklicher Ort für mich. Der insgeheime Wunsch, von der Bundeswehr schlicht vergessen zu werden, erfüllt sich für mich leider nicht. Auch ich finde wie etliche meiner Klassenkameraden vor mir die Einladung zum »Kreiswehrersatzamt« im Briefkasten.
Obwohl ich so ein komisches Gefühl habe, dass die Bundeswehr nichts für mich ist, will ich doch lieber zur Bundeswehr, als Zivildienst zu machen. Denn der dauert ja noch länger! Dann könnte ich ja erst noch später mit dem Geophysikstudium beginnen.
Ich werde darauf achten müssen, dass ich nicht alles mitmachen kann und brauche. So werde ich hoffentlich mit T3 gemustert. Auf keinen Fall werde ich mir gruppendynamische Rituale gefallen lassen, die irgendwelche erniedrigenden Hänseleien zum Inhalt haben. Niemals darf auf Kosten meiner Intimität Spaß bei anderen entstehen!
So fahre ich wie verlangt mit allen noch verfügbaren Dokumenten potentiell relevanter ärztlicher Berichte aus der Kindheit in der Hand am 24. Januar 1985, einem weinrot-grünem Tag, nach Braunschweig zur Bundeswehr, genauer: zu der runden Ausweichstelle der Feuerwehr, dem Kreiswehrersatzamt. Wie überall beginnt der Arztbesuch mit Warten, obwohl man einen genau einzuhaltenden Termin hat. Terminpanikentwarnung! Nach einigen Minuten werde ich doch gleich aufgerufen – ohne langes Warten:
»Herr Schmidt, bitte!«
Ich trete in den altbacken aussehenden und riechenden Raum ein, in dem mich ein arztartiger Mensch fragt:
»Wie war die Anreise? Haben Sie uns leicht gefunden?«
»Ja, das war ganz leicht. Man musste einfach nur geradeaus und dann an der dritten Ampel rechts und schon straßte ich richtig. Und eine Parkung lückte auch.«
Es folgt eine stille Gesichtsmusterung, bevor er antwortet:
»Sprechen Sie immer so?«
»Nein, normalerweise nicht, das kommt bei Anspannung vor, wenn mir einfach die richtigen Wörter nicht schnell genug einfallen oder noch unsortiert sind!«
Nach einigen weiteren normalen ärztlichen Blabla-Wortwechseln fragt er mich:
»Hhm, na ja, was wollen Sie denn bei der Bundeswehr mal machen, vorausgesetzt ihr Tauglichkeitsgrad passt?«
»Irgendwas beim Luftwaffen-Bodenpersonal!«
»Haben Sie denn vor, mehr als nur den Grundwehrdienst zu leisten?«
»Nein, ich möchte im Oktober 1986 anfangen zu studieren. Geophysik. Und damit das klappt, bitte ich auch darum, mich bereits zum 1. Juli 1985 einzuberufen. Nur so passt das mit den 15 Monaten lückenlos wie ein Puzzleteil in meinen Lebensplan!«
»Dann müssen Sie aber einen Antrag auf ›Zurückstellung‹ stellen!«
»Wieso denn das? Ich will mich doch nicht zurückstellen lassen, sondern gleich drankommen!«
»So nennt man das! Das ist ein Formblatt für alle, die zu einem bestimmten Termin einberufen werden wollen. Wir können nichts versprechen!«
»So ein merkwürdiges Blatt glaube ich schon ausgefüllt zu haben!«
Nach dem interviewartigen Auftakt folgt eine körperliche Untersuchung. Dazu fordert mich der Arzt auf:
»Dann wollen wir Sie mal genauer anschauen. Machen Sie sich bitte mal frei!«
Der Arzt untersucht Blutdruck, Puls, tastet mich ab und geht dann zu seinem Schreibtisch.
Einige Minuten später kommt er zurück und sagt:
»So, Englisch und Französisch können Sie sprechen. Das klingt interessant. Und zur Luftwaffe möchten Sie, hmmm.«
Er schaut sich meine Bauchnarbe an, die von der operativen Entfernung großer Teile des Dickdarms wegen meiner Hirschsprungschen Krankheit in der Babyzeit stammt, und fragt:
»Haben Sie noch Probleme mit dem Morbus Hirschsprung?«
»Grundsätzlich nicht«, antworte ich, »aber bei bestimmten Essenskombinationen bekomme ich sehr schnell Durchfall, zum Beispiel wenn ich zu viel Obst esse oder wenn …«
»Haben Sie damit sonst noch weitere Probleme?«
»Ich müsste jederzeit die Möglichkeit haben, auch eine Toilette aufsuchen zu können, weil es bei mir schnell mal dringend werden kann! Entweder wird mir dann komisch, das heißt, ich kann mich kaum noch bewegen, oder es geht dann irgendwann in die Hose. Und mit dreckiger Hose möchte ich auf keinen Fall erwischt werden.«
»So, so, es kann also in die Hose gehen!«
»Also zum Beispiel möchte ich auch niemals in einem Panzer sitzen müssen. Das geht nicht gut, höchstens mal zum Kennenlernen, aber nicht dauerhaft. Dadrin ist es für mich viel zu eng und laut. Deswegen will ich ja auch zur Luftwaffe. Da brauchen die bestimmt Leute wie mich, und da kann ich auch jederzeit aufs Klo gehen.«
Im Untersuchungszimmer kehrt für einige Sekunden sinnierende Stille ein. Dann fährt der Arzt forsch fort:
»Hhmmm … Stellen Sie sich doch endlich mal richtig gerade hin, ein bisschen ordentlich!« Ich mache dies, so gut ich kann. Da schaut er auf meine Füße und murmelt vor sich hin: »Wissen Sie was, Sie stehen da wie ein Pinguin, und Plattfüße haben Sie auch!«
Da ich auf genau solche Anspielungen überhaupt keine Lust habe, muss ich das von Beginn an schon hier klarstellen und ergreife aus reiner Überlebensstrategie heraus das Wort:
»Sollte ich irgendwann einmal von einem Vorgesetzten in unangemessener Weise behandelt werden oder von meinen Kameraden über Gebühr hinaus veräppelt, gehänselt oder verarscht werden, werde ich diese Vorfälle in jedem Falle der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil ich mir vorstellen kann, dass eine Meldung beim Vorgesetzten, der dann mit unangenehmen Kameraden sozusagen ›unter einer Decke steckt‹, auch nicht reicht, um Abhilfe zu schaffen. Das kenne ich schon von woanders her. Chefs decken auch Fehltaten und unfähige Mitarbeiter, habe ich von meinem Vater gehört. Ich werde es mir niemals gefallen lassen, dass irgendwelche Leute sich über mich mehr als nötig lustig machen, mir zum Beispiel zwischen die Beine grapschen oder an der Hose herumfummeln, mich am besten vielleicht noch gegen meinen Willen ausziehen oder mich in den Dreck schmeißen, wo es nicht nötig ist!«
Nach diesem Kurzvortrag über die »No-Gos« schaut mich der Arzt plötzlich ganz komisch gesichtig an. Ich habe keine Ahnung, ob und gegebenenfalls was das bedeuten soll, aber seine Fratze kommt mir auf einmal unheimlich vor. Sie ist deutlich anders als vorher. Schließlich setzt er ermahnend das Gespräch fort:
»Sie können nicht den Befehl verweigern!«
»Doch, wenn ich nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, für die ich ja hier dienen soll, meine Würde verletzt sehe. Und das kommt dann auch raus. Man hört halt so verschiedene Geschichten an der Schule, in die ich niemals verwickelt werden möchte! Auch müsse man seinen Verstand am Kasernentor abgeben, wird da gesagt, was mit mir kaum gehen wird. Da würde ich ausrasten. Panik kriegen! Ich weiß nicht, ob all diese Sachen, die da so erzählt werden, wirklich stimmen, aber wenn, dann nehme ich an, dass Sie wissen, was ich meine.«
Wieder Stille im Raum. So ergreife ich das Wort:
»Bei den Fliegern seien die etwas intellektuelleren Leute zu finden, deshalb möchte ich da auch hin! Und außerdem muss ein guter General nicht unbedingt sportlich sein oder gut schießen können!«
Nach einer weiteren Denkpause raschelt der Arzt in den Papieren, füllt einen Bescheidbogen aus und übergibt ihn mir mit den knappen Worten: »Tee fünf, Herr Schmidt! Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag! Vergessen Sie die Zahlstelle nicht! Wegen der Fahrtkosten!«
Was ist los? Ich stehe da herum, um diese völlig überraschende, teeige Antwort zu verkraften. Als ich begreife, dass das »T5« heißen soll, erwidere ich laut denkend monologisierend:
»Warum das denn? Ich möchte aber zur Bundeswehr. Ich habe keine Lust auf Zivildienst! Und was ist mit T3? Warum kann ich das nicht kriegen?«
»Herr Schmidt, es bleibt dabei, Sie bekommen T5, das bedeutet, dass wir Sie leider nicht gebrauchen können, basta! Sie wollen ja zur Luftwaffe. Dort benötigen Sie sowieso T1 oder zumindest T2.«
»Ich glaube, ich bin T3, das heißt, ich brauche nicht alles mitzumachen, aber für das Büro müsste das doch reichen! Dann brauche ich wenigstens keinen Zivildienst zu machen. Im Krankenhaus arbeiten, das ist noch viel weniger geeignet für mich als das hier.«
»Mit T5 brauchen Sie auch keinen Zivildienst zu leisten!«, versucht er klarzustellen. Ich bin überrascht, denn damit habe ich nicht gerechnet. Das wäre ja auch voll ungerecht! So frage ich:
»Wieso nicht?«
»Weil das so ist! Andere kommen hier rein, strengen sich nach Strich und Faden an, um T5 zu kriegen, obwohl bei denen alles richtig gewachsen ist, auch im Kopf, und Sie wollen unbedingt T3 haben, damit Sie keinen Zivildienst machen müssen. Das habe ich auch noch nicht erlebt!«
»Wirklich keinen Zivildienst, Ehrenwort?«
Die forschen Worte werden weicher: »Ehrenwort. Es bleibt bei T5! Noch mal für Sie: Vergessen Sie die Zahlstelle nicht, um Ihre Fahrtkosten erstattet zu bekommen. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Lebensweg – ohne Bundeswehr – und ohne Zivildienst!«
Kaum bin ich zurück zu Hause, will die Locken natürlich gleich wissen, wie es war. So antworte ich:
»Ich brauch da nich’ hin!«
»Wie – nich’ hin?«
»T5 – ausgemustert!« Ich reiche ihr den Musterungsbescheid.
»Und nun?«, fragt sie.
»Jetzt kann ich schon dieses Jahr im Oktober anfangen zu studieren!«
»Da müssen wir erst mal sehen, ob wir dafür schon genug Flöhe haben!«
Flöhe, ein neues Wort der Locken für Geld. Geld hat offenbar ganz viele Namen: Schotter, Asche, Kohle, so nennt es Tantchen, meine Schwester. Auch Tiere vergelden sich immer mehr: Kröten und Mäuse nannten es die Omas, Mücken der braune Brummelbär. Wieso gibt es so viele Wörter für Geld? Es gibt nur eine Erklärung: Geld ist der Joker für eine Sache. Und die Sache, die ich jetzt angehen kann, ist die mit dem Studium. Noch dieses Jahr!
»Auf jeden Fall werde ich mich sofort um einen Studienplatz kümmern!«, stelle ich gegenüber der Locken klar.
Das mit den Flöhen wird sich schon irgendwie finden. Notfalls gibt es BAföG.
Am nächsten Tag in der Schule erwarten mich die Klassenkameraden schon ganz neugierig, um zu wissen, was denn bei deeeeehhm rausgekommen ist:
»Na, wie war’s?«
»Gut – sehr gut – viel mehr als gut – ausgezeichnet!«, antworte ich.
»Was heißt das?«, wollen sie alle wissen, besonders Thomas, der als Einziger aus dem Jahrgang einen hochwertigen privaten Apple-Computer hat.
Ich sage nur knapp: »T5!«
»Teeeeee füüünnnnnf?? – EEEEiiihhhh, wie hast du dassssss denn geschafft?«
Ich muss gerade daran denken, dass ich ja auf der Erde eine Kolonie einer erdfernen Heimat habe, die auf dem Saturnmond Japetus liegt. Einst rief ich die »States of Japetus on Earth« als unabhängigen Staat aus. Meine rotblaue Staatsflagge mit dem aufgehenden Saturn als Logo kennen alle meine Mitschüler von meinen Schulheften. Insofern bin ich ja kein Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Aber das dürfte nicht wirklich die Antwort auf seine Frage sein. So antworte ich ihm:
»Ehrlich gesagt, so genau weiß ich es nicht. Ich bin einfach so gewesen, wie ich nun mal bin. Aber so einen, der immer mit seinem neutrinogetriebenen Raumschiff vom Saturn kommt, den brauchen die da offenbar nicht.«
»Na, dann kannste ja gleich wieder mit deinem Neutrino zum Saturnsystem zurückfliegen!«, kommentiert Holger, der ebenfalls wie ich die Sprache der Formeln als die einzig ehrliche Sprache der Welt schätzt. An die anderen gegruppt stehenden Leute gewendet fährt er fort: »Der Typ schaffte mal fast 300 km an einem Tag mit dem Fahrrad, Kilometersammeln, wie er das nannte, und kriegt jetzt Tee fünnef – das gibt’s doch gar nicht!«
»Tssssss – wo bleibt da die Wehrgerechtigkeit?«, wundert sich auch Thomas laut. »Da ist die Fünf mal ausnahmsweise die beste Note, schon kriegt er sie!«