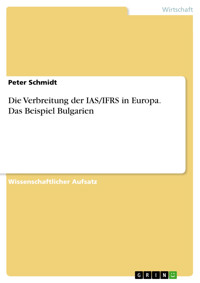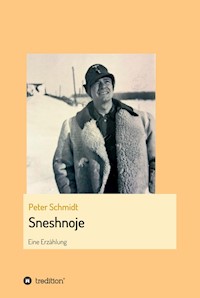Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Klein K., ein winziges Dorf mitten im kargem Heidesand und zwischen rauschenden Kiefernwäldern gelegen, ist zweifelsohne ein magischer Ort. Die Sonne steht hier ein bisschen dramatischer am rötlichen Abendhimmel, die klaren Wildbäche fließen etwas erfrischender durch die blühenden Waldwiesen und die tosenden Winde streichen ein wenig mitteilungsbedürftiger durch die raschelnden Birnenbäume an der Dorfstraße. Nicht zu vergessen sind die eigenwilligen, aber stets liebevollen Menschen hier. Da ist der abergläubige Wanderschäfer Manuel Mühlsiegel, der sich dem Gespött seines aufgeklärten Nachbarn auf eindrucksvolle Weise entledigt. Der arbeitswütige Großbauer Alfred Kuligk, der sich in die wohlklingenden Worte einer Kontaktanzeige verliebt. Und der rastlose Dorfschullehrer Werner Wachtel, der mit seinem Literaturverein die Aufgabe übertragen bekommt, den Streit zweier Imker über einen entflohenen Bienenschwarm zu schlichten. Alle diese Charaktere mit ihren ganz eigenen Freuden und Sorgen, mit ihren Vorstellungen von Glück und Zufriedenheit finden hier im Dorf ihren Platz, haben hier ihre natürliche Daseinsberechtigung. Und jenes Dorf wächst mit jeder Zeile, mit jeder Geschichte mehr und mehr zu einer neuen Heimat heran.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kieferngrün und Umgebung
Dübener Heidegeschichten
für meine Mutter
in Dankbarkeit für die vielen wahren Geschichten und phantastischen Begebenheiten aus ihrer Kindheit
Peter Schmidt
KIEFERNGRÜN UND UMGEBUNG
Dübener Heidegeschichten
Engelsdorfer Verlag Leipzig 2023
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2023) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Illustration Einband: Janina Gassner, „Das Dorf am Horizont“, 2021
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Lektorat: Catrin Sandner
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
1. Dübener Heidegeschichte
Von den Besonderheiten der Birnenernte
2. Dübener Heidegeschichte
Die Verpflichtung zur Verpflichtung
3. Dübener Heidegeschichte
Ein Mittel gegen die Redseligkeit
4. Dübener Heidegeschichte
Die Ursache einer Äußerung
5. Dübener Heidegeschichte
Der Streit um die Streitwiese
6. Dübener Heidegeschichte
Eine eigentümliche Wette
7. Dübener Heidegeschichte
Die Sache mit den wilden Tieren
8. Dübener Heidegeschichte
Eine andere Weihnachtsgeschichte
9. Dübener Heidegeschichte
Ein teurer Brief
10. Dübener Heidegeschichte
Der Karneval von Klein K.
11. Dübener Heidegeschichte
Ein genialer Einfall
12. Dübener Heidegeschichte
Eine wohltuende Medizin
13. Dübener Heidegeschichte
Die Verzögerung eines Spiels
14. Dübener Heidegeschichte
Ein lesendes Dorf
15. Dübener Heidegeschichte
Wildbienen
16. Dübener Heidegeschichte
Gastgeschenk
17. Dübener Heidegeschichte
Ein großes Spektakel
18. Dübener Heidegeschichte
Der schwere Verzicht
19. Dübener Heidegeschichte
Aberglaube
20. Dübener Heidegeschichte
Der Hauptgewinn
21. Dübener Heidegeschichte
Die blinde Verabredung
22. Dübener Heidegeschichte
Eine unerwartete Heilung
23. Dübener Heidegeschichte
Eine Lesung der anderen Art
VORWORT
Klein K. ist ein lebendiges Örtchen, das so tief in der Dübener Heide liegt, dass es auf keiner Landkarte zu finden ist. Und diese Ansammlung von kleinen Häuschen und Straßen liegt im Heidesand, umschlossen von gesunden Kiefernsiedlungen, dampfenden Moorwiesen, glasklaren Waldteichen und in sicherer Entfernung zu den überquirlenden Metropolen der Welt. Abgeschieden aber nicht abgeschnitten.
Fernab von den Fabriken für Zeitgeschehen hat die Seele hier Zeit, sich auszuschwingen und etwas was sich das wahre, gereinigte Leben nennt, entstehen zu lassen.
Auf den Bühnen von Klein K. findet kein Welttheater statt. Hier meistern die Lichtgestalten des Alltags ihr bescheidenes Leben.
Und dieses Leben besteht aus Frohsinn und Starrsinn, aus Mut und Übermut, aus Vernunft und Unvernunft.
In Klein K. gibt es keine Geheimnisse. Die Lebensläufe sind so transparent wie geputztes Fensterglas. Man sieht zeitlose Geduld, herzöffnende Gutmütigkeit, scharfes Urteilsvermögen, objektiven Gerechtigkeitssinn, unerschütterliches Urvertrauen, unnachahmliche Gelassenheit, ansprechende Genügsamkeit.
1. DÜBENER HEIDEGESCHICHTE
Von den Besonderheiten der Birnenernte
In Klein K. – so wird es übermittelt, und dass dies in vollem Umfang der Wahrheit entspricht, ist unbestritten – zog sich eine prächtige Allee aus Birnenbäumen die kopfsteingepflasterte Dorfstraße vom Dorfplatz bis fast zum Waldrand entlang. Und die Früchte jener Bäume waren es, die einmal für große Verwirrung sorgten und das ausgelassene Dorfleben fast vollständig zum Erliegen brachten.
Wie diese Bäume an jenen Platz kamen, ist im Nebel der Geschichte versunken. Auch in der Wahrnehmung der ältesten Dorfbewohner waren die Bäume früher zwar kleiner, aber schon immer da. Und weil die Leute in Klein K. die Dinge eher hinnahmen als sie zu hinterfragen, war es auch einfach so. Mit der ungeklärten Herkunft der Birnenhölzer ging auch die ungeklärte Eigentumsfrage der Ernte einher. Aus diesem Grund sind diese Früchte jener Birnenbäume in der Dorfstraße einst zum allgemeinen Eigentum aller Bewohner von Klein K. erklärt worden.
Nun wäre Klein K. allerdings nicht Klein K., hätten seine Einwohner nicht aus diesem Umstand ein besonderes Ritual entwickelt. Eines der hochrangigsten Feste des Dorfes stellte somit das alljährlich im September stattfindende Birnenernten dar. Zum Anfang hatten die Männer, welche am verabredeten Termin in gemeinsamer Anstrengung die Bäume abpflückten, im Schatten der Bäume gesessen und die ersten Früchte gekostet. Später kamen dann die Frauen und Kinder dazu, denn auch sie waren neugierig auf die neue Ernte. So saß man bis in den Abend und sang gemeinsam Lieder, bis jeder, mit einem Sack voller reifer Birnen beladen, nach Hause ging. In den darauffolgenden Jahren kamen ein Bratwurstgrill, ein Bierwagen, ein Karussell, Luftgewehrschießen, eine Losbude mit mehreren Hauptgewinnen, Sackhüpfen und eine Geisterbahn hinzu. Alle Stände reihten sich wie eine Perlenkette an der Dorfstraße auf und waren nicht zufällig unter jenen Bäumen aufgestellt, welche für ihr Dasein verantwortlich waren. Hin und wieder gelang es den Bürgern von Klein K., Sänger, Bauchredner oder Zauberkünstler von überregionaler Bekanntheit für einen Auftritt auf dem Dorfplatz zu verpflichten. Das Fest wuchs und wuchs zu einer beachtlichen Attraktion heran, einem Magneten, der sogar schon die Leute aus anderen Heidedörfern anzog.
Wenn im zeitigen Frühjahr der Himmel plötzlich aufriss und sein sonniges Blau präsentierte, wanderten die neugierigen Blicke der Dorfbevölkerung zur Dorfstraße und dem bienenumsummten Blütenschaum hinüber. Man begutachtete und kalkulierte.
Wenn im Frühsommer das Korn und die Linden blühten, hingen in den Ästen schon die ersten winzigen Birnenfrüchte. Dann wuchsen sie in den gewitterintensiven Sommertagen heran und es war so, als ob die Tropfen eines warmen Sommerregens zwischen den Blättern hängen geblieben wären.
Im Spätsommer saßen die flatternden Schmetterlinge im blühenden Heidekraut. Jenes leuchtende Violett sorgte für die irrige Annahme, ein Stückchen leuchtendes Abendrot wäre auf die brachen Heideäcker gefallen. Zu jener Zeit der sanfteren Sonnenstrahlen bekamen die Birnen Farbe und Geschmack. Dann war es wieder soweit: Birnenernte und Fest konnten beginnen.
Trotz allen Lobes über die Tradition aus dem Schoße der Vorväter, gab es aus der Bevölkerung von Klein K. leise Kritik an der Art der Verteilung der Birnenernte. Die Tradition sah vor, dass der gesamte Ernteertrag gleichmäßig auf alle Häuser des Dorfes aufgeteilt werden sollte. Dieser Zustand erregte seit Jahren schon den Missmut von Paul Papenthien, dem gedankenarmen Waldarbeiter. Er hatte sich im Laufe der Jahre seinem Werkstoff so sehr angenähert, dass sein Gesicht knorrig und sein ganzes Wesen holzig geworden waren.
Als ihm seine Frau das achte Kind schenkte, gingen den beiden die Namen aus. Nur so ist es zu erklären, dass die Kinder sieben und acht, beides Jungen, Heinz und Karl-Heinz hießen. Jedes der Kinder war mit einem gesunden Appetit gesegnet. Wenn Hilde Papenthien, eine ernsthafte Frau mit sanften Zügen, in die größte Pfanne den Speck für Bratkartoffeln schnitt, angelten unzählige Kinderhände die Stückchen wieder aus der zerlassenen Butter heraus. Aus diesem Grund gab es trotz der besten Absichten oftmals Bratkartoffeln ohne Speck.
„Es geht doch nicht mit rechten Dingen zu, wenn wir als zehnmäulige Familie den gleichen Anteil an der Birnenernte bekommen, wie ein Haus mit zwei Leuten unter dem Dach.“ Diesen Makel sprach er allerdings nur in seinem Hause aus und wunderte sich, dass sich über die Jahre nichts an der Bestimmung änderte.
Als die Kornfelder abgemäht waren und leuchtende Sonnenstrahlen die Stoppelfelder in goldene Seen verwandelten, saßen die Laubblätter in den Kronen der Birnenbäume schon lockerer und es näherte sich die Erntezeit. Mit unauffällig prüfendem Blick lief Paul Papenthien die Dorfstraße entlang und begutachtete den Reifegrad der Birnen. Immer wieder stieß er sich den Kopf an der bestehenden Verteilungsregel. Das dauerte so lange, bis ihm von irgendwoher ein Gedanke in den Kopf geflogen kam und sich dort einnistete. Von diesem Zeitpunkt an sah er mit Wohlwollen zu, wie der herbstliche Nebeldunst aus den Wiesen kroch, sich die ersten Zugvögel auf und davon machten und die rauen Winde die Baumkronen der Dorfpappeln am Waldsaum zerzausten. Denn seine große Stunde rückte immer näher.
Auch von offizieller Seite wurden die Birnen begutachtet. Als sich in den Baumkronen die ersten gelben Strähnen ausbreiteten, prüfte Bürgermeister Krischke den Zustand der Birnen. Er nickte zu sich selber und das sollte bedeuten, dass die Erntereife und der geplante Termin für das Erntefest wieder einmal trefflich zusammenpassten.
An einem Spätsommertag im September begannen in der Dorfstraße die Aufbauarbeiten für das Erntefest. Es wurde geschraubt, gehämmert, gesägt und genagelt und schon verwandelte sich der kopfsteingepflasterte Weg in eine Schaubudenprozession.
Den ganzen Abend stand Paul Papenthien hinter der Gardine, beobachtete das Treiben und sah wie Karl Kienzapfen, der Besitzer des Gasthofs Zum durstigen Ochsen als Letzter seinen Bierstand verriegelte, seinen Rücken durchstreckte und nach Hause ging.
Dann wartete er auf den Mond und als dieser mit seinem silbernen Licht die Sternennacht erhellte, weckte er Frau und Kinder, und alle versammelten sich um den riesigen Küchentisch. Halb flüsternd sprach er zu seiner Familie folgende Worte: „Die Luft ist rein. Ich habe alles ausgekundschaftet. Jeder von euch nimmt sich einen Sack, klettert auf einen Baum und erntet ihn ab. Das Mondlicht wird euch leuchten. Wer einen Baum fertig hat, bringt den Sack nach Hause und holt sich für den nächsten Baum einen neuen.“
Verschlafen und ohne Widerrede verließ die Familie Papenthien zu zehnt das Haus und verteilte sich auf die Birnenbäume. Es raschelte und wackelte in den Baumkronen, so als ob der Nachtwind durch ihre Äste fuhr. Birnen fielen in Kartoffelsäcke und schwarze Gestalten wieselten durch die mondhelle Nacht zwischen der Dorfstraße und dem Haus der Familie Papenthien hin und her.
Noch vor der ersten Dämmerung war die Arbeit beendet. Zehn Augenpaare sahen auf das Nachtwerk – einen riesigen Berg prall gefüllter Kartoffelsäcke. Paul Papenthien rieb sich vor Schadenfreude die Hände und richtete noch einmal das Wort an seine Familie. „Die haben wir jetzt alle für uns. Warum sollen wir jedes Mal mit den anderen teilen? Nicht eine einzige Birne gönne ich denen. Jetzt können wir uns schon auf ihre Gesichter freuen, wenn sie morgen feststellen, dass es nichts mehr zu ernten gibt.“
Als der neue Morgen erwachte und die ersten vorsichtigen Sonnenstrahlen die tauüberladenen Netze der Baldachinspinnen auf den Nebelwiesen zum Glitzern brachten, war der Erntetag endlich da. Man stelle sich allerdings jene Verwunderung vor, die der Anblick der birnenlosen Birnenbäume bei seinen Betrachtern auslöste. Die Nachricht breitete sich wie ein Flächenbrand in alle Richtungen gleichzeitig aus und war innerhalb weniger Minuten bei Bürgermeister Krischke im Rathaus angelangt. Dieser traf zur gleichen Zeit wie Hauptwachtmeister Pomm am Tatort ein. Die Luft war elektrisch wie vor einem großen Gewitter. Durch energisches Kopfschütteln drückten sie ihre Missbilligung aus. Bürgermeister Krischke sah sich ratlos um. Wenn die Birnen schon gepflückt waren, lief doch auch der Grund für das Erntefest ins Leere. Kurzentschlossen kündigte er an, dass das traditionelle Erntefest auch ohne Ernte stattfinden sollte und Hauptwachtmeister Pomm redete von einem der größten Kriminalfälle in der Geschichte von Klein K. Er werde nicht eher ruhen, bis der Täter ermittelt sei und dieser die volle Strenge des Gesetzes zu spüren bekäme.
Immer mehr Menschen drängten sich zu den leeren Birnenbäumen hin und damit sich Paul Papenthien nicht sofort tatverdächtig machte, ordnete er seiner Familie an, sich ebenfalls unter die verwunderte Menge zu mischen und auf die entflohenen Diebe zu schimpfen.
Und das Erntefest? Am Nachmittag lief es nur sehr schleppend an. Lustlos ließ sich Bürgermeister Krischke bei Karl Kienzapfen vom durstigen Ochsen das erste Bier zapfen und stieß mechanisch mit ihm an. Aber worauf? Diese Stimmung übertrug sich auf die anderen Festgäste. Niemand war so recht in Feierlaune. Die Geisterbahn blieb fast unbesucht. Das Karussell war nur einmal voll besetzt, als die Kinder der Familie Papenthien eine extra lange Fahrt spendiert bekamen. Marius Mosig, der Bratwurstgriller, blieb auf seinen Würsten sitzen und vor dem Bierstand versammelten sich nur ein paar ältere Herren, die immer da standen und auffallend häufig den Kopf schüttelten. Die Festlichkeit glich eher einer Trauerveranstaltung. Es war so, als ob jeder einzelne Bewohner von Klein K. bestohlen worden war.
Beim Anblick der langen Gesichter wuchs die Schadenfreude von Paul Papenthien fast ins Unermessliche und sein knorriges Antlitz erhellte sich für ein paar Augenblicke zu einem Stückchen Birkenrinde. Er war der Sieger. Aber als er dann heimlich vergnügt nach Hause kam, wurde er von seiner Familie umringt. Hilfesuchend fragte ihn seine Frau: „Was machen wir denn jetzt mit den ganzen Birnen?“ Diese Frage stand wie ein fremder Gegenstand im Raum und irritierte das Familienoberhaupt. Wollte er den Nachbarn die Birnen nicht eigentlich nur vorenthalten? Ihnen einen Streich spielen? Sie zum Nachdenken anregen? Das hatte er wohl geschafft. Aber wie sollte es jetzt mit den übervollen Birnensäcken weitergehen? „Wir könnten ja einen Teil der Birnen zu Marmelade verarbeiten.“ schlug seine Frau halblaut vor. Doch Paul Papenthien schüttelte den Kopf. „So viel Marmelade können selbst wir nicht verbrauchen.“ „Und wenn wir sie als Kompott in Gläser füllen?“ „Wer hat denn Appetit auf so viel Birnenkompott?“ Eine große Leere machte sich in den Köpfen breit. Und keine der hervorgebrachten Ideen konnte sie ausfüllen. Den ganzen Abend saßen sie wie von einer Krankheit befallen vor dem riesigen Berg reifer Birnen. Sie wägten ab und kalkulierten. Sie beratschlagten und dann fällten sie eine Entscheidung. Wieder huschten große und kleine Schattengestalten zu den Konzerten der Spätsommergrillen durch die laue Mondnacht.
Als der nächste Morgen graute, stand vor jeder Haustür ein großer Sack mit frisch geernteten Birnen. Ein unbestelltes Paket ohne Absender.
So kam doch noch jede Familie auf Umwegen zu ihren Birnen von der Dorfstraße. Mit diesem glücklichen Ausgang der Verstrickungen brach Hauptwachtmeister Pomm seine Ermittlungen ab. Er führte die Wiederkehr der verschwundenen Birnen auf seine öffentliche Androhung auf dem Dorfplatz zurück.
Bis zum heutigen Tag ist noch nicht ans Tageslicht gelangt, unter welchen denkwürdigen Umständen die Birnen von den Bäumen verschwanden und ihren Weg vor die Haustüren der Bewohner von Klein K. fanden. Und wenn wir, die wir mit der Familie Papenthien waren, es nicht ausplaudern, dann wird es für immer eines der nebelumwobensten Kapitel in der Chronik dieses beschaulichen Ortes bleiben.
2. DÜBENER HEIDEGESCHICHTE
Die Verpflichtung zur Verpflichtung
In Klein K. – so wird es übermittelt, und dass dies in vollem Umfang der Wahrheit entspricht, ist unbestritten – lebte der rüstige und einfallsreiche Rentner Hubert Hirsekorn. Ein kleiner, immer verschlafen wirkender Mann, der unauffällig seine Tage mit Nachdenken verbrachte.
Unbeabsichtigt trug er einst aktiv zum Dorfleben bei.
Es war im Frühherbst, kurz nachdem die letzten Hitzegewitter über das Land gerollt waren, die Zeit der ersten Nebel, des Blätterfalls und der ziehenden Wildgänse. Die Zeit, in der die Vorgärten ausblühten.
Als im nebligen Heidedunst ein neuer Morgen entstand, klopfte es an der Haustür von Hubert Hirsekorn. Widerwillig unterbrach er seine Nachtruhe, stapfte in seinen Schlafsachen zur Tür und öffnete. Auf der anderen Seite erkannte er Bürgermeister Krischke. Dieser kam mit einer Botschaft zu ihm. Förmlich und mit etwas Feierlichem in seiner Stimme richtete er folgende Worte an seinen verwunderten Gegenüber: „Mir scheint, lieber Freund, dass in naher Zukunft dein achtzigster Geburtstag ins Haus steht. Deshalb möchte ich diesen Tag zu einem besonderen Erlebnis machen. Ein kleines Dorffest auf dem Rathausplatz, zu dem alle Bürger von Klein K. eingeladen werden, soll unser Geburtstagsgeschenk für dich sein.“
Die Worte des Bürgermeisters machten Hubert Hirsekorn einen Moment sprachlos. Es war fast so, als ob er nachdenken würde. Als aber dieser Zustand nach einigen Augenblicken verflog, winkte er dankend ab und antwortete: „Nun, mein lieber Freund, ich danke dir für deine Mühen, die du mit dem Weg zu mir auf dich genommen hast. Aber was habe ich denn dazu beigetragen, dass ich bald achtzig Jahre alt werde? Nicht viel. Niemand kann etwas für sein Alter. Es ist lediglich ein Stückchen Zeit vergangen. Deshalb wird es wohl auch nicht nötig sein, mich hochleben zu lassen. In meiner Vorstellung soll es ein ganz normaler Tag werden, der auf keinen Fall irgendetwas Besonderes an sich hat.“
Das Gespräch war beendet. Man verabschiedete sich höflich, wie es unter den Bewohnern von Klein K. üblich war. Die Herren gingen auseinander. Der eine ging in seine Amtsstube im Rathaus am Dorfplatz zurück. Der andere stieg wieder ins Bett, erfreut darüber, den ungebetenen Besuch abgeschüttelt zu haben und wieder zu seiner Vormittagsruhe zurückkehren zu können.
So sehr sich Hubert Hirsekorn allerdings auch anstrengte, er konnte nicht zu jener Gelassenheit zurückfinden, die ihn erneut hätte einschlafen lassen. Er starrte an die Decke, sah aus dem Fenster und konnte die Augen nicht wieder schließen. Gedanken flogen ihm durch den Kopf. Gedanken, die ihm keine Ruhe ließen. Er stand auf, bekleidete sich und lief, ohne nach links und rechts zu sehen, auf direktem Wege in Richtung Rathaus. Dort traf er zum zweiten Mal an diesem Morgen auf den Bürgermeister. Dieser besetzte seinen gepolsterten Bürgermeisterstuhl in der Bürgermeisterschreibstube und war schon wieder in seine Regierungstätigkeit vertieft. Da für ihn aber Volksnähe die Grundlage seiner Tätigkeit war, hatte er selbst in den Phasen höchster Anstrengung immer ein offenes Ohr für seine Mitmenschen. So richtete er seine ganze Aufmerksamkeit auf den unruhig wirkenden Hubert Hirsekorn. Dieser begann gleich damit, ungefragt seine Gedanken auszuplaudern. „Ich halte zwar nicht viel von großen Geburtstagsfeiern, aber dich möchte ich zu meinem Ehrentag gern als Gast begrüßen dürfen. Du bist mein Freund. Auf dich ist Verlass. Komme, wann immer du Zeit findest. Ich bin zu Hause.“ Bürgermeister Krischke nahm diese Einladung wie einen unsichtbaren Blumenstrauß dankend entgegen und versprach, vorbeizukommen. Hubert Hirsekorn nickte zu sich selber. In seinen Augen hatte er ein gutes Werk vollbracht. Jetzt konnte er sich geradewegs wieder in Richtung seines Hauses aufmachen.
Gleich vor dem Rathaus traf er auf Hauptwachtmeister Pomm, den Dorfpolizisten. Recht und Ordnung in einer Person. Er steckte in seiner steifen Uniform und die Sterne auf seinen Schulterstücken symbolisierten jene Last, unter welcher er seinen Dienst ordentlich zu verrichten hatte. Geballte Staatsgewalt ging von ihm aus. Er wirkte geschäftig, als er Hubert Hirsekorn bemerkte, und seine verbindlichen Gesichtszüge tauten für einen kurzen Moment auf.
Hubert Hirsekorn dachte an seinen Geburtstag. Wie schön wäre es, einen zweiten Würdenträger zu seinem Geburtstag begrüßen zu dürfen. Bürgermeister und Polizist waren zwei seriöse Amtspersonen und Persönlichkeiten des Dorflebens. Diese Herren gäben eine gute Dekoration für seinen Geburtstagstisch ab.
So erfreute sich auch Hauptwachtmeister Pomm gern der ausgesprochenen Einladung von Hubert Hirsekorn, dem Jubilar. „Und bring deine Frau mit. Sonst plaudern wir nur über Männerkram.“ Hauptwachtmeister Pomm nickte und sein Gesichtsausdruck wurde wieder dienstlich.
Auf seinem Heimweg schlenderte Hubert Hirsekorn wie zufällig am Dorfkonsum vorbei und beschloss, gleich das Nötigste einzukaufen.
Der Dorfkonsum, war er nicht immer ein Treffpunkt und eine Informationsbörse? Hubert Hirsekorn verbrachte nur allzu gern die Zeit hier. Zwischen den Regalen hielt die Verkaufsstätte neue und aufgewärmte Dorfgeschichten bereit. Lebensmittel der besonderen Art, die man hier in Klein K. genauso zum Existieren brauchte wie Brot und Butter.
Gleich am Eingang traf er auf Karin Kaufmann, die Betreiberin und Mitherausgeberin der mündlichen Dorfzeitung. Hubert Hirsekorn dachte erneut an seinen Geburtstag und setzte auch Karin Kaufmann auf seine Gästeliste. Warum soll sich denn die Frau des Hauptwachtmeisters Pomm in einer Männergesellschaft langweilen? Würde Karin Kaufmann die Geburtstagsgesellschaft exzellent ergänzen?
Jetzt konnte er jenen Tag, der ihm eigentlich gar nichts bedeutete, kaum noch erwarten. Ungeduldig lief er nach Hause, aß eine Kleinigkeit und versuchte es erfolglos mit einem einen kleinen Mittagsschlaf.
Als er sein Sofa wieder verließ, war er immer noch nicht recht zufrieden. Wie konnte er es versäumen, an Brigitte Bendix, die Schwester von Karin Kaufmann zu denken. Die beiden Geschwister waren unzertrennlich. Und wenn er die eine einlud, dann musste er zwangsläufig auch die andere einladen, um Ärger zu vermeiden. Dies wollte er am nächsten Tag erledigen.
Tags darauf lief er auf dem Weg zu Brigitte Bendix und ihrer Familie seinem alten Freund Alfred Kuligk in die Arme. Es herrschte Wiedersehensfreude. „Ich werde zu meinem achtzigsten Geburtstag ein kleines Fest bei mir zu Hause ausrichten. Und wenn du möchtest, bist du eingeladen.“ Alfred Kuligk dankte höflich und versprach, pünktlich zu erscheinen.
Am Dorfanger kreuzten sich die Wege von Hubert Hirsekorn und Reinhold Raddatz. Der Jubilar wurde auch bei ihm eine Einladung los.
Als Hubert Hirsekorn wieder zu Hause war, begann er nachzudenken. Er zerbrach sich darüber den Kopf, in welcher Konstellation sich seine Gäste gegenüberstanden. Wenn er also Reinhold Raddatz zu sich einlud, dann konnte er seinem Freund Sigismund Schnappka die Einladung nicht vorenthalten. Wie würde er sonst dastehen, wenn Schnappka erfuhr, dass Reinhold Raddatz, aber er nicht, auf der Gästeliste stand? Waren sie denn nicht seit ihrer Jugend befreundet und mehr oder weniger zu dritt durchs Leben geschritten?
So geschah es, dass die Anzahl der Personen, die den achtzigsten Geburtstag feierlich begehen sollten, in den folgenden Tagen stetig ausgeweitet wurde. Die Verstrickungen unter der Einwohnerschaft von Klein K. verlangten es so.
Etwa drei Tage vor seinem großen Ehrentag wurde Hubert Hirsekorn gewahr, dass er mittlerweile das ganze Dorf eingeladen hatte und bereits schon einige Einladungen bis nach Groß K. aussprach, weil es nicht anders ging. Er hatte sich in eine Situation gebracht, in der er selber nicht mehr Herr der Lage war.
Am Abend vor seinem Ehrentag verkroch er sich in sein Bett und sah gedankenverloren an die Decke. Er entschloss sich dazu, am nächsten Morgen die Tür einfach nicht zu öffnen. Niemand sollte mitbekommen, dass er zu Hause war.
Es folgte ein herrlicher Spätsommertag. In der ersten Morgendämmerung glänzten die Tautropfen in den Spinnennetzen und als die Sonne weiter stieg, übergoss sie die ganze Heide mit Licht und Wärme. In Klein K. regte sich Leben. Eine Musikkapelle zog spielend durch das Dorf, sammelte die Dorfbewohner auf ihrem Weg ein und steuerte schließlich zielsicher auf das Haus von Hubert Hirsekorn zu. An der Spitze des Umzugs lief Bürgermeister Krischke, der feierlich die Gartenpforte öffnete und an der Haustür klopfte. Das Klopfen allerdings rief keine Reaktion hervor. Die Verwunderung darüber verflog jedoch recht schnell. Die Gäste ließen sich im Vorgarten nieder, packten die mitgebrachten Geschenke – vorwiegend Selbstgebackenes und Selbstgekochtes – aus, aßen, tranken und tanzten. Die Stimmung war hervorragend. Es wurde gelacht und gesungen und niemand bemerkte so richtig, dass sich die eigentliche Hauptperson Hubert Hirsekorn gar nicht in ihrer Mitte befand. Dieser lag immer noch regungslos unter seiner Bettdecke und wartete die Zeit ab. Musik und Gesang dröhnten schon einige Zeit in seinem Garten, als ihn die Neugier schließlich doch aus den Federn trieb. Er schob die Gardine ein wenig zur Seite und konnte das ganze Dorf in seinem Garten feiern sehen. Und wie er sich richtig erinnerte, feierten sie seinen achtzigsten Geburtstag. Bei diesem Gedanken hielt es ihn nicht mehr länger im Haus. Er öffnete die Tür und trat ein paar Schritte in den Garten hinaus. Seine Geburtstagsgäste fielen über ihn her wie ein Mückenschwarm über süßes Blut. Ihm wurden die Hände geschüttelt, Essen und Trinken gereicht und ein musikalisches Ständchen gebracht.
Man feierte noch lange und friedlich und so wurde der achtzigste Geburtstag von Hubert Hirsekorn dann über unerwartete Umwege doch noch zu einem Fest des ganzen Dorfes. Nur nicht auf dem Rathausplatz, sondern in seinem eigenen Garten.
3. DÜBENER HEIDEGESCHICHTE
Ein Mittel gegen die Redseligkeit
In Klein K. – so wird es übermittelt, und dass dies in vollem Umfang der Wahrheit entspricht, ist unbestritten – musste ein aufrichtiger Mensch, der auf den Namen Wilhelm Winterkorn hörte, einst seinen ganzen Verstand zusammennehmen, damit ein Geheimnis tatsächlich auch geheim bleiben konnte. In seinem Beruf war er Holzfäller und in seiner Freizeit war er Waldmensch. Der Wald war sein Wohnzimmer. Lang und dürr schlenderte er durch sein Leben und gab dabei selbst die Figur eines fällreifen Kiefernstamms ab. Dieser vertrauenswürdige Wilhelm Winterkorn war eine der Lichtgestalten von Klein K. und aus dem kulturellen Dorfleben nicht wegzudenken. Er vervollständigte ein Orchester, denn er blies für die Dorfkapelle regelmäßig Luft in sein Waldhorn. Er brachte mit seinen Diskussionsbeiträgen Teile der Dorfbevölkerung intellektuell voran, denn er war ein hochgeschätztes Mitglied im Literaturverein. Und er war ein Förderer der Spielkultur, denn er vollführte samstags bis spät in die Nacht hinein im Gasthaus Zum durstigen Ochsen seine einstudierten Brettspieltricks. Männer von solch gesellschaftlichem Rang waren rar gesät. Darüber war man sich in ganz Klein K. und ein bisschen darüber hinaus einig.
Wie erfuhr Wilhelm Winterkorn vom geheim zu haltenden Geheimnis?
Es war jene regungslose Zeit zwischen Spätsommer und Frühherbst, in welcher die bunten Mischwälder schon regennass waren. Wilhelm Winterkorn hatte Feierabend, lief die langgezogenen Sandwege entlang und lauschte auf die Abendstrophen der Buchfinken. Spätsommermücken umschwirrten seinen kahlen Kopf wie ein Bündel flirrender Gedanken. Die Sonne war bereits hinter den Kiefernwipfeln verschwunden und der glutrote Westhimmel verdaute die letzten Wolkenfetzen, als ihn ein besonders appetitlicher Duft vom Weg abkommen ließ. Eine Windbotschaft hatte seine Nase auf dem Luftwege erreicht. Er streifte ein paar Schritte durch das Unterholz und entdeckte eine Lichtung, auf der eine Großfamilie Schirmpilze stand. Welch ein freudiger Anblick war dies für ihn. Er war in eine Goldgrube gestürzt, gehörten Pilze doch zu seinen Lieblingsspeisen. Und deshalb übte dieses Stillleben aus kleinen Pilzhüten, die sich aus dem mattgrünen Wiesengrund erhoben hatten, einen besonderen Reiz auf ihn aus. In der Faszination des Anblicks gefangen, wollte er sofort mit der Ernte beginnen. Jedoch sollten die Pilze noch eine gewisse Schonfrist erhalten, denn er hatte weder Beutel noch Körbe für den Transport dabei. Ein weiteres Problem rollte am gedanklichen Horizont auf ihn zu. Er zählte die Pilze und machte dann so etwas wie eine Überschlagsrechnung. Für den Transport würde er seine Frau Wilhelmina bemühen müssen. Und dieser Umstand setzte ihm mächtig zu, denn seine Frau war ein recht mitteilungsbedürftiges Geschöpf. So eine Pilzstelle war schließlich eine geheime Sache und Geheimnisse kannte sie nicht. Sie hatte eine viel zu gutmütige Seele, war leichtgläubig, ließ sich gern aushören und stellte somit das Gegenstück zum verschwiegenen Wesen ihres Mannes dar.
In mittleren Jahren traf er sie auf dem Birnenerntefest von Klein K. und konnte nicht mehr von ihr lassen. Er befreite sie kurzerhand aus ihrem Stand, indem er mit ihr in den Hafen der Ehe segelte, ohne vorher allerdings das Hafengelände ausgiebig besichtigt zu haben. Ihre Redseligkeit entfaltete sich erst im Laufe der Zeit und er lernte damit zu leben. Er musste eben nur aufpassen, was er ihr anvertraute.
Wilhelm Winterkorn ließ seine Gedanken auf dem Weg nach Hause in alle Richtungen schweifen. Es musste doch möglich sein, das einfache Gemüt seiner Frau für sich auszunutzen, den Spieß einfach umzudrehen. Bisher konnte er sich immer auf seine angeborene Bauernschläue verlassen. Und auch diesmal ließ der Erfolg seiner Geistesbemühungen nicht lange auf sich warten. Es dauerte ein paar Minuten, bis er sich einen wasserdichten Plan zurechtgelegt hatte.
Als er aus dem Wald trat, sah er auf die Uhr. Die abgelesene Zeit schien ihn zu bestätigen. Er lief zum Dorfkonsum und kaufte Zitronenlimonade. Beim Bäcker besorgte er ein paar Brötchen. Dann kam er nach Hause, ging in den Stall und holte fünf Eier aus dem Hühnernest. Kurz darauf verschwanden die Eier im kochenden Wasser auf dem Küchenherd. Mit einer Radioantenne fischte er Fetzen beschwingter Blasmusik aus der Luft und wartete. Als er die Zeit für angemessen hielt, stellte er die Flamme ab und befreite die Eier aus dem blubbernden Kochwasser. Brötchen, Limonade und Eier verschwanden im Rucksack und wanderten auf dem Rücken von Wilhelm Winterkorn in den dämmernden Wald.
Der Mond war bereits aufgegangen und sein silberner Schein erleuchtete die Waldwege. Wilhelm Winterkorn lief den kleinen Bach am Gesundbrunnen entlang. Kurz vor der Quelle ließ er die Flasche mit Zitronenlimonade ins Wasser gleiten. Etwa hundert Meter weiter gelangte er an eine kleine Senke, die im Schutz eines Birkenhains versteckt war. Dort legte er die Hühnereier in eine kleine Mulde. Dann schlug er sich zu einer kleinen Kiefernschonung durch und verteilte die Brötchen auf den Ästen einer Jungkiefer. Wie zur Bekräftigung nickte er zu sich selbst.
Dann kam eine Sternennacht über die Heide und als der Morgen zu dämmern begann, holte Wilhelm Winterkorn vier Pilzkörbe aus dem Schuppen, weckte seine Frau und bat sie in kurzen Sätzen, ihn zu begleiten. Als sie ihre Sprache gefunden hatte und ihn nach dem Grund des Ausfluges zu so früher Stunde fragen konnte, waren sie schon mitten im Geschehen. „Tief im Wald versteckt gibt es eine Lichtung mit den stattlichsten Pilzen.“ „Und was soll ich dabei tun?“ „Du musst mir helfen, die Pilze zu sammeln.“ „Aber warum ich?“ „Weil der Platz geheim ist.“ Sofort steigerte sich ihre Aufmerksamkeit. „Geheim?“ „Ja, denn wenn wir ihn verraten, dann schnappt uns irgendjemand die Pilze vor der Nase weg. Du darfst also zu keinem Menschen ein Sterbenswörtchen sagen. Versprichst du mir das?“ Und Wilhelmina versprach es ihrem Mann mit feierlicher Geste.
Sie liefen so etwa eine halbe Stunde den Waldweg entlang. Seichter Wind raschelte durch das goldene Birkenlaub und auf den Gräsern der Waldwiesen glänzte der Morgentau. Dann verließen sie den Weg und liefen quer durch einen Hochwald. „Wo willst du hin?“ „Komm nur mit, Mina. Das ist eine Abkürzung.“