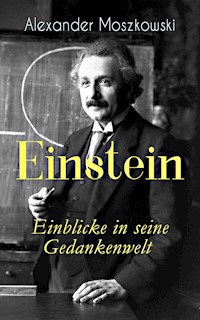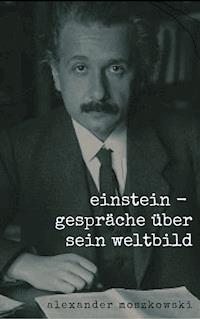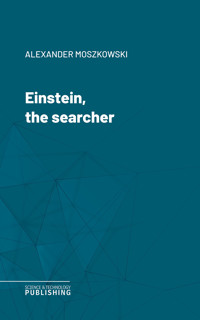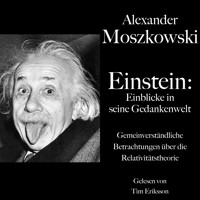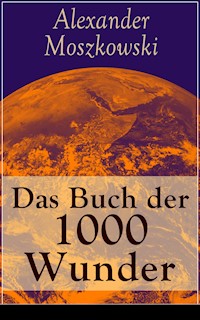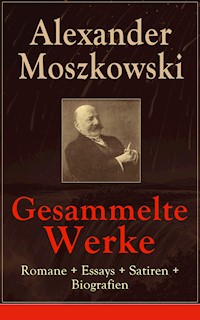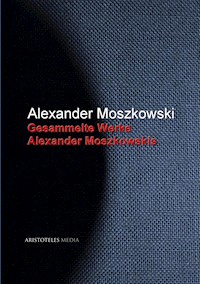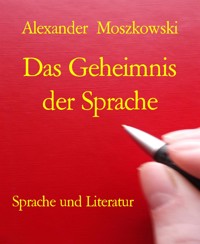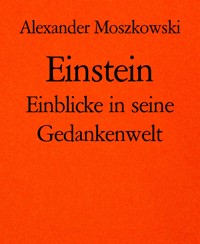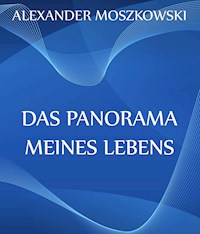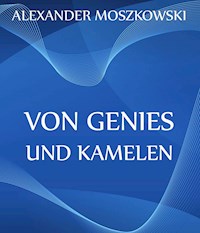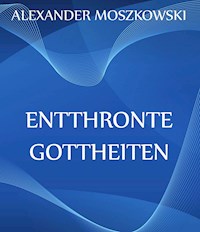3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein populärwissenschaftliches Buch der Extraklasse. Nicht nur dass Moszkowski hier bereits vor 100 Jahren Internet und Handys voraussah und vor deren Missbrauch warnte – nein, er öffnet uns durch seine unnachahmliche Art der Sicht auf die Dinge die Augen über Staunenswertes und Nachdenkliches aus Natur, Technik, Geschichte Kunst, Medizin, Wissenschaft usw.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die Welt von der Kehrseite
Eine Philosophie der reinen Galle
BookRix GmbH & Co. KG81371 München1. Vorspruch
Dieses Buch wendet seine Stirnseite gegen das Vorurteil, gegen die Götzen, die eine lange Zeit der Aufklärung überdauert haben. Sie erkennen heißt: sie bekämpfen. Aber man kann sie nicht erkennen, wenn man nicht das Denken ganz gründlich umkrempelt.
Bisher haben sie es vortrefflich verstanden, aus einer Betrachtung in die andere zu schlüpfen. Überall nisten sie, in allen Gehirnen haben sie Altäre; angefangen von dem Obergötzen „Natur“, bis zu den kleinen Fetischen, die wir Kunst, Technik, Wissenschaft, Schönheitslehre, Moral, Logik nennen.
Diese Altäre sind sturmreif geworden. Besonders aber wird dem Götzen „Mensch“ zu Leibe gegangen, dem Menschen selbst, der sich so kräftig als die Krone der Schöpfung auszurufen wusste, dass selbst die Zweifler der Erkenntnis sich vor ihm verbeugten.
Hier zum ersten Mal wird wirklich geprüft, ob es in irgendwelchen Sphären ein Oben oder Unten gibt. Und da gelangen wir an staunenswerte Ergebnisse. Sie lassen sich nicht vorwegnehmen, da sie sich nur im Nacheinander enthüllen können. Aber es wird sich für den Leser lohnen, dieses Nacheinander zu erleben.
Ob die Ergebnisse an sich erfreulich oder unerfreulich sein werden, das soll nicht unsere Sorge sein. Noch weniger, ob wir sie in gerader Linie oder im Zickzack gewinnen. Was liegt am System? Was liegt an der Innehaltung einer Methode? Nur darauf kommt es an, dass vom Gedanken die letzten Fesseln abfallen; dass der Staub aus den Gehirnen geblasen wird; und das wird ein Vergnügen sein.
Ich verspreche also etwas höchst Interessantes und nehme das Zutrauen in Anspruch, dass ich imstande bin, Interessantes zu bieten. Um meine Schriften hat sich der Anfang einer Gemeinde gebildet, der es aufzugehen beginnt, dass der Philosoph den Humoristen und der Satiriker den Erkenner nicht ausschließt.
Sophisterei!, wird man eher sagen. Das höre ich nicht ungern. Denn den Sophisten verdankt es die Welt, dass die Philosophie noch nicht zugrunde gegangen ist. Sie dringen mit Mitteln der Überraschung, ja der amüsanten Spannung in Tiefen, die dem pedantischen Wahrheitsgrübler verschlossen bleiben.
Aristoteles sagt: „Der Mensch beginnt zu philosophieren, wenn er das erste Mal erstaunt.“
Wichtiger als das Erstaunen ist der Ärger und der Zorn.
Nietzsche stellte sich zornig, als er „mit dem Hammer philosophierte“. Aber der Hammer bleibt äußerlich und mechanisch und kann die Umwertung aller Werte nicht zustande bringen. Diese verlangt die Mitwirkung eines inneren Organs.
Nur mit der Galle kann man die Dinge bis zu Ende durchdenken. Mit ihr, die sich aufrührt über die anspruchsvollen Torheiten so vieler angeblicher Wahrheitssucher. Das Auge unterliegt optischen Täuschungen, das Hirn den eingewachsenen Denkfehlern. Die Galle irrt sich selten; sie ist schon durch ihre Bitternis der Wahrheit verwandt. Und selbst wenn sie sich irrt, so gerät ihr Irrtum nicht langweilig, denn sie ist das Organ des Witzes, und jeder trotzige Humor entquillt aus ihr.
Hier also sagt die Galle philosophischen Krieg an gegen alles Überlieferte. Und es wird sich zeigen, dass diese Überlieferungen durchweg auf einer Seite der uns bekannten Welt verzeichnet stehen, auf der Schauseite, die sie uns zuwendet. Viel scheinbare Herrlichkeiten darunter, Blender, die erborgte Lichter ausstecken; sie alle sollen als trügende Gebilde durch leicht verständlichen, auf anschauliche Beispiele gegründeten Vortrag nachgewiesen werden. Maske und Blendwerk herunter!
Dieses Buch konnte nur in dieser Zeit geschrieben werden. Weltkrieg und Weltelend mussten vorhergehen, um es zu ermöglichen. Viel Neues ist darin auszusprechen, viel Symbolisches, das mit dem Rätsel spielt, um Rätsel zu lösen. Nicht nur das Bewusstsein des Lesers wird angerufen, sondern auch sein Unterbewusstsein, aus dem sich Gärendes zutage ringen soll.
Dämmernde Innenblicke sollen sich nach außen kehren, um ein groteskes, abenteuerliches, aber höchst eindrucksvolles Bild wahrzunehmen: Die Welt von der Kehrseite!
2. Stümperwerke der Natur
Wer die Bücher der Natur richtig zu lesen versteht, der muss allmählich dahinter kommen, dass die Physik und die Physis, die Naturkunde und die Natur selbst, einander wert sind. Sie taugen alle zusammen nicht viel.
Seit Urzeiten bemüht sich eine dürftige Wissenschaft, die Zusammenhänge einer erbärmlichen Erscheinungswelt zu erforschen und zu erklären.
Ich werde dir diese Erbärmlichkeit bis in alle Einzelheiten nachweisen, und ich bin sicher, dass bis zum Schluss meiner Erörterungen deine Naturbegeisterung und deine Verehrung der physikalischen Wissenschaften sich in Fetzen aufgelöst haben wird. Du wirst erkennen, dass die sogenannte Allmutter Natur, weit entfernt von jeder Meisterschaft, in jeder Sekunde ihrer Tätigkeit als vollendete Stümperin wirtschaftet und dass jede Wissenschaft, die sich nicht von Anfang an auf diesen Standpunkt der Betrachtung einstellt, notwendig dazu verurteilt ist, Stümperwerk zu liefen.
In meiner Verurteilung der Natur mögen manche Folgerungen und Schlüsse mit den pessimistischen Ansichten Voltaires, Schopenhauers und ihrer Jünger zusammenfallen.
Allein du wirst bald genug erkennen, dass meine Lehre über den landläufigen ethischen Pessimismus weit hinausragt. Und zwar wesentlich dadurch, dass ich mich nicht damit begnüge, die üblichen Sittenwerte Gut und Böse zur Richtschnur meiner Beurteilung zu nehmen, sondern weil ich darauf ausgehe, das wirkliche Können der Natur zu prüfen; sie als Arbeiterin in ihren eigenen Werkstätten nach Tüchtigkeit, Fleiß, Geschick, Technik zu prüfen; wobei es dann allerdings herauskommt, dass die Summe ihrer Leistungen nichts anderes darstellt als ein unendliches Register von groben Fehlern, Schnitzern, Irrtümern, Fehlgriffen, Tölpeleien und tapsigen hanebüchenen Dummheiten.
Einem Haupteinwand möchte ich von vornherein in aller Kürze den Kopf zertreten. Man wird, man könnte mir entgegenrufen:
„Ja, du denkst eben ganz anthropozentrisch, du misst die große Natur nach deinem engen Menschenmaß, du bist also gar nicht fähig, ihre Größe zu fassen.“
Darauf hätte ich zu entgegnen:
„Selbstverständlich denke ich so, denn der Mensch – das Maß aller Dinge, nach Protagoras –, kann aus seinem Eigenmaß ebenso wenig heraus wie aus seiner Haut; nur denke ich so mit dem Unterschied zu den allermeisten, dass ich richtig anthropozentrisch denke, die andern aber falsch.
Spinoza hat gesagt:
„Wenn die Dreiecke denken könnten, so würden sie sich ihren Gott dreieckig vorstellen.“
Wenn nun aber ein gewisses Dreieck sich seinen Gott siebzehneckig oder kreisrund vorstellte, so wäre das nicht etwa ein höher organisiertes, sondern ein stumpfsinniges Dreieck.
Und genau so stumpfsinnig urteilen eben die andern, die ihrem Anthropomorphismus zu entgehen vermeinen, wenn sie der Natur außermenschliche Eigenschaften andichten.
Sind wir schon verurteilt, anthropozentrisch zu denken, so wollen wir uns wenigstens keine Flausen vormachen und nicht mitten auf dem Denkwege umknicken, etwa zur Logik eines Wiedehopfes, der die Welt deshalb so löblich findet, weil es um ihn herum so hübsch stinkt.
Nein, wir wollen folgerichtig bis zu der Erkenntnis fortschreiten, dass die Natur auf uns passt wie die Faust aufs Auge.
Und ganz besonders wollen wir beachten, dass es ja die Natur selbst ist, die unser Gehirn anthropozentrisch geschaffen hat.
Ist dies ein unausrottbarer Fehler, ja zum Teufel, warum hat sie denn bei unserem wichtigsten Organ mit so einem Fehler angefangen, wenn es ihr doch als Allmutter freistand, unserem Hirn statt des ewigen Unsinns den ewigen Sinn einzupflanzen?!
Einfache Antwort: Weil sie nicht nur sämtliche Fehler gemacht hat, die zu machen waren, sondern noch unendlich viele dazu, die sie eigens erfand, um die Welt so verkehrt wie möglich zu gestalten.
Also denken wir schon, wie wir zu denken gezwungen sind, und sehen wir zu, wohin wir gelangen, wenn wir wenigstens in dem uns auferlegten Denkzwange ehrlich und folgerecht, das heißt ohne Selbstbeschwindelung vorgehen!
Goethe hat als Dreißigjähriger einen klingenden Kantus auf die Natur angestimmt, nach Schwung und Gehalt den schönsten, der ihr unter allen Psalmen in Prosa jemals gewidmet worden ist. Und die Zahl dieser Psalmen füllt nicht nur Bibliotheken, sie stellt sogar den Kern alles dessen dar, was von der Mehrzahl der Denker und Dichter überhaupt geschrieben worden ist.
Dabei kommt Goethe in einigen Worten seiner Hymne der wirklichen Wahrheit erkennbar nahe, er, der Genießer, der Bejaher, der sich den Urquellen der Schöpfung so innig verwandt fühlte. Er ringt gegen die furchtbare Erkenntnis, dass sich die Natur nur darum so unerforschlich gemacht hat, weil sie den dichtesten Schleier braucht, um ihre schaurigen Mängel zu verstecken. Aber im Ganzen siegt doch das Anbetungsbedürfnis, und so vergöttert auch er die Außenseite, die mit so blendendem Faltenwurf den plundrigen Kern überdeckt.
Hören wir und nehmen wir uns die Freiheit, ihm mit unseren eigenen vorläufig noch ganz behutsamen Worten in die Rede zu fallen:
„Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen – unvermögend, aus ihr herauszutreten, und unvermögend, tiefer in sie hineinzukommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arm entfallen.
Sie schafft ewig neue Gestalten; was da ist, war noch nie; was war, kommt nie wieder: Alles ist neu und doch immer das Alte.“ (Das heißt: Es erscheint neu, wie eine frischgeschüttelte Figur im Kaleidoskop, die nur dem primitiven Kindergemüt eine Neuheit vorzutäuschen vermag; wer den Trick kennt, der weiß: Es ist nichts dahinter als Erfindungslosigkeit, armseliges Material und Spiegeltäuschung.)
„Sie scheint alles auf Individualität angelegt zu haben und macht sich nichts aus den Individuen. Sie baut immer und zerstört immer, und ihre Werkstätte ist unzugänglich.“ (Das heißt: Sie lässt zum Einblick nur einen schmalen Spalt, der uns verrät, dass in der Werkstätte nicht das geringste Gültige zustande kommt. Sie wirtschaftet darin wie ein wahnsinniger Bildhauer, dessen hammerschwingende Linke andauernd entzweischlägt, was die Rechte in der Sekunde vorher geformt hat. Man kann, auch auf das Sisyphus-Gleichnis geraten; aber Sisyphus sah doch wenigstens eine Aufgabe vor sich und stemmte sich nicht gegen seine eigene Absicht.)
„Es ist ein ewiges Leben, Werden und Bewegung in ihr, und doch rückt sie nicht weiter. Sie verwandelt sich ewig, und ist kein Moment Stillstehen in ihr. Fürs Bleiben hat sie keinen Begriff, und ihren Fluch hat sie ans Stillstehen gehängt. Sie ist fest: Ihr Tritt ist gemessen, ihre Ausnahmen selten, ihre Gesetze unwandelbar.“ (Also undurchbrechliche Gesetze, die durch Ausnahmen zerbrochen werden können. Ist die „Seltenheit“ der Ausnahme wiederum eine Regel, so kann auch diese außer Kraft gesetzt werden, das heißt: Die Ausnahmen können überwiegen, anders ausgedrückt: es gibt in der Natur keine Regel, kein Gesetz, sondern nur Regellosigkeit, Gesetzlosigkeit. Dabei aber ist sie „fest“ und hat, nach Goethe, ihren Fluch ans Stillstehen gehängt; sie selbst rückt aber, auch nach Goethe, nicht weiter, das heißt also: Sie verflucht ihren eigenen Stillstand, sie verflucht sich selbst. Wir aber, ihre Geschöpfe, wir sollen sie segnen, denn Goethe ergänzt bald darauf):
„Sie macht alles, was sie gibt, zur Wohltat: Denn sie macht es erst unentbehrlich. Sie säumt, dass man sie verlange; sie eilt, dass man sie nicht satt werde ... Ihre Krone ist die Liebe; nur durch sie kommt man ihr nahe. Sie macht Klüfte zwischen allen Wesen, und alles will sie verschlingen.“ (Das heißt: Sie benimmt sich uns gegenüber wie ein Oger, wie ein Werwolf, und wir haben dies als Wohltat anzuerkennen und als Inbegriff der Liebe. Warum auch nicht? Da ihr Wesen die Gesetzlosigkeit ist, so verlangt sie auch in unserer Wertung der Dinge die Anarchie; sie verschlingt uns, wir quittieren darüber mit den Kennworten „Wohltat“ und „Liebe“ – so stimmt nach Goethe die Rechnung.)
„Sie ist alles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, erfreut und quält sich selbst. Sie ist rau und gelinde, lieblich und schrecklich, kraftlos und allgewaltig ... Vergangenheit und Zukunft kennt sie nicht. Gegenwart ist ihre Ewigkeit. Sie ist gütig. Ich preise sie in allen ihren Werken ... Sie ist listig, aber zu gutem Ziele, und am besten ist’s, ihre List nicht zu merken.“ (Aber die gesamte Naturwissenschaft verfolgt doch nur das eine: Diese Listen zu ergründen; also ist’s wohl am besten, diese Wissenschaft preiszugeben und die List samt ihrem Ziele unerforscht zu lassen. Entschließt man sich aber dazu, so hat es nicht leisesten Sinn, dieses unbekannte und unerforschbare Ziel als ein „gutes“ auszurufen, zumal ein Ziel in der Zukunft liegen muss, und die Natur, nach Goethe, eine Zukunft gar nicht kennt.)
„Sie hat mich hineingestellt, sie wird mich auch hinausführen ... Sie mag mit mir schalten; sie wird ihr Werk nicht hassen.“ (Weil sie so gütig ist, mit ihrer gelinden Rauheit und ihren lieblichen Schrecknissen; weil sie ihr Werk dauernd zerstört und unablässig auffrisst; weil ihre Krone die Liebe ist, und weil sie sich kraft dieser Liebe aus den Individuen nichts macht; deshalb wird sie auch das Individuum Goethe nicht hassen.)
„Ich sprach nicht von ihr; nein, was wahr ist und was falsch ist, alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Verdienst.“
Wir wollen nunmehr in diesem Schuld- und Verdienstkonto einige Hauptseiten vergleichen und danach ermitteln, ob auf der Kreditseite überhaupt noch ein nennenswerter Posten übrig bleibt. Und bei dieser Prüfung soll uns nicht der Drang leiten, mit Worten zu jonglieren und vollkommene Widersprüche, gleich geheimnisvoll für Weise und für Toren, zu errichten.
Wir wollen uns vielmehr dem einzigen Führer anvertrauen, der als gar zu selbstverständlich von Wissenschaft und Dichtung mit affektierter Geringschätzung betrachtet wird: dem gesunden Menschenverstand. Seine Leuchte ist die stärkste, über die wir verfügen, und nur die Furcht, sie könnte am Ende ein ungeheures Gerümpel bestrahlen, hat bis jetzt die meisten Denker verhindert, diese Fackel der Natur ins Gesicht zu halten.
Stellen wir uns einmal ganz anthropozentrisch, das heißt ganz menschenlogisch, und ohne Flunkerei Folgendes vor: Ein mit ungeheuren Kräften ausgerüsteter Baumeister baut sich ein Wohnhaus, so groß, wie der Vatikan mit seinen fünfhundert Sälen und elftausend Zimmern, mit seinen unendlichen Hallen, Fluren und Galerien.
Der Hauptbau ist fertig, und nun überlegt der Mann, wie er die Innenräume für sich und die Seinen wohnlich und behaglich einzurichten habe.
Dabei verfällt er auf die Idee, die ganze Großartigkeit unmöbliert zu lassen, bis auf eine winzige Seitenkammer von wenigen Fuß im Umfang.
In dieses Gelass hinein pfercht er Betten, Kochherd, sonstiges Hausgerät, alsdann versammelt er seine Angehörigen, quetscht sie ebenfalls in das Loch, dass ihnen vor Engnis die Rippen krachen, sich dazu, und indem er die Tür von innen verriegelt, lädt er die Leute ein, sich’s hier bequem zu machen.
Eine Stimme ruft ihm zu:
„Hausvater! Wir können uns nicht rühren! Wir ersticken!“
„Kinder“, erklärt der Baumeister, „ihr habt den Dingen gegenüber eine ganz falsche Betrachtungsart – es fehlt euch an vergeistigter Philosophie und höherer Wissenschaftlichkeit. Tatsächlich bewohnt ihr ja nicht nur diese räumlich sehr eng begrenzte Kabuse, sondern einen ganz unermesslichen Palast. Keinen andern Mieter lasse ich da hinein, ich lasse den Palast absolut leer stehen, damit wir das wonnige Gefühl hegen können: Er gehört uns! Euren schweifenden Gedanken bleibt es unverwehrt, in all seine Säle und Hallen hinauszufliegen, und gar nichts hat es zu bedeuten, wenn euer bisschen Körperlichkeit sich auf etwas beschränkte Verhältnisse einrichten muss.“
Man könnte ja nun einwerfen, dass ein so stupider und grausamer Baumeister auf Erden noch nie gelebt hat. Aber da wir ihn als existierend annehmen, so müssen wir zu seiner Entschuldigung anführen, dass er sein Verfahren ganz getreu nach dem Vorbild der kosmischen Natur entworfen hat.
Sie, die große Baumeisterin, hat in ihrer Architektur, die wir „Welt“ nennen, das Modell aufgestellt, das er kopierte; soweit er es eben zu kopieren vermochte, also ganz unzulänglich: Denn wenn der Mensch das Menschenmögliche leistet, so bleibt er immer noch weltenweit hinter den Unsinnigkeiten zurück, die ihm die Natur in Raumverschwendung und Raumverknauserung vormacht.
Wie des Menschen Hand das Gebäude von vatikanischen Dimensionen hinstellte, so formte die Natur den Kosmos, indem sie den unendlichen Raum mit Sterneninseln, Milchstraßen, Sonnen und ihren Trabanten durchsetzte.
Lassen wir selbst die fernen, nach Tausenden von Lichtjahren zu messenden Universen ganz außer Betracht, und beschränken wir uns durchaus auf das Nächstliegende, auf unser eigenes Sonnensystem, so überblicken wir Räume, die nichts anderes darstellen als eben nur unwirtlichen Raum, Entfernung, Erstreckung, ohne nennenswerten Inhalt.
Sie alle haben schon Planetarien gesehen, sogenannte Nachbildungen unserer um die Sonne kreisenden Welten, und Sie wissen vermutlich auch, dass diese Planetarien grundfalsch sind, so falsch wie die meisten Anschaulichkeiten, mit denen uns die populäre Wissenschaft ein Verständnis vorzutäuschen sucht.
Denn in Wirklichkeit müsste so ein Planetarium, um uns nur das Geringste zu verdeutlichen, einen Umfang aufzeigen wie Großberlin, und auch dann würden die meisten Planeten, in Erbsen oder Kirschengröße, unserer Betrachtung fast entschwinden, mit den leeren Kilometern, die zwischen ihnen liegen.
Eine solche Erbse, verloren hingestreut in die Unabsehbarkeit des Raumes, wäre unsere Erde, und nun schließen wir unsern Vergleichsring mit der Ansage:
Diese Erde ist im Weltpalast die Kabuse, in die uns die gütige Natur hineingeklemmt hat, uns und alle Geschöpfe, von denen wir Kunde haben. Sie hat uns mehrdimensional geschaffen, uns auf den Raum als die Grundlebensbedingung verwiesen und uns gleichzeitig das Grundelement verweigert: den Raum.
Dieser ist vorhanden, überall da draußen, verschlossen und unbenützt, groß genug, um unzähligen Milliarden von Erdbevölkerungen Unterkunft zu gewähren.
„Nein!“, spricht die Natur. „Der ist nicht für euch, den lasse ich leer stehen; sieh zu, wimmelnder Haufen, wie du dich auf diesem Erbsenglobus einrichtest! Quetscht euch eins am andern entzwei, und will’s gar nicht anders gehen, so vertilge doch eines das andere, da wird schon immer wieder etwas Platz werden!“
Die Wissenschaft hat natürlich im Laufe ihrer Entwicklung diesen harten Anruf vernommen, obschon sie ihn lange genug mit ererbter oder gewollter Taubheit überhörte. Dann aber etikettierte sie ihn, seit 1789, als Kampf ums Dasein, als struggle for life, erhob ihn zum Forschungsprinzip, nicht etwa mit Heulen und Wehklagen, sondern mit Hymnen und dithyrambischem Wonnegerassel; und sie bewies uns biologisch wie soziologisch, dass dieser Kampf ums Dasein eigentlich eine ganz prächtige Sache sei und alle Schönheit, Stärke und Gediegenheit des Lebens verursacht habe.
Ein anschauliches Beispiel hierfür ist im Naturhistorischen Museum zu Dublin sichtbar: Im Längsschnitt ein Hai, der einen Kabeljau verschluckt hat, in dessen Magen zwei Heringe befindlich, welche Sprotten verspeist haben, in deren Magen sich noch unverdaute Krustazeen befinden. Eine niedliche Illustration zu Werners in aller Ewigkeit gültigem Epigramm:
„O wunderschön ist Gottes Erde und der Geschöpfe Lebenslauf; dass alles satt und glücklich werde, frisst einfach eins das andre auf!“
Dass der Daseinskampf als Einzelerscheinung sonderlich erquickend wirke, wird freilich wohl kaum irgendjemand behaupten. Denn der Nahrungshunger ist ja genau genommen nur eine Verkleidung des Raumhungers, nämlich des Dranges, für Zellen und Moleküle neue Lagerungen im Raume zu gewinnen.
Und kein noch so raffiniert bereitetes, angeblich der „edlen Geselligkeit“ dienendes Gastmahl kann uns darüber hinwegbringen, dass zwischen Speisen, Schlürfen und Fressen im Grunde kein Unterschied besteht, wie überhaupt, dass Nahrung, Verdauung, Entleerung und wiederum Nahrung nur die schauerlichen Exponenten jenes Kampfes darstellen, dem wir nach landläufigem Darwinismus so viel Entwicklung und Aufstieg verdanken.
Im Atlantischen Ozean gibt es streckenweise drei übereinander gelagerte weit ausgedehnte Wasserschichten, deren lebende Bewohner das klarste, natürlichste Paradigma für die Beziehung von Geschöpf zu Geschöpf liefern. Ohne jede Pause frisst dort die Mittelschicht die Unterschicht, während dieselbe Mittelschicht ohne jede Pause von der Oberschicht aufgefressen wird.
Es ist in seiner Einfachheit das denkbar übersichtlichste Verfahren, gleichsam als hätte die Natur an einer bestimmten Stelle ihrer Werkstatt einen Unterrichtskursus eingerichtet, um uns zu zeigen, wie sie es eigentlich meint.
Wenn nun dort im Atlantischen Ozean das Fisch- und Quallenzeug eine Wissenschaft besäße, so würde ein oberer Fischprofessor wahrscheinlich folgende Lehre aus den Vorgängen ableiten:
Erstens, dass die Natur sehr gütig handle, indem sie ihn momentan schmackhaft sättige.
Zweitens, dass sich aus diesem Kampf ums Dasein vermöge des Prinzips der Auslese eine Veredelung der Typen herausbilden müsse, wofür die Beweise vorlägen: Denn er, der Fresser der Oberschicht, sei ja schon hochedel organisiert gegenüber den tiefer fressenden und gefressenen Fischen.
Drittens aber: Diese Steigerung des Organismus führe notwendig auch zu einer Erhöhung des sittlichen Charakters; so zu verstehen, dass der nackte Egoismus in seiner ganzen Verwerflichkeit nur ganz unten herrsche; während beim Fischprofessor und seinen Genossen bereits der Altruismus, der Edelmut, kurzum das Prinzip der Nächstenliebe hervorzukommen anfange und in einen prachtvollen kategorischen Imperativ von Kantischer Prägung auszumünden verspreche.
Und diese Lehre wäre tatsächlich gar nichts anderes als die Projektion der von und für Menschen verkündeten biologischen Ethik auf jenen Fresskrater im Atlantik. Sie sind in Motiven und Ergebnissen ganz genau aufeinander abgebildet. Woraus dann wiederum folgt, dass die akademische Ethik des Menschen ebenso gut die eines Haifisches sein könnte.
Wir nehmen als erwiesen an, dass die Natur organische Formen gestaltet und diese fortwährend abändert, etwa wie ein züchtender Gärtner, der aus einer Art verschiedene Spielarten abzweigt. Die allgemeine Annahme lautet: Der Gärtner hat seine Methode den Kunstgriffen der Natur abgelauscht.
Wir sehen uns gedrängt, diesen Satz in der Hauptsache umzukehren: Der Gärtner verfährt plan- und sinnvoll; die Natur aber experimentiert planverlassen drauflos, sie weiß nie, worauf sie hinaus will, und sie endet fast durchweg bei einem experimentellen Fiasko.
Die Leistungen der Züchter von Beruf gehen ins Staunenswerte, ja direkt ins Fabelhafte. Freilich handelt es sich auch bei ihnen vielfach um spielerische Plundermätzchen, um die Verwirklichung einfältiger Modelaunen.
Allein sie sehen ihr Ziel und erreichen es in der kürzesten Linie, sie entfalten Erfindung und Technik, sie bewähren sich als Meister im Prinzip von der überwundenen Schwierigkeit.
Schon vor mehreren Jahrzehnten rühmte Häckel, man könne an die geübtesten Züchter ganz bestimmte Aufgaben, stellen und zum Beispiel sagen: „Ich wünsche diese Nelkenart oder diese Taubenrasse in der und der Farbe, mit der und der Zeichnung zu haben“; und die Beauftragten seien imstande, innerhalb einer vorbemessenen Zeit das verlangte Resultat auf Bestellung zu liefern.
Einer der erfahrensten englischen Züchter, Sir John Sebright, erklärte, er wolle jede ihm aufgegebene Feder in drei Jahren, jede gewünschte Form des Kopfes und des Schnabels in sechs Jahren hervorbringen.
Diese drei oder sechs Jahre sind Sekunden im Vergleich mit den ungeheuren Zeiträumen, die die Natur braucht, um eine Veränderung in Form oder Farbe zu erzielen. Weil eben die Natur, sofern man ihr Absichten zuschreibt, unterwegs vergisst, was sie eigentlich vorhat, während der Mensoh, der das Abwandlungsprinzip erst erfasst hat, planmäßig arbeitet und dadurch Hunderttausende von Jahren erspart, die von der großen Zeitbesitzerin Natur ohne Zweck vergeudet werden.
Und nun stellen wir uns wieder einmal einen perversen Einzelfall vor: Wie vordem den Verdrehten Baumeister, so jetzt einen verdrehten Züchter.
Was will er herstellen? Einen plundrigen Organismus? Der könnte immer noch einen Kuriositätswert besitzen, irgendeinem Bedürfnis entsprechen, und wäre es auch dem einer snobistischen Mode, die zwar unnütz, aber auch unschädlich einigen Gaffern Freude und Zerstreuung gewährt.
Nein! Dieser Züchter will etwas grundsätzlich anderes: Im Besitz der vollendetsten Methoden will er ein lebendes Geschöpf in die Welt setzen, das sämtliche miserablen Eigenschaften in sich vereinigt. Den lebenden Brennpunkt aller organischen Fehlerhaftigkeiten will er konstruieren. Das soll sein Triumph werden, der Höhepunkt der Vererbung, Anpassung und damit der ganzen Darwinschen Selektion.
Und wiederum höre ich den Einwand, dass so ein Extrem an Verbohrtheit unter Züchtern doch gar nicht vorkommen könne, denn schließlich, seine Technik möge noch so verblüffend sein, von den vorbildlichen Regeln der Natur vermöge er doch nicht ganz und gar abzukommen; und diese schaffe eben unbedingt und vollkommen zweckmäßig, selbst da, wo sie sich auf blind wirkende Mechanik zu stützen scheine. Folglich wäre auch ein Züchter undenkbar, der schnurstracks das Gegenteil aller Zweckdienlichkeit, nämlich den Inbegriff aller Miserabilität anstreben oder gar in irgendeiner Form verwirklichen könnte.
Eine schöne und tröstliche Berechnung; nur leider sie stimmt nicht. Und sie stimmt deswegen nicht, weil sie schon im ersten Ansatz einen groben Fehler enthält. Die Natur schafft nämlich, von einzelnen auch noch sehr fragwürdigen Mechanismen abgesehen, keineswegs zweckdienlich, sondern im höchsten Grade zweckwidrig!
Davon ist auch nichts abzuhandeln, indem man etwa den Neutralbegriff „zwecklos“ einschmuggelt; denn eine Wirtschaft mit unendlichen Kräften an unendlichen Stoffen mit unendlichen wahrnehmbaren Erscheinungen wäre, wenn zwecklos, der Gipfel aller Zweckwidrigkeit.
Das Ziel der Natur in allem Organischen ist der Mensch, nach durchgreifender Meinung aller Forscher, die ein Nieder und Höher und damit eine Entwicklung im Sinne des Fortschritts gelten lassen.
Und in diesem höchstentwickelten aller Geschöpfe, in diesem Menschen, hat die Natur tatsächlich das Ideal jenes perversen Züchters herausgestellt. Verfolgt dieser den Plan, die Summe aller Verkehrtheiten in einem einzigen Lebewesen zu vereinigen, so darf man ihm nicht entgegenhalten: „Der Plan ist vermöge seiner Abstrusität unmöglich“; sondern höchstens: „Verlege dich auf Originelleres, denn diesen blöden Plan hat dir die Natur im Menschen längst vorweg konstruiert!“
Wählen Sie den Maßstab, wie Sie wollen – sobald Sie ihn nur richtig anlegen und beim Ablesen nicht leichtfertig verschieben, werden Sie erkennen, dass das krönende Gebilde der Schöpfung in jedem Betracht weit zurückbleibt, nicht nur hinter dem vorstellbaren Ideal „Mensch“, sondern hinter vielen anderen Geschöpfen; dass auch diese sich mit Mängeln, Fehlern, Unbeholfenheiten durchs Dasein schleppen, das verschlechtert nur noch des Menschen Rangstellung. Immerhin ergibt die Prüfung ein relatives Optimum aufseiten der Tiere und das Maximum der Fehlerhäufung beim Menschen.
Von diesem Missverhältnis hat eine falsch gerichtete Anthropozentrie durch die Jahrhunderte nichts geahnt. Vielmehr ist das schnurrige Leitmotiv von der Suprematie des Menschen in unzähligen Variationen bis zu wahren Orgien der Selbstvergötterung abgeleiert worden. Man müsste Bücherreihen vollschreiben, um auch nur der dicksten Verhimmelungen zu gedenken, die von den Urschriften bis Descartes zu Ehren des Homo sapiens, zu Schimpf der Tierwelt in einem unabsehbaren Literaturkram angestimmt wurden.
Als den tonangebenden Chorführer betrachte ich Cicero, der in seinem Schwatz „Über das Wesen der Gottheit“ die Ansicht vertritt: „dass alles, was auf dieser Welt existiert, nur um der Menschen willen geschaffen und veranstaltet ist; dass die Tiere keinen Anspruch auf die Bodenerzeugnisse besäßen, da sie in voller Unkenntnis vom Anpflanzen, vom Anbau, vom gehörigen Einsammeln her umliefen, mithin nur „diebischer Weise“ genössen, was dem Herrn gehört; dass die Existenzberechtigung der Schafe nur in der Wolle stecke, die sie zum Bekleidungszwecke für den Menschen hervorbrächten; ja, dass gewisse Vögel lediglich zum Zwecke der Auguren die Luft bevölkerten“.
Gewiss wird schon manchem, der auch sonst an die Suprematie des Menschen glauben mag, die Albernheit solchen Geschwätzes auffallen; um aber ihre ganze Blödheit zu ermessen, wird man sich doch entschließen müssen, einmal den Tugendmaßstab an Mensch und Tier genau anzulegen, um zunächst zu ergründen, ob denn die Natur in der Konstruktion des Menschen überhaupt einen Fortschritt über das Tier erzielt hat.
Auf der Tugendskala stehen verzeichnet: Stärke, Schönheit, Charakter, Talent, Tapferkeit und derlei gute Dinge, die man als einzelne Komponenten des Göttlichen betrachtet.
Dass der Mensch im Betracht der Stärke und der Maße hinter vielen Tieren zurückbleibt, hinter den großen Raubtieren, dem Elefanten, Nashorn, dem Büffel und Wisent, den Walen, dem Thunfisch, der Bärenrobbe, dem Gorilla, dem Kamel, braucht als allzu auffällig kaum betont zu werden und ist ja wohl auch den Ciceronianern kaum entgangen.
Allein diese offensichtliche Unterlegenheit hat sie niemals bekümmert. Sie blickten nicht aufwärts, sondern unter sich, ins Kleinvieh, ins Geflügel, ins Gewürm, und beruhigten sich bei der Wahrnehmung, dass der Stärke des Menschen alles in allem gerechnet immerhin noch ein leidliches Mittelmaß zukam.
Doch schon hier sitzt ein Denkfehler. War der Mensch das Ziel der Schöpfung, so durfte sie an ihm in der Ausbildung einer Edel-Eigenschaft wie der Stärke nicht knickern; sie durfte sie vor allem nicht einer Rückbildung verfallen lassen im Vergleich mit seinen Stammeseltern, den anthropoiden Affen, die stärker waren als er.
Die Annahme einer Mittelstellung ist sinnlos, wo der Erweis einer Göttlichkeit infrage steht. Die Stärke ist nun einmal ein Attribut der Gottheit.
Aber könnte der als ein Gott gelten, der zwar stärker wäre als irgendein Schwächling, aber schwächer als ein Theseus?
Warum wirkt Wagners Wotan auf der Bühne so lächerlich? Weil er mit dem Anspruch der unbedingten Stärke auftritt und von den neben ihm auftretenden Riesen programmgemäß überragt wird.
Und warum wirken obendrein diese Riesen so lächerlich? Weil sie ihn eben nur programmgemäß, bühnenkonventionell überragen, während sie tatsächlich das Durchschnittsformat des Menschen aufzeigen.
Aber der Mensch als solcher im Kreise der anderen Lebewesen soll nicht lächerlich wirken; und er hat das auch gar nicht nötig, sobald man ihm nur seine bescheidene Stellung nach Verdienst anweist.
Die Lächerlichkeit fliegt ihm nur an, wenn man seiner offenkundigen Schwäche zum Trotz erklärt: Der Löwe ist ihm zwar als Körperlichkeit überlegen, aber dafür hat ja der Mensch eine Waffe!
Hier kommt der Bühnentrick der Lebensarena zum Vorschein, die durchsichtige und fadenscheinige Konvention, das Heldische aus der Hauptsache herauszunehmen und ins Nebensächliche zu verlegen.
Nur der Körper ist heldenhaft, nicht das Drum und Dran! Nicht durch seinen Speer wird der Homerische Achill zur Heldenfigur, sondern durch sein Achilleisches Eigenmaß.
Ein Bübchen mit einer Pulverflinte könnte ihn niederknallen; dann wäre das Bübchen in jener Betrachtungsweise der Stärkere, der Gott, der höher entwickelte Organismus!
Nein, Achill bleibt der Löwe, und der Löwe bleibt Achill gegen den Menschen, der die Qualität der Stärke ein für allemal aus dem Tugendregister auszustreichen hat.
Suche er andere vitale Eigenschaften hervor; etwa die Lebenszähigkeit, die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Unbilden und Eingriffe; denn in dieser Hinsicht müsste doch wohl die Natur ihn besonders gut ausgerüstet haben, wenn sie vor hatte, den Menschen als ihr Meisterwerk in den Kampf ums Dasein hineinzustellen.
Da sieht es nun besonders traurig aus. So traurig, dass sogar die biologische Wissenschaft bei all ihren krampfhaften Versuchen, dem Menschen die Suprematie zuzuschanzen, auf diesem Gebiet fast alle Posten geräumt hat.
Die Biologie selbst erzählt uns, dass mit der Lebenszähigkeit beim Menschen nicht viel los sei, dass dagegen viele Tiere aus niederen Sphären als Wunder der Naturtechnik gepriesen werden müssten.
Genaugenommen kann der Mensch wenig mehr als nichts aushalten; ein unscheinbarer Stich von Fingerlänge, eine winzige Erhöhung oder Erniedrigung der Temperatur, eine Tropfendosis von Gift tötet ihn.
Er kann sich nicht mit dem Karpfen messen, der zu splitternder Stahlhärte gefroren unter Erwärmung wieder zu rüstigem Leben auftaut, nicht mit der Kröte, die in Felsen eingeschlossen tausend Jahre überdauert, nicht mit der Trichine, die dem Kreosot, dem Holzessig und dem heißen Wasser bis nahe zur Siedehitze widersteht.
Und welche kümmerliche Rolle spielt der Mensch im Vergleich mit dem Regenwurm, mit den Süßwasserpolypen, deren Leben gegen jede Zerteilung gefestigt ist.
Der Polyp, Hydra viridis, beantwortet jede Zerschneidung derart, dass sich noch die kleinsten abgeschnittenen Tentakeln wieder zu vollen Individuen auswachsen; es ist so, als ob einem Menschen der amputierte Finger und gleichzeitig dem amputierten Finger ein neuer Mensch hinzuwüchse.
Zu welchem Grade der Göttlichkeit würde die Legende einen Heros emporjubeln, emporschwindeln, wenn dieser Held eine solche Lebenstüchtigkeit an den Tag gelegt hätte!
Aber bis zu so abenteuerlichem Anspruch hat sich Frau Saga nicht aufgeschwungen. Im besten Fall schafft sie ihn „hürnen“ und schützt ihn notdürftig gegen Wunden. Aber sie weiß, dass sie sich selbst um allen Kredit bringen würde, wenn sie etwa behaupten wollte, ein Held könnte gegen Waffenangriff so tüchtig, so lebenszäh werden wie ein Ringelwurm.
Aber dafür hat doch der Mensch die Schönheit, er ist das schönste aller Geschöpfe, und in diesem außerordentlichen Vorzug hat die Natur doch deutlich genug zu erkennen gegeben, dass sie ihm die Sonderstellung ganz zu oberst vorbehalten und sichern wollte.
Freilich hapert es auch damit ganz bedenklich, denn die Schönheit ist doch nichts objektiv Feststellbares, sie bleibt vielmehr immer vom Urteil, vom Standpunkt abhängig. Und der Standpunkt darf nicht dort liegen, wo sich das zu Beurteilende befindet, da sonst der Begriff der Beurteilung verfliegt und die Kritik sinnlos wird.
Ob ein Kunstwerk schön ist, das hat nicht das Kunstwerk zu entscheiden, sondern das Individuum, das davor steht, und wenn dieses selbst als das Kunstwerk gelten will, so fehlt es in alle Ewigkeit an dem draußenstehenden beurteilenden Individuum.
Die Kritik „ich bin schön“ ist schon an sich wertlos; sie wird aber geradezu possenhaft, wenn man sich vergegenwärtigt, dass zum Beispiel alle Menschen das Pferd schön finden, während wir nicht das Geringste darüber wissen, ob irgendein Pferd irgendeinen Menschen für schön hält.
Wenn ich mir das Pferd als ein ästhetisch empfindendes Wesen vorstelle, so ist mir das Gegenteil sehr wahrscheinlich, und der große Denker Swift hat in seiner Antithese vom „Jähu“ und „Haunhm“ diese Wahrscheinlichkeit fast zur Gewissheit gesteigert.
Aber auch der Durchschnittsmensch widerlegt seine eigene Wertung unablässig: Er spricht vom schönen Geschlecht und meint damit das Weib, während ihm doch der oberflächlichste Blick über die gesamte Tierwelt zeigen müsste, dass sich die Schönheitscharaktere in Gestalt und Farbenwirkung durchaus auf das Männliche häufen.
Womit allein schon bewiesen wäre, dass unsere ganze Schönheitsskala, als ausschließlich vom Geschlechtstrieb bestimmt, nicht die geringste Geltung haben kann, sobald wir nur den leisesten Versuch wagen, sie auf ein Nicht-Menschliches zu übertragen.
Nur ein wirklich draußen und darüber Stehender, ein kritikübender Gott könnte uns sagen, wie wir uns im Punkte der Schönheit zu anderen Geschöpfen verhalten. Der würde uns vielleicht erklären:
„Schön ist ein Panther, ein Hirsch, ein Pfau, eine Bachstelze, ein Kolibri, eine Meduse, ein Seestern; etwas minder schön ist der Pavian, dessen Farbenpracht an den Gesäßschwielen indes nicht unterschätzt werden darf; während ihr entarteten Affenabkömmlinge, ihr Menschen, ja schon durch euer eigenes Geständnis aus der Schönheitslinie ausscheidet, da ihr ja allesamt die erbärmlichste Angst habt, euch in natürlicher Figur zu zeigen, nämlich nackt.“
Und tröstend würde er vielleicht ergänzen:
„Fahret fort, wenn es euch vergnügt, von ,Schön und Hässlich‘ zu reden, was im Universum so viel Sinn hat wie ,Oben – Unten‘, ,Vorn – Hinten‘, nämlich gar keinen. Aber da ihr einmal relative Geschöpfe seid, so soll man euch euren relativen Spaß lassen. Aus seinem Geschlechtszentrum heraus kräht der kalekutische Hahn: „Von allen Hennen dieser Welt die kalekutische mir am besten gefällt“, warum sollt ihr nicht ähnliche Hymnen auf Weiber Schönheit und Menschenschönheit krähen?“
Aber seine Machtstellung ist doch wohl unbestritten, als eine überall zu beobachtende Tatsache, unabhängig von jeder Rechtsbegründüng? Der Mensch befiehlt, das Tier gehorcht, er schaltet und waltet mit ihm nach Gutdünken, und wenn auch hin und wieder der Tiger den Menschen zerreißt, so wird doch niemand behaupten, dass die Ordnung der Dinge durch solchen Ausnahmefall ernstlich infrage gestellt werde.
Zweifellos spielt hier ein neuer Faktor hinein, der Verstand des Menschen, die Leistung seines Gehirns, die wir später noch besonders zu untersuchen haben werden.
Auch das sittliche Moment wäre zu berücksichtigen, und man könnte fragen, ob nicht jene ganze Machtstellung auf einem teuflischen Prinzip beruht, wonach es allzeit Überwinder und Überwundene, Tyrannen und Märtyrer gegeben habe, mit der Folge, dass letzten Endes der Makel am Tyrannen, die Gloriole am Märtyrer haften blieb.
Vorerst aber wollen wir doch untersuchen, ob denn die Machtstellung überhaupt vorhanden ist, und ob das von der Natur dem Menschen verliehene Zepter sich nicht am Ende als eine Karnevals-Attrappe aus Pappe und Flittergold ausweist.
So gewiss ein wirkliches Zepter das Symbol einer wirklichen Keule ist, so gewiss bleibt die Allgemeinbeziehung Herrschen – Dienen, Befehlen – Gehorchen unabtrennbar von wirklicher körperlicher Gewalt.
Wir haben bereits erörtert, dass den Menschen in dieser Hinsicht nur eine recht bescheidene Mittelstellung zukommt, und diese erniedrigt sich noch erheblich, wenn wir statt der absoluten Kräfte die relativen zum Vergleich heranziehen.
Nach relativer Muskelkraft gemessen kommt nämlich der Mensch so ziemlich auf die unterste Sprosse der Skala, er wird geradezu zum Typus der Schwäche und Untüchtigkeit. Jeder, auch der winzigste Kletteraffe, ist ihm nach solcher Messung überlegen, das Känguru, die Springmaus, der Kakadu, der Hirschkäfer, der Krebs, der Aal machen ihm Muskelleistungen vor, die ihm – relativ – unerreichbar bleiben.
Der gemeine Floh überspringt seine eigene Länge zweihundert Mal; besäße der Mensch auch nur annähernd die Flohstärke, so könnte er mit vier Ansätzen einen Kilometer bewältigen, und ein Sprung über das Brandenburger Tor hinweg wäre ihm eine Kleinigkeit.
Bleibt ihm diese Fähigkeit versagt, so macht sein Dünkel dafür desto größere Sprünge, indem er immer wieder auf die anscheinend so offensichtlichen Machtverhältnisse hinweist, nach denen seine Herrschaft über alles, was da kreucht und fleucht, unweigerlich feststehen soll.
Wirklich über alles? Oder doch nur über eine Reihe von Wirbeltieren, denen eine Unendlichkeit von unbeherrschten Gliedertieren, von Weichtieren, von Strahltieren gegenübersteht?
Zum Herrschen gehört der wahrnehmbare Ausdruck des Zwanges, nicht das eroberte oder verbriefte Recht, sondern auch die Möglichkeit, dieses Recht in irgendeiner Weise auszuüben und fühlbar zu machen.
Der Mensch besitzt einen Wald und damit das Herrscherrecht über das vierfüßige und federgeflügelte Viehzeug, das sich in ihm tummelt; er kann es einfangen, es abschießen, für seine Zwecke verwenden.
Erstreckt sich sein Machtbereich auch noch auf die unvergleichlich größere Zahl der Insekten im nämlichen Walde?
Nur noch sehr bedingungsweise. Der Specht, der Igel, der Maulwurf, die Spitzmaus besitzen ein sehr viel ausgedehnteres Jagd- und Herrscherrecht auf die Insekten als der Mensch und üben es so nachdrücklich aus, dass der Mensch neben ihnen gar nicht in Betracht kommt.
Aber der Mensch beherrscht doch nun wiederum den Specht und die Spitzmaus, und damit „indirekt“ das Insektengewimmel.
In diesem Schluss steckt eine spitzfindige logische Unstimmigkeit. Wir spüren, dass wir mit ihm eine klare Tatsache verdunkeln. Und die klare Tatsache besagt eben, dass der Unzahl gegenüber der Herrscherbegriff versagt; dass man nur über Tausende herrschen kann, nicht aber über Billionen; und dass der Mensch über das Gewürm ebenso wenig eine Gewalt ausübt wie über die Sonnenstäubchen, die er zufällig in seinem verschlossenen Zimmer gefangen hält.
Aber auch in der oberen Lage der Wirbeltiere macht sich eine Unstimmigkeit zwischen Herrscher und Beherrschten geltend, wie denn jedes Besitztum seinen Herrn knechtet; und zwar umso entschiedener, je größeren Wert der Besitz gewinnt und je vornehmere Leistung von ihm erwartet wird.
Der Mensch, der auf dem Gaul reitet, ist nur auf Zeit Herr des Pferdes, zu anderer Zeit sein Diener in aller erdenklichen Form: als sein Pfleger, Hauswart, Kellner, Friseur, begleitender Lakai, sogar als sein dienstwilliger Kuppler.
Und weshalb sollte sich wohl ein verzärteltes Wesen im Zoologischen Garten, sagen wir eine Antilope, als beherrscht erscheinen? Weil sie nicht über den Menschen verfügt, der aber über sie? Welch eine papierne Formel juridischen Inhalts ohne lebendigen Kern!
Tatsächlich hat sich die Antilope gegen den Freizustand in Afrika sehr wesentlich verbessert, ungefähr so wie ein in europäische Zivilisation überführter afrikanischer Wildmensch. Gerade ihre Unfreiheit hat sie vom furchtbaren Fluch der Tierwelt befreit, vom Kampf ums Dasein; allen Gefahren entrückt, aller Sorgen überhoben hat sie Ursache, sich als glückliche Villenbesitzerin zu fühlen, mit einem Tross von Menschen, die sie hegen, hätscheln und bedienen, ohne die geringste Gegenleistung zu verlangen.
Sie ist eingesperrt? Wiederum eine papierne Konstruktion, diesmal geometrischen Zeichens. Denn das Gitter sperrt ebenso wohl ein wie aus, und die Antilope darf ohne Fehlschluss die Umfriedigung als einen Raum betrachten, der ihr die Freiheit verbürgt und die Unbefugten aussperrt.
Freilich weiß jedes Kind, dass der Mensch die Macht und damit das Herrscherrecht besitzt, sich vom Fleisch der Tiere zu ernähren.
Aber diesen Vorzug teilt er mit Existenzen, denen er sonst mit tiefster Verachtung die unterste animalische Stufe anweist; nämlich mit den Parasiten.
Ja, der Parasit kann mit weit stärkerem Grunde als ein Herr angesprochen werden, da er eben nur Machtrecht ausübt, ohne irgendwelche Gegenleistung im Dienstsinne zu gewähren.
Für eine bestimmte Form der Flohkrebse, für die Walfischlaus, ist der Walfisch gleichzeitig Pferd und Rind: Sie reitet auf ihm, und zwar zeitlebens, und sie frisst ihn auf, ebenso unablässig. Sie besitzt alle Gewalt über das Großtier, dieses nicht die geringste über den Reiter und Verzehrer.
Danach wäre es erlaubt, wenn die Skala des Dünkels überhaupt Weltgeltung besäße, die Walfischlaus als den Vorgesetzten des Pottwals zu betrachten; und weiterhin, weil die Laus mit dem Wal wirtschaftet, wie sie will, ohne Gegenrechnung, so müsste man schließen, dass der Flohkrebs auch naturgeschichtlich den höheren Typus darstelle.
Davon aber will der Mensch nichts wissen. Er schleudert diese Laus mit dem Schimpfwort „Schmarotzer!“ in den Abgrund der Verdammnis und wird sich nicht klar darüber, dass er auf dem Körper der Erde und auf der Gesamtheit der essbaren Tiere genau ebenso schmarotzt.
Am übelsten aber schneidet der Mensch mit seiner Machtstellung ab, wenn man seine Beziehung zu den wirklich tiefsten Organismen in Anschlag bringt, zu den kleinsten Lebewesen, die so niedrig stehen, dass sie nicht einmal der Verachtung verfallen.
In trotziger Machtstellung fühlt er sich, das heißt in der Verbindung Mensch plus Schießeisen, gegenüber dem Tiger, dem Eber und dem Sechzehnender; allein vom Mikrob, vom Spaltpilz, von der Bakterie lässt er sich überwältigen; allen hygienischen Maßregeln zum Trotz erdrosseln sie ihn als Krankheitsträger, allen Immunisierungskünsten zum Trotz überrumpeln sie ihn in immer neuen Formen, gegen deren äußerste, die Alterskrankheit, überhaupt kein Kraut und kein Impfstoff gewachsen ist.
Seine Verstäubung von Serum, Karbol und Sublimat wirkt im Großen gesehen so – um ein Wort von Schopenhauer zu gebrauchen –, wie wenn man mit einer Klystierspritze gegen eine Feuersbrunst spritzt.
Er befindet sich auf der ganzen Linie in verzweifelter Defensive, er ist wehrlos, er unterliegt; die Kleinsten sind stärker als er, ihm übergeordnet in der Machtstellung, und das ganze dünkelhafte Fantasiegebäude von einer nach Herrschaft gegliederten Rangordnung bricht hier zusammen. Nicht zu oberst steht er, der Herrscher der Welt, sondern tief unten, unter dem Kokkus!
Hier wird nun eine billige Ausrede ausgespielt: Nicht das Wesen, so sagt man, sondern bloß die unnennbare Überzahl, der brutale Faktor der Menge, verleiht den Mikroben das Übergewicht.
Man hat ausgerechnet, dass im Luftmeer an die Quadrillionen oder Quintillionen dieses abscheulichen Kleinzeugs Platz hätten – dagegen ist natürlich nichts zu machen.
Aber durch diese Ausrede wird die Stellung des Menschen keineswegs verbessert; denn das Wesen der Dinge liegt eben nach der noch immer unerschütterten Lehre des Pythagoras in der Zahl. Und wir brauchen uns nur zu entschließen, die ungeheure Menge der Mikroben als eine Einheit, als das gewaltige „Makrob“ aufzufassen, um zu erkennen, dass dieser makrobische Erdentyrann als der unbedingte Vorgesetzte über den Menschen regiert.
Die Wissenschaft ist ja sonst so schnell bereit, Einzelzellen und Moleküle zu lebenden Gesamtheiten zu addieren; sie hat ja sogar den Mut gefunden, sämtliche deutsche Pappeln als eine Gesamtheit, sämtliche La France-Rosen als einen einzigen Rosenbusch zu definieren; aber am entscheidenden Punkte stockt ihr die Courage, und beim Bazill fürchtet sie sich vor dem entscheidenden Schritt der Schlussfolgerung; weil diese ihr eben klar erweisen würde, dass es mit der Suprematie des Menschen eitel Wind ist, während sie von dem kurzsichtigen Vorurteil der Menschenmacht nicht loskommen kann.
Und noch in einem anderen Betracht bezeichnet uns die Zahl das Wesen der Dinge: Sie ist nämlich der Ausdruck für die körperliche Unsterblichkeit. Eine Kreatur, welche die Fähigkeit besäße, über seine persönliche Begrenztheit hinaus die unbegrenzte Vielheit zu erreichen, müsste uns als unsterblich gelten und hätte nicht nötig, unbewiesene Dogmen in Anspruch zu nehmen, um über den schmählichen Todeszerfall des Individuums hinauszukommen.
Gibt es solche Kreaturen?
Nun, sie sind wirklich vorhanden, und es sind keine Übermenschen, keine Engel, die dieses beneidenswerte Vorrecht entwickeln, sondern belebte Körperchen der allereinfachsten, oder biologisch gesprochen „allerniedersten“ Gestaltung.
Es sind die Moneren, die Amöben, die Protozoen, die uns das himmlische Kunststück vormachen, ihre eigene Unsterblichkeit zu erleben. Ein Wimperinfusor teilt sich vor unsern Augen, doppelt seine Individualität, teilt sich weiter, vervierfacht sich, überspringt jeden Tod, bleibt unberührt von den Zeichen der Altersschwäche und erweist sich schließlich in zahllosen lebenden Exemplaren als ein Wesen jenseits des Lebensgesetzes, dem wir andern uns unterwerfen müssen.
Die Beobachtung des Forschers Woodruff hat mehr als dreitausend Generationen in lückenloser Folge ergeben, aus einem einzigen Ur-Individuum, das ist die Unendlichkeit, die bewiesene Unsterblichkeit in diesseitiger Existenz.
Wo bleibt da der Mensch mit seinen verzweifelten Versuchen, aus den Todesschrecken der Gegenwart hinaus irgendwo ins Transzendente hinein Anker zu werfen? Kann er sich noch immer an das Bewusstsein des höheren, des höchsten Typus klammern, wo der sogenannt Niedrigste ihm den Widersinn dieser Rangstellung so nachdrücklich vor Augen führt?
Das wäre nun ein sauberer Trost, sich zu sagen: Diese Monere ist doch ein ganz oder nahezu strukturloses Gallertklümpchen, ohne Sinn und Gefühl, ich aber, der Mensch, besitze die differenzierten Sinnesorgane und mit ihnen die Vernunft, den Verstand, die Erkenntnis, das entwickelte Gehirn!
Mit diesem Argument rettet sich der Mensch aus jeder Klemme. Das Gehirn ist und bleibt das große Trumpfs-Ass, mit dem er all die kleinen, nach Stärke, Lebenstüchtigkeit und Zahlgewalt bezeichneten Karten sticht.