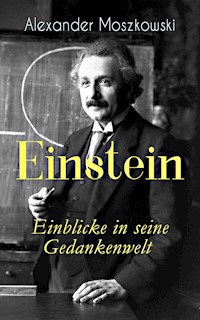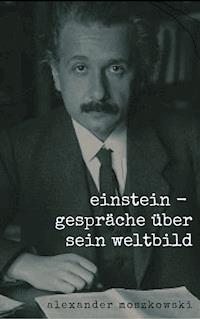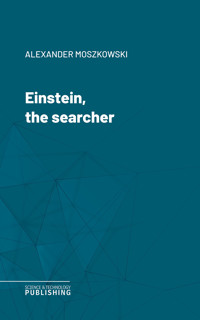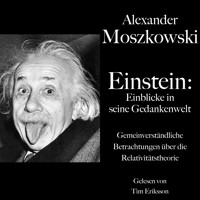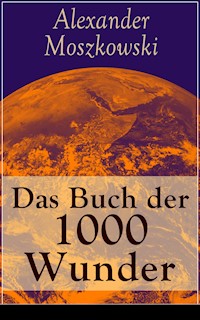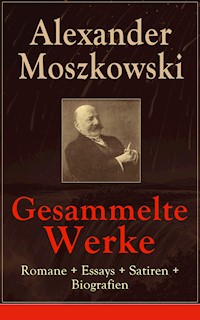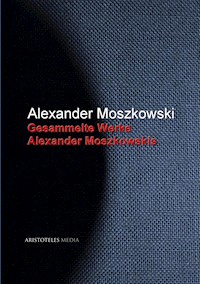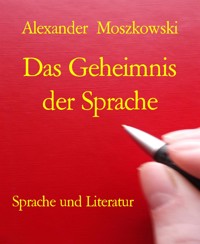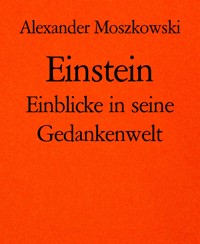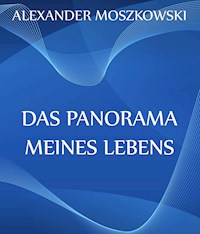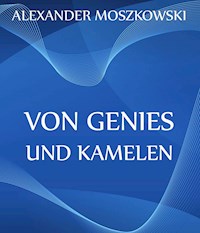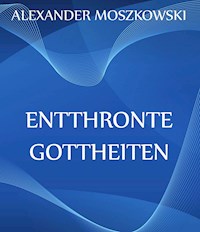Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neben dem Schreiben und dem Sammeln von Witzen gehörte der Inhalt dieses Buches zu Moszkowskis Hauptbeschäftigungen: Ernste und heitere Paradoxe. Alexander Moszkowski war ein deutscher Schriftsteller und Satiriker polnischer Herkunft. Er ist der Bruder des Komponisten und Pianisten Moritz Moszkowski.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Venuspark
Phantasien über Liebe und Philosophie
Alexander Moszkowski
Inhalt:
Alexander Moszkowski – Biografie und Bibliografie
Der Venuspark
Die Verlockung
Der Lebenskünstler
Lichter und Schatten
Das Tempelwunder
Auferstehung
Entdeckung
Sinnliches und Übersinnliches
Orgien im Geiste
An der Quelle der Weisheit
Die Romane der Herrin
I. Die Liebe in Marmor
II. Die Liebe in Lumpen
Verschwimmende Epochen
Das erste Symposion
Der Weg zum Ruhm
Erotische Seitensprünge
Das zweite Symposion
Ausklang
Das verlorene Paradies
Der Venuspark, A. Moszkowski
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849632205
www.jazzybee-verlag.de
Alexander Moszkowski – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller und Satiriker polnisch-jüdischer Abstammung. Geboren am 15. Januar 1851 in Pilica, verstorben am 26. September 1934 in Berlin. Bruder des Komponisten und Pianisten Moritz Moszkowski. Aufgewachsen in Breslau und später Umzug nach Berlin, wo er für die Satirezeitung "Berliner Wespen" arbeitete. Nach Differenzen mit dem Verleger gründete er seine eigene Zeitschrift „Lustige Blätter“, die sehr erfolgreich war. Seine Freundschaft mit Albert Einstein gipfelte darin, dass er als einer der ersten die Relativitätstheorie einem breiten Publikum populärwissenschaftlich zugänglich machte.
Wichtige Werke:
· Das Geheimnis der Sprache (Essays)
· Das Panorama meines Lebens (Autobiographie)
· Der Venuspark
· Die Ehe im Rückfall und andere Anzüglichkeiten (Satiren)
· Von Genies und Kamelen (Satiren)
· Die Inseln der Weisheit (Utopischer Roman)
· Einstein - Einblicke in seine Gedankenwelt
· Entthronte Gottheiten
· Unglaublichkeiten (Satiren)
Der Venuspark
Die Verlockung
Es ist mir nicht unbekannt, daß jede romanhafte Erzählung eine gewisse Bestimmung nach Ort und Zeit voraussetzt. Man will doch vor allem erfahren: wo und wann? Selbstverständliche Fragen, die der Erzähler, sofern er Tatsachen berichtet, mit auskömmlichen Antworten zu bedienen hat. Aber hier sitze ich schon bei der ersten Zeile in einem Ausnahmefall. Denn ich bin wirklich nicht in der Lage, bis auf Stunde und Tag genau anzugeben, wann diese Geschichte beginnt. Sie wird im Verlaufe ziemlich weit in die Vergangenheit schweifen, und hierzu wäre es wohl erforderlich, daß ich erst einmal den Gegenwartspunkt präzisierte, ein Jetzt, ein Heute. Und da möchte ich von vornherein um die Erlaubnis bitten, dieses Heute um ein paar Jahre über das eben giltige Kalenderdatum hinausschieben zu dürfen. Ich werde also in der Neuzeit anfangen und verstehe darunter eine zwar noch nicht erlebte, aber sehr nahe Zukunft; demzufolge in einer Umwelt, die sich von der allgemein bekannten nur in wenigen Einzelheiten unterscheidet.
Es wird hier streckenweis ganz real zugehen wie in einem Erlebnis, das mich selbst betroffen hat. Beinahe hätte ich gesagt: betroffen haben könnte. Aber das wäre eine Ausflucht gewesen, eine matte Verklausulierung des Gewissens. Wahr und wahrhaftig ist alles, was einem von der eigenen Anschauung als wahr und lebendig vorgehalten wird. Und in dieser Hinsicht brauche ich mir von der Realität der Geschehnisse nichts abhandeln zu lassen, auch wenn ein erhebliches Maß von Phantasie hineinspielt; zumal ich gar nicht mehr imstande wäre, die beiden Elemente nach irgend einem psycho-chemischen Verfahren zu trennen und auseinanderzuhalten. Wie sie sich aber durchdringen, verflechten und zu einer besonderen Tatsacheneinheit verschmelzen, das kann sich erst am Gang der Erzählung erweisen. Denn sie gehört, als Exemplar des Schrifttums genommen, zu denjenigen Büchern, bei denen der Anfang das Ende fast ebenso voraussetzt, wie das Ende den Anfang. Nur das eine möchte ich schon im ersten Ansatz versprechen: daß sich aus den bunten Handlungsteilen neue Erkenntnisse ergeben werden, vielleicht sogar die Anfänge einer neuen Lehre, die mit der Laterne der Wissenschaft in die Gefühlsgründe der Liebe hineinleuchtet.
*
Ich befand mich eines Tages in einer Kunstausstellung Unter den Linden, in einer jener vielzuvielen Schaustellungen, die der Berliner Kulturmensch besucht, weniger um sie zu sehen, als um sie gesehen zu haben; bisweilen auch, um gesehen zu werden; was sich aber hier nicht sonderlich verlohnte, da sich nur eine geringe Zahl von Schaulustigen eingefunden hatte. Im Publikum war nämlich die Kunde verbreitet, daß auf diesen Leinwandflächen so gut wie gar keine aufsehenerregenden Tollheiten zu sehen wären, daß man sonach nicht auf die Kosten käme, da man ja in anderen Ausstellungen wahre Orgien exzentrischer Neukunst genießen könnte. Tatsächlich, hier war ein akademischer Anstrich unverkennbar, zumal in den Bildern eines lebenden Meisters, der seine Motive aus dem antiken Leben geschöpft hatte. Das waren, soweit ich meinem Urteil trauen darf, recht gediegene Werte, so etwa im Stile des Alma Tadema, den man ja vor einem halben Jahrhundert bewundern durfte, ohne noch in den Verdacht der Trottelei zu verfallen. Und vor einem dieser Gemälde, »Horaz als Deklamator an der Tafel des Maecenas«, hatte ich Posto gefaßt, ohne im mindesten von einem anderen Individuum Notiz zu nehmen, das sich neben mich zur Betrachtung desselben Bildwerks hinpflanzte.
Lose Bruchstücke aus Horazischen Oden surrten mir durch den Kopf, und es war wohl ein assoziativer Vorgang, daß sich ein paar Verssplitter auf meine murmelnden Lippen verirrten: »Macenas atavis edite regibus ...«; der andere lieferte die Fortsetzung indem er mit deutlicher Betonung ergänzte: »o et praesidium et dulce decus meum«. Der Träger der zweiten Stimme in diesem Duett war ein länglicher, ergrauter Herr, um den ein stark verjährter Havelock schlotterte. Für mich war der Nachbar ein Unbekannter, ohne Befugnis in mein monologisches Geflüster einzugreifen, während er selbst, wie sich sogleich herausstellte, das Zitat nur als einen Vorwand benutzte, um eine alte Bekanntschaft aufzuwärmen. Er sprach mich mit meinem richtigen Namen an, nannte den seinen: Xaver Gregory, und schien sehr verwundert, als ich auf seine duzende Anrede nicht augenblicklich mit der nämlichen Vertraulichkeit einsprang. Allein nach wenigen Sekunden dämmerte mir der Sachverhalt: der da und ich hatten in längstverschollenen, glücklichen Zeiten ein paar Wochen wirklich zueinander gehört. Wie hob sich das auf einmal aus dem Dunkel der Vergessenheit! Eine Ferienspritze frohgelaunter Jungburschen von Anno Olim!
Jetzt war mir der Sprung über die Jahrzehnte eine Kleinigkeit. Gleich kristallischen Strahlen schossen die Begebenheiten aus dem Unterbewußtsein ins Helle. Wo hatte das doch angefangen? Richtig, auf dem Bahnhof Appenweier. Dort war der aus der badischen Provinz stammende Studio Xaver Gregory zu mir in den Bummelzug gestiegen, und nach fünfzehn Kilometern hatten wir uns, kurz zuvor noch wildfremd, zu wackerer Strapazentour aneinandergeschlossen. Mit knappem Geld und enormer Unternehmungslust wollten wir das Schweizer Erdreich unter unseren Sohlen zerstampfen.
Im Kontrast eroberten wir uns die Sensationen. Auf den Pilatus stürmten wir zuerst, ich mit einem Kopfschmerz zum Schädelsprengen, mein Kumpan mit einer frischen Halsentzündung. Aber dieser Begleiterscheinungen achteten wir kaum in dem prasselnden Regen, mit dem uns die Urkantone begrüßten. Wir waren ausdauernder als die pathologischen und atmosphärischen Tücken. Nur weiter hinauf, aus dem Guß mitten hinein in den dicksten Nebel, direkt zum Wolkenthron des Jupiter Pluvius. Die Luft schien sich in eine Mischung von Molke, Dunst und Watte verwandelt zu haben und legte sich schwer und feierlich auf die Atmungsorgane. Da plötzlich, nahe am Tomlishorn, zerriß der Wolkenflor, ein geisterhafter Lichtbalken legte sich, von der verhüllten Sonne ausgehend, quer über die Vorberge; wie die Strahlen eines Scheinwerfers sich fortbewegen, so rückte der Lichtbalken weiter hinaus, bis er in äußerster Ferne die Spitzen der Berner Alpen ergriffen hatte. Finsteraarhorn, Schreckhorn und Jungfrau kamen mit verschwimmenden Umrissen zum Vorschein, wie Wölkchen unter Wolken, das ersehnte, traumhaft vorausgefühlte Panorama wurde lichtübergossene Wirklichkeit.
In den Armen lagen sich beide und weinten für Schmerzen und Freude. Es war uns zumute, als hätten wir selbst durch die Fernwirkung des heißen Wunsches in die starre Nebelmauer Bresche geschlagen, wir spürten das ganze Lustgefühl des Bezwingers und Eroberers. Dann begaben wir uns in eine Mansarde der Pilatuswirtschaft, machten Umschläge, ich um den Schädel, er um die Gurgel, und von Zeit zu Zeit fanden sich unsere Hände zu kräftigem Glückwunsch.
Vor soviel Jahrzehnten! Und jetzt stand derselbe Kumpan neben mir, ergraut und verkümmert. Die Chronik der Erinnerung beglaubigte ihn als meinen Freund, aber das lebendige Gefühl wußte nichts davon. Man nimmt keine Anhänglichkeit mit über so breite Zeitklüfte. Ich sprach »Du« zu ihm aus Höflichkeit, nicht aus Überzeugung, wie in einem atavistischen Rückfall, der überwunden werden mußte. Und dann erkundigte ich mich, ohne sonderliches Interesse, nach seinen Lebensschicksalen seit jener verklungenen alpinen Offenbarung.
Unser gemeinsamer Jugendrausch hatte wirklich die alte Schweizertour nicht überdauert. Unmittelbar darauf waren die Fäden gerissen, und jetzt erfuhr ich, daß der Studio von damals eigentlich zu den gestrandeten Existenzen gehörte. Er hatte sich durchs philologische Studium bis zur Habilitation durchgeackert und war schließlich auf der Göttinger Universität als Privatdozent untergekrochen. Einer von vielen Tantalussen, die den fruchtschweren Zweig der Professur zu Häupten erklicken, ohne ihn je ergreifen zu können.
»Worüber haben Sie denn – – – worüber hast du denn gelesen, Gregory?«
– Über altklassische Literatur. Exegesen zu Herodot, Thukydides, Plutarch usw. Ich war nämlich auf diesen Gebieten recht gut beschlagen, aber die Hörer wollten auf meine Vorträge nicht recht anbeißen. Ich dozierte vielleicht nicht blühend genug, ein bißchen zu schulmeisterlich, man verlangte damals vom Dozenten eine gewisse Eleganz, die mir versagt blieb, weil ich aufs Gründliche ging. Und da lichtete sich die Schar. Drei Zuhörer im Lehrsaal – tres faciunt colloquium –, ich las weiter, semesterlang, bis zu zweien, bis zu einem. Und dieser eine war eine Frau – meine eigene!
»Ach, Sie sind verheiratet?«
– Ich war's. Meine Frau hat das Hungermartyrium mit mir geteilt, bis sie verwelkte und dahinstarb. Sie war die letzte, die einzige Person, die in meinen Kollegien aushielt. Dann empfahl mir die Fakultät, auf die Fortsetzung meiner Lehrtätigkeit zu verzichten. Das waren zwei Leichenbegängnisse kurz nacheinander. Ich begrub meine akademischen Hoffnungen und stand vor dem Vakuum. Ich schrieb ab und zu gelehrte Abhandlungen, aber die hielten mich nicht über Wasser. Viele Jahre vegetierte ich als Korrektor in Druckereien. Aber endlich passierte mir ein Glücksfall: ich wurde Privatsekretär beim Professor Borretius ...
»Und das genügte Ihnen?«
– Es genügt mir noch heute. Ich fühle mich ganz glücklich in dieser Stelle; sie ist materiell recht auskömmlich, und was die Hauptsache, sie läßt mir reichlich Zeit zu eigenen fruchtbaren Arbeiten. Das ist nämlich der Kernpunkt: meine neueren Studien bewegen sich in derselben Richtung wie die Untersuchungen meines Chefs, der, wie dir vielleicht bekannt, als eine Leuchte der Altertumsforschung gilt; und da mein Professor über höchst bedeutende Mittel verfügt...
»Hört, hört!« schaltete ich ein. »Ein Archäologe mit Glücksgütern – das ist eine Seltenheit!«
– Kannst ruhig sagen: ein Unikum. Mein Professor ist wirklich in der Lage, ganz aus dem Vollen zu wirtschaften, er betreibt das Wissenschaftliche mit der Freigebigkeit eines Mäcenas – der Vergleich liegt ja nahe, wir befinden uns ja gerade vor dem Bilde des Mäcen –, aber ganz stimmt es doch nicht, denn der Professor ist nur das sichtbare Organ eines verschleierten Medizeers, der hinter ihm steht...
»Bitte, etwas deutlicher. Was treibt eigentlich Ihr Arbeitgeber, und wie hängt ein hiesiger Professor mit einem Mäcenas oder Mediceer zusammen?«
– Das war doch nur bildlich gesprochen. Mein Professor ist der nämliche, der seit Monaten die großen Ausgrabungen auf Zypern leitet, und die enormen Geldmittel hierfür werden von einem dort ansässigen Krösus bereitgestellt.
»So, so, Zypern! Davon hat man ja neuerdings allerlei gehört.«
– Aber noch lange nicht genug. Es ist der leise Anfang, und erst in den nächsten Jahren wird die volle Resonanz für die staunende Welt durchdringen. Und nun stelle dir vor: ich als Sekretär und Adlatus des großen Archäologen sitze sozusagen an der Quelle der antiken Wunder, die dort aufsteigen! Eines ist mir ganz sicher: die berühmten Ausgrabungen von Pergamon, Mykenä, Theben sind ein Kinderspiel dagegen. Die wahre klassische Heilsbotschaft wird uns von Zypern kommen!
»Und Sie, Gregory, wollen daran mitgewirkt haben?«
– In gewissem Anteil allerdings, das darf ich ohne Ruhmredigkeit bekennen. Der Löwenanteil des Verdienstes gebührt natürlich meinem Professor, der mit unglaublichem Scharfsinn die hauptsächlichsten Fundstätten herausgewittert und bezeichnet hat. Allein da ist auch sehr viel Kleinarbeit zu verrichten, in Mutmaßungen, die sich auf antike Texte stützen, in Entzifferung der Inschriften, und darin habe ich allerhand geleistet. Ja, das darf ich wohl sagen, ich besitze ein Stöbertalent wie wenige. Weißt du, ich möchte den Professor mit einem Fernrohr vergleichen, und mich mit einem Mikroskop. Er hat das Durchdringende in die Weite, und ich das Aufhellende in der Nähe. Vorläufig war ich ja, abgesehen von den Textstudien in alten defekten Klassikern, die ich durch Kombinatorik ergänzt habe, auf Reproduktionen angewiesen, auf Abzeichnungen und photographische Proben freigelegter Steinschriften, aber nächstens komme ich an Ort und Stelle. Der Professor steht vor einer neuen Reise nach Zypern – zum fünften Male fährt er dorthin – und da nimmt er mich mit. Was sagst du dazu!
Diese Mitteilungen trafen in mir einen Seelennerv, der lebhaft zu schwingen begann. Es durchzog mich so etwas wie das Präludium zu einer Fuge, von der ich nur die Tonart, nicht aber die Klangstruktur zu ahnen vermochte. Zypern! Ein abseitiges, märchenhaftes Gebilde, in mythologischer Verträumtheit, verschwommen überhaucht vom abgeblaßten Goldglanz aphrodisischer Freuden! Aber das gehörte ja gänzlich einer unvordenklichen Vergangenheit an, in die man nur gelegentlich hinabsteigt, mit einem gedruckten Klassiker vor den Augen, wenn man einmal auf Stunden loskommen will von seiner eigenen fatalen Neuzeitlichkeit. Gab es wirklich außerhalb dieses Phantasielands noch ein gegenständliches, geographisches Gelände dieses Namens? Eine dem Reisenden von heute erreichbare Insel Zypern? Schwer vorstellbar. Die räumliche Entfernung ließ sich ja überbrücken, und wer dort archäologisch zu tun hat, der fährt eben hin; fährt in ein Land verwitterter Ruinen; läßt schaufeln und graben, stößt auf Mauerfragment und Säulenstumpf. Oder doch vielleicht auf mehr als traurige Reste; am Ende gar auf eindrucksvolle Monumente, die den ideellen Zusammenhang wiederherstellen ...
»Sage, Xaver, was ist eigentlich der Hauptzweck dieser Unternehmungen? Aber sprich ohne den Überschwang eines Forschers, der mit gieriger Hand nach Schätzen gräbt und froh ist, wenn er Regenwürmer findet. Und erzähle mir nichts von Museumsgerümpel, sondern von wirklichen Bauwerken.
– Es handelt sich in der Hauptsache um einen Tempel.
»Also natürlich um einen Venus-Tempel. Das wäre ja ein ganz lohnendes Objekt. Und wie weit seid ihr mit der Ausgrabung?«
– Weit genug, um mich und den Professor in der Taxe auseinanderzubringen. Er ist nämlich tief davon durchdrungen, daß dieses Heiligtum wirklich der Venus gehörte, während ich eine ganz andere Ansicht vertrete. Ich behaupte und glaube es beweisen zu können: es ist ein Minerva-Tempel.
»Das müßte sich doch durch den Augenschein feststellen lassen?«
– So denkt der Laie, der sich da eine fertige Sache vorstellt, eine völlige Wiederherstellung der alten Baugestalt. Aber die Grabungen sind doch kaum aus dem Rohesten heraus, und der Augenschein entscheidet da garnichts. Hier hat die Deutung mitzusprechen, und die verliert sich in so viele archäologische Knifflichkeiten, daß man dem Nichtfachmann gar keinen Begriff davon geben kann. Ich freue mich aber schon auf den Moment, wo Professor Borretius selber ...
»Halt mal einen Augenblick! Ich unterbrach mit Wort und Handbewegung, indem ich aus meiner Rocktasche einen Brief hervorzog, einen unter mehreren, die ich kurz vor meinem Ausgang erhalten hatte. Ich entfaltete das Schreiben, das in eine ziemlich unleserliche Unterschrift auslief, und zeigte es dem andern: »Du bist doch so stark im Entziffern, ist das am Ende dein Chef?«
– Wie seltsam! Eben reden wir lang und breit von ihm, und du weißt nicht einmal, daß er dir geschrieben hat. Darf man lesen?
Der Inhalt war nicht sonderlich aufregend. Nur eine kurze Notiz darüber, daß er sich gern mit mir über eine wissenschaftlich-künstlerische Angelegenheit unterhalten möchte, und die Bitte, ihm in diesen Nachmittagen eine Zusammenkunft zu bestimmen, bei ihm oder bei mir. Jetzt, da der Absender festgestellt war, kam mir auch die Unterschrift »Prof. Borretius« ausreichend leserlich vor.
– Was mag er bloß von dir wollen? meinte Gregory mit divinatorischen Fragefalten auf der Stirn. Bist du nicht neugierig?
»Ganz und gar nicht. Ich bekomme viel derartige Briefe, auch von Gelehrten, und weiß aus Erfahrung, daß bei solchen Unterredungen in der Regel nicht viel herauskommt. Hier nun vollends möchte ich sogar einen sachlichen Irrtum des Absenders vermuten. Wahrscheinlich setzt er bei mir irgendwelche Spezialkenntnisse auf seinem eigenen Gebiete voraus, und die Konversation darüber kann nichts anderes bringen, als eine Enttäuschung für ihn, und eine verlorene Stunde für mich.
– Aber ein paar Minuten könntest du schon opfern. Wir befinden uns nur hundert Schritt von seiner Wohnung in der Schadowstraße, und wenn wir ihn jetzt besuchen, wissen wir doch sofort, woran wir sind.
Die Redewendung mit dem pluralisierenden »Wir« erschien mir als eine unzulässige Verallgemeinerung. Schließlich ging ihn doch meine Korrespondenz nichts an. Aber ich glitt darüber hinweg, entschloß mich zu dem kurzen Abstecher und wehrte seine Begleitung nicht ab. Nach wenigen Minuten waren wir beim Professor Borretius.
Ein Sanktuarium, wie man sich wohl die ehemaligen Arbeitsstätten eines Niebuhr oder Mommsen vorstellt. Von jenem mystischen Bücherduft durchwittert, der an die Studierräume reichdotierter Mönchsklöster gemahnt. Ein Monte-Cassino in vornehmster altberliner Gegend, freilich mit heidnischen Elementen durchsetzt, mit Trümmerstücken hellenischer Skulpturen, die wohl hier nur interimistisch aufgestellt waren, um später in ein Museum hinüberzuwandern. Die Feierlichkeit des Ortes wurde bald verweltlicht durch den Professor selbst, der zwar recht imponierend aussah – er erinnerte als Charakterkopf an Ernst Haeckel –, der es aber keineswegs darauf anlegte, den profunden Entdecker herauszubeißen. Kurzum, die Unterhaltung gestaltete sich bei einer guten Zigarre ganz gemütlich, zumal in ihren Anfängen, während späterhin allerdings aus dem erfreulichen Inhalt seiner Mitteilungen gewisse Bedenklichkeiten für mich aufstiegen.
Tatsächlich handelte es sich um Zypern, und ich erfuhr, daß Borretius vorhatte, mich zu einem längeren Aufenthalt auf dieser Insel zu veranlassen. Wie dies zusammenhing, und warum gerade ich in sein Projekt hineingeriet, das kann nur auf Umwegen erklärt werden.
Ich gehe gewiß in der Annahme nicht fehl, daß die Mehrzahl der Leser von der Neugestaltung der Insel nicht viel mehr weiß, als mir selbst vor den Erläuterungen des Professors bekannt war. Denn wir befinden uns, wie schon betont, nicht genau im Gegenwartspunkt, sondern um eine gewisse Zeitspanne vorgerückt. Was man allenfalls in den geographischen Handbüchern findet, ist in einigen Punkten überholt. Abgesehen von der auf türkischen Rückständen errichteten englischen Suprematie hat sich die Insel durch politische und gesellschaftliche Einflüsse erheblich internationalisiert; und diese Veränderung kommt besonders in Neu-Limisso zum Ausdruck, einer modernen Kolonie, die sich an der Südküste, von der alten Hafenstadt Limisso ausstrahlend, in rapidem Tempo entwickelt. Es bleibe ununtersucht, wieso sich an diesem Punkte eine Art von autonomem Gemeinwesen entfaltete. Genug, daß sich günstige Bedingungen zusammenfanden, um dem landschaftlich und klimatisch bevorzugten Ort zu einer raschen Blüte zu verhelfen. Man hatte hier eine neue, orientalische Riviera entdeckt, und aus der ursprünglich bescheidenen Siedelung war eine Ortschaft entstanden, die es an Reizen beinahe mit Nizza aufnehmen konnte.
Die von Borretius geleiteten Ausgrabungen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Kolonie, die den Fortschritt dieser Forscherarbeit mit größter Teilnahme verfolgt. Unbeschadet ihres ganz modernen Kulturbewußtseins pflegen die Bewohner die geistigen Zusammenhänge mit der klassischen Altwelt, die mit so vielen eindrucksvollen Ruinen in ihre Gegenwart hineinragt. Wie denn überhaupt die geistigen Strebungen hier kaum eine geringere Rolle spielen, als die aus Bedürfnis nach weltlichem Genuß erfließenden. Hier versagt die Parallele mit Nizza; man könnte vielmehr feststellen, daß Neu-Limisso, das auch Neu-Amathus genannt wird, Anstalten trifft, um Perikleische Spuren aufzunehmen und sich einem athenischen Vorbild zu nähern. Es sind Ansätze zu einer Akademie vorhanden, deren Begründung auf die Initiative eines reichen Stadtbürgers zurückgeht. Kyprides, aus griechischem Geschlecht, ist heute eigentlich der ungekrönte König der Landschaft. Neben ihm amtiert zwar noch das Stadtparlament von Limisso, über ihm schwebt, ungesehen, ein britischer Resident; allein sein Krösusreichtum und seine Freigebigkeit gibt fast durchweg den Ausschlag, und in der Hauptsache geht es nach seinen Wünschen und Neigungen, von deren Ersprießlichkeit die ganze Kolonie Kunde gibt.
Bei seinem letzten Aufenthalt auf Zypern hatte der Professor von seinem intimen Gönner Kyprides den Auftrag entgegengenommen, für die aufkeimende Akademie einige neue Kräfte zu gewinnen; nicht sowohl Männer von professoralem Zuschnitt, als vielmehr Außenseiter von eigenwilligem Denktypus. Und hier ergab sich das Absonderliche, daß Borretius, der einige meiner Bücher kannte, auf den Einfall geraten war, ich könnte neben anderen, die er mir namhaft machte, für den erwähnten Zweck in Betracht kommen.
»Herr Professor,« sagte ich, »Ihr Vertrauen berührt mich selbstverständlich sehr sympathisch, allein ich weiß wirklich nicht, wie ich es verdient habe. Ich bin in meinen bescheidenen Hervorbringungen gänzlich von Papier und Tinte abhängig, ich arbeite nur in Klausur, und wenn ich vielleicht einiges aufzuschreiben vermag, was nicht auf begangener Heerstraße gefunden wird, so liegt mir doch die Tätigkeit des Dozierens recht fern; um so ferner, als ich aller Systematik abgewandt bin und in meinen Promenaden auf Grenzgebieten zwischen Wissenschaft und Schöngeisterei höchstens anregende Stoffe gefunden habe, dagegen nichts, was sich für einen zusammenhängenden Kursus eignen könnte.« – Solche Kurse nach üblichem Schulschema wollen wir ja auch gar nicht einrichten. Uns schweben vielmehr dialogische Übungen vor, Extemporalien zur Erweiterung der Horizonte, und was Sie »auf Grenzgebieten« nennen, ist gerade das, worauf es uns ankommt. Mit Fachmagistern sind wir versehen, und es wäre uns ein Leichtes, noch viele andere aus aller Welt nach Limisso-Amathus zu locken.
»Das läßt sich denken, da das Geld für Honorare dort allem Anschein nach in Mengen bereit liegt. Ich kombiniere dies aus Ihren eigenen Mitteilungen und aus Andeutungen, die mir Gregory vor einer Stunde gemacht hat, als wir unsere alte Bekanntschaft auffrischten. Übrigens, da wäre doch eine vortreffliche Gelegenheit, um Herrn Gregory selbst auf einem Lehrstuhl in Zypern festzumachen?«
Der vormalige Privatdozent wehrte ab; er würde so etwas gar nicht annehmen ...
– Er hat leicht verzichten, lachte der Professor, da er sehr gut weiß, daß ich ihn gar nicht freigebe. Er ist mir als Sekretär und Gehilfe in der Bibliothek und auf den Trümmerstätten weit wertvoller als in der Akademie. Aber Sie, wie gesagt, sollten hier zugreifen, und ich möchte den Angelhaken, den ich Ihnen auswerfe, gleich mit einem recht reizvollen Köder bespicken. Nämlich so: Nehmen Sie sich Zeit zur Überlegung und absolvieren Sie die Bedenkzeit auf der Insel selbst. Ich garantiere Ihnen freie Reise, freien Aufenthalt mit allem Komfort, und garantiere Ihnen vor allem herrliche Eindrücke. Das ursprünglich auf Athen, später auf Neapel gemünzte Sprichwort muß heutzutage zyprisch umgeprägt werden. Niemand darf sagen, er habe gelebt, ohne Zypern gesehen zu haben. Betrachten Sie also die Sache als eine höchst lohnende Ferienfahrt, und wenn Sie sich nach zwei Monaten mit Nein entscheiden, gut, dann soll keinerlei Verpflichtung für Sie bestehen. Erklären Sie sich nach zwei Monaten mit Ja, dann verabreden wir die weiteren Bedingungen, und es unterliegt mir keinem Zweifel, daß Sie sich als Dialogführer auf unserer Akademie ganz behaglich fühlen werden.
Hätte ich ahnen können, welche Dialoge mir auf dem zytherischen Eiland bevorstanden!!
Vorerst gelangten wir noch zu keinem Resultat, nicht einmal zu einem provisorischen. Alles blieb in der Schwebe, und ich bemühte mich, den Blick von dem verlockenden Köder abzuwenden. Ich verabschiedete mich bald mit höflichem Dank für eine mir verheißene Sensation, die sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht realisieren würde. Der Professor antwortete mit einem logischen Quersprung: Also dann auf Wiedersehen in Zypern!
Gregory begleitete mich bis an mein Haustor. Er schritt eine Weile stumm dahin, blieb plötzlich stehen und sagte: Du wirst sehen, ich behalte Recht! Es ist ein Minerva-Tempel!
»Das wird sich ja herausstellen,« entgegnete ich. »Nur irrst du dich in der Voraussetzung: ich werde es nicht sehen. Man entschließt sich nicht ohne zwingendes Motiv zu einer so großen und umständlichen Reise, und ich bin nicht in der Lage, meine hiesigen Arbeitsverpflichtungen durch improvisierte Ferien entzweizuschneiden. Ich hätte auch das Gefühl der Bedrückung, wenn ich mich zu einer immerhin kostspieligen Tour einladen ließe mit dem Vorgedanken: meine Gegenleistung wird ausbleiben.«
– Lieber Alex, meinte der andere, wer so ausführlich verneint, behält sich die Bejahung vor. Ich habe dich vorhin beobachtet, du sahst nicht aus wie einer, der glattweg ablehnt. Überschlafe dir die Sache ein paarmal, dann werden wir ja weitersehen.
Er pluralisierte schon wieder. Und um so eigenwilliger nahm ich mir vor, noch am selben Abend dem Professor einen bis ins Einzelne begründeten Verzichtbrief zu schreiben.
Ich verschob dies aber zu Hause auf morgen, auf übermorgen, und am dritten Vormittag meldete sich bei mir Gregory, sozusagen mit gezücktem Dolch. Unbildlich gesprochen: er kam als Borretius Beauftragter und schwenkte vor mir einige Objekte, die das Verlockungsmotiv im fortissimo wiederholten: erstens einen Fahrschein, gültig ab Berlin über Brenner, Florenz, Rom nach Brindisi; zweitens Anweisung auf eine Spezialkammer des Prachtschiffes »Velox«, das den Dienst zwischen Brindisi und Zypern vermittelt; dazu einen sehr respektablen Check, also eine Dreiheit von Elementen, die jene mündlich hingeworfene Garantie schon sehr real verkörperten. Und diese Vereinigung wurde mir mit der bündigen Formel vorgehalten: »Entweder – Oder«.
Ich stand vor einem Ultimatum mit einer Befristung von fünf Minuten.
Und im Augenblick war es mir, als würde eine Menge von Gefühlswiderständen in meinem Inneren zersprengt. Nach mechanischen Grundsätzen wirkt ein Stoß unendlich mal stärker als jeder Druck, und hier stand ich unter der Wirkung eines motivischen Stoßes. Ja, ich spürte sogar, daß alle meine Bedenken und Verneinungen von vorher nur Masken waren, hinter die sich der eigentliche Wunsch verkrochen hatte. Ich vernahm einen Schicksalsruf, aus dem noch ganz anderes tönte als Reise, Losbindung vom Beruf und Sehenswürdigkeit; einen Fernruf wie aus einer anderen Welt, die tief unter der Oberfläche der Zeitlichkeit schwebend mir unwiderstehliche Antennen entgegenstreckte.
»Wann fährt dieser Dampfer Velox?« fragte ich den Xaver.
– Am dreißigsten März in aller Frühe. Du bist für die Bahnfahrt nicht an einen bestimmten Tag gebunden. Wir haben heut Montag; wenn du, sagen wir am Mittwoch die Fahrt beginnst, so kannst du in Florenz und Rom zusammengenommen eine Woche lang unterbrechen; sehr wenig an sich, sehr reichlich zum Genuß des Wiedersehens für einen, der wie du die Städte kennt.
»Und ihr beiden?«
– Wir bleiben noch einige Tage länger in Berlin; aber am dreißigsten, wie gesagt, gedenken wir von Brindisi loszusteuern.
»Bestelle deinem Auftraggeber meinen Gruß. Ich werde pünktlich zur Stelle sein. Er hat mich gefangen!«
Der Lebenskünstler
Mit Aufbietung aller Maschinenkräfte hätte das Schiff die Strecke von Brindisi nach Zypern in etwa fünfzig Stunden bewältigen können. Allein zu den besonderen Vorzügen der »Velox« gehörte es, daß sie auf ihren Namen nicht pochte, sich vielmehr Zeit ließ und dadurch ihren Gästen den Genuß einer ausgiebigen Mittelmeerfahrt verschaffte. Es wurden zudem etliche Jonische Häfen angelaufen, eine weitere Rast war in Kanea auf Kreta zu absolvieren, und zum Überfluß ergab sich noch ein kleiner Maschinendefekt auf freier See, dessen Reparatur einen Tag beanspruchte; so daß wir alles in allem eine volle Woche die Herrlichkeiten des Hindämmerns im Farbenspiel zwischen Himmel und Wasser auskosten durften. Es fehlte aber auch nicht an gesellschaftlichen Veranstaltungen, die das internationale Publikum des Dampfers sehr wohl zu schätzen wußte. Hier gab es Typen aus aller Herren Länder, die alle dem nämlichen Ziel zustrebten, und es war ersichtlich, daß dieses zyprische Ziel auf die Westvölker einen weit stärkeren Magnetismus ausstrahlte, als ich vordem vermutet hatte. Der Neustaat Limisso, und was damit zusammenhing, war eben in den amüsierbedürftigen Schichten Europas modern geworden und stand im Begriff, den vormaligen Allerweltszielen Madera, Sizilien, Algier und Ägypten den Rang abzulaufen. Und gerade weil diese Leute fast sämtlich genau wußten, was sie wollten, indem sie der selbstverständlichen Linie der Mode folgten, mußte ich mich oft zweifelnd fragen, welches Fatum mich eigentlich aus meiner heimischen Klausur in diesen mondänen Trupp hineingerissen hatte. War nicht am Ende meine eigene Absicht improvisierter, abseitiger, exzentrischer als die Pläne dieser Menschen, die einfach dorthin fuhren, weil die Saison das verlangte?
Meine zwei Bekannten wurden in den ersten Tagen nur selten sichtbar. Sie hausten zumeist in einem geräumigen Verschlage zwischen mächtigen Stapeln von Büchern und Skripturen, die gesichtet und katalogisiert werden sollten, bevor sie der neuen Akademie der Insel zugeführt wurden. Auch in dieser Hinsicht hatte der Krösus Kyprides größte Munifizenz geübt, und es war dem Professor gelungen, im ersten Anlauf eine große Anzahl wertvoller Werke, darunter Unika, zusammenzubringen. Hier hatte Xaver Gregory eine besondere Gelegenheit, sich in Schätze hineinzuhamstern, mit jener gefräßigen Wißbegier, die der Minute mehr abverlangt, als die Stunde zu gewähren vermag. Und oft genug mußte er ermahnt werden, den Hauptzweck, das Ordnen, nicht zu vernachlässigen, da er immer dabei war, in das Innere jedes Buches zu kriechen, das er gerade in seinen lüsternen Händen hielt. Daneben gab es Meinungsdifferenzen auszutragen, denn Gregory fand in diesen Schriften abermals gewisse Hinweise archäologischer Art, in deren Deutung er von den Ansichten seines Magisters eigensinnig abwich. Das waren aber Dinge, die die Herren unter sich abzumachen hatten. Mir lag damals das strittige Stoffgebiet noch zu fern, und meine Aufmerksamkeit wurde zudem durch andere, lohnendere Erscheinungen abgezogen. In meinen Gesichtskreis trat eine neue Persönlichkeit, die sich vom Chor der Fahrgäste deutlich abhob, ohne daß ich anfänglich zu sagen gewußt hätte, worauf sich diese Besonderheit gründete. Aber ich verspürte gewisse Fühlfäden, die von dem Menschen ausgingen und mich mit einem magnetischen Feld umgaben. Wer war dieser Mann? Jedenfalls »Auch Einer«, also Einer, der nicht in das allgemeine Schema »Fabrikware der Natur« hineinpaßte. Dieser Schablone widersprach schon sein Äußeres. Er zeigte das Bild einer männlichen Schönheit, ohne die verdächtige Süßlichkeit, die sonst den Nachfahren des Narziß und Adonis anzuhaften pflegt. Er trug seine Wohlgestalt nicht vor sich her, posierte nicht mit ihr, vermied jede absichtsvolle Wirkung. Er schwamm vielmehr auf seiner ausdrucksvollen und sympathischen Männlichkeit wie auf einem Fluidum, das ihn mit selbstverständlichem Gleichgewicht dahinführte.
Da diese Figur in den weiteren Begebenheiten eine erhebliche Rolle spielen wird, so möchte ich einige Merkzeichen vorwegnehmen. Lothar Argelander, Deutschbalte, stammte aus sehr vermögendem Hause, das auf einer Seitenlinie seines weitverästelten Stammbaums den Namen eines berühmten Forschers trägt. Der Glanz des Astronomen Friedrich Argelander hatte den Jüngling Lothar stark beeinflußt und ihm den Wunsch erregt, in die Fußstapfen seines hervorragenden Anverwandten zu treten. Allein schon auf der Universität entsagte er den ehrgeizigen Träumen der Namensberühmtheit, um sich dafür den Realitäten des Daseins zuzuwenden. Er fand heraus, daß ihn die Summe seiner Talente am weitesten führen würde, wenn er sie gleichmäßig pflegte, ohne sich einer bestimmt abgezirkelten Laufbahn zu verschreiben. Tatsächlich ergaben sie in ihrer Vereinigung ein übergeordnetes Talent, die seltenste aller Begabungen, nämlich die Fähigkeit, im eigenen Leben ein Himmelreich zu finden, zugleich diesseits und jenseits aller Sternkataloge. Hier berühren sich Kunst und Wissenschaft, denn das Vermögen, ein Leben zum Kunstwerk zu gestalten, die Harmonie der Sphären in sich zum Ertönen zu bringen, erfließt nur als Resultante künstlerischer und wissenschaftlicher Teilkräfte. Mit der bloßen Lebensklugheit wird keiner ein Lebenskünstler, höchstens ein bloßer Genießer in den Niederungen des Daseins. Von ihnen wimmelt die Welt, und in ihrer Massenhaftigkeit bilden sie nur einen pfützenhaft irisierenden Oberschaum auf dem Pfuhl des Weltelends. Der wahre Lebenskünstler, als welcher mir Lothar Argelander entgegentrat, strahlt von sich auf andere, er erhöht das Niveau der Umgebung, er gibt ihr Möglichkeiten des Genusses zu spüren, die sonst weder im Trott des Alltags noch sogar im Verkehr mit geistig Bevorzugten angetroffen werden; weil auch diese Bevorzugten, Künstler wie Forscher, fast ausnahmslos zwischen Ringen und Vollendung stehen, keinen Abschluß kennen, und als Signal ihrer Anstrengung beständig die Kette ihres eigenen Lebens klirren lassen.
*
Am zweiten Tage der Seereise näherte er sich mir ohne Umstände auf dem Promenadendeck: ob wir uns nicht zur nächsten Mahlzeit zusammensetzen wollten; und zwar nicht bei Tafel, sondern im kleinen Extrasalon, wo man sich außerhalb der Tischzeit ein hübsches Lunch nach der Karte servieren lassen konnte. Dieser Vorschlag kam meinem Wunsch entgegen, da ich hier den Anfang einer Unterhaltung mit ersprießlichen Fortsetzungen voraussah. Im Moment beschlich mich die Ahnung, daß dieses Impromptu einer flüchtigen Berührung den Auftakt eines Erlebnisses bilden würde.
– Wenn wir uns von der Horde absondern, sagte Argelander, so ist das zunächst eine Angelegenheit der reinen Zahl. Sie kennen das hübsche Wort des Varro: Eine gute Gesellschaft muß größer sein als die Zahl der Grazien, kleiner als die der Musen ...
»Dies Rezept«, korrigierte ich, »könnten wir beide nicht erfüllen. Es begrenzt zwischen vier und acht, und wir sind doch vorläufig nur zwei.«
– Ich würde mich darüber mit dem gelehrten Varro verständigt haben, denn ich vermute aus guten Gründen, daß er lediglich gegen die Masse, nicht aber gegen die Auslese protestieren wollte. Als das Ideal eines Konviviums wäre vielleicht ein tafelndes Quartett anzusehen, zwei Herren und zwei Damen, vorausgesetzt, daß die Konversation als leichtes Spiel gelten soll, bei dem die Worte aufgefangen und abgeschwungen werden wie Federbälle. Soll aber die Unterhaltung mehr bezwecken, als eine bloße Ergötzung mit spielerisch fliegenden Worten, so erscheint mir das Minimum des Varro noch zu hoch gegriffen: zwei Personen bei Tisch sind dann die notwendige und hinreichende Bedingung.
»Und woraus schließen Sie, daß ich Ihr geeigneter Partner wäre?«
– Weil ich Sie gestern beim Diner im großen Schiffssalon beobachtete. Sie zuckten schmerzhaft zusammen, als der erste Ton der Tafelmusik losbrach. Und Sie waren der einzige, bei dem ich dieses Symptom wahrnahm. Ein solches Zeichen feinerer Kultur ist so vielsagend, daß es unmöglich übersehen werden kann.
»Das ist in keiner Weise schlüssig. Ich könnte doch überhaupt, musikfeindlich organisiert sein?«
– Nehmen Sie an, ich sei über Sie informiert. Professor Borretius hat mir zudem einiges erzählt. Sie brauchen also nicht mit mir Versteck zu spielen. Somit bleibt bestehen, daß Sie – außer mir – der einzige Gast sind, dessen Nerven die Tafelmusik als das nehmen, was sie in Wahrheit vorstellt: als eine Barbarei.
»Ist das alles?«
– Es ist für den Anfang genug. Wenn zwei Seelen in einem Ton übereinstimmen, so darf man auf weitere Konsonanzen schließen.
»Sehr kühn gefolgert. Allein ich gebe Ihnen zu, daß Sie sich in Ihrer Voraussetzung nicht geirrt haben. Die Tafelmusik hat sich tatsächlich in aller Zivilisation zu einer Land- und Wasserplage schlimmster Sorte ausgewachsen, und wenn ich dabei zusammenzucke, so unterliege ich einer doppelten Empörung darüber, daß dieser Greuel einem sogenannten Bedürfnis entgegenkommt; und daß er verlangt wird von einer Gesellschaft, die ihre Genüsse zu steigern vermeint, wenn sie Küche mit Tonkunst verkuppelt, während sie tatsächlich nur die Instinkte eines bäurischen Kirmespöbels aufzeigt.«
– Nur noch einen Schritt weiter, und wir sind bereits bei einem Problem. Nämlich bei der Frage, ob der Mensch überhaupt imstande ist, Genüsse zu summieren, zur Verstärkung übereinanderzusetzen. Oder ob die Genüsse letzten Endes auf Schwingungen beruhen, die sich wie die optischen Wellen durch Interferenz gegenseitig auslöschen können.
»Das wird sich so allgemein wohl niemals beantworten lassen,« sagte ich zweifelnd, während wir sehr materiell begannen, uns mit der Mahlzeit auseinanderzusetzen. Wir waren die beiden einzigen redenden Menschen im kleinen blauen Gemach; der bedienende Ganymed huschte lautlos auf und ab und verwirklichte maschinenmäßig die fast unmerklichen Winke, die mein Gegenüber bei Komposition der Speisen- und Trankfolge gegeben hatte. Ich beabsichtige nicht, mit Aufzählung aller Einzelheiten den verspäteten Neid der Leser zu erwecken, möchte vielmehr den Verdacht einer von uns provozierten Schlemmerei abwehren. Denn der Dampfer »Velox« kam als alleiniger Gastgeber in Betracht, und seine köstlichen Tischleindeckdich waren ein für allemal in den Besitz der Fahrkarte einbegriffen.
Mein neuer Kumpan präparierte eine Auster mit zärtlicher Handbewegung und bemerkte dabei: – Wenn Sie auf der Zyprischen Akademie philosophische Themen behandeln wollen, so rate ich Ihnen: beginnen Sie mit solchen vermeintlichen Banalitäten. Sie erreichen dadurch weit sicherer die Höhe der Lebensphilosophie, als wenn sie von metaphysischen Abstraktionen ausgehen. Der Genuß ist die Basis aller Geistigkeit, und im ganzen Umfange der Genüsse gibt es keine Nebensächlichkeit. Es ist meine feste Überzeugung, daß man an der Hand der großen Genußkünstler wie Apicius, Mantegazza, Brillat-Savarin die letzten Dinge weit sicherer und tiefer erschließt, als wenn man sich von Descartes oder Kant beraten läßt.
»Man wird aber mit solcher Methode von den Ethikern als Genüßling und Wüstling gerüffelt werden.«
– Gönnen wir ihnen den Angriff und verlassen wir uns auf die Durchschlagskraft unserer Abwehrhiebe. Wir sind die Stärkeren, und um gute Bundesgenossen brauchen wir uns keine Sorge zu machen. Wo saßen die großen Moralisten der Vorzeit? Bei den Symposien! Und mit dem einen Aristoteles hebe ich schon das ganze Gelichter der scheinheiligen Abstinenten aus den Angeln. Meine klassischen Freunde betrachteten das Essen und Trinken nicht als die gemeine Notdurft, sondern als Weiheopfer für die Götter, und Aristoteles hat aus sprachkritischen Gründen bewiesen, daß der Schmaus an sich, η θοινη, einen geistigen Kult bedeute, woraus eine erhabene Pflicht herzuleiten, sich gottesdienstlich an der Tafel zu berauschen. Liegt nicht schon im Doppelsinn des Wortes »Spiritus« eine sublime Weisheit? Und ist es ein Zufall, daß die Verwalter der Aristotelischen Erbschaft, die Mönche, auf spirituosem Gebiet soviel erfinderischen Scharfsinn entwickelten?
»Sie meinen die Benediktiner und die frommen Ordensbrüder der Chartreuse – nicht üble Eideshelfer für einen Sybariten!«
– Wie die beschaulichen Klosterweisen überhaupt. Wir werden uns nachher in eine Suppe à la Carmelite vertiefen...
»Aber das ist doch nur ein Küchenname wie Chateaubriand oder Tournedos a la Rossini? Meines Wissens waren die Carmeliter vegetarische Bettelbrüder mit asketischen Gepflogenheiten, ohne jede Möglichkeit, Pfade der Sinnenlust zu beschreiten.«
– So mag es im Brockhaus stehen, aber aus genaueren Dokumenten – ich nenne Bulwer – erfahren wir es anders. Wie einst Poncelet als Eingesperrter in den finsteren Kasematten von Saratow eine neue Mathematik, die projektivische Geometrie aufbaute, so erweiterten die Carmeliter in ihren trüben Zellen eine andere Wissenschaft, die der Gaumenfreude. »Lassen wir dem Orden dieser unvergleichlichen Männer Gerechtigkeit widerfahren, die, von den Sorgen einer sündhaften Welt zurückgezogen, sich mit ungeteiltem Eifer und Nachdenken in Theorie und Praxis der tiefen Wissenschaft der Gastronomie ergaben. Uns ist es aufbehalten, den dankbaren Tribut der Erinnerung diesen geistreichen Klausnern zu zollen, die eine lange Periode der Barbarei und Finsternis hindurch in der Einsamkeit der Klöster retteten, was aus der Großzeit des klassischen Genusses in Trümmern auf uns herabgekommen ist.« Die Geschichte dieser Lüste gäbe für Philosophen und Moralisten ein wichtiges Forschungsziel, denn sie enthält zugleich die Geschichte künstlerischer Illusionen, in denen Leibliches mit Geistigem zusammenfließt. Warum waren in den Gelagen der Alten Nachtigallenzungen so hoch geschätzt? Nicht aus großtuerischer Perversität, sondern weil sie die ganze Musik dieses Vogels in seinen Singorganen schmeckten. Sowie noch heute der Kenner in den Austern den Gesang der Nereiden herausspürt, die mit goldenen Instrumenten die Tiefe des Meeres durchrauschen. Da haben Sie die eine Seite des soeben angeschlagenen Problems: diese Austern mit ihren ozeanisch irisierenden Rändern stehen auf der Grenze zwischen Eßwerk und schönen Künsten. Ihr Nährwert ist Null, ihr Geschmackswert minimal für den schlingenden Banausen, der keine Ahnung hat, wie die Sinne miteinander korrespondieren. Aber im Edelmenschen reagiert das innere Ohr auf den Anschlag der Zunge, und ein Fluidum durchzieht ihn wie aus dem ersten Akt von Wagners Tristan. Fährt man ihm hier mit Tafelmusik dazwischen, so wird er der nackten Brutalität ausgeliefert.
»Danach müßte man also überhaupt jeden Genuß vollkommen isolieren.«
– Doch nicht. Nur darauf ist zu achten, daß die Erregungen logisch konsonieren; und hierfür lassen sich die Kriterien nur aus der Erfahrung gewinnen. Sie belehrt uns zum Beispiel darüber, daß Austern und Chablis in einen vollen Akkord zusammenklingen, während Austern und Bier oder Tee einen direkt lächerlichen Mißklang liefern. Sie zeigt uns ferner, daß das Gewürz einer geistigen Unterhaltung nicht nur zu jeder Tafelfreude paßt, sondern zur Vollendung des Genusses gar nicht entbehrt werden kann.
»Damit stoßen Sie eigentlich auf eine Anomalie. Denn die geistige Unterhaltung umschließt doch einen Wert für sich, dessen Verfolg von der unmittelbaren Sinnenfreude ablenkt.«
– Ich glaube, Ihnen fehlt noch allerlei zum Lebensvirtuosen; wie ja nicht anders zu erwarten bei einem Menschen, der neunzehn Zwanzigstel seines Daseins im düsteren Norden vegetiert, in einem Wirkungskreis, der dauernd von der Antinomie Geistig-Leiblich drangsaliert wird. Ich kenne in dieser Hinsicht keinen Kontrast, nur Parallelität, und dieser Gleichlauf ist mir vollends klar geworden, als ich persönlich anfing, in Küche und Keller zu hantieren, wo ich mit derselben Andacht weilte wie in einem Laboratorium oder in einer Bibliothek. Man muß selbst in diesen Dingen komponiert haben, um zu fühlen, daß Tischgenuß und Gedankenentwickelung im Gespräch sich ergänzen wie Gesangstext und Melodie. Wie kann man da von Ablenkung reden, wo nur Durchdringung und Eindruckserhöhung in Betracht kommen!
»Sie befanden sich in einem Ausnahmsfall, Herr Argelander. Der Philosoph an sich, selbst der materialistisch gerichtete, sucht das Animalische zu überwinden. Zeigen Sie mir in der ganzen Geschichte der Philosophie eine Größe, die sich praktisch mit kulinarischen Dingen abgegeben hat!«
– Sie sind vorhanden; und sie wären leichter zu finden, wenn unsere Gelehrten bei ihren Buchentwürfen vom Schema loskommen könnten. Schreibe einer die Geschichte der großen Sybariten, und man wird staunen über die Menge der philosophischen Spuren, die darin im Abdruck auftreten müssen. Der große Fontenelle, dem wir den erhabenen Gedanken einer Mehrheit bewohnter Welten verdanken, unterhielt sich eindringlich mit Köchen, und die Rezepte zur besten Bereitung der Spargel erschienen ihm nicht unwichtiger als die Geheimnisse des Firmaments. Alexander Pope, seinerzeit Mittelpunkt einer literarischen Epoche, äußerlich verkümmert als ein verwachsener, ewig kränkelnder Knirps von vier Fuß Höhe, fand den Ausgleich zwischen seiner Mißgestalt und der Harmonia Mundi in der lukullischen Tafel. Die erlesensten Leckerbissen waren ihm grade gut genug, und als ein törichter Höfling darüber ironisieren wollte, fuhr er ihm mit dem klassischen Merkwort in die Schnauze ... »Ist mir bekannt. Pope rief: ›Glauben Sie etwa, mein Herr, daß Gott der Allmächtige diese Herrlichkeiten nur für die Narren erschaffen hat?‹ Übrigens warte ich auf stärkere Beweise für Ihre Lehrmeinung.«
– Vielleicht genügt Ihnen die Weisheit Salomonis. Betrachten Sie einmal sein Hohelied als eine Synthese von Liebe, Naturfreude und Verzehrungslust. Es strotzt von Allegorien, und beinah in jedem Gleichnis steckt etwas zum Essen oder zum Trinken: des Gaumens Süßigkeiten werden gepriesen nach einem endlosen Vokabular eines Menüs voller Honigscheiben, Milchsaucen, Gewürze, süßer Früchte, zyprischer Weine, Brüste allegorisieren sich zu Trauben, Atemdüfte zu Äpfeln, Augen zu Tauben, und mitten in die verliebten Evokationen erschallt der salomonische Bacchantenruf: »Esset, Genossen, trinket und berauscht euch, meine Freunde!« Das ganze Hohelied ist mit der Zunge gedichtet, Gaumen und Nase haben den Rhythmus beschwingt über Themen, die man sonst nur dem Gefühl und Gesicht zuweist, und so ist es eine Weisheitsdichtung geworden; weil die Weisheit in ihrer Höchstleistung dionysisch wird, zur Verzückung umschlägt. Stoßen wir darauf an, Genosse der Zypernfahrt, es lebe die genußfrohe Weisheit!
»Sehr gern, wenn Ihnen daran liegt, diesen vortrefflichen Mousseux noch besonders zu rechtfertigen. Ich mache Sie aber darauf aufmerksam, daß Sie jetzt nahe daran sind, ins Extrem zu verfallen. Was Sie vertreten, geht schon über allen Epikur hinaus und nähert sich bedenklich dem Polyphem bei Euripides, der den Magen als die einzige Gottheit erklärt.«
– Durchaus nicht, obschon ich nicht verhehle, daß die Theologie des gefräßigen Zyklopen immer noch besser an die salomonische Weisheit anschließt, als das andere Extrem der landläufigen Taxe. Denn ebensowenig wie die Sinne, funktionell genommen, dürfen die körperlichen Organe getrennt werden. Es ist in höchstem Grade unphilosophisch und klingt mir wie das Geplärr eines Fastenpredigers, wenn einer das Gehirn als göttlich, den Magen aber als profan und schäbig ausruft, da doch beide gleichwertig als Substrate dessen auftreten, was wir Bewußtsein oder Seele nennen. Jede Wertabstufung in diesem Betracht – und noch Kant watet knietief in diesem Irrtumspfuhl – führt zum Blödsinn. Es ist genau so, als wollte man das Auge vergöttlichen, wenn es durchs Teleskop einen Spiralnebel erforscht, dagegen verteufeln, wenn es auf damastner Decke einen getrüffelten Fasan erblickt. Der Vorgang erinnert an die Preziösenzeit der Literatur, wo man zwischen »edlen« und »unedlen« Ausdrücken unterschied und ganze Register aufstellte von Worten, die in der Poesie verfemt waren. So sind auch hier nach Sprachgebrauch und Philosophentaxe gewisse Glieder edel, andere gemein. Schon in dem Worte Bauch steckt Verachtung, bei Nennung der Gedärme muß man sich entschuldigen, und das Gesäß schleppt sich mit dem Makel der Unanständigkeit. Aber das alles gehört zur neueren Kultur, zu einer Ideenwelt, in der die Venus Kallipygos vollkommener wäre, wenn sie ohne Steiß dastände.
Ich gab der Vermutung Ausdruck, daß Argelanders Reise wohl auch den Zweck verfolge, von dieser west- und nordeuropäischen Kultur zeitweilig abzurücken, und er zögerte nicht, mir seine Motive etwas ausführlicher zu erläutern. Er hatte sich vor einem Jahre in Zypern angekauft und nannte dort eine kleine Villa mit hübschem Garten sein eigen, ein recht wohnliches Anwesen, wie ich bald durch eigene Anschauung bestätigen konnte, da er mir mit verbindlichsten Worten seine Gastfreundschaft entgegentrug. Vorläufig hauste er da als Junggeselle, allein nach seinen Andeutungen war es nicht ganz ausgeschlossen, daß in absehbarer Zeit neben ihm eine Dame Argelandera erscheinen würde. Auf dem Kontinent und in England besaß er materielle Verbindungen geschäftlicher Art, die er während der letzten Monate mehr und mehr abgewickelt und bei persönlicher Anwesenheit in nordischen Städten bis auf gewisse Reste gelöst hatte. Eigentlich, so meinte er, könnte man in den geräuschvollen Kulturzentren überhaupt nicht mehr existieren. Sie böten nur noch abgegraste Weideplätze für einen wirklichen Hedoniker, und man stieße überall, ob in London, Paris, Brüssel, Berlin, Stockholm, selbst in Rom auf dieselben Unzuträglichkeiten, namentlich auf die gleichen monotonen Moralwucherungen, deren fade Säuerlichkeit sich überall als der Grundgeschmack des Daseins durchsetze. Im Grunde genommen wäre dort nichts elementar und selbstverständlich, alles vielmehr entweder erlaubt oder verboten, und gerade die Menge der lästerlich aufgeputzten Vergnügungen zeuge dafür, daß man sich überall Ventile gegen drückende und überflüssige Normen schaffen wolle. Neun Zehntel aller Exzesse würden gerade durch solche Verfügungen hervorgerufen, die sie verhüten wollten. Der Staat als Polizeianstalt müsse überwunden werden, und hierfür entfalte sich auf Zypern ein neues Muster von vollendeter Toleranz, sozusagen eine Enklave der Zivilisation mit einem Mindestmaß von Befehlen und Gehorchen. Hat nicht schon Buckle in seiner Geschichte der Zivilisation auf die Möglichkeit solcher Gestaltung hingewiesen? »Die wertvollsten Gesetze sind die Abschaffung früherer Gesetze gewesen, und die besten Gesetze, die je gegeben worden sind, waren die, welche alte Gesetze aufhoben.« Nur einen Schritt weiter, und wir sind beim Idealgesetz, das alle Verfügungen überflüssig macht und die Menschheit endlich von der Paragraphenfuchtel erlöst. Aber dann herrscht ja Anarchie! zetert der Philister, der unentwegt vom ungeschriebenen Sittengesetz fabelt und sich doch den moralischen Imperativ nicht anders vorzustellen vermag, als mit Büttel und Galgen daneben. Dieser Philister (meinte Argelander) soll dort bleiben, wo er mit seinen Artgenossen zu zappeln gewohnt ist, in dem engmaschigen Netz des Dürfens, Sollens und Müssens, das ihm eine Freiheit vortäuscht, während die ganze Konstruktion des Netzes auf quälerischem Sadismus beruht. Wir aber fliegen hier einem Bestimmungsort entgegen, der sich aus eigener Naivität von der Zwangskultur freigehalten hat, einer Kolonie freigeistiger, lebenswilliger Menschen, die ihr Ich pflegen, ohne in jeder Sekunde auf ein Kontra-Ich zu prallen. Fay ce quevouldras! Diese alte Spruchformel der Abbaye de Télème ist hier neu aufgerichtet. Ob sie durchhalten wird, wer kann's wissen; genug, daß das Motto des Rabelais heute in Neu-Amathus gilt, und daß wir uns einem Erdenfleck nähern, wo wir bis auf weiteres abseits der Weltschikane tun können, was wir wollen.
Ich durfte vorerst nicht widersprechen, denn aus ihm redete der Ortskundige, während ich die verheißenden Möglichkeiten noch an der kurzen Elle meiner heimischen Erfahrungen maß. Immerhin hatte ich doch auf früheren Erholungsreisen so manche paradiesische Woche verträumt, in erhöhter Gefühlsebene und von zauberischen Natureindrücken berauscht. Und je mehr wir uns dem Ziel näherten, desto lebhafter beschäftigte mich die Frage, was mir wohl die zyprische Natur mit ihren Stimmen aus Fels, Garten, Wald und Gewässer zu sagen haben würde.
Ich empfing keine Schilderung, nur einen Vergleich, aus dem hervorging, daß ich meine Erwartungen nicht direkt auf verblüffende Szenerien zu spannen hatte. Das Signalement ging eher auf die Holdseligkeit der Landschaft, auf deren innere, sanfte Magie, als auf ihre sensationelle Wirkung beim ersten Anblick. Sicherlich gäbe es an der Ligurischen Küste, am Lago maggiore, in den Urkantonen, wie im Wallis bevorzugte Punkte, die als Knalleffekte der Natur herausfordernder aufträten. Allein beim Vergleich zeige sich der Unterschied wie bei weiblichen Reizen, die man gern sieht, wenn man sie entdeckt, und die abstoßen können, wenn sie anbietend gezeigt werden. Die seit Jahrzehnten berühmten Fremdenpunkte hätten alle etwas an sich von affischierten Freudenstätten, vor denen der Baedekerstern als Schild und Wappen herausgesteckt würde zum Zeichen, daß da furchtbar viel los sei. Fabelhafte landschaftliche Schönheiten, auf dem Präsentierbrett entgegengetragen, zu allerdings hohen, aber, wie jedem einleuchten müsse, gerechtfertigten Preisen. Dagegen wohne auf Zypern eine landschaftliche Natur, die sich suchen läßt und ihre Schleier erst in der Intimität der Umwerbung abstreift ... Und hier kam ganz beiläufig eine Eigenheit zur Erörterung, der ich im Augenblick keine wesentliche Bedeutung beimaß, die aber von meinem Gefährten mit geflissentlicher Betonung unterstrichen wurde.
In dem vegetativen Schmuck des Landes tritt nämlich eine bestimmte hochstämmige Pflanze mit seltsamer Wirkung zutage. Sie gehört zur Klasse der Gewächse mit »hochgewölbten Blätterkronen, Baldachinen von Smaragd«, unter denen sich ein Dichter in Visionen wiegen kann, um vielleicht ins Reich der ewigen Träume einzugehen; denn der Aufenthalt unter der Euphorbia aromatica ist nicht ungefährlich. Sie kann als eine reale Schwester des phantastischen Manzanillo bezeichnet werden, unter dessen Gifthauch Vasco de Gama und Selica opernhaft verdämmern. Unter normalen Verhältnissen verrät sie sich durch ein zartes Gedüft aus eiförmigen spitzen Blättern und grünlichen knäuelförmigen Blütengruppen, durch einen leisen Dunst, der, vom Winde aufgenommen und zerstreut, keine Tücke eines Opiates zu äußern vermag; um so weniger, als hier die Gewöhnung als ausgleichender Faktor auftritt, bis zu dem Grade, daß sogar die Neu-Ansiedler sich dem Rauschduft gegenüber fast durchweg so indifferent verhalten, wie die Urbewohner. Allein man hat Ausnahmen beobachtet bei besonders empfänglichen, nervös reagierenden Personen, denen das längere Verweilen bei den Euphorbien allerlei Haschisch-Zustände mit recht bedenklichen klinischen Folgeerscheinungen eintrug. Zudem verlaufen diese Ausdünstungen dem Grade nach periodisch; die Botaniker haben festgestellt, daß sie einen merkwürdigen Zusammenhang mit gewissen meteorologischen Abläufen aufzeigen, die wiederum von der Häufigkeit der Sonnenflecken abhängen. Auf alle Fälle wäre eine Warnung am Platz, damit der Neuling sich nicht leichtsinnig in die Gefahrzone der mit Phantasmagorien gaukelnden Gewächse begebe.
»Und Sie selbst, Herr Argelander, haben Sie jemals von diesen Halluzinationen etwas verspürt?«
– Vorübergehend allerdings. Ich bin indes abgehärtet und vertrage sogar einige Opiumpfeifen ohne sonderliche Nachwehen. Nichtsdestoweniger würde ich in der bevorstehenden Saison meine Hängematte nicht gerade zwischen den Manzanillen ausspannen; denn die Sternwarten melden ein Maximum von Sonnenflecken, wie es seit vielen Jahrzehnten nicht beobachtet worden ist.
»Verzeihen Sie eine Zwischenfrage. Nach Ihren Andeutungen sind Sie in der Wahl Ihres jeweiligen Wohnorts ganz unbeschränkt, Sie schlagen Ihr Zelt auf, wo es Ihnen beliebt. Das wäre mir nicht weiter auffällig, wenn ich Sie einfach in die Klasse der nichtstuerischen Millionäre rubrizierte, der Gesellschaftsdrohnen, zu denen ich Sie doch nicht rechnen möchte. Denn so eindringlich Sie auch vom Genießen reden – Sie sehen nicht aus wie einer, der in den Tag hineinlebt. Ich gebe zu, in der Frage steckt eine gewisse Peinlichkeit, aber ich möchte sie nicht länger zurückhalten: Haben Sie denn gar keinen Beruf?«
Der andere stutzte einen Moment und biß sich auf die Lippe. Er witterte Methode in meiner Fragestellung und befand sich damit nicht auf falscher Fährte. Denn ich neige allerdings dazu, gewisse Antworten, deren Umriß ich längst erraten habe, meinem Gesprächspartner zur persönlichen Kolorierung zuzuschieben.
– Das wird also ein Examen, sagte er, und das Thema sieht so aus, als ob es mich in Verlegenheit bringen könnte. Denn ich habe entweder mehrere Berufe, oder auch gar keinen, wie man's nimmt. Auf einen Meldezettel könnte ich schreiben: Gutsherr, Landwirt, Privatier, Rennstallbesitzer – in Pharanthese: ich habe dabei keine Seide gesponnen, und wenn das heutige Rennen in Epsom keine Wendung bringt, löse ich den Stall auf und jage meine Jockeis zum Teufel – aber das sind, wie gesagt, nur Zettelvermerke, Ausweise neugierigen Behörden gegenüber. Im Grunde genommen bleibt Beruf ein Rest des Kastengeistes, der zünftigen Ordnungskette, die wir doch sprengen wollen. Wo wir uns in der Tragödie des Geistes umsehen, finden wir den Beruf, das Fach, das Schema der Fakultät als die verhängnisvollen Ur- und Quellmotive ...
»Ich merke, worauf Sie hinaus wollen. Man könnte allerdings eine Kulturgeschichte aufstellen mit dem Leitmotiv: »Los vom Beruf!« Man könnte zeigen, daß die hervorragendsten Leistungen im Trotz gegen Fach und Beruf zustande gekommen sind. Und das mag Ihnen wohl vorgeschwebt haben bei Ihrer Tendenz, sich möglichst außerhalb eines etikettierten Berufes zu stellen. Aber die Leistung selbst müßte doch vorhanden sein, und nach Ihrer Anlage zu schließen, könnten Sie wohl zu denen gehören, die für die Philosophie um so energischer leben, je weniger sie darauf angewiesen sind, von der Philosophie zu leben.«
– Ja, damit wären wir beim Hauptpunkt. Allein, wenn man mich fragt, was hast du geleistet? dann muß ich den gültigen Ausweis schuldig bleiben. Ich habe nichts, was ich auf den Tisch legen könnte, kein Buch aus meiner Feder, kein Diplom, kein Patent – nichts. Und ich befinde mich da etwa in der Lage eines Montaigne in zweiter Potenz: denn der in erster Potenz hat wenigstens noch geschrieben, ich aber habe auch das unterlassen; nach dem Vorbild von Thales, Phythagoras, Sokrates, Diogenes, Pyrrhon, Epiktet, die auch nicht eine Zeile verfaßt haben. Trotzdem berufe ich mich am liebsten auf Montaigne, der sich nur zu einem einzigen Gewerbe bekannte: zum Leben, das heißt zur Erforschung des einzigen Gegenstandes, der darum der wichtigste ist, weil er innerhalb des Universums nur in einem einzigen Exemplar existiert. »Wenn ich über mich selbst urteile, so ist es erwiesen, daß niemals ein Mensch einen Gegenstand behandelte, den er besser kannte und verstand, als ich ihn verstehe, und daß ich hierin der gelehrteste Mensch bin, der auf der Welt lebt«; und wenn ich mich selbst ans Licht bringe ...
»Da steckt eben der Haken. Sie mögen in Ihrem Innern die wunderbarsten Geheimnisse entdecken – sobald Sie nichts veröffentlichen wie die Leute vom Beruf, bringen Sie gar nichts ans Licht, und Ihre Funde bleiben in Ihnen verschlossen als Ihr persönliches Mysterium.«
– Die Natur sorgt schon für die Veröffentlichung, auch ohne die unmittelbare Bereitschaft von Tinte, Feder und Typendruck. Ich finde in mir die absolute Gewißheit, daß jede Erkenntnis, jedes geahnte oder durchschaute Mysterium meines Selbst, durch unsichtbare Poren hinausströmt und sich früher oder später der Welt mitteilen muß. Was einmal als original empfunden, angeschaut oder durchdacht wurde, das dringt unfehlbar in die Ferne, denn die Gehirne und Herzen aller Intellektuellen sind drahtlos, telepathisch verbunden.
»Sie wären also dabei selbstlos genug, den Ruhm an etwaigen Erkenntnissen und Entdeckungen anderen zu überlassen, die Ihnen Ihre Mysterien vierdimensional abfangen werden?«
– Mir wäre der Ruhm nur ein lästiger Begleiter. Niemals verdient er den Preis, der dafür gezahlt wird, billiger als für das Opfer an Glückseligkeit ist er nicht zu haben. »Ruhm und Ruhe sind Gäste, die nicht unter einem Dache Herberge finden können,« ja oft genug ist der Ruhm der grimmigste Feind des Denkens selbst, nämlich jeder Denkarbeit, die eine innere Stille voraussetzt. Sobald der Ruhm dazwischenbrüllt, die Sorge um den Ruhm hinausstöhnt, ist es vorbei damit. Sie wissen so gut wie ich, daß bei den sogenannten Großen Männern die Höchstleistung fast durchweg in die frühen Lebensalter fiel. Weil ihr Genie in der Frühe am stärksten war? Das soll mir keiner einreden. Das Genie verbraucht sich nicht in einer Hervorbringung, ebensowenig wie die Muskelkraft in einem athletischen Akt. Aber der aufsteigende Ruhm hat die Produktion gelähmt. Man stellt sich ihn als einen Sporn vor, und er ist ein Hemmschuh. Und dabei ein höchst unsauberer Geselle, mit deutlichem Hang zu posthumer Unzucht. Der bloße Gedanke, daß er mich zwar zu Lebzeiten ungeschoren ließe, aber dereinst mit meiner Leiche nekrophile Buhlschaft treiben könnte, macht mich schaudern ... Und dennoch – setzte Argelander mit plötzlicher Veränderung im Tonfall hinzu – und dennoch – es ist mir so, als spürte ich bereits seine Klaue. Nein, das war falsch ausgedrückt – denn sehen Sie, während ich mit Ihnen rede, verwandelt sich mir das Gespenst des Nachruhms in einen bereits erlebten Vorruhm – wahrhaftig, es ist sehr schwierig, das irgendwie auszudrücken, und ich muß damit rechnen, Ihnen recht grotesk zu erscheinen – – –
»Was haben Sie, Herr Argelander? Ist Ihnen unwohl?«
– Nein, das nicht – allein mich überkommt bisweilen so etwas wie Gedankenflucht – vielleicht besser zu sagen: Gegenwartsflucht, und soeben hatte ich die blitzartige Vorstellung, als wehrte ich mich vergebens gegen den Ruhm, da ich doch schon vor Jahrhunderten sehr berühmt gewesen bin ...
»Ich verstehe Sie nicht.«
– Das ist auch nicht zu verstehen; höchstens dämmerhaft zu erahnen. Sagen Sie, Herr, hatten Sie noch nie die Empfindung, daß Sie schon in grauer Vorzeit über die Erde wandelten, als ein Wesensverwandter, der seitdem längst vermoderte, aber in Ihrer Gestaltung wieder auferstand?
»Nein, dazu bin ich nicht ideal genug veranlagt. Aber soviel Phantasie bringe ich schon auf, um mich in einen derartigen Wachtraum hineinzudenken. Sie unterliegen offenbar zeitweilig einem Zustand, der, um das Wort für die Tatsache zu setzen, mit der Seelenwanderung zusammenhängt. Was nicht ganz so erstaunlich auf mich wirkt, als Sie vielleicht vermuten; denn Sie waren ja eben dabei, mir einiges von Ihren persönlichen Mysterien anzuvertrauen. Also vervollständigen Sie nur Ihre Andeutung und sagen Sie mir: Welche berühmte Person schwebte Ihnen vor, mit der Sie sich im Augenblick identisch fühlten?«
– Es geschah wirklich nur einen Augenblick lang. Schon wieder vorüber. Aber ein Rest von Erinnerung ist noch vorhanden, nicht deutlich genug, um eine bestimmte Persönlichkeit zu bezeichnen. Nur griff es ganz gewiß in die heidnische Vorzeit zurück. Ja, ganz recht: griechische Blüte. Möglicherweise Epikur, oder so einer. Jedenfalls ein sehr Berühmter aus der Epikurischen Epoche, und dazu merkwürdigerweise ein sehr Glücklicher. Ja, das habe ich in dem einen Moment ganz genau gespürt: er war ich, und ich war er!
*
Hier saßen wir auf einem Thema, von dem wir so bald nicht loskamen: Seelenwanderung als eine Form der Unsterblichkeit! Und je skeptischer ich mich anfänglich verhielt, desto dringender verbiß sich Argelander auf die ewige Wiederkehr in verschiedenen menschlichen Gestaltungen. Das große Erlebnis, das uns später auf Zypern in seinen Bann schlagen sollte, warf seine Schatten voraus. Es ergaben sich Betrachtungen, die mir schon hier, nahe dem Gestade von Kreta, ein fernes Abenteuer hätten ankündigen können. Aber auf dieser Lustfahrt im östlichen Teil des Mittelländischen Meeres war die freundliche Gegenwart noch zu überragend; und ich spürte in mir weder das Bedürfnis noch die Möglichkeit, mich in eine Welt mit gänzlich veränderten Zeitbedingungen zu versetzen.
Heute weiß ich, daß eine solche Welt nicht nur erreichbar, sondern auch im höchsten Grade erstrebenswert ist. Wer den Weg zu ihr finden will, hat zunächst in sich den alten Glauben an die Einheit und Unteilbarkeit des Individuums auszurotten. Das Ich kann in ein Doppelt-Ich, in ein Vielfach-Ich zerfallen, und es zerfällt wirklich, wenn man sich entschließt, die Tatsachen der Naturkunde so anzusehen, wie sie, kurz gesagt, noch nie zuvor angesehen worden sind.
Da sitzt ein Biologe in seinem Untersuchungskabinett und zerschneidet ein niederes Tier, einen Wurm, einen grünlichen Polypen, um das Nachwachsen der Glieder zu beobachten. Oder er verfolgt durchs Mikroskop die unausgesetzte Teilung einer Monere bis in die dreitausendste Generation. Vielleicht befällt ihn dabei der Gedanke an eine Art von Unsterblichkeit in den Tiefen der Geschöpfe. Aber was er nicht ahnt, ist: daß er hier dicht an der Pforte eines Menschen-Mysteriums steht; daß sein Experiment imstande ist, die Wirklichkeit einer Seelenwanderung zu erweisen; ja sogar gegenständlich sichtbar zu machen.
Tatsächlich läßt sich der Faden von Bewußtsein zu Bewußtsein knüpfen, nicht bloß redensartlich, sondern, sinnfällig, ganz real, in Form eines gewöhnlichen Nähfadens. Das klingt sehr blasphemisch. Aber hier kommt die Natur der Erkenntnisschwäche zu Hilfe, sie bietet dem Verstande ein banales Hilfsmittel, um ihn am Leitseile der Substanz auf einen idealen Gedankengang zu führen.
Nämlich so: Der Forscher durchschneidet einen Regenwurm quer in zwei Stücke, deren selbständiges Fortleben ihn nicht weiter in Verwunderung setzt, denn das gehört zum alten Wissensbestande. Aber nun heftet er das Hinterende in natürlicher Lage mit einem Faden an das Vorderende, und beide Stücke, räumlich getrennt, offenbaren plötzlich Einheit des Bewußtseins: ihre Kriechbewegungen verlaufen völlig koordiniert, wie in Abhängigkeit von einem einzigen dirigierenden Impuls. Eine Erregungsleitung im Bauchmark von Segment zu Segment kann nicht stattfinden, der Beschauer hat wirklich zwei Individuen vor sich, die ihrer organischen Unabhängigkeit zum Trotz in Trieb und Handlung als Einheit auftreten; das Ich des einen ist zugleich das Ich des anderen.