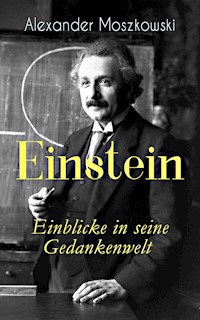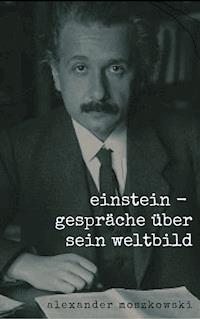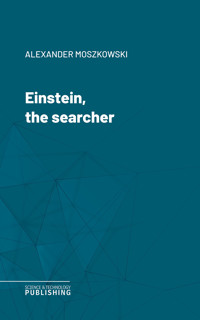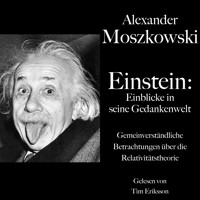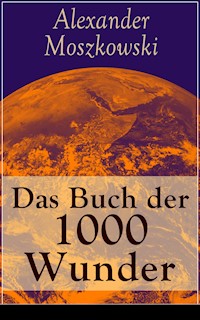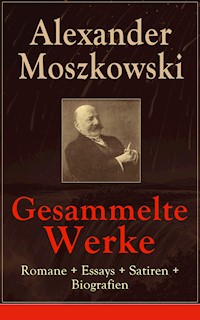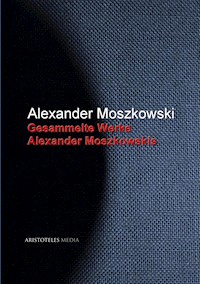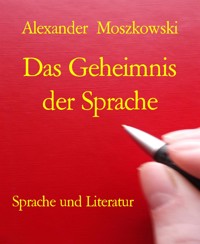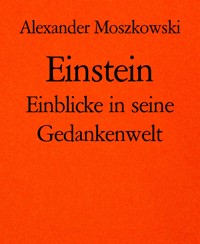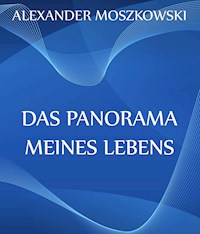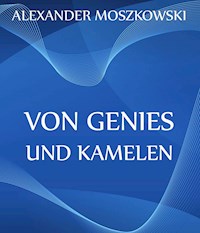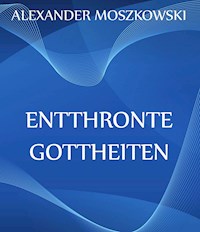Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Moszkowski greift hier die Geschichte des Robinson Crusoe auf und erzählt diese fort. Es wirkt wie ein Märchen und ist doch Wirklichkeit, es erzählt die Wahrheit und umspinnt den Leser dennoch mit Zauberfäden. Denn glaubt man dem Autor: nichts ist so wunderbar wie die Natur, und alle Feengeschichten können sich vor dem Buch der Welt verstecken. Man muß es bloß an der richtigen Stelle aufschlagen, da wo man es zu lesen versteht. Und das ist hier geschehen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meister Robinson
Artur Fürst und Alexander Moszkowski
Inhalt:
Meister Robinson
Liebe Kinder!
Der Garten an der Elbe
Erster Nachmittag
Zweiter Nachmittag
Dritter Nachmittag
Vierter Nachmittag
Fünfter Nachmittag
Sechster Nachmittag
Siebenter Nachmittag
Achter Nachmittag
Neunter Nachmittag
Zehnter Nachmittag
Elfter Nachmittag
Zwölfter Nachmittag
Dreizehnter Nachmittag
Vierzehnter Nachmittag
Fünfzehnter Nachmittag
Sechzehnter Nachmittag
Siebzehnter Nachmittag
Achtzehnter Nachmittag
Neunzehnter Nachmittag
Zwanzigster Nachmittag
Einundzwanzigster Nachmittag
Zweiundzwanzigster Nachmittag
Dreiundzwanzigster Nachmittag
Vierundzwanzigster Nachmittag
Fünfundzwanzigster Nachmittag
Sechsundzwanzigster Nachmittag
Siebenundzwanzigster Nachmittag
Achtundzwanzigster Nachmittag
Neunundzwanzigster Nachmittag
Dreißigster Nachmittag
Schlußwort an die Erwachsenen
Meister Robinson, A. Moszkowski
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849632175
www.jazzybee-verlag.de
Alexander Moszkowski – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller und Satiriker polnisch-jüdischer Abstammung. Geboren am 15. Januar 1851 in Pilica, verstorben am 26. September 1934 in Berlin. Bruder des Komponisten und Pianisten Moritz Moszkowski. Aufgewachsen in Breslau und später Umzug nach Berlin, wo er für die Satirezeitung "Berliner Wespen" arbeitete. Nach Differenzen mit dem Verleger gründete er seine eigene Zeitschrift „Lustige Blätter“, die sehr erfolgreich war. Seine Freundschaft mit Albert Einstein gipfelte darin, dass er als einer der ersten die Relativitätstheorie einem breiten Publikum populärwissenschaftlich zugänglich machte.
Wichtige Werke:
·Das Geheimnis der Sprache (Essays)
·Das Panorama meines Lebens (Autobiographie)
·Der Venuspark
·Die Ehe im Rückfall und andere Anzüglichkeiten (Satiren)
·Von Genies und Kamelen (Satiren)
·Die Inseln der Weisheit (Utopischer Roman)
·Einstein - Einblicke in seine Gedankenwelt
·Entthronte Gottheiten
·Unglaublichkeiten (Satiren)
Meister Robinson
Liebe Kinder!
Was ihr da in euren Händen haltet, ist ein sehr merkwürdiges Buch und mit keinem der euch bekannten Bücher zu vergleichen. Es wirkt wie ein Märchen und ist doch Wirklichkeit, es erzählt die Wahrheit und umspinnt euch dennoch mit Zauberfäden. Denn glaubt uns nur, ihr Kinder: nichts ist so wunderbar wie die Natur, und alle Feengeschichten können sich vor dem Buch der Welt verstecken. Man muß es bloß an der richtigen Stelle aufschlagen, da wo ihr es zu lesen versteht. Und das ist hier geschehen, so denken die Verfasser dieses Buchs.
Auf der Titelseite habt ihr den Namen Robinson gelesen, und von diesem berühmten Menschen handelt das Buch auch durchweg. Eigentlich könntet ihr nun gleich da anfangen, wo richtig erzählt wird, und manche von euch werden das ja auch wirklich tun; nämlich diejenigen, die überhaupt niemals eine Vorrede lesen. Aber einige werden doch denken: da die Verfasser so einen Vorspruch an den Anfang gestellt haben, so wollen wir doch hören, was sie uns extra sagen möchten.
Und das wäre etwa folgendes:
Dieser Robinson, dessen Geschichte hier auf vielen Blättern aufgezeichnet steht und mit allerlei Bildern anschaulich wird, hat einmal wirklich gelebt. Eigentlich hieß er zwar anders, aber im Lauf langer Zeiten haben sich die Menschen daran gewöhnt, ihn Robinson zu nennen, und dabei wollen wir denn auch bleiben.
Wobei wir aber nicht bleiben wollen, das ist etwas anderes. Die Erlebnisse des uralten Robinson klingen nämlich heute gar nicht mehr so schön und so spannend, wie sie euren Vätern und Großvätern geklungen haben. Es hat sich in der Zeit so viel geändert, daß gar vieles in dem alten Robinson heutzutage wie verwelkt und abgestanden anmutet; oder etwa wie eine Speise, zu der ursprünglich vorzügliche Stoffe verwendet wurden, die aber einen ranzig schmeckenden Schaum angesetzt hat. So eine Speise kann aber wohl mit Kunst wieder genießbar gemacht werden. Man muß den übeln Schaum abschöpfen, das Ganze sorgsam aufkochen und einige neue leckere Zutaten beifügen; dann kann ein Gericht herauskommen, das noch schöner schmeckt als die alte Speise.
So etwas ähnliches hat man nun mit guten Büchern schon manchmal versucht, und Wertvolles ist dadurch entstanden. Nur an euch Kindern sind die Buchschreiber gewöhnlich vorbeigegangen. Sie haben vielleicht in alten Kinderbüchern dies und das ein wenig zurechtgestutzt, einiges gar zu Langweilige herausgestrichen, ein paar neue Bilderchen hinzugemalt. Aber etwas wertvolles Altes für euch zu erhalten und es doch ganz neu zu formen, daran hat keiner gedacht. Und so war es denn auch bei dem alten Robinson geblieben, der mehr und mehr in Vergessenheit gerät, weil seine Zeit um ist.
Aber weshalb ist sie denn um? Weshalb blühen heute noch die alten Grimmschen Märchen und viele andere Jugendgeschichten, die man jetzt noch genau so erzählt, wie sie zur Zeit der Urahnen erzählt wurden?
Das wollen wir euch sagen: weil solche reinen Märchen, Sagen, Fabeln in gar keiner Zeit spielen, und weil ihr Inhalt vor hundert, vor tausend Jahren so gültig war, wie er in hundert, in tausend Jahren gültig sein wird.
Das ist aber bei Robinson anders. Der ist ein auf eine einsame Insel verschlagener Mensch, den wir als unseresgleichen betrachten sollen. Aber ist er denn noch unseresgleichen, wenn er so denkt und die Welt so anschaut wie die Leute vor urlangen Zeiten? Ganz gewiß nicht. Ihr Kinder seid heute in zahllosen Dingen weit gescheiter als die Erwachsenen vor hundert Jahren. Mit den ersten Schritten in die Stadt und ins Land hinein lernt ihr Unzähliges kennen, wovon die Großen von ehedem noch gar keine Ahnung hatten, mit einem Wort: ihr denkt mit dem Zeitalter der Dampfmaschinen, der Eisenbahnen, der Luftschiffe, der letzten Erfindungen und Entdeckungen, und ein Mensch, der hiervon noch gar nichts ahnt, ist nicht euresgleichen.
Deshalb wird euch hier von einem Robinson erzählt, den ihr versteht, und der auch euch verstehen würde, wenn er sich mit euch unterhalten könnte. Seine Geschichte wird darum nicht weniger spannend und abenteuerlich sein als die des alten Robinson. Nein, noch weit spannender, merkwürdiger und abenteuerlicher. Das werdet ihr ja bald genug merken, wenn ihr erst zu lesen angefangen habt. Und wir versichern euch dabei: es ist im Grunde jene Geschichte, die schon so viele Gemüter erregt und beschäftigt hat; nur so erzählt und vorgetragen, daß ihr als Kinder einer vorgeschrittenen Zeit daran ein wahrhaftes Vergnügen haben könnt.
Und dann, wenn ihr erst das ganze Buch fertig gelesen habt, steht euch noch eine besondere Entdeckung bevor. Ihr werdet dann nämlich zu eurer Überraschung wahrnehmen, daß ihr nicht nur um eine merkwürdige Geschichte, sondern auch um ein tüchtiges Stück Wissen reicher geworden seid.
Darüber soll euch aber diese Ansprache vorläufig nichts weiter verraten. Nur das eine wollen wir euch geloben, daß euch nicht eine Minute lang so zumute sein soll, als säßet ihr auf der Lernbank und solltet mit Lehrstoff gefüttert werden. Nein, die seltsamen, gefahrvollen und stürmischen Erlebnisse des Robinson bleiben immer die Hauptsache; ihr sollt nie aufhören, mit ihm zu sorgen, zu hoffen, Leid und Wonne zu empfinden und – mit ihm zu lernen. Denn Robinson lernt unablässig, und kein Ereignis überfällt ihn, das nicht auch das Maß seines Wissens vergrößert. An dieser Wissensvermehrung sollt ihr teilnehmen, wie ihr in Zittern und Bangen, in Schreck und Freude an all seinen Schicksalen teilnehmen werdet.
Und wenn eines von euch, sei es Knabe oder Mädchen, dann noch etwas auf dem Herzen hat, in irgendeiner Frage über dies und das oder sonst in einer Bemerkung über Robinsons Erlebnisse und Erfahrungen, dann schreibt es nur den Verfassern und richtet eure Briefe an den Verlag, der unten auf dem Titelblatt steht. Die Verfasser versprechen euch, alles, was ihr ihnen kundtut, sehr aufmerksam zu lesen, zu prüfen und euch durch die Post Antwort zu geben, Auskunft zu erteilen über manches Schöne und Wissenswerte, was in diesem Buch nur lose berührt werden konnte. Und damit, liebe Kinder, begrüßen wir euch und wünschen euch viel Genuß zu der Geschichte, die auf der nächsten Seite anfängt.
Die Buchschreiber und Herausgeber Artur Fürst Alexander Moszkowski
Der Garten an der Elbe
In der hohen, weit gespannten Halle des Hamburger Hauptbahnhofs hielt der elektrische Vorortzug nach Blankenese.
In ein leeres Abteil stieg eine kleine Gesellschaft: drei Knaben, der älteste von ihnen schon fast ein Jüngling. Wenn man die Gruppe genau beobachtete, sah man, daß von einem Einsteigen eigentlich nur bei den beiden größeren Knaben die Rede sein konnte. Der Jüngste sauste wie eine Kanonenkugel in das Abteil hinein, warf die Büchermappe mit lautem Knall auf die Bank, drehte sich dreimal wie ein Kreisel auf dem Absatz herum und rief: »Gott sei Dank, große Fe . . .!« Er konnte das Wort nicht ganz zu Ende sprechen, denn gerade jetzt zog der Zug an, und der Kreiselnde stürzte etwas heftig gegen die Bank.
Der Zweitgrößte hob die Arme gen Himmel, streckte sich, daß es in allen Gliedern knackte, und rief gleichfalls: »Gott sei Dank, große Ferien!«
Der Älteste, dem man es deutlich ansah, daß er auch gern für ein paar Augenblicke den Kreisel gespielt hätte, der aber offenbar eine solche Bewegung doch nicht für vereinbar mit seiner Primanerwürde hielt, blickte leuchtenden Auges auf die weite, sonnenbeglänzte Wasserfläche hinaus, die vor ihnen lag.
Der Zug fuhr gerade über die Lombardsbrücke, die wie ein Tintenstrich inmitten einer leeren Heftseite die Außen-Alster von der Binnen-Alster trennt. Auf den weiten Gewässern sah man Fahrzeuge aller Art sich tummeln. Da fuhren die Wasseromnibusse Hamburgs, die kleinen Alsterdampfer, und zogen leuchtende Streifen hinter sich, die wie Falten der seidenen, mit Brillanten und Perlen geschmückten Schleppe einer Königin aussahen. Schlanke Boote, mit weißgekleideten Ruderern besetzt, durchschnitten messerscharf die Wasserfläche. Am schönsten jedoch waren die Segelboote anzusehen, deren von der Sonne überstrahlte weiße Leinwandflächen sich zwischen den anderen Fahrzeugen wiegten wie die königlichen Märchenschwäne zwischen den Graugänsen.
Raschen, strahlenden Blicks fing der Primaner dieses bewegte Sommertreiben auf dem Wasser mit seinem Auge ein. Er mußte sich beeilen, das Bild festzuhalten, denn schon verschwanden leuchtende Wasserfläche, Dampfer und Boote; dunkle Häuserwände ragten zu beiden Seiten der Bahnstrecke empor. Der Zug hatte die kurze Lombardsbrücke rasch überfahren und tauchte nun in das Häusermeer der großen Stadt hinein.
»Donnerwetter, Kinder,« sagte Dietrich, der Älteste, indem er seine von der Sonne geblendeten Augen für ein paar Sekunden schloß, zu seinen Brüdern, »Donnerwetter, Jungens, wenn man so etwas sieht, dann kriegt man ordentliches Reisefieber!«
»Hoho,« rief Peter, der Jüngste in der kleinen Gesellschaft, der noch immer seinen von dem Stoß gegen die Bank getroffenen Oberschenkel rieb, »Reisefieber habe ich schon den ganzen Tag! Ich habe während der Schulstunden heute überhaupt an nichts anderes gedacht als ans Reisen!«
»Na,« sagte Johannes, »das ist doch klar! An einem so schönen Tag, und wenn noch dazu gerade die großen Ferien anfangen, müßte man ja ein schöner Schafskopf sein, wenn man sich wirklich mit Dezimalbrüchen und solchem Quatsch beschäftigen wollte, statt an die Alpen, den Schwarzwald oder sowas zu denken.«
Peter puffte seine Büchermappe in eine Ecke. »Pass' mal auf,« sagte er zu dem ledernen Behältnis, »was ich mit dir machen werde! Wenn wir zu Hause sind, werfe ich dich in den Schrank und sehe dich fünf Wochen lang nicht ein einziges Mal an.«
»Ach, Jungens, ihr habt's gut,« sagte Dietrich und gähnte mächtig. »Ihr könnt so ziemlich die ganzen Ferien durch bummeln. Aber wenn man erst in Prima ist,« – und er setzte sich würdevoll zurecht – »darf man sich das nicht mehr leisten. Übernächstes Jahr kommt das Examen, und da muß man so furchtbar viel wissen, daß man schon jetzt überhaupt nicht mehr von den Büchern wegkommt. Ach, in der Prima hat man's wirklich schwer!«
»Spiele dich bloß nicht so auf,« rief Johannes. »Was, glaubst du, wird alles verlangt, wenn man nach Obertertia kommen will. Das hast du wohl schon wieder vergessen!«
Peter, der sich offenbar vor Lust nicht zu lassen wußte, war indessen auf die eine Bank geklettert und machte Turnübungen am Gepäcknetz, obgleich doch so etwas streng verboten ist. »Ich möchte bloß wissen, wohin wir nun reisen werden,« fragte er zwischen zwei Klimmzügen.
»Ja,« antwortete der Primaner Dietrich, »ich denke Berchtesgaden oder Titisee im Schwarzwald. Na, wir werden's ja bald erfahren.«
»Peter,« rief Johannes, »lass' doch endlich das dumme Turnen sein. Du wirst mir noch mit deinem Stiefel ein Auge ausstoßen!« Und als der Kleine doch mit dem Herumstrampeln nicht aufhören wollte, packte ihn Johannes bei den Beinen und zog daran so lange, bis Peter die Stange des Gepäcknetzes loslassen mußte und ziemlich unsanft auf der Bank landete.
»Frech ist das von dir,« sagte er zu seinem Bruder. Aber dann begann er, da Stillsitzen offenbar ganz unmöglich war, zu singen:
Das Wandern ist des Müllers Lust, Das Wandern ist des Müllers Lust, Das Wandern.
Dietrich sah ihn mißbilligend an, denn die Melodie war nicht ganz richtig. Aber es kam zu keiner weiteren Auseinandersetzung, denn schon näherten sie sich dem Bahnhof Blankenese, wo die Brüder aussteigen mußten.
Als der Zug bereits ganz langsam fuhr, steckte Johannes den Kopf aus dem Fenster. Blitzschnell fuhr er wieder zurück. »Da steht ja Vater auf dem Bahnsteig,« rief er, »mit Urselchen an der Hand! Was hat das wohl zu bedeuten?«
Dietrichs Gesicht verfinsterte sich. »Mir ahnt nichts Gutes. Wenn nur Mama gesund ist!«
Und nun ergriffen sie ihre Büchermappen und sprangen heraus. Dietrich hatte den Drücker in die Hand genommen und als der Vernünftigste unter den Dreien die Tür so lange zugehalten, bis der Zug wirklich stillstand. Denn die neugierigen Jüngeren wären sonst wohl schon vorher hinausgeklettert.
Die kleine Ursula kam ihnen entgegengelaufen und kriegte von jedem ihrer Brüder einen Kuß. Aber er fiel sehr flüchtig aus, denn man wollte möglichst rasch zum Vater, um zu hören, weshalb er wohl bis auf den Bahnhof gekommen sei.
Die Hüte flogen vom Kopf, und jeder schüttelte dem Vater die Hand.
»Gut habt ihr's heute, ihr Jungens,« sagte der, »ich brauche euch nicht nach den Zeugnissen zu fragen. Als ich in die Schule ging, gab's auch noch zu den großen Ferien solche, und es soll hier und da vorgekommen sein, daß dadurch die Ferienfreude etwas gedämpft wurde. Ihr aber bekommt ja nur noch dreimal im Jahr Zeugnisse.«
Die Knaben sagten nichts, sondern sahen den Vater nur erwartungsvoll an, während sie nun zusammen im lachenden Sonnenschein über die Straßen ihrer Wohnung zuschritten. Ursula, die Sechsjährige, trabte voran, denn ein zitronengelber Schmetterling gaukelte vor ihnen her, den sie gar zu gern mit ihren kleinen Händen greifen wollte.
Der Vater, der die Frage wohl in den Augen seiner Kinder gelesen hatte, schritt nachdenklich dahin. Endlich aber sagte er: »Ihr seid wohl neugierig, weshalb ich euch bis zum Bahnhof entgegengekommen bin?«
»Ja, Vater,« erwiderte Dietrich, »das sind wir.«
»Heute vormittag war der Herr Doktor Hansen bei uns und hat Mutter noch einmal untersucht. Ihr wißt ja, daß sie sich in der letzten Zeit nicht so ganz wohl gefühlt hat. Leider hat er festgestellt, daß ihr Ruhe unbedingt notwendig ist. Längere Abwesenheit von Hause hat er ihr strengstens verboten.«
Aus Dietrichs Brust kam ein tiefer Seufzer, und seine Augen, mit denen er zu Johannes hinüberblickte, sagten deutlich: »Habe ich es nicht geahnt?«
Johannes holte indessen das Taschentuch hervor und trompetete hinein, damit man nicht sehen solle, daß Feuchtigkeit jäh in seine Augen geschossen war. Peter blickte nur fragend empor, denn er wußte noch nicht ganz genau, was das alles zu bedeuten hatte.
»Wollen wir nun reisen und Mutter allein hier lassen?« fragte der Vater.
Eine Antwort erfolgte nicht. Denn daß man die leidende Mutter verlassen sollte, um sich zu unterhalten, während sie sich bangte, war natürlich so vollkommen ausgeschlossen, daß es keiner Erörterung bedurfte.
Auch Peter war inzwischen das Verständnis für die Sachlage aufgegangen. Er vermochte sich nicht zu beherrschen, er seufzte »Ach Gott!« und begann zu weinen.
Der Vater faßte den jüngsten Sohn um die Schultern, zog ihn zu sich heran und sprach: »Es tut mir selbst furchtbar leid für euch und auch für uns. Wir hatten uns ebenfalls sehr auf die Reise nach Berchtesgaden gefreut. Aber diesmal soll es nicht sein. Ihr müßt tapfer sein und euch nicht grämen! Ich bin zum Bahnhof gekommen und habe euch die Nachricht dorthin gebracht, damit ihr Zeit habt, euch zu beruhigen, bis wir wieder zu Hause sind. Mutter darf nichts davon merken, daß ihr traurig seid. Als sie den Ausspruch des Arztes hörte, galt ihr erster Gedanke nicht ihrem schwächlichen Gesundheitszustand, sondern euch Kindern. Fast hätte sie geweint, weil sie schuld daran ist, daß ihr um eure schöne Ferienreise kommt. Ihr wißt ja, wie gut sie ist.«
Die Kinder sagten noch immer nichts, und der Vater fuhr fort:
»Ich habe mir's wohl gedacht, daß es euch recht zu Herzen gehen wird, aber ich habe doch mancherlei Trost mitgebracht. Mutter ist sicher bis zum Winter wiederhergestellt. Ich verspreche euch, daß wir dann während der Weihnachtsferien zum Rodeln in die Berge fahren werden. Und auch jetzt in den großen Ferien sollt ihr nicht leer ausgehen. Haben wir doch den schönen Garten bei unserem Landhaus zur Verfügung, in dem ihr euch nach Herzenslust tummeln könnt. Wie prächtig es darin ist, wißt ihr noch gar nicht so recht, denn wir sind ja erst im letzten Herbst aus Braunschweig hierher gezogen, und während des Mai und Juni hat euch die Schule ja nie so recht Zeit gelassen, den Garten auszunutzen.«
»Sicher hast du recht, Vater,« sagte nun endlich Johannes, und seine Stimme zitterte ein wenig. »Aber so hübsch unsere Besitzung auch ist, schöner muß es doch sein, fremde Gegenden zu durchreisen und kennenzulernen.«
»Nun, auch da will ich euch helfen!« sprach der Vater. »Sicherlich ist es unterhaltend und belehrend zugleich, wenn man reist und sich eifrig umsieht. Aber nicht unbedingt muß der Körper sich auf Reisen begeben. Auch mit dem geistigen Auge kann man Fremdes schauen und kennenlernen, wobei noch das Gute hinzukommt, daß man die fernsten Länder aufzusuchen vermag, ohne sich allzu große Mühe zu machen und viel mehr Zeit zu verlieren, als eure Ferien euch lassen.«
»Wie meinst du das, Vater?« fragte Peter.
»Ich will dafür sorgen, daß ihr fremde Länder kennenlernt und viel Fesselndes dabei erschaut, ohne daß wir Mutter zu verlassen brauchen. Ich habe mir vorgenommen, mich während der Ferien jeden Nachmittag einige Stunden lang für euch frei zu machen und euch etwas zu erzählen. Ich weiß auch schon, was das sein soll, und ich bin sicher, daß ich eine gute Wahl getroffen habe.«
Nun hoben sich die Köpfe der drei Knaben wieder, die lange gesenkt gewesen waren, so daß sie von dem jubelnden Sonnenschein um sie her und der lachenden Pracht gar nichts mehr wahrgenommen hatten. Die Winterrinde, welche die Enttäuschung um ihre jungen Herzen gelegt hatte, begann zu schmelzen. Lustig blickten sie zwar immer noch nicht drein, aber man merkte doch, daß sie die Erfüllung eines langgehegten Wunschs vor sich sahen.
»Wenn du uns etwas erzählen willst, Vater, wird es sicher sehr schön sein,« sagte Johannes.
»Und noch dazu, wenn es so lang ist wie die ganzen großen Ferien,« fügte Peter bei.
Dietrich dachte daran, wie oft er sich eine recht ausführliche Unterhaltung mit dem Vater gewünscht hatte. Bei den gemeinschaftlichen Spaziergängen hatte er häufig genug bemerkt, daß er sich mit niemandem so gut unterhalten konnte wie mit dem Vater. Keiner verstand so gut, zum Fragen anzuregen, und keiner gab so klare und verständliche Antworten, niemand war so geduldig beim Erklären wie der Vater. Oft genug hatten er und Johannes ihn gebeten, doch einmal ein besonders hübsches und spannendes Thema, das sie bei einem Spaziergang begonnen hatten, ausführlich mit ihnen durchzusprechen. Der Vater hätte gern diesen Wunsch erfüllt, aber niemals war es ihm in Braunschweig möglich gewesen, hierfür Zeit zu finden. Unausgesetzt saß er an seinem Schreibtisch in dem schönen Arbeitszimmer, dessen Wände ganz von Bücherreihen bedeckt waren. Und die Mutter hatte oft Mühe genug, ihn nur für die Mahlzeiten von der Arbeit abzuziehen.
Jetzt, seitdem sie in das Landhaus bei Hamburg gezogen, war es, wie sie bereits gemerkt hatten, damit schon etwas besser geworden. Der Vater hatte hier mehr Zeit. Was er jetzt gesagt hatte, brachte aber erst die Erfüllung still gehegter Hoffnungen.
Der Primaner blieb stehen und küßte den Vater. »Du bist gut zu uns,« sagte er, »und es wäre häßlich, wenn wir jetzt noch betrübt sein sollten. Nicht wahr, Johannes und Peter? Im Winter geht's in die Schneeberge, und jetzt will uns Vater etwas Schönes erzählen. Da brauchen wir Mutter doch nicht mehr merken zu lassen, daß wir traurig gewesen sind.«
Johannes sagte laut und vernehmlich »Ja!«, der kleine Peter schien aber doch noch nicht so ganz zufriedengestellt. Er mußte sich erst noch weitere Gewißheit verschaffen. »Was willst du uns denn erzählen, Vater?« fragte er.
»Ich habe etwas gewählt, das uns weit hinausträgt – bis in ferne Erdteile. Von unserem Garten aus können wir ja die Schiffe auf der Elbe hinausfahren sehen ins Meer. Eins von ihnen werden wir in Gedanken begleiten, einem Fahrgast darauf werden wir uns zugesellen, und ich verspreche euch, daß die Erlebnisse, die er haben wird, nicht die langweiligsten sein sollen. Mehr will ich vorläufig nicht sagen. Ihr werdet ja bald Näheres erfahren, da wir schon heute nachmittag mit der Erzählung beginnen wollen.«
Die kleine Ursula kam herbeigesprungen, denn sie waren vor ihrem Haus angelangt, und es bestand keine Hoffnung mehr, den Schmetterling einzufangen.
»Also, Jungens, tapfer!« sagte der Vater. »Daß Mutter nichts von eurer Betrübnis merkt!«
»Wir sind ja gar nicht mehr betrübt,« riefen sie alle drei zu gleicher Zeit.
»Das wäre ja auch schrecklich undankbar von uns,« fügte Johannes noch hinzu und drückte dem Vater warm die Hand.
Dann traten sie ein, küßten die Mutter, die etwas blaß, aber doch nicht wirklich krank auf dem Sofa lag, und ihre Gesichter strahlten.
Kaum konnten sie erwarten, bis das Mittagbrot gegessen, und der Vater von seinem kurzen Schläfchen aufgestanden war. Gleich einem Sturmwind stürzten die Knaben in den Garten hinaus, der Vater folgte bedächtigen Schritts und setzte sich in den Armstuhl. Jeder von den Knaben holte sich einen der neuen, weiß gestrichenen Gartenstühle. Ursula hatte sich ein Fußbänkchen aus dem Zimmer mitgebracht und ließ sich zu Füßen des Vaters darauf nieder.
Es war wirklich ein wunderschöner Platz, an dem die kleine Gesellschaft nun versammelt war. Ein mächtiger Lindenbaum breitete seine schattige Krone über den Tisch, der in der Mitte der Gruppe stand. Rankengewächse, an weißen Spalierstangen gezogen, schlossen in angenehmster Weise den Blick nach rechts und nach links ab. Im Hintergrund erhob sich die Terrasse vor dem Haus. Das Geländer war überwuchert von prächtig blühenden Blumen, die in großen Büscheln aus den Töpfen hinabfielen. Als ein großes schwarzes Rechteck zeichnete sich in der sonnenbeschienenen Hauswand der Eingang in das große Gartenzimmer ab, in seinem Dunkel Kühlung versprechend für solche Nachmittage, an denen es draußen trotz des Baumschattens zu heiß werden würde. Ein Duft von Rosen und Reseden drang aus den ferneren Teilen des Gartens hinüber.
Vor den Sitzenden aber weitete sich ein prächtiges Landschaftsbild. Der Garten lag auf dem Rücken eines der ziemlich hohen Hügel, wie sie sich am Elbufer in der Nähe von Blankenese hinziehen. In Terrassen stiegen blumige Wiesen hinunter bis dort, wo der Hügel in jähem Absturz zur Elbe niederging. Lautlos wälzte der mächtige Fluß seine Wogen. Müde strebten sie nach langem, langem Weg durch das deutsche Land der Ruhe im Weltmeer entgegen.
Während auf der Alster ein lustiges Getümmel von Fahrzeugen zu sehen gewesen war, erblickte man auf diesem Wasser ernste Geschäftigkeit. Schiffe aller Art und aus aller Herren Ländern zogen in rascher Folge vorbei. Die einen fuhren mit lustig flatternden Wimpeln hinaus, andere strebten elbaufwärts dem Schutz des großen Hamburger Hafens zu. Riesige Dampfer ließen mächtige Rauchfahnen emporwirbeln, kleine Schlepper wühlten das Wasser auf und zogen große Segelschiffe hinter sich her, die hier im Land nicht mehr genügend Wind finden konnten, um ihre weißen Schwingen zu entfalten.
»Gibt es einen schöneren Platz, um von fernen Ländern zu erzählen?« fragte der Vater, »müssen wir nicht glücklich sein, daß wir reisen und trotzdem auf diesem schönen Erdenfleck verweilen können?« Schweigend stimmten alle zu. Und der Vater fuhr fort:
»Ich will meine Erzählung nun gleich anfangen, vorher möchte ich euch aber noch folgendes sagen. Ihr wißt, daß es euch strengstens verboten ist, zu unterbrechen, wenn euer Vater, eure Mutter oder ein anderer Erwachsener spricht. Wir merken wohl, daß das Schweigen euch Kindern oft schwer fällt, haben aber gerade darum großen Wert darauf gelegt, euch hierfür zu erziehen, weil ein solcher Zwang ein besonders gutes Mittel ist, Selbstbeherrschung zu lernen. Bei meiner Erzählung aber soll eine Ausnahme von dieser sonst so streng festgehaltenen Regel stattfinden. Wenn ich etwas sagen sollte, was ihr nicht gleich versteht, so dürft ihr um nähere Erklärung bitten. Ich werde mich sogar über solche Unterbrechungen, wenn sie verständig sind, freuen. Denn die Fragen werden mir zweierlei zeigen. Einmal, daß ihr aufmerksam seid, und zweitens, daß meine Erzählung euch fesselt. Denn im Kopf eines jeden Menschen, der mit Aufmerksamkeit einer ihn wirklich packenden Darlegung folgt, müssen eigene Gedanken entstehen. Es wird ihm im Anschluß daran dies und jenes in den Kopf kommen, woran der Erzählende nicht denkt, und er muß den Willen haben, sich darüber zu unterrichten. Fragt also nur tapfer darauf los, ich werde gern antworten.«
»Oh, das ist fein,« rief Peter, »ich werde sicher viel zu fragen haben!«
»Bedenke immer, mein Kind, daß die Frage verständig sein und zur Sache gehören muß.«
Auch Dietrich und Johannes nickten beifällig mit den Köpfen, und Ursula sah aus, als bereite sie sich schon jetzt auf eine besonders kluge Frage vor. Der Vater streichelte dem Nesthäkchen das aufgeregte Gesicht.
Der Wind bewegte leise die Blätter der großen Linde. Drunten auf dem Fluß glitten ein mächtiger Personendampfer, offenbar ein Amerikafahrer, der heimkam, und ein ausreisender, niedriger Frachtdampfer aneinander vorbei. In den Spalieren des Gartens wiegten sich ein paar Vögel auf den Ranken. Die Sonne, welche durch die Blätter fiel, zeichnete seltsame Lichtgestalten auf die Tischplatte. Kein Laut aus der geschäftigen Welt drang bis zu dem kleinen Kreis.
Und die Erzählung begann.
Erster Nachmittag
Vater:In Hamburg lebte gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ein Ehepaar, das drei Söhne hatte. Der Jüngste war ihnen geschenkt worden, als die anderen beiden schon beinahe herangewachsen waren, und so stand er ihrem Herzen am nächsten.
Das Unglück wollte es, daß die beiden anderen ums Leben kamen, bevor sie noch das Mannesalter erreicht hatten. Der älteste der Brüder war, als er gerade im Heer diente, einem Aufruf seines Generals gefolgt, in dem Freiwillige zur Niederkämpfung eines Negeraufstands gesucht wurden, und in eines der afrikanischen Länder gezogen, die, wie ihr wißt, den Deutschen gehören. In einer Schlacht hatte ihn einer der Schwarzen erstochen. Der zweite der Brüder hörte, daß man auf einer Halbinsel im fernsten Westen von Nordamerika Gold finden könne, und er war hinübergefahren, um auf diese Weise leicht, wie er meinte, zu Reichtum zu gelangen. Aber was er fand, waren nicht Goldklumpen, sondern der Tod.
So war den Eltern nur noch der Jüngste geblieben, und ihr könnt euch denken, daß sie ihn nun über alles liebten. Leider aber handelten sie an ihrem Kind nicht so, wie es recht gewesen wäre. Statt in ihrer großen Liebe alles daran zu wenden, aus dem Jungen einen tüchtigen Menschen zu erziehen, bemühten sie sich lediglich, ihm alles so angenehm und bequem wie möglich zu machen.
Sie achteten nicht darauf, daß er in der Schule ordentlich lernte, daß er seinen Körper abhärtete und aus eigenen Erfahrungen das Dasein auch von seiner weniger angenehmen Seite kennenlernte, vielmehr ließen sie ihn faulenzen, ein weichliches Leben führen und räumten ihm alles aus dem Weg, was ihn verdrießen konnte.
Die Folge war, daß der Knabe zu einem rechten Nichtsnutz heranwuchs. Er hatte nichts Ordentliches gelernt, wußte sich ins Leben nicht recht zu schicken und ging allen Dingen aus dem Weg, von denen er irgendwie annehmen konnte, daß sie ihm unangenehm werden könnten. Trotzdem war er ein geweckter Junge, aus dessen Augen man oft ein kluges Feuer herausleuchten sah. Insbesondere war dies immer dann der Fall, wenn er Gelegenheit hatte, einen Handwerker bei seinem Treiben zu beobachten. Wo er konnte, schlüpfte er in eine Werkstatt, sah zu, wie der Zimmermann seine Bretter behaute, wie die Maurer Ziegel für einen Hausbau aufeinanderlegten, wie der Schmied das Eisen schlug und der Korbmacher die Weiden flocht. Aber seine unrichtige Erziehung ließ nie den Gedanken in ihm aufkommen, nun selbst ein Handwerk zu ergreifen. Andere arbeiten zu sehen, war ihm ein Vergnügen, er selbst aber hatte keine Lust dazu.
Selbstverständlich nahm ein Junge solcher Art jede Gelegenheit wahr, sich in den mächtigen Anlagen des Hamburger Hafens zu tummeln, wo so viel zu sehen ist. Zeit genug hatte er ja dazu, nachdem er mit vierzehn Jahren die Schule verlassen hatte, und die Eltern es nicht über ihr Herz bringen konnten, ihn zum Ergreifen eines Berufs zu zwingen.
Es gibt wohl wenige Orte auf der Erde, die das Gemüt eines Knaben so stark anzuregen vermögen wie der Hamburger Hafen. Das wißt ihr ja selbst von den wenigen Besuchen, die wir bisher dort machen konnten. Ich will euch gleich versprechen, daß wir während der Ferien hier und da einmal hinunterfahren und uns alles möglichst genau betrachten wollen.
Peter:Oh, das ist fein, Vater!
Johannes:Ach ja, ich wollte dich schon immer darum bitten. Aber deine große Erzählung darf dadurch nicht gestört werden.
Ursula:Ich will aber nicht wieder zu Hause bleiben, wenn ihr zu den vielen Schiffen fahrt!
Vater:Nein, mein Liebling, wir werden dich bestimmt mitnehmen. Jetzt, wo du bereits ein Vierteljahr lang in die Schule gehst, bist du ja schon gescheit genug, um manches verstehen zu können.
Ursula:Ach ja! ach ja!
Vater:Es ist da drunten mancherlei zu sehen. Der Hafen von Hamburg ist einer der allergrößten auf der Erde. Die breite Elbe gestattet selbst den mächtigsten Schiffen, bis zur Stadt hinaufzufahren. Und was wir hier vor unseren Augen auf dem Fluß hinauf- und hinabgleiten sehen, sind Fahrzeuge, die von allen Teilen der Erde herkommen und in alle Meere hinausfahren.
Unser Junge, der Robinson hieß, erblickte also in dem Hafen Schiffe aller Größen. Neben den kleinen Elbkähnen, die von den Flüssen des Binnenlandes herkommen, erschienen ihm die gewaltigen Bauten der Ozeanfahrer um so riesenhafter. In unabsehbarer Fülle sah er Masten und Schornsteine vor seinen Augen aufragen. Ein fast undurchdringlicher Qualm lag damals wie auch heute ständig über dem Hafen. Wie ein Schleier überdeckt er all die eigenartigen Gebilde, die dort aus dem Wasser ragen, und auch die Bauten an den Ufern. Unzählige Maler haben schon versucht, dieses wunderschöne Hafenbild mit der verschleierten Luft festzuhalten. In unserem Eßzimmer hängt ja auch ein schönes Gemälde dieser Art.
Wohin es den jungen Robinson besonders zog, waren jedoch nicht die Hafenteile, in denen die Dampfer liegen, sondern eine andere Stelle, dort wo die Segelschiffe ihre prächtigen Masten emporrecken. Mehrere seiner Schulkameraden waren nämlich Schiffsjungen geworden und auf Segelschiffen hinausgefahren. Robinson wollte ein gleiches auch schrecklich gern tun, aber Schiffsjunge zu werden, hatte er keine Lust, weil er dann hätte arbeiten müssen. Die Segelschiffe aber nahmen, wie er gehört hatte, schon für geringes Geld Fahrgäste mit. Und als ein solcher wollte er sich bequem die Welt ansehen. Was er rings um sich erblickte, war auch geeignet genug, ihn hinauszulocken. Denn fast die ganze Erde sendet ja ununterbrochen ihre Boten nach dem Hamburger Hafen.
In den riesenhaften Speichern und auf den hölzernen Bollwerken davor sieht man Gummiballen aus dem Innern Südamerikas, herrliche Früchte aus Kalifornien, Straußenfedern und Elfenbein aus Afrika, ungeheure Säcke mit Reis gefüllt, der in China gewachsen ist, Getreide, das bis aus Australien hergebracht ist, Teppiche aus Persien, Salpeter aus Chile, Walfischtran und Fischbein aus den Ländern nahe am Nordpol, Kokosnüsse, die in der heißen Zone gereift sind. All dies wird fortwährend aus den Bäuchen der Schiffe ausgeladen, und welcher nur ein bißchen gescheite Junge sollte in sich nicht die Sehnsucht fühlen, die Länder kennenzulernen, welche all diese prächtigen Dinge hervorbringen!
Peter:Ich wollte es dir eigentlich noch nicht sagen, Vater, aber seit wir damals im Hafen waren, möchte ich nichts anderes werden als Schiffsjunge.
Johannes:Und ich Maschinenputzer auf einem großen Amerikadampfer.
Vater:Na und du, Dietrich, willst du auch zur See?
Dietrich:Gewiß möchte ich das, aber ich warte, bis ich mir selbst genügend Geld verdient habe, um einen Platz bezahlen und als Passagier hinausfahren zu können.
Ursula(weinend): Ach, Vater, dann werden sie ja bald alle von uns fort sein!
Vater:Das hat doch, wie ich denke, noch gute Weile. Dietrich muß erst das Examen machen und sich einen Beruf schaffen. Und was Johannes und Peter anbetrifft, so glaube ich, werden sie ihre Anschauungen über das Seefahren als Schiffsjunge und Maschinenputzer wohl noch etwas ändern. Es wird ihnen, wenn sie älter geworden sind, nicht so ganz einfach erscheinen, das Elternhaus ohne zwingenden Grund frühzeitig zu verlassen. Wir haben euch ja glücklicherweise anders erzogen, als es bei Robinson geschehen war. Ihr wißt schon heute, während die meisten von euch noch so viel jünger sind als jener, daß ohne Arbeit auf der Welt nichts zu erreichen ist, daß man sich überall bemühen muß, und daß die gebratenen Tauben keinem in den Mund fliegen. Schiffsjungen und andere untergeordnete Kräfte auf Seefahrzeugen haben ganz besonders schwere Arbeiten zu leisten. Gewiß gibt es Menschen, die derartige Verrichtungen gern tun und besonders dazu geeignet sind. Wo sollten auch sonst all die tüchtigen Matrosen und Kapitäne herkommen, die alle auf kleinstem Posten anfangen müssen. Aber bei euch ist es doch noch nicht erwiesen, daß ihr hierzu paßt, und so wollen wir mit der Entscheidung über eure Berufe warten, bis wir uns ganz klar über eure Eigenschaften geworden sind.
Derartiges wurde Robinson von seinem Vater leider nicht gesagt. So konnte es denn kommen, daß er dem Zureden eines seiner Schulkameraden folgte, der auf einem Segelschiff schon einmal in England gewesen und nun wieder zurückgekommen war, und beschloß, aufs Schiff zu gehen, ohne seine Eltern überhaupt davon in Kenntnis zu setzen.
Peter:Das ist aber häßlich von Robinson, einfach wegzulaufen! Wie konnte er so etwas tun, wo die Eltern doch stets so gut zu ihm waren!
Vater:Es muß doch wohl nicht die richtige Liebe gewesen sein. Wir sind weit strenger zu euch, und ihr würdet uns doch solchen Kummer niemals machen.
Peter:Nein!
Johannes:Gewiß nicht!
Vater:Da könnt ihr also sehen, daß Eltern, die ihre Kinder in richtiger Weise lieben, ihnen nicht alle Wünsche erfüllen dürfen, sondern die Aufgabe haben, das kindliche Gemüt, dem es nicht gegeben ist, alles zu übersehen, richtig zu führen. Freude und Pflichterfüllung müssen im Leben des Kindes gemischt sein, so ist die Welt nun einmal eingerichtet.
Robinson steckte also eines Tages alle Ersparnisse zu sich, die er von seinem Taschengeld gemacht hatte, ging an Bord eines Segelschiffs, das den Kurs nach England nehmen sollte, und gab dem Kapitän das Geld, damit er ihn mitnähme. Dieser strich die Summe ein, die für ihn genügend war, um Robinson als Gast mitfahren zu lassen. Bald wurden die Taue gelöst, die das Schiff am Ufer festhielten, und die Reise begann. Sie sollte sehr viel länger dauern und ganz anders ausfallen, als Robinson es sich gedacht hatte.
Ein Schlepper legte sich vor das Schiff und zog es hinaus. Es war ein nicht allzu stattlicher Zweimaster von der Größe etwa wie der, welchen ihr jetzt gerade dort unten vorüberziehen seht. Die Bemannung bestand nur aus achtzehn Köpfen. Alle Räume auf dem Schiff waren klein und unbequem. Aber darum kümmerte sich Robinson nicht. Seine Augen glänzten vor Wanderlust, er stellte sich an die Spitze des Schiffs und schaute immer voraus.
Zunächst ging es noch recht langsam, da der Segelschiffhafen ganz oben, schon fast hinter Hamburg, von hier aus gesehen, liegt. Sie mußten sich erst zwischen all den Schiffen durchwinden, die den Hafen belebten. Und das waren nicht wenige. Ist doch das Wasser der Elbe im Hafengebiet durch die vielen Fahrzeuge, die unausgesetzt darauf hin und her fahren, den ganzen Tag so aufgewühlt wie das Meer bei heftigem Wind. Die Wellen schlagen ständig über die Spitzen der kleinen, grünen Dampfer, die als Fährboote die zahlreichen wichtigen Punkte des Hafengebiets miteinander verbinden. Dazwischen laufen die ankommenden und ausgehenden Frachtdampfer, die riesigen Prachtbauten der Personenschiffe, große Lastkähne mit Kohlen werden zu den Werften und Anlegeplätzen gefahren, Fischdampfer bringen ihre Ladung zu den Schuppen am Ufer, kreuz und quer sieht man ein unaufhörliches Kommen und Gehen von Schiffen. Dieses Bild, das jeden entzückt, der es noch nicht kennt, wie es ja auch uns vor wenigen Monaten begeistert hat, war für Robinson natürlich nichts Neues. Erst nachdem sie hier bei Blankenese vorüber und der Elbmündung näher gekommen waren, als der Schlepper das verbindende Drahtseil abgeworfen hatte und davongefahren war, der Segler seine weißen Schwingen entfaltet hatte, da begann unser Reisender, noch nicht Gesehenes zu schauen.
Macht die Elbe schon hier vor uns einen mächtigen Eindruck, so wächst dieser, je mehr man sich Cuxhaven nähert, immer stärker an. Diese Stadt ist der letzte größere Ort vor der Ausmündung des Stroms ins Meer. Manche der allergrößten Schiffe, denen es doch schon ein wenig schwer fällt, bis nach Hamburg hineinzufahren, gehen von hier ab. Wer in diesem Ort am Flußrand steht, kann das gegenüberliegende Ufer nicht mehr sehen. Die Elbe ist hier bereits fast fünfzehn Kilometer breit, ihre Mündung stellt also beinahe einen Meerbusen dar. Der Unerfahrene merkt bei stillem Wetter gar nicht, wann er den Fluß verläßt und die freie See gewinnt. Als letztes Merkmal des festen Landes grüßt der kurze, fest aufgemauerte Leuchtturm bei dem Dörfchen Neuwerk hinaus.
Bevor noch fremdes Land vor seinen Augen auftauchte, sah Robinson jetzt bald ein Werk der Natur, das so schön und eigenartig ist, wie man es vor der kargen deutschen Küste nicht vermuten sollte. Nachdem sie mehrere Stunden bei glatter See gefahren und das Festland aus den Augen verloren hatten, stieg unvermittelt aus dem Meer ein hoher, roter Felsen vor ihnen auf.
Johannes:Oh, das ist Helgoland!
Vater:Niemand, der diese Insel jemals gesehen, kann sie wieder vergessen, und auch Robinson dachte später noch oft an dieses letzte Stück deutscher Erde zurück, das er bei seiner Ausfahrt erblickt hatte. Wie eine rote Ziegelwand hebt sich der Felsen bis zur Höhe von dreiundsechzig Metern steil aus den Wellen. Wütend und feindlich nagen die Wogen an dem nicht allzu harten Gestein, um diesen Fetzen festen Landes, der sich mitten in ihre ewige Beweglichkeit verloren hat, zu zerstören. Mächtige Anlagen sind notwendig gewesen, um den Felsen zu erhalten, denn Wasser hat eine starke nagende Kraft und vermag sogar Felsengebirge abzutragen, worauf wir vielleicht noch später zu sprechen kommen werden.
Helgoland gehörte früher den Engländern, ist aber seit dem Jahre 1890 deutsch geworden. Wir haben den Engländern dafür das Gebiet von Sansibar in Ostafrika gegeben. Wie der Lindwurm vor der Grotte, die den Nibelungenschatz birgt, liegt die Insel vor der Elbmündung. Die auf dem hohen Felsen aufgestellten riesigen Kanonen, die mit zu den größten gehören, die es überhaupt gibt, verteidigen die Einfahrt nach Hamburg.
Aber auch in friedlichen Zeiten hat Helgoland eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Auch das sollte Robinson wahrnehmen.
Nachdem sie an der Insel vorbeigefahren waren, und er staunend an dem Tonsteinfelsen hinaufgeblickt, auch die einsame, von den Wogen bereits abgetrennte Felspyramide des Mönch gesehen hatte, ging die Sonne unter. Die Insel erschien nun mit wunderbaren Farben übergossen. Die noch von der Sonne getroffenen Wände leuchteten, als wären sie in Feuersglut getaucht, die im Schatten liegenden sahen schwarz wie Kohle aus. Dann versank das Eiland fast zugleich mit der Sonne vor Robinsons Blicken.
Aber als er noch immer weiter zurückschaute, erschrak er plötzlich. Denn ein scharfes Licht, so hell etwa, wie es die Sommersonne am Mittag versendet, hatte seine Augen getroffen, so daß er sie geblendet schließen mußte. Sogleich war das Licht wieder verschwunden. Schon dachte er, daß er sich getäuscht hätte, aber gleich tauchte es wieder auf. Und so ging es nun fort. Abwechselnd sah er die Schiffsmasten in hellstem Licht plötzlich aus der immer tiefer werdenden Finsternis auftauchen, dann waren sie wieder jäh im schwarzen Dunkel verschwunden.
Johannes:Eigentümlich, Vater, das war wohl ein Zauberschiff, auf dem Robinson fuhr?
Vater:Nein, dieser Lichtzauber hatte in Wirklichkeit keine geheimnisvollen Ursachen, er ging vielmehr von dem mächtigen Leuchtturm aus, der auf Helgoland steht. Dieser ist so eingerichtet, daß jedes Schiff, welches in einer Entfernung bis zu sechzig Kilometern und mehr durch die Nacht bei Helgoland vorbeifährt, alle fünf Sekunden von einem Lichtstrahl getroffen wird. Die mächtigen Strahlen werden von drei ungeheuren Laternen erzeugt, die sich ständig mit ziemlich großer Geschwindigkeit drehen und so die ganze Wasserfläche ableuchten. Die Umdrehung der Laternen ist so eingerichtet, daß diese ihr Licht immer nur eine Zehntelsekunde lang nach einem Punkt senden. Darauf wird es dort dunkel, und nach Ablauf von fünf Sekunden folgt dann wieder ein Lichtblitz. Das Leuchten ist so stark, wie wenn man zehn Millionen Kerzen entzündet hätte. Eine so gewaltige Lichtfülle vermag nur elektrisches Licht hervorzurufen, so wie es in unseren Bogenlampen brennt, und auch dies nur, wenn es durch dahintergesetzte, besonders geschliffene Spiegel verstärkt wird.
Ein Matrose, den Robinson fragte, erklärte ihm denn auch sofort die Herkunft des seltsamen, fortwährend über das Schiff huschenden Lichts, denn die Leuchtfeuer, wie der Seemann sagt, sind selbstverständlich allen Schiffsleuten bekannt. Sie werden ja nur für sie angezündet und leisten ihnen außerordentliche Dienste.
Peter:Wozu dienen denn die Leuchtfeuer, Vater?
Vater:Es sind Merkzeichen in der zur Nacht schwarzen Wasserwüste, die ähnlich wirken wie Wegweiser auf dem festen Land. Wenn ein Schiff sich inmitten des Weltmeers fernab von allen Küsten befindet, so hat es nicht viel auf sich, wenn es nicht ganz genau in der gewollten Fahrtrichtung fährt. Denn das Wasser ist dort überall wenn auch nicht gleich tief, so doch immer tief genug, daß ein Auflaufen nicht möglich ist. Anders aber in der Nähe der Küsten. Dort müssen die Schiffe ein bestimmtes Fahrwasser innehalten, wenn sie nicht auf Untiefen, das heißt solche Stellen stoßen wollen, wo der Meeresboden nur wenig unter der Wasseroberfläche liegt. Am Tag sagen dem geübten Seefahrer viele Merkzeichen am Land, die in die mitgeführten Seekarten eingezeichnet sind, genau, wo er sich befindet. Bei ganz besonders schwierigen Strecken, wo nur eine schmale Fahrrinne mit genügender Tiefe vorhanden ist, sind Bojen zu beiden Seiten der Rinne ausgelegt, Körper, die bald spitz und bald rund aussehen, an schweren, auf dem Boden ruhenden Steinen befestigt, auf dem Wasser schwimmen und den Schiffer leiten.
Während der Nacht aber sind alle diese Merkzeichen nicht zu sehen. Da haben sich nun sämtliche seefahrenden Länder auf der Erde geeinigt, ihre Küsten zu befeuern. Sobald die Dunkelheit eintritt, werden an allen Festland- und Inselküsten in gewissen Abständen starke Lichter angezündet, die auf Türmen untergebracht sind, damit man sie weithin sehen kann.
Es würde aber nicht genügen, wenn alle diese Leuchtfeuer nur einfache Lampen, wenn auch von großer Lichtstärke, besäßen. Der Schiffer würde dann wohl sehen, an welcher Stelle Land liegt, er würde aber nicht wissen, welchen Teil des Landes er vor sich hat, und darum auch in seiner Karte nicht feststellen können, wo er sich befindet, und in welcher Richtung er steuern muß, um nicht aufzulaufen. Aus diesem Grund hat jedes Leuchtfeuer eine ganz bestimmte Lichtart. Einige leuchten eine bestimmte Zahl von Sekunden und werden dann wieder für eine andere, genau festgelegte Sekundenzahl verdunkelt. Alsdann erscheint ihr Licht wieder. Man nennt das Blinkfeuer. Bei anderen folgt einem kurzen Blitz längere Dunkelheit wie beim Helgoländer Leuchtturm, wieder andere haben farbige Lichter, die abwechselnd auftauchen und verschwinden. Mit Hilfe der sehr genau gehenden Uhr, die sich an Bord jedes Schiffs befindet, kann die Blinkweise eines jeden Leuchtfeuers, das heißt die Zeit seiner abwechselnden Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, vom Kapitän stets genau festgestellt werden. Ein gleichfalls stets an Bord vorhandenes Buch sagt ihm alsdann, welchen Leuchtturm er vor sich hat. Durch diese großartige Einrichtung werden die Schiffe an allen Küsten auf der ganzen Erde geleitet, wo kultivierte Menschen wohnen. Ein Kapitän kann sich in Südamerika oder in Australien während der Dunkelheit genau so zurechtfinden wie an der deutschen Küste.
Dietrich:Das ist großartig!
Vater:Ganz gewiß! Durch Verständigung über die ganze Erde ist ein an sich so einfaches und bescheidenes Gerät wie ein Leuchtfeuer zu einem bewundernswerten Hilfsmittel von weitestgreifender Wirkung geworden. Viel Großes können die Menschen erreichen, wenn sie einig zusammengehen. Derartiges wird uns bei der Verfolgung von Robinsons Weg noch öfter begegnen.
Aber wir wollen uns nun wieder nach unserem Freund umschauen. Von dem vielen Neuen, das er gesehen hatte, war er müde geworden, in seine Kammer hinabgestiegen und schlief die Nacht hindurch in einer einfachen Hängematte, wie sie auf so kleinen Seglern, aber auch auf den größten Kriegsschiffen der Mannschaft für die Nachtruhe nur zur Verfügung stehen, da zum Aufschlagen von Betten kein Platz vorhanden ist. Am nächsten Morgen vermochte er, als er erwacht war, gar nicht die Zeit zu erwarten, bis er seinen Kaffee in der Küche getrunken hatte und sich auf das Verdeck begeben konnte. Denn das Schiff mußte indessen die offene See gewonnen haben. Wie freute Robinson sich darauf, zum erstenmal das weite Meer zu sehen.
Doch welch ein Anblick harrte seiner, als er hinaufkam!
Statt der grünen, schäumenden Meereswogen, die er erwartete, erblickte er eine undurchdringliche, graue Wand vor sich. Kaum daß er zehn Schritte weit auf dem Verdeck zu sehen vermochte. Das Geländer, die Segel, die Planken, jedes Tau, alles troff von Wasser. Die Matrosen, die wie Schatten aus dem dichten Grau auftauchten, hatten dicke Mäntel an und sahen verfroren aus, obgleich am Tag vorher schönes, warmes Sommerwetter geherrscht hatte. Am Morgen war nämlich dichter Nebel gefallen, wie er in der Gegend, die Robinson jetzt durchfuhr, nicht selten vorkommt.
Doch wir wollen jetzt nicht abwarten, bis der Nebel sich wieder verzogen hat, sondern die Erzählung abbrechen und uns zum Abendbrot hineinbegeben. Ihr habt vielleicht auch bemerkt, daß Marie schon zweimal auf der Terrasse war, um uns anzudeuten, daß das Essen bereit sei.
Peter:Ach bitte, lieber Vater, jetzt noch nicht!
Johannes:Jetzt gerade fing es an, besonders spannend zu werden.
Dietrich:Solch dichter Nebel ist sicher gefährlich; was mag dem Robinson da wohl begegnen?
Vater:Das werden wir morgen sehen. Jetzt wollen wir hineingehen!
Zweiter Nachmittag
Am nächsten Tag versammelte sich die Familie wieder um den Gartentisch unter der Linde. Der Wind vom Meer her wehte etwas kräftiger, so daß die Zweige des Baums auf und ab schaukelten. Peter und Ursula hatten sich, bevor der Vater erschien, damit vergnügt, die über die Tischplatte huschenden Sonnenkringel mit den Händen zu greifen. Große Möwenvölker flatterten über der Wasserfläche. Prächtig leuchteten die schneeweißen Flügel, wenn sie von der Sonne getroffen wurden. Schneeflocken gleich sah man ganze Schwärme der Vögel plötzlich auf das Wasser hinabschießen, um vorwitzige Fischlein mit den Schnäbeln rasch im Flug zu erhaschen.
Mit heiterem Blick umfaßte der Vater, nachdem er wie am Tag vorher in seinem Stuhl Platz genommen hatte, dieses Bild, und dann war alles zur Fortsetzung der Erzählung bereit.
Vater:Wir haben Robinson gestern verlassen, als er gerade auf das Deck hinaufkam und zu seinem Erstaunen nichts weiter erblickte als schweren, grauen, nach Rauch riechenden Nebel ringsum. Erschreckt blieb er stehen und wagte zuerst nicht, einen Schritt vorwärts zu tun, da überall unbekannte Welt zu liegen schien. Dann fuhr er plötzlich zusammen. An der Spitze des Schiffs, nicht weit von seinem Standplatz wurde die große Schiffsglocke mächtig angeschlagen. In gewissen Zwischenräumen wiederholte sich dieses Läuten immerfort. Und von draußen her vernahm Robinson seltsame Töne, die seine Angst noch erhöhten. Es war, als sei die ganze unsichtbare Meeresfläche von seltsamen Geschöpfen bevölkert. Bald hörte Robinson helle Töne wie von kreischenden Wassernymphen, bald tiefes, markerschütterndes Brüllen, wie es wohl die vorweltlichen Riesentiere ausgestoßen haben mochten. Auch Glockentöne klangen von fernher heran. Aber all das zusammen ergab eine Musik, die von weit, weit her, wie aus einer anderen Welt zu kommen schien. Und dennoch fühlte man, daß die Wesen, von denen die Töne ausgingen, nicht fern sein konnten.
Ursula:Ich fürchte mich, Vater! Nun werden die Ungeheuer sicherlich Robinson auffressen!
Dietrich:Davor brauchst du dich nicht zu fürchten, Schwesterchen. Ich weiß schon, woher die schrecklichen Töne kamen. Es waren die Nebelhörner der anderen Schiffe.
Vater:Freilich. Dieser Spuk hatte wie jeder andere, der Wirklichkeit ist, seine natürlichen Ursachen. Wenn Nebel auf der See fällt, befinden sich alle Schiffe in nicht geringer Bedrängnis. Am gefährlichsten ist solch ein Ereignis gerade in dem Meeresteil, in welchem sich Robinsons Schiff jetzt aufhielt, nämlich in der verhältnismäßig schmalen Fahrstraße zwischen England und dem europäischen Festland. Es ist das diejenige Stelle, die von allen Meeren der Erde am lebhaftesten befahren wird. Kaum jemals kommt es vor, daß man vom Deck eines Schiffs aus nicht fünf oder sechs andere Fahrzeuge erblickt. Für alle ist Platz genug auf der ja immer noch außerordentlich geräumigen Wasserfläche vorhanden. Sie können einander unter gewöhnlichen Umständen ohne jede Schwierigkeit ausweichen. Wenn aber Nebel herrscht, verlieren die Schiffe einander aus dem Gesicht. Jetzt ist jedes von ihnen durch jedes andere schwer bedroht. Es gibt kein anderes Mittel, seinen Standort den anderen kundzutun, als möglichst großen Lärm zu machen. Die Augen, das wichtigste Werkzeug für den Menschen im allgemeinen und für den Schiffskapitän im besonderen, um sich über seine Umgebung klar zu werden, versagen. Nur das Ohr bleibt noch aufnahmefähig, wenn freilich Nebelschwaden auch den Ton stark dämpfen. Die großen Dampfer lassen bei solchem Wetter in bestimmten Abständen ihre riesenhaften Dampfpfeifen erschallen, die so fürchterliche Töne ausstoßen, daß man es in ihrer Nähe gar nicht auszuhalten vermag. Die kleineren schrillen mit ihren höher gestimmten Pfeifen, die Segelschiffe läuten mit den Glocken, welche zu diesem Zweck stets auf dem Deck angebracht sind. Zugleich setzen alle Schiffe ihre Fahrgeschwindigkeit sehr stark hinab, die meisten bleiben ganz stehen. Wer es aber eilig hat, versucht wohl doch, einigermaßen rasch vorwärtszukommen, und das kann dann leicht genug Unheil herbeiführen.
Robinson hatte sich an das Geländer auf dem Deck seines Schiffs gestellt und starrte mit bleichem Gesicht hinaus. Er sah keinen Menschen und fühlte sich schrecklich vereinsamt. Viel würde er darum gegeben haben, jetzt wieder am sicheren Tisch im Elternhaus sitzen zu können, das er so leichtsinnig verlassen hatte. Mehr als einmal sah er düstere Schatten in nächster Nähe auftauchen, die Umrisse von Schiffen, deren Art genauer zu erkennen unmöglich war.
Immer weiter ertönte das markerschütternde Brüllen und Kreischen, immer neue Stimmen mischten sich ein; ein besonders tiefes Brummen, das wie der Ton einer ungeheuren Orgel klang, verlor sich langsam in der Ferne. Die Augen tränten Robinson von der Anstrengung, mit der er sich bemühte, die Nebelwand zu durchdringen, weil er glaubte, daß dies helfen müsse, das stilliegende Schiff zu beschützen.
Plötzlich stieß er einen Schrei aus und fiel rücklings nieder. Ein furchtbarer Stoß hatte das Schiff getroffen.
Peter:War das eine hohe Welle?
Vater:Nein, bei schwerem Nebel pflegt das Meer stets ganz ruhig zu sein. Es war etwas weit Gefährlicheres, mit dem das Schiff in Berührung gekommen war. Nur ein paar Meter von seinem Platz entfernt, hatte Robinson erst einen Schatten näher und näher kommen gesehen. Dann war die schwarze Spitze eines Schiffs deutlich aus dem Grau aufgetaucht, und gleich darauf krachten schon die Bretter und Balken. Der Segler, auf dem sich Robinson befand, machte einen Sprung wie ein scheuendes Pferd, und dann trat für einige Augenblicke furchtbare Stille ein.
Als Robinson sich entsetzt aufrichtete, sah er, wie die Matrosen und auch der Kapitän herbeistürzten. Alles schrie entsetzt durcheinander. Das fremde Schiff war in den kleinen Segler hineingefahren und hatte ihm die ganze Seite aufgerissen.
Sofort gellte die Mundpfeife des Steuermanns, der alle Mann zu Hilfe rief. Der Kapitän beugte sich über das Geländer, und Robinson sah, wie er wankte. »Wir sind verloren! Wir sinken!« riefen einzelne Stimmen. »Die Schwimmgürtel nehmen!« befahl der Kapitän. Robinson wußte nicht, wohin er sich zu wenden hatte, um solch einen rettenden Gegenstand zu fassen. Wie angewurzelt blieb er stehen.
»Zu Hilfe, zu Hilfe, wir sind in Not!« schrien die Matrosen zu dem fremden Schiff hinüber, dessen Spitze das Deck zur Hälfte durchschnitten hatte. Aber zu ihrem furchtbaren Schreck sahen die Leute, daß die schwarze Spitze, die allein man von dem fremden Fahrzeug wahrnehmen konnte, sich zurückzog und das Schiff im Nebel verschwand. Der gewissenlose Führer wollte sich offenbar den schweren Unannehmlichkeiten entziehen, wegen Herbeiführung eines Zusammenstoßes vor das Seegericht gestellt zu werden. Er fuhr unerkannt davon und überließ die Menschen auf dem schwer getroffenen Segler ihrem Schicksal.
Johannes:Das ist aber ein ganz abscheulicher Mensch. Er hatte doch schuld daran, wenn das Schiff jetzt unterging. Da hätte er doch dableiben und helfen müssen.
Vater:Ja, das hätte er gemußt, sogar wenn er nicht selbst schuld an dem Unglück gewesen wäre. Denn alle Seeleute sind verpflichtet, einander Hilfe zu bringen. Außer dem Gesetz gebietet dies schon die Menschenpflicht. Es wird auch selten einen Kapitän geben, der sich einer solchen Verpflichtung entzieht. Dieser hier war eine häßliche Ausnahme.
Schon begannen sich auch die Folgen des Zusammenstoßes zu zeigen. Des Steuermanns Pfeife rief die Matrosen unter Deck an die Pumpen. Mit aller Kraft versuchte man, das durch den Riß eindringende Wasser auszuwerfen. Aber das Leck war zu groß; es lief mehr Wasser hinein, als man hinauszuschaffen vermochte. Langsam aber deutlich fühlbar begann das Schiff zu sinken. Die große Glocke läutete wie toll, um Hilfe herbeizuschaffen. Jetzt stand das Deck nur noch ein Meter über dem Wasser. Robinson zitterte am ganzen Körper. Schon sah er sich für die häßliche Tat, die er an seinen Eltern begangen hatte, schwer bestraft. Das Grab im Meer schien ihm sicher. Und niemand kümmerte sich um ihn. Alle hatten zu arbeiten, um zu retten, was noch zu retten war; er, der auf einem Schiff nicht Bescheid wußte, stand ganz verlassen da. »Ach, lieber Vater, liebe Mutter, helft mir doch!« schrie er und rang die Hände. Fast von Sinnen lief er auf dem leeren Deck hin und her, aber keine Menschenstimme antwortete ihm.
Schon begann das Schiff sich nach der Seite zu senken, auf der das Wasser eindrang. Da zerriß plötzlich wie durch einen Zauberschlag der Nebel, der inzwischen schon leichter geworden war, ohne daß dies jemand bemerkt hatte, und auf einmal lag das weite Meer in grüner, schimmernder Ruhe vor Robinsons Blicken. In geringen Entfernungen sah man andere Schiffe teils stilliegen, teils sich langsam bewegen und nun gerade wieder zu voller Fahrt übergehen.
Der Kapitän hatte die Änderung des Wetters natürlich auch sofort bemerkt. Mit mehreren Matrosen, die er von den Pumpen fortgeholt hatte, stürzte er aufs Deck. Einige von der Mannschaft eilten zum Heck, dem Hinterteil des Schiffs, um das dort hängende Rettungsboot fertig zum Hinunterlassen zu machen. Oh, wie klein war dieses Rettungsschifflein! Kaum die Hälfte der Mannschaft konnte darin Platz finden. Zwei Matrosen aber knüpften unter dem Befehl des Kapitäns mit größter Geschwindigkeit bunte Flaggen an einen Strick und zogen sie am Mast empor.
Ursula:Nanu, jetzt hängen die auf einmal Flaggen raus? Das tut man doch bloß, wenn etwas Lustiges los ist.
Dietrich:Für so dumm brauchst du den Kapitän aber wirklich nicht zu halten, daß er in solcher Not das Schiff bloß zum Vergnügen flaggen läßt. Das sollte natürlich ein Notzeichen für die anderen Schiffe sein.
Vater:So war es wirklich. Der Kapitän hatte am Mast weithin sichtbar das Zeichen setzen lassen: »Wir sind in Not! Sofortige Hilfe erforderlich!« Solche Flaggen reden eine Sprache, die jeder Seemann versteht, mag er nun Deutscher, Engländer, Spanier oder Grieche sein. Mittels zwei, drei oder vier Flaggen von allgemein festgesetzter Art können viele Tausende verschiedener Signale gegeben werden. Da von der Kommandobrücke jedes Schiffs aus, das sich in See befindet, stets scharf Ausguck gehalten wird, so kann man sicher sein, daß solch ein Flaggensignal von einem in Sicht befindlichen Fahrzeug wahrgenommen wird. Und so geschah es auch hier. Nur etwa fünfhundert Meter von ihnen entfernt lag ein großes Segelschiff hochragend auf dem Wasser. Sogleich stieg an dessen Mast gleichfalls ein Flaggensignal empor, das meldete: »Verstanden! Ich schicke Hilfe hinüber!«
Peter:Es ist aber wirklich wunderschön, daß man sich so verständigen kann. Wie klug das ausgedacht ist!
Vater:Es war aber auch dringend notwendig, daß die Schiffbrüchigen jetzt Hilfe bekamen. Mit dem Pumpen hatte man schon aufgehört, denn die unteren Räume des Schiffs waren bereits voller Wasser. Die ganze Mannschaft befand sich jetzt an Deck, und wer konnte, sprang in das einzige Rettungsboot. Es vermochte nur wenige Mann aufzunehmen. Dann stieß es rasch ab.
Als Robinson das sah, fiel er ohnmächtig nieder. Die Bedeutung der Signalisierung durch die Flaggen war ihm natürlich unbekannt geblieben. Er hatte sie, wie unsere Ursula, mit aufgerissenem Mund wohl auch für einen höchst unangebrachten Spaß gehalten. Da er das Rettungsboot davonfahren sah, glaubte er sich endgültig verloren. Die hilfreichen Leute drüben aber hatten gleichfalls geschwind zwei Boote zu Wasser gebracht, und mit kräftigen Ruderschlägen kamen diese näher.
Jauchzender Zuruf empfing sie, als sie längsseits des sinkenden Schiffs angekommen waren. Im letzten Augenblick, als schon fast das Wasser über das Deck zu laufen begann, sprangen alle hinüber. Beinahe hätte man den ohnmächtigen Robinson liegengelassen, nicht etwa absichtlich, sondern weil er dicht neben einem Haufen Tauwerk hingefallen war, der ihn halb verdeckte, und in der begreiflichen Aufregung niemand an ihn dachte. Im letzten Augenblick warf man ihn noch in das Boot.
Ursula:Gott sei Dank, ich hatte schon gefürchtet, daß sie ihn allein würden ertrinken lassen!
Peter:Ich habe das nicht gedacht, denn der Vater harte ja gesagt, daß seine Erzählung von Robinson sehr lang sein würde, und dann hätte sie ja jetzt schon nicht mehr weitem gehen können.
Vater:Als Robinson zu erwachen begann, fühlte er sich, während seine Augen noch geschlossen waren, weich gebettet und ein Glas heißen Tees an seinen Lippen. Er trank, streckte sich müde aus und sprach leise: »Danke schön, Mutter!« Mit seligem Lächeln schlief er wieder ein und sah sich im Schutz des Elternhauses geborgen.
Als er aber einige Stunden später recht gestärkt die Augen aufschlug, nahm er wahr, daß das weiche Lager nicht ein Bett, sondern ein Haufen zusammengefalteter Segeltücher und der hilfreiche Mensch, der ihm den stärkenden Tee gereicht, nicht seine Mutter, sondern ein Matrose war, der schon gleich von Hamburg aus besonders freundlich zu ihm gewesen und sich jetzt um ihn bemühte. Er richtete sich auf und blickte umher. Zunächst vermochte er gar nicht, sich zurechtzufinden. Das Schiffsdeck, das ihm doch nun schon seit zwei Tagen recht vertraut gewesen, hatte sich völlig verändert. Die Masten waren viel dicker, es standen auch drei da an Stelle von zweien wie bisher. Das Schiff war länger und breiter und fuhr mit mächtigen Segeln sehr rasch durch das Wasser. Robinson konnte sich diese Verwandlung zuerst gar nicht erklären. Dann fiel ihm ein, daß er ja nahe am Ertrinken sei, und voll Schreck sprang er auf. Doch der hilfreiche Matrose beruhigte ihn. Er erzählte, daß während Robinsons Ohnmacht die Rettung vollzogen, das eigene Schiff allerdings untergegangen sei, sie aber nun auf dem großen Segler wohl geborgen wären. Sogleich hatte Robinsons kräftiges, jugendliches Gemüt die ganze Furcht vergessen, und er begann alsbald, sich auf dem neuen Fahrzeug umzuschauen. Hier war alles größer und schöner als auf dem ersten. Jeder konnte sehen, daß man sich auf einem mächtigen Fahrzeug befand, das, wenn nicht gerade ein großes Unglück geschah, wohl imstande sein mußte, auch den schwersten Angriffen der See standzuhalten.
Robinson wurde zu dem Kapitän geführt, und dieser fand bald Gefallen an den klugen Augen und munteren Antworten unseres Freundes. Schließlich sagte er, Robinson solle einmal raten, wohin das Schiff fahre. »Nach England,« antwortete dieser. Der Kapitän lachte. »Das ist falsch. Wir fahren weiter!« »Nach Neuyork.« »Noch weiter.« »Vielleicht gar nach Südamerika?« fragte Robinson, »oder zu den Negern nach Afrika?« »Auch das ist noch nicht weit genug,« erwiderte lachend der Kapitän. Robinson dachte nach, aber es fiel ihm kein Land ein, das noch weiter entfernt wäre als die genannten Teile der Erde.
Johannes: